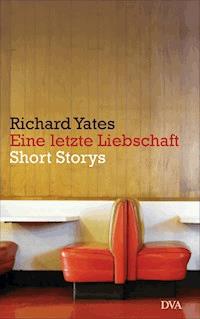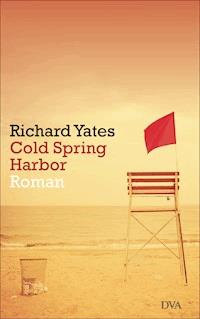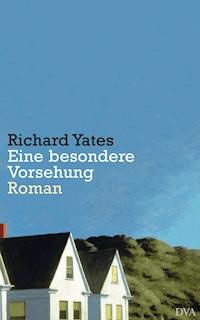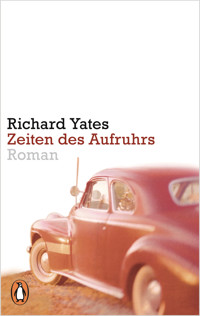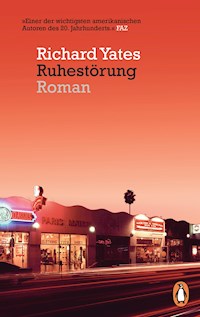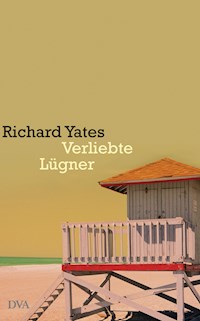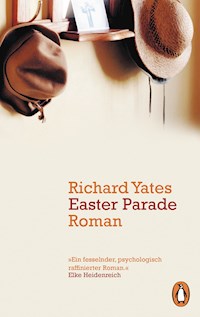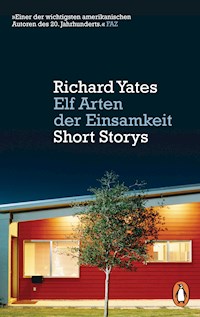5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jung, frisch verheiratet und ehrgeizig, versucht Michael Davenport, als Schriftsteller sein auskommen zu finden. Das große Privatvermögen seiner Ehefrau Lucy will er nicht angreifen, aus Angst, es würde ihn als Künstler korrumpieren. Lucy, unsicher, was von ihr erwartet wird, stürzt sich in die Schauspielerei, die Malerei, um ihrem Leben so einen Sinn zu geben. Doch die Jahre vergehen, die Misserfolge häufen sich, und hinter den hochtrabenden Erwartungen lauert ein Leben in Durchschnittlichkeit. und dann setzen die Zweifel aneinander ein …
In seiner Schilderung einer Ehe, die auf gegenseitigen Abhängigkeiten gründet und durch enttäuschte Hoffnungen und Ambitionen von innen zerfressen wird, begibt sich Richard Yates auf für ihn klassisches Terrain. Wie schon in seinem Meisterwerk "Zeiten des Aufruhrs" demonstriert er einmal mehr sein Können als Chronist des Scheiterns, für das er in die Annalen der amerikanischen Literaturgeschichte eingegangen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Richard Yates
Eine strahlende Zukunft
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Gunkel
Deutsche Verlags-Anstalt
Meinen drei Töchtern gewidmet
1. KAPITEL
Mit dreiundzwanzig hatte Michael Davenport gelernt, seiner eigenen Skepsis zu trauen. Er hielt nichts von Mythen oder Legenden, nicht einmal in Gestalt allgemeiner Annahmen; er wollte stets zur wahren Geschichte vordringen.
Gegen Ende des Kriegs in Europa war er als Rumpfschütze einer B-17 erwachsen geworden, und eins der Dinge, die ihn am meisten an der Luftwaffe gestört hatten, war ihre Werbekampagne. Jeder betrachtete die Air Force als den tollsten, glücklichsten Militärzweig – besser verpflegt, untergebracht und bezahlt als die anderen, mit größeren persönlichen Freiheiten und schicker Kleidung ausgestattet, die man auf »legere« Art trug. Und jeder dachte, die Air Force gebe sich nicht mit dem belanglosen Problem militärischer Disziplin ab: Fliegen, Kühnheit und Kameradschaft galten mehr als blinder Respekt vor Höherrangigen; Offiziere und gemeine Soldaten konnten, wenn sie wollten, miteinander befreundet sein, und auch der vorgeschriebene militärische Gruß war dort nur eine angedeutete, beiläufige Verspottung seiner selbst. Angeblich bezeichneten die Soldaten der Bodentruppen die Air-Force-Leute neidvoll als »Fly-Boys«.
Vermutlich war das nur harmloses Gerede; es lohnte sich nicht, darüber zu streiten; doch Michael Davenport würde nie vergessen, dass seine eigene Air-Force-Zeit erniedrigend, langweilig und trostlos gewesen war, dass er bei seinen Kampfeinsätzen schreckliche Angst gehabt hatte und im Nachhinein ungeheuer froh war, den ganzen Mist hinter sich zu haben.
Dennoch hatte er auch ein paar gute Erinnerungen mit nach Hause gebracht. Zum Beispiel, dass er es bei dem Boxturnier in Blanchard Fields, Texas, im Mittelgewicht bis ins Halbfinale geschafft hatte – so etwas konnten nicht viele Anwaltssöhne aus Morristown, New Jersey, von sich behaupten. Eine weitere Erinnerung, die im Laufe der Zeit zunehmend philosophische Züge annahm, war die Bemerkung, die ein namenloser Schießausbilder in Blanchard Fields eines glühend heißen Nachmittags während eines ansonsten langweiligen Vortrags gemacht hatte.
»Versucht, euch das zu merken, Männer. Einen Profi erkennt man stets daran – und ich meine, in jedem Metier –, dass er etwas Schwieriges leicht aussehen lässt.«
Schon damals, inmitten der schläfrigen Rekruten von jenem eindrücklichen Gedanken wachgerüttelt, hatte Michael eine Zeit lang gewusst, welches Metier es war, in dem er sich einmal als Profi auszeichnen wollte: Er wollte Gedichte und Theaterstücke schreiben.
Kaum aus der Army entlassen, ging er nach Harvard, vor allem weil ihn sein Vater dazu gedrängt hatte, und zunächst war er fest entschlossen, sich auch von den Mythen oder Legenden Harvards nicht täuschen zu lassen: Er wollte nicht einmal die äußerliche Schönheit des Ortes eingestehen, geschweige denn sie bewundern. Es war eine Universität wie jede andere, die es ebenso verbissen auf sein GI-Bill-of-Rights-Geld abgesehen hatte wie jede andere.
Doch nach ein, zwei Jahren wurde er etwas nachsichtiger. Die meisten Kurse waren tatsächlich anregend; die meisten Bücher gehörten tatsächlich zu der Literatur, die er schon immer hatte lesen wollen; seine Kommilitonen, jedenfalls manche, erwiesen sich als Menschen, wie er sie sich immer als Freunde ersehnt hatte. Nie trug er seine alte Armeeuniform – auf dem Campus wimmelte es von Männern, die sich so kleideten und größtenteils als »Berufsveteranen« abgetan wurden –, doch er behielt den modifizierten Schnauzbart, der beim Militär seine einzige Affektiertheit gewesen war, denn dieser diente noch immer dem Zweck, ihn älter wirken zu lassen. Und gelegentlich musste er zugeben, dass er weder gegen das Leuchten, das den Leuten in die Augen trat, noch gegen ihre gesteigerte Aufmerksamkeit, wenn sie erfuhren, dass er Bordschütze gewesen war, etwas einzuwenden hatte – auch nicht dagegen, dass es anscheinend noch eindrucksvoller war, wenn er das Ganze herunterspielte. Er war bereit zu glauben, dass Harvard doch das geeignete Umfeld sein könnte, um zu lernen, wie man etwas Schwieriges leicht aussehen lässt.
Und eines Frühlingsnachmittags im dritten Universitätsjahr – alle Bitterkeit verschwunden, jeglicher Zynismus erstickt – erlag er gänzlich dem Mythos und der Legende der hübschen Radcliffe-Studentin, die jeden Moment auftauchen und dein Leben verändern konnte.
»Du weißt so viel«, sagte sie zu ihm und streckte beide Hände über den Restauranttisch, um seine Hand damit zu ergreifen. »Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Du … weißt einfach so viel.«
Die Radcliffe-Studentin hieß Lucy Blaine. Sie war für die Hauptrolle in Michaels erstem halbwegs passablem Einakter ausgewählt worden, der damals an einem kleinen Campustheater geprobt wurde, und dies war das erste Mal, dass er den Mut aufgebracht hatte, sie einzuladen. »Jedes Wort«, sagte sie, »jeder Ton und jede Stille in diesem Stück sind das Werk eines Menschen, der ein tief gehendes Verständnis des … du weißt schon … des menschlichen Herzens hat. Ach, Gott, jetzt hab ich dich verlegen gemacht.«
Das stimmte – er war zu verlegen, um ihr in die Augen zu blicken –, und deshalb konnte er bloß hoffen, dass sie nicht beabsichtigte, das Thema zu wechseln. Sie war nicht das hübscheste Mädchen, dem er je begegnet war, doch das erste hübsche Mädchen, das je so viel Interesse an ihm gezeigt hatte, und er wusste, dass er aus dieser Mischung viel Nutzen schlagen konnte.
Als er es angebracht fand, auch ihr Komplimente zu machen, sagte er, dass ihm ihre Leistung bei den Proben sehr gut gefallen habe.
»Ach was«, sagte sie schnell, und erst da fiel ihm auf, dass sie ihre Papierserviette auf dem Tisch sorgsam in streng parallele Streifen zerrissen hatte. »Ich meine, danke, und natürlich ist das schön zu hören, aber ich weiß, dass ich eigentlich keine Schauspielerin bin. Wenn es so wäre, hätte ich irgendwo die Schauspielschule besucht, würde mich bei Sommeraufführungen abplacken und vorsprechen und alles. Nein« – sie klaubte die Serviettenstreifen auf und schlug, um ihre Worte zu unterstreichen, mit der Faust auf den Tisch – »nein, es ist bloß ein Zeitvertreib, so wie kleine Mädchen sich mit den Sachen ihrer Mutter verkleiden. Aber worauf es ankommt, ist, dass ich mir nie hätte träumen lassen … mir nie hätte träumen lassen, mal in so einem Stück mitzuspielen.«
Als sie das Theater gemeinsam verlassen hatten, war ihm bereits aufgefallen, dass sie genau die richtige Größe hatte – ihr Kopf reichte ihm bis zur Schulter –, und er wusste, dass sie auch im richtigen Alter war: Sie war zwanzig; er wurde bald vierundzwanzig. Als er sie in die triste Studentenbude in der Ware Street mitnahm, in der er allein wohnte, fragte er sich, ob dieses ständige Genau-richtig-Sein, dieses Muster des nahezu Perfekten, vielleicht von Dauer sein könnte. Hatte die Sache nicht irgendwo einen Haken?
»Tja, so hab ich mir das ungefähr vorgestellt«, sagte sie, als er ihr seine Unterkunft vorgeführt hatte, und er sah sich verstohlen im Zimmer um, um sich zu vergewissern, dass nirgends schmutzige Socken oder Unterwäsche zu sehen waren. »Irgendwie schlicht und einfach und gut zum Arbeiten. Ach, und es ist so … männlich.«
Das Muster des nahezu Perfekten blieb bestehen. Als sie sich abwandte, um aus dem Fenster zu schauen – »Und morgens ist es hier bestimmt schön und hell, stimmt’s? Mit diesen hohen Fenstern? Und diesen Bäumen?« –, kam es ihm völlig natürlich vor, dicht hinter sie zu treten, die Arme um sie zu legen und nach ihren beiden Brüsten zu fassen, während er den Mund an ihrem Hals vergrub.
Innerhalb einer knappen Minute waren sie nackt und vergnügten sich unter den Armeedecken seines Doppelbetts, und Michael Davenport stellte fest, dass er noch nie einem so netten, entgegenkommenden Mädchen begegnet war, dass er nicht einmal geahnt hatte, was für eine grenzenlose, außergewöhnliche neue Welt ein Mädchen sein konnte.
»O Gott«, sagte er, als sie schließlich zur Ruhe gekommen waren, und er hätte ihr gern etwas Poetisches gesagt, wusste aber nicht, wie. »O Gott, du bist toll, Lucy.«
»Freut mich«, sagte sie mit leiser, zarter Stimme, »denn ich finde dich auch wunderbar.«
Es war Frühling in Cambridge. Alles andere war einerlei. Selbst das Stück spielte keine besonders große Rolle mehr: Als ein Kritiker des Harvard Crimson es als »skizzenhaft« und Lucys Auftritt als »tastend« bezeichnete, kamen beide mühelos damit klar. Schon bald würden andere Stücke folgen; und außerdem wussten alle, was für neidische kleine Scheißkerle die Kritiker vom Crimson waren.
»Ich weiß nicht, ob ich dich schon mal danach gefragt habe«, sagte er einmal, als sie im Boston Common spazieren gingen, »aber was macht eigentlich dein Vater beruflich?«
»Ach, er ist so eine Art Manager. In verschiedenen Geschäftsangelegenheiten. Ich habe nie ganz verstanden, was er genau tut.«
Abgesehen von Lucys eleganter, schlichter Kleidung und ihren guten Umgangsformen war das der erste Anhaltspunkt, dass ihre Familie sehr wohlhabend sein könnte.
Als sie ihn ein, zwei Monate später im Sommerhaus der Familie auf Martha’s Vineyard ihren Eltern vorstellte, erhielt diese Vermutung neue Nahrung. So etwas hatte er noch nie gesehen. Zunächst fuhr man zu einem unbekannten Küstenort namens Woods Hole, wo man an Bord einer erstaunlich luxuriösen Fähre ging, die einen meilenweit übers Meer schipperte; und wenn man auf der fernen Insel des »Vineyard« wieder an Land ging, folgte man einer von hohen, ungestutzten Hecken gesäumten Straße, bis man zu einer halb versteckten Einfahrt gelangte, die zwischen Rasenflächen und Bäumen hindurch zum Ufer des sanften Wassers hinunterführte, und dort stand das Haus der Blaines – lang und weitläufig, zu gleichen Teilen aus Glas und Holz, das Holz mit dunkelbraunen Schindeln verkleidet, die im gesprenkelten Sonnenlicht silbern glänzten.
»Ich habe schon gedacht, wir würden Sie gar nicht mehr kennenlernen, Michael«, sagte Lucys Vater, nachdem er ihm die Hand geschüttelt hatte. »Bisher haben wir außer Ihrem Namen fast nichts erfahren – na ja, es geht wohl erst seit April oder so, aber mir kommt es viel länger vor.«
Mr Blaine und seine Frau waren groß, schlank und elegant, ihre Gesichter so intelligent wie das ihrer Tochter. Beide hatten eine so straffe, gebräunte Haut, wie man sie beim Schwimmen und Tennisspielen bekommt, und ihre rauchigen Stimmen deuteten darauf hin, dass sie dem täglichen Alkoholkonsum nicht abgeneigt waren. Keiner von beiden sah älter als fünfundvierzig aus. Wie sie da lächelnd in ihrer makellosen Sommerkleidung auf einem langen, mit Chintz bezogenen Sofa saßen, hätte es ein Foto sein können, das einen Zeitschriftenartikel mit dem Titel »Gibt es eine amerikanische Aristokratie?« illustrierte.
»Lucy?«, sagte Mrs Blaine. »Meinst du, ihr könnt bis Sonntag bleiben? Oder würde euch das von irgendwelchen romantischen Notwendigkeiten in Cambridge abhalten?«
Mit leisen Schritten kam ein schwarzes Dienstmädchen mit einem Tablett voller Gläser herein, und die anfängliche Anspannung ihres Treffens legte sich langsam. Während Michael sich zurücklehnte, um sich den ersten Schluck eines eiskalten, staubtrockenen Martinis zu genehmigen, warf er verstohlen einen ungläubigen Blick auf das Mädchen seiner Träume und ließ ihn dann an der hohen Deckenkante einer hellen Wand entlanggleiten, bis sie sich rechtwinklig mit einer anderen traf, die, weit entfernt, zu anderen im Schatten des Nachmittags liegenden Zimmern führte. Dieses Haus strahlte eine zeitlose Ruhe aus, wie ihn nur ein seit Generationen währender Erfolg hervorbringen konnte. Das hatte Stil.
»Aber was meinst du mit ›Stil‹?«, fragte ihn Lucy mit verärgertem Stirnrunzeln, als sie am nächsten Tag allein den schmalen Strand entlanggingen. »Wenn du so ein Wort verwendest, klingst du irgendwie proletarisch und dumm, und eigentlich solltest du wissen, dass ich es besser weiß.«
»Na ja, im Vergleich zu dir bin ich ein Proletarier.«
»Ach, das ist doch albern«, sagte sie. »Das ist das Albernste, was ich je von dir gehört habe.«
»Okay, aber hör mal: Meinst du, wir könnten heute Abend von hier verschwinden? Statt bis Sonntag zu bleiben?«
»Ich glaube schon, klar. Aber warum?«
»Darum.« Und er blieb stehen, damit sie sich zu ihm umdrehte und seine Finger durch den Stoff ihrer Bluse ganz zärtlich eine ihrer Brustwarzen berühren konnten. »Weil in Cambridge romantische Notwendigkeiten warten.«
Seine eigene wichtigste romantische Notwendigkeit im Herbst und Winter jenes Jahres bestand darin, ihren schüchternen, aber beharrlichen Heiratswunsch auf gefällige Weise abzuwehren.
»Natürlich will ich heiraten«, sagte er immer. »Das weißt du doch. Ich wünsche es mir genauso wie du, vielleicht sogar noch mehr. Ich glaube bloß nicht, dass es besonders klug wäre, bevor ich eine feste Anstellung habe. Klingt das nicht vernünftig?«
Sie schien seiner Meinung zu sein, doch schon bald lernte er, dass Worte wie »vernünftig« bei Lucy Blaine kaum ins Gewicht fielen.
Der Hochzeitstermin wurde für die Woche nach seiner Abschlussprüfung festgesetzt. Seine Familie reiste aus Morristown an, um während der ganzen Feier in höflicher Verwirrung zu lächeln, und plötzlich war Michael verheiratet, ohne genau zu wissen, wie es dazu gekommen war. Als ihr Taxi sie von der Kirche zu dem Empfang in einem alten Steingebäude am Fuß von Beacon Hill brachte, stiegen sie vor der imposanten Gestalt eines berittenen Polizisten aus, der in feierlichem Gruß die Hand an den Schild seiner Mütze führte, während sein gestriegeltes Pferd aufrecht und reglos wie eine Statue am Bordstein stand.
»Mein Gott«, sagte Michael, während sie eine elegante Treppe hinaufstiegen. »Was meinst du, wie viel es kostet, einen berittenen Polizisten für einen Hochzeitsempfang zu mieten?«
»Ach, ich weiß nicht«, sagte sie ungeduldig. »Nicht viel, würde ich sagen. Vielleicht fünfzig?«
»Das müssen wesentlich mehr als fünfzig sein, Schatz«, erwiderte er, »und sei es nur, weil man den Hafer für das Pferd kaufen muss.« Da lachte sie und umschlang seinen Arm, um zu zeigen, dass sie wusste, dass er das Ganze nicht ernst meinte.
In einem der drei oder vier großen, offenen Säle, in denen die Feier stattfand, spielte ein kleines Orchester ein Potpourri von Cole-Porter-Melodien, und die Barkeeper eilten geduckt unter dem Druck der Bestellungen hin und her. Einmal entdeckte Michael seine Eltern in dem Meer von Gästen und war froh zu sehen, dass es genug Leute gab, mit denen sie sich unterhalten konnten, und dass ihre Morristown-Kleidung in Ordnung war, doch dann verlor er sie wieder aus den Augen. Ein uralter, keuchender Mann, der eine seltene Ehrenrosette aus Seide am Revers seines maßgeschneiderten Anzugs trug, versuchte zu erklären, dass er Lucy schon als Baby gekannt habe – »In ihrem Kinderwagen! Mit ihren winzigen Wollhandschuhen und den gestrickten Babyschühchen!« –, und ein anderer, weitaus jüngerer Mann mit schmerzhaftem Händedruck wollte wissen, was Michael von Tilgungsanleihen halte. Es gab drei Mädchen, die Lucy »aus Farmington« kannten und mit freudigem Kreischen herbeigeeilt kamen, um sie zu umarmen, doch Lucy konnte es kaum erwarten, bis sie wieder verschwanden, um Michael zu sagen, dass sie alle drei nicht ausstehen konnte, und es gab Frauen im Alter ihrer Mutter, die sich unsichtbare Tränen abtupften und sagten, sie hätten noch nie eine so schöne Braut gesehen. Während Michael so tat, als würde er dem betrunkenen Geschwätz eines Mannes zuhören, der mit Lucys Vater Squash spielte, musste er wieder an den berittenen Polizisten am Bordstein denken. Es war bestimmt nicht möglich, einen Polizisten mit seinem Pferd zu »mieten«; sie konnten nur mit Genehmigung der Polizeibehörde oder des Bürgermeisters hier postiert worden sein, und das ließ neben dem Geld auch auf einen gewissen »Einfluss« von Lucys Familie schließen.
»Ich finde, das Ganze lief ziemlich gut, oder?«, sagte Lucy später am Abend, als sie in ihrer feudalen Suite im Copley Plaza allein waren. »Die Feier war schön, auch wenn die Party gegen Ende ein bisschen chaotisch war, aber das ist wohl immer so.«
»Nein, ich fand es schön«, versicherte er ihr. »Trotzdem bin ich froh, dass es vorbei ist.«
»Ach, Gott, ja«, sagte sie. »Ich auch.«
Erst als die Hälfte ihres einwöchigen Aufenthalts in diesem herrlichen Hotel vorüber war, einer Woche voller Luxus, abgesehen von gelegentlichen ungezogenen Blicken von Fremden – erst da machte ihm Lucy eine schüchterne Mitteilung, die alles zwischen ihnen ungeheuer erschwerte.
Es geschah eines Morgens nach dem Frühstück, als der Zimmerkellner ihre Teller voller Melonenschalen, Eigelb und den dicken Flocken zerrupfter Croissants weggebracht hatte. Lucy saß an der Frisierkommode, bürstete sich das Haar und beobachtete gleichzeitig im Spiegel, wie ihr frisch gebackener Ehemann hinter ihr auf dem Teppichboden auf und ab ging.
»Michael?«, sagte sie. »Meinst du, du könntest dich einen Augenblick hinsetzen? Weil du mich irgendwie nervös machst? Und außerdem«, fügte sie hinzu und legte ihre Haarbürste so vorsichtig hin, als könnte sie zerbrechen, »außerdem muss ich dir etwas Wichtiges sagen.«
Als sie Gesprächshaltung eingenommen hatten und sich in zwei prall gepolsterten Copley-Plaza-Sesseln gegenübersaßen, dachte er im ersten Moment, sie könnte schwanger sein – das wäre keine gute Nachricht, aber auch keine Hiobsbotschaft – oder dass man ihr vielleicht gesagt hatte, sie könne keine Kinder bekommen; dann verfiel er auf den schrecklichen Gedanken, dass sie vielleicht an einer tödlichen Krankheit litt.
»Ich wollte, dass du das von Anfang an weißt«, sagte sie, »aber ich hatte Angst, es könnte … etwas ändern.«
Plötzlich hatte er das Gefühl, dass er sie kaum kannte, dieses langbeinige, hübsche Mädchen, auf die das Wort »Ehefrau« vielleicht nie richtig passen würde, und er saß mit einem Angstschauder da, der ihn von den Hoden bis zur Kehle durchlief, während er ihre Lippen betrachtete und auf das Schlimmste gefasst war.
»Also muss ich jetzt meine Angst überwinden, das ist alles. Ich erzähl’s dir einfach und kann nur hoffen, dass du nicht … ach, egal. Es ist so, dass ich zwischen drei und vier Millionen Dollar besitze. Eigenes Geld.»
»Oh», sagte er.
Wenn Michael sich später zurückerinnerte, auch noch nach vielen Jahren, kam es ihm immer so vor, als hätten sie die ihnen im Hotel verbleibenden Tage und Nächte allein mit Gesprächen ausgefüllt. Es kam nur selten zu angespannten Wortwechseln, und nie brach ein Streit zwischen ihnen aus, sondern es war eine stetige, todernste Diskussion, die immer wieder um dieselben Probleme kreiste, und dabei gab es eindeutig zwei verschiedene Standpunkte.
Lucy sagte, das Geld habe ihr nie viel bedeutet; warum sollte es dann für ihn etwas anderes sein als die außergewöhnliche Chance, bei seiner Arbeit Zeit und Freiheit zu haben? Sie konnten überall auf der Welt leben. Sie konnten reisen, wenn ihnen der Sinn danach stand, bis sie den richtigen Rahmen für ein erfülltes, schöpferisches Leben gefunden hatten. War das nicht etwas, wovon die meisten Schriftsteller träumten?
Und Michael gab zu, dass er den Gedanken verlockend fand – o Gott, und wie! –, doch er vertrat folgende Auffassung: Er sei ein Mittelschichtkind und habe immer gedacht, er werde aus eigener Kraft etwas aus sich machen. Könne man wirklich erwarten, dass er diese lebenslange Sichtweise von heute auf morgen aufgebe? Von ihrem Vermögen zu leben, könnte seinen Ehrgeiz schwächen, es könnte ihn sogar jeglicher Energie berauben, die er zum Arbeiten brauche; das wäre ein unvorstellbar hoher Preis.
Er hoffe, sie werde das nicht falsch verstehen: Natürlich sei es gut zu wissen, dass sie all dieses Geld besitze, und sei es nur, weil ihre Kinder dann stets Treuhandfonds und dergleichen als Sicherheit hätten. Aber sei es einstweilen nicht besser, wenn das Ganze eine Angelegenheit zwischen ihr und ihren Bankern, ihren Brokern blieb oder wer zum Teufel sich darum kümmerte?
Sie versicherte mehrfach, seine Einstellung sei »bewundernswert«, doch er wies dieses Kompliment stets mit den Worten zurück, dass es sich ganz anders verhalte; dass er nur starrköpfig sei. Er wolle bloß die Pläne umsetzen, die er schon lange vor der Hochzeit für sie beide geschmiedet habe.
Sie würden nach New York gehen, wo er eine ähnliche Stelle wie andere angehende Schriftsteller antreten würde, bei einer Werbeagentur oder einem Verlag – verdammt noch mal, diese Arbeit konnte doch jeder mit links bewältigen –, und dann würden sie wie ein gewöhnliches junges Paar von seinem Gehalt leben, wenn möglich in einer schlichten, halbwegs annehmbaren Wohnung im West Village. Jetzt, wo er von ihren Millionen wusste, bestand der einzige echte Unterschied darin, dass sie vor den anderen gewöhnlichen jungen Leuten, die sie kennenlernen würden, ein Geheimnis bewahren mussten.
»Ist das nicht das Vernünftigste«, fragte er sie, »wenigstens im Moment? Verstehst du, worauf ich hinauswill, Lucy?«
»Na ja, wenn du ›im Moment‹ sagst, dann verstehe ich das wohl schon. Denn wir werden immer genug Geld haben, auf das wir zurückgreifen können.«
»Okay«, räumte er ein, »aber wer hat gesagt, dass wir darauf zurückgreifen wollen? Meinst du, ich hätte das nötig?«
Er war froh, dass ihm diese Worte sofort eingefallen waren. Manchmal hatte er sich bei diesem Thema dabei ertappt, wie er fast gesagt hätte, wenn er ihr Geld annähme, würde das seine »Männlichkeit« infrage stellen oder ihn »in seiner Mannesehre kränken«, doch jetzt konnte er all die heiklen Folgen einer so schwachen, verzweifelt endgültigen Rechtfertigung vergessen.
Er war wieder aufgestanden und ging, die Fäuste in den Taschen, auf und ab, dann trat er für eine Weile ans Fenster und blickte über den Copley Square hinweg auf die sonnenbeschienene Prozession der Fußgänger an einem Wochentagsmorgen auf der Boylston Street und den endlos blauen Himmel jenseits der Gebäude. Es war gutes Flugwetter.
»Ich würde mir bloß wünschen, dass du noch mal darüber nachdenkst«, sagte Lucy irgendwo hinter ihm im Zimmer. »Kannst du nicht wenigstens unvoreingenommen sein?«
»Nein«, sagte er schließlich und drehte sich zu ihr um. »Nein, tut mir leid, Baby, aber wir machen das auf meine Art.«
2. KAPITEL
Die Unterkunft, die sie in New York fanden, war fast genau so, wie Michael es gesagt hatte: eine schlichte, halbwegs annehmbare Wohnung im West Village. Sie hatten drei Zimmer im Erdgeschoss, in der Perry Street unweit der Ecke Hudson Street, und er konnte sich in das kleinste Zimmer zurückziehen und sich über das Manuskript eines Gedichtbandes beugen, den er noch vor seinem sechsundzwanzigsten Geburtstag vollenden und verkaufen wollte.
Die Suche nach der richtigen Tätigkeit für seine linke Hand verlief jedoch etwas schwieriger. Nach mehreren Vorstellungsgesprächen begann er den Verdacht zu hegen, dass die Arbeit in einer Werbeagentur ihm den Verstand rauben könnte; also entschied er sich für eine Stelle in der Lizenzabteilung eines mittelgroßen Verlags. Dort hatte er nicht viel mehr zu tun als untätig herumzusitzen: Meistens arbeitete er im Büro an seinen Gedichten, und das schien niemand zu bemerken und auch keinen zu interessieren.
»Das klingt doch geradezu ideal«, sagte Lucy – und das wäre auch richtig gewesen, hätte nicht das Geld, das er nach Hause brachte, kaum für Miete und Lebensmittel gereicht. Dennoch, es bestand die berechtigte Hoffnung, dass man ihn befördern würde – andere Leute aus dieser trägen Abteilung »fielen manchmal die Treppe hinauf« und bekamen ein richtiges Gehalt –, deshalb beschloss er, ein Jahr lang durchzuhalten. Es war das Jahr, in dem er sechsundzwanzig wurde, und sein Buch war längst noch nicht fertig, weil er viele seiner früheren, schwächeren Gedichte aussortiert hatte; und es war auch das Jahr, in dem sie erfuhren, dass Lucy schwanger war.
Als ihre Tochter Laura im Frühling 1950 zur Welt kam, vertrödelte er seine Zeit nicht mehr in dem Verlag, sondern hatte eine besser bezahlte Arbeit gefunden. Er war fest angestellt bei einem schnell wachsenden Hochglanzmagazin namens Zeit der Handelsketten und saß den ganzen Tag an Artikeln über »kühne, revolutionäre neue Konzepte« im Einzelhandel. Das war nicht gerade eine Arbeit, die er mit links bewältigen konnte – diese Leute verlangten unglaublich viel für ihr Geld –, und es gab Augenblicke an seiner klappernden Schreibmaschine, in denen er sich fragte, was der Mann einer Millionärin an so einem Ort zu suchen hatte.
Wenn er nach Hause kam, war er müde, sehnte sich nach ein paar Drinks, und es bestand nicht einmal die Hoffnung, dass er sich nach dem Abendessen mit seinem Manuskript zurückziehen konnte, denn die Kammer, in der er früher geschrieben hatte, diente inzwischen als Kinderzimmer.
Doch auch wenn er es sich immer wieder ins Gedächtnis rufen musste, wusste er, dass sich nur ein gottverdammter Idiot darüber beklagen würde, wie die Dinge liefen. Lucy war zum Inbegriff einer abgeklärten jungen Mutter geworden – ihm gefiel der Blick, der in ihr Gesicht trat, wenn sie das Baby stillte –, und das Baby selbst, mit seiner blütenzarten Haut und seinen runden, tiefblauen Augen, war ein steter Quell des Erstaunens. Ach, Laura, hätte er am liebsten gesagt, wenn er mit ihr umherging, bis sie einschlief, ach, kleines Mädchen, vertrau mir einfach. Vertrau mir, dann wirst du nie Angst haben.
Es dauerte nicht lange, bis Michael bei der Zeitschrift den Bogen heraus hatte. Als er für mehrere seiner »Artikel« lobend hervorgehoben wurde, begann er sich zu entspannen – vielleicht war es gar nicht nötig, sich für diese Sachen zu verausgaben –, und schon bald freundete er sich mit einem Kollegen an, einem umgänglichen, gesprächigen jungen Mann namens Bill Brock, dessen Verachtung für diese Arbeit noch größer zu sein schien als seine eigene. Brock hatte in Amherst studiert, danach ein paar Jahre bei der Elektrikergewerkschaft gearbeitet – »die beste, dankbarste Zeit meines Lebens« – und war jetzt mit dem Verfassen eines Buches beschäftigt, das er als »Arbeiterroman« bezeichnete.
»Zugegeben, da waren Dreiser und Frank Norris und diese Leute«, erklärte er Michael immer, »und dann noch der frühe Steinbeck, aber eigentlich gibt’s in Amerika keine proletarische Literatur. Wir haben eine Scheißangst, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken, darauf läuft’s doch hinaus.« Doch als käme ihm seine eigene Leidenschaft für soziale Reformen etwas absurd vor, tat er es in anderen Momenten mit einem trübseligen kurzen Kopfschütteln ab und sagte, er sei wohl zwanzig Jahre zu spät geboren.
Als Michael ihn eines Abends zum Essen einlud, sagte er: »Klar, gern. Ist es okay, wenn ich meine Freundin mitbringe?«
»Aber natürlich.«
Und als Michael ihm die Adresse in der Perry Street aufschrieb, sagte er: »Ich fasse es nicht; wir sind ja fast Nachbarn. Wir wohnen nur ein paar Hundert Meter von euch entfernt, auf der anderen Seite des Abingdon Square. Also gut; wir freuen uns drauf.«
Und von dem Augenblick an, als Bill Brock mit seiner Freundin – »Das ist Diana Maitland« – die Wohnung der Davenports betrat, befürchtete Michael, er könnte insgeheim, quälend, für immer in sie verliebt sein. Sie war schlank und schwarzhaarig, hatte ein trauriges, junges Gesicht, das auf eine große Ausdruckskraft hindeutete, und bewegte sich fast wie ein Mannequin – oder eher mit einer achtlosen, schlaksigen Eleganz, die durch eine Ausbildung zum Mannequin bloß verfeinert und zerstört worden wäre. Er konnte den Blick nicht von ihr wenden und nur hoffen, dass Lucy es nicht bemerkte.
Als die vier vor ihrem ersten oder zweiten Drink saßen, bedachte ihn Diana Maitland mit einem kurzen, funkelnden Blick. »Michael erinnert mich an meinen Bruder«, sagte sie zu Brock. »Meinst du nicht auch? Ich meine, nicht so sehr vom Gesicht her, sondern vom Körperbau und Auftreten; irgendwie von der ganzen Persönlichkeit.«
Bill Brock runzelte die Stirn und schien nicht ihrer Meinung zu sein, doch er sagte: »Aber das ist ein großes Kompliment, Mike: Sie ist vernarrt in ihren Bruder. Sehr netter Kerl, ich glaube, du würdest ihn mögen. Manchmal ein bisschen launisch und unausgeglichen, aber im Grunde ein sehr …« Er hielt die Hand hoch, um jeglichen Einwand Dianas abzuwehren. »Na komm schon, Baby, das ist durchaus zutreffend. Du weißt genau, dass er eine totale Plage sein kann, wenn er getrunken hat und diesen grüblerischen Großer-tragischer-Künstler-Scheiß abzieht.« Und als sei er überzeugt, sie zum Schweigen gebracht zu haben, wandte er sich wieder den Davenports zu und erklärte, Paul Maitland sei Maler – »Nach allem, was ich höre, sogar ein verdammt guter, und ich meine, zumindest das muss man ihm lassen: Er schuftet wie ein Berserker und scheint sich nicht darum zu kümmern, ob er damit irgendwann mal Geld verdient. Wohnt ganz weit unten in der Delancey Street oder so, in einem Atelier so groß wie ’ne Scheune, das ihn um die dreißig Dollar im Monat kostet. Arbeitet als Zimmermann, um die Miete bezahlen und sich Alkohol kaufen zu können – kannst du dir das vorstellen? Ein knallharter Bursche. Wenn jemand käme und ihm eine Stelle anbieten würde, wie wir sie haben – verstehst du? als Grafiker oder so? –, wenn das je passieren würde, würde er ihm eine reinhauen. Für ihn wäre das kompromittierend. Er würde sagen, dass man ihn überreden will, sich zu verkaufen, und genauso würde er es auch formulieren: ›sich verkaufen‹. Nein, aber ich schwärme total für Paul, und ich bewundere ihn. Ich bewundere jeden, der den Mut hat, seinen … du weißt schon … den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. Paul und ich waren zusammen in Amherst; sonst wäre ich diesem Geschöpf hier nie begegnet.«
Der Ausdruck »dieses Geschöpf« hallte das ganze Abendessen und noch lange darüber hinaus in Michaels Kopf nach. Diana Maitland mochte nur ein zum Essen eingeladenes Mädchen sein, das höflich Lucys Kochkünste lobte; sie mochte auch während des ein- oder zweistündigen Gesprächs, das folgte, nur ein Mädchen sein und ebenso als Bill Brock ihr in der Diele in den Mantel half, sie sich verabschiedeten und ihre Schritte auf dem Weg über den Abingdon Square zu Brocks Wohnung, »ihrer« Wohnung, allmählich verhallten – doch sobald sie zu Hause waren, die Tür hinter sich abgeschlossen und ihre Kleidungsstücke auf dem Fußboden verstreut, sobald sie sich windend und stöhnend in Brocks Armen, in seinem Bett lag, würde sie ein Geschöpf sein.
Im Herbst jenes Jahres gab es noch weitere Besuche auf beiden Seiten des Abingdon Square. Jedes Mal nahm Michael allen Mut zusammen, um einen raschen Blick von Diana zu Lucy zu riskieren, in der Hoffnung, Lucy könnte sich als die Attraktivere von beiden erweisen, doch er wurde immer enttäuscht. Jedes Mal gewann Diana den Wettbewerb – O Gott, was für ein Mädchen! –, bis er nach einer Weile beschloss, mit diesen kläglich geheimen Vergleichen aufzuhören. Wie konnte man nur so etwas Saudummes tun? Andere Ehemänner taten es vielleicht hin und wieder, größtenteils um sich zu quälen, doch man musste nicht besonders klug sein, um zu wissen, wie dumm es war. Und wenn er und Lucy allein waren und er sie aus verschiedenen Blickwinkeln und in jeglichem Licht betrachten konnte, fiel es ihm stets leicht zu glauben, dass sie hübsch genug war, um das ganze Leben mit ihr zu verbringen.
Eines eiskalten Dezemberabends fuhren die vier auf Dianas Drängen hin im Taxi nach Downtown, um ihren Bruder zu besuchen.
Wie sich herausstellte, sah Paul Maitland Michael kein bisschen ähnlich: Er trug zwar ebenfalls einen Schnurrbart, den er in der kurzen Schüchternheit angesichts fremder Leute mit seinen schönen Fingern berührte und glatt strich, doch auch das schuf keine wirkliche Ähnlichkeit, denn seiner war viel üppiger – der Schnurrbart eines furchtlosen jungen Bilderstürmers im Gegensatz zu dem eines Büroangestellten. Er war schlank und geschmeidig, das männliche Gegenstück zum Modestil seiner Schwester, in Jeans und Jeansjacke gekleidet, unter der Jacke einen Matrosenpullover, und er sprach in höflichem Ton mit einer sanften, geradezu flüsternden Stimme, sodass man sich aus Angst, etwas überhören zu können, leicht vorbeugte.
Als er die Gäste durch sein Atelier führte, ein großes, schlichtes Loft, das einmal eine kleine Fabrik beherbergt hatte, mussten sie feststellen, dass sie keins seiner Gemälde erkennen konnten, weil alles im Schatten des Lichtscheins einer jenseits der Fensterscheiben schimmernden Straßenlaterne lag. Doch hinten in einer Ecke hingen an Seilen etliche Meter schweren Sackleinens, das eine Art Zelt bildete, und in diesem kleinen abgegrenzten Bereich hatte sich Paul Maitland für den Winter eingerichtet. Er hob eine Stoffbahn an, um sie ins Innere zu führen, und dort entdeckten sie andere Leute, die mit Rotwein in der Wärme eines Petroleumofens saßen.
Bei der flüchtigen Vorstellung bekam man die meisten Namen nicht richtig mit, doch inzwischen war Michael eher mit Kleidung als mit Namen beschäftigt. Er saß auf einer umgedrehten Orangenkiste, ein warmes Glas Wein in der Hand, und konnte nur daran denken, dass er und Bill Brock in ihren Straßenanzügen, den Button-Down-Hemden und Seidenkrawatten hoffnungslos deplatziert wirken mussten, zwei lächelnde Eindringlinge von der Madison Avenue. Und er wusste, dass sich auch Lucy unbehaglich fühlen musste, doch er wollte ihr nicht ins Gesicht blicken und sich davon überzeugen.
Diana war in dieser Gruppe eindeutig willkommen – als sie unter dem Sackleinen hindurchgetaucht war, hatten mehrere Leute »Diana!« und »Baby!« gerufen –, und jetzt saß sie hübsch neben den Füßen ihres Bruders auf dem Boden und unterhielt sich angeregt mit einem stellenweise kahlköpfigen jungen Mann, dessen Kleidung darauf schließen ließ, dass auch er Maler war. Wenn sie je das Interesse an Brock verlor – und würde das nicht jedem erstklassigen Mädchen schon bald so gehen? –, würde sie nicht lange überlegen müssen, wo sie als Nächstes suchen sollte.
Außerdem war noch ein Mädchen namens Peggy da, das nicht älter als neunzehn oder zwanzig zu sein schien, ein reizendes, ernstes Gesicht hatte, eine Bauernbluse und einen Dirndlrock trug und fest entschlossen wirkte zu zeigen, dass sie zu Paul gehörte. Sie saß so dicht wie möglich neben ihm auf der niedrigen Schlafcouch, die ihnen offenbar als Bett diente; sie ließ ihn nicht aus den Augen, und es war deutlich, dass sie auch gern die Hand auf ihm gehabt hätte. Während er sich vorbeugte und das Kinn hob, um über den Ofen hinweg ein paar lakonische Bemerkungen mit dem Mann auf der Orangenkiste neben Michael auszutauschen, schien er Peggy kaum zu bemerken, doch als er sich wieder zurücklehnte, lächelte er sie träge an und legte nach einer Weile den Arm um sie.
Niemand in dem trockenen, überheizten kleinen Behelfsraum sah so sehr nach einem Künstler aus wie der Mann auf der Orangenkiste neben Michael – er trug einen weißen Overall voller Farbflecke –, doch er sagte schnell, dass er »nur ein Dilettant, ein wohlmeinender Laie« sei. Er war ein hiesiger Unternehmer, ein Zulieferer in der Baubranche: Er war es, der Paul Maitland die Teilzeitstelle als Zimmermann verschafft hatte, die ihn am Leben erhielt.
»Und ich betrachte es als Privileg«, sagte er, sich näher zu Michael beugend und die Stimme senkend, damit ihr Gastgeber es nicht hörte. »Ich betrachte es als Privileg, weil dieser Junge gut ist. Dieser Junge hat’s einfach drauf.«
»Das ist … das ist schön«, sagte Michael.
»Wissen Sie, er hat im Krieg eine Menge mitgemacht.«
»Ach?« Das war ein Teil der Paul-Maitland-Geschichte, den Michael noch nicht gehört hatte – wahrscheinlich weil Bill Brock, der im Krieg als untauglich eingestuft worden und in diesem Punkt noch immer empfindlich war, keine Lust gehabt hatte, ihm davon zu erzählen.
»O Gott, ja. Natürlich zu jung, um alles mitgemacht zu haben, aber von der Ardennen-Offensive bis zum Ende voll dabei. Infanterie. Grenadier. Redet nicht drüber, aber man kann es sehen. Man kann es an seinem Werk sehen.«
Michael löste seine Krawatte und knöpfte den Kragen auf, als könnte sein Gehirn so besser arbeiten. Er wusste nicht, was er von dem Ganzen halten sollte.
Der Mann im Overall kniete sich hin, um sich aus dem riesigen Krug auf dem Fußboden noch etwas Wein einzuschenken; als er zurückkam, trank er einen Schluck, wischte sich mit dem Ärmel den Mund ab und begann wieder im selben Ton vertraulicher Ehrfurcht mit Michael zu reden. »Verdammt, in New York wimmelt’s nur so von Malern«, sagte er. »Das ganze verdammte Land, wenn man so will. Aber einen Jungen wie den hier findet man vielleicht ein Mal pro Generation. Davon bin ich überzeugt. Und es kann Jahre dauern, ja vielleicht passiert es nicht mal zu seinen Lebzeiten, da sei Gott vor« – bei diesen Worten streckte er die Hand nach unten und klopfte mit den Fingerknöcheln an eine Latte seiner Kiste – »aber eines Tages werden unglaublich viele Leute ins Museum of Modern Art kommen, und alles dort wird von Paul Maitland sein. In jedem einzelnen Raum. Davon bin ich überzeugt.«
Ja, okay, toll, hätte Michael am liebsten gesagt, aber könnten Sie jetzt mal davon aufhören? Stattdessen nickte er langsam in respektvollem Schweigen; dann starrte er über den Petroleumofen hinweg Paul Maitlands abgewandtes Gesicht an, als könnte eine genaue Musterung desselben einen erfreulichen Makel enthüllen. Er dachte daran, dass Maitland in Amherst gewesen war – wusste nicht jeder, dass Amherst eine teure Universität für feine Pinkel und geistige Tiefflieger war? –, doch nein, seit dem Krieg stimmten diese Klischees angeblich nicht mehr; und außerdem hatte er sich vielleicht für Amherst entschieden, weil es dort ein gutes Kunstinstitut gab oder ihm mehr Zeit zum Malen zugestanden wurde als an anderen Colleges. Dennoch musste er dort nach den ganzen Strapazen bei der Infanterie einen Vorgeschmack von aristokratischer Trägheit bekommen haben. Vermutlich hatte er wie alle anderen sich um den exakt richtigen Schnitt von Tweedkleidung und Flanellhosen gesorgt, um den exakt richtigen lockeren, geistreichen Gesprächston und am allgemeinen Wetteifern um Perfektion in der Planung eines sorglosen Wochenendes teilgenommen (»Bill, ich würde dich gern meiner Schwester Diana vorstellen …«). Verlieh das Ganze diesem ungestümen Abstieg in die Niederungen der Boheme und die gelegentliche Arbeit als Zimmermann nicht etwas ziemlich Lächerliches? Nun, vielleicht; vielleicht auch nicht.
In dem Glaskrug waren noch ein paar Fingerbreit Wein, doch Paul Maitland verkündete in seinem üblichen Murmeln, dass es Zeit sei für einen richtigen Drink. Er griff in eine Nische des herabhängenden Sackleinens und holte eine Flasche des billigen Whiskeyverschnitts namens Four Roses hervor – so ein Zeug zu trinken, hatte er todsicher nicht in Amherst gelernt –, und Michael fragte sich, ob sie jetzt vielleicht die Seite von ihm zu sehen bekämen, über die Bill Brock gelästert hatte: dass er, vom Alkohol benebelt, den grüblerischen Großer-tragischer-Künstler-Scheiß abzog.
Doch offensichtlich stand dafür weder genug Zeit noch genug Whiskey zur Verfügung. Paul schenkte allen großzügig Drinks ein, die sie anerkennend nach Luft schnappen oder das Gesicht verziehen ließen, und trotz des schlechten Geschmacks fand auch Michael an der Wirkung Gefallen. Für eine Weile wurden die Gespräche in dem mit Sackleinen abgegrenzten Raum lebhafter und temperamentvoller – mehrere Stimmen wurden richtig übermütig –, doch schon bald war es kurz vor Mitternacht, und alle standen auf und zogen ihre Mäntel an, um zu gehen. Paul erhob sich, um sich von seinen Gästen zu verabschieden, doch nach dem dritten oder vierten Händedruck bückte er sich, erstarrte und widmete seine ganze Aufmerksamkeit einem kleinen verschmierten Plastikradio, das den ganzen Abend auf dem Fußboden neben dem Bett gebrummt und geknistert hatte. Das Rauschen des Radios hatte sich verflüchtigt, und jetzt ertönte eine wohlklingende, schnelle Melodie voller Klarinetten, die alle ins Jahr 1944 zurückversetzte.
»Glenn Miller«, sagte Paul und kauerte sich flink hin, um das Radio lauter zu drehen. Dann schaltete er eine helle Deckenleuchte hinter dem Sackleinen ein, fasste seine Freundin an der Hand und führte sie in die Kälte des Ateliers hinaus, um mit ihr zu tanzen. Doch dort draußen war die gedämpfte Musik für seinen Geschmack nicht laut genug, und er kam wieder hereingeeilt, trug das Radio mit dem Stecker in der freien Hand nach draußen und suchte an der Fußleiste vergeblich nach einer Steckdose. Dann hob er von einem im Schatten liegenden Stück Fußboden das Anschlussende einer Geräteschnur auf, eine flache rechteckige Vorrichtung mit zwei Löchern, in die man die Zinken eines elektrischen Bügeleisens oder eines altmodischen Toasters steckte, und er zögerte nur ganz kurz angesichts der Frage, ob das funktionieren würde.
Michael hätte am liebsten gesagt: Nein, warte, ich würde das sein lassen – es sah so gefährlich aus, dass jedes Kind es besser gewusst hätte –, doch Paul Maitland zwängte den Radiostecker mit der Gelassenheit eines Mannes, der weiß, was er tut, in das andere Ding. In seinen Händen blitzte ein großer blau-weißer Funke auf, doch die Sicherung flog nicht raus, und es funktionierte: Das Radio lief wieder in voller Lautstärke, und er kehrte im selben Moment zu dem Mädchen zurück, als Glenn Millers Holzblasinstrumente vom aufsteigenden, triumphierenden Schmettern seiner Blechbläser abgelöst wurden.
Während Michael in seinem Mantel dastand und sich dumm vorkam, musste er eingestehen, dass es eine Freude war, den beiden beim Tanzen zuzuschauen. Pauls schwere, hoch geschnittene Arbeitsschuhe waren erstaunlich geschmeidig bei ihren eleganten kleinen Schritten auf dem Fußboden, und auch der Rest von ihm war schierer Rhythmus: Er wirbelte Peggy so weit von sich, wie es ihre verschränkten Hände zuließen, und dann zog er sie wirbelnd wieder heran, sodass sich ihr Dirndlrock bauschte und ihre hübschen jungen Knie umschwebte. Weder an der Highschool noch in seiner gesamten Militärzeit oder in Harvard hatte Michael je so gut tanzen gelernt – was nicht daran lag, dass er es nicht versucht hatte.
Und so lange er sich so dumm vorkam, konnte er genauso gut das große Gemälde in Augenschein nehmen, das jetzt im Licht der einzigen Atelierlampe zu sehen war. Es war, wie er befürchtet hatte: unbegreiflich bis zur Grenze des totalen Chaos; es schien keinen Sinn für Ordnung zu haben oder überhaupt einen Sinn, außer vielleicht in der Stille der Gedanken des Malers. Es war das, was Michael widerwillig Abstrakten Expressionismus zu nennen gelernt hatte, die Art Bild, die einmal zu einem schlimmen Streit mit Lucy geführt hatte, als sie, noch vor ihrer Hochzeit, im gedämpften Stimmengewirr einer Bostoner Kunstgalerie standen.
»… Wie meinst du das, du ›kapierst‹ es nicht?«, hatte sie verärgert gefragt. »Da gibt es nichts zu ›kapieren‹, verstehst du? Das ist nichts Gegenständliches.«
»Und was ist es dann?«
»Genau das, wonach es aussieht: eine Komposition aus Formen und Farben, vielleicht eine Feier des Malens selbst. Die persönliche Aussage des Künstlers, das ist alles.«
»Ja, ja, klar, aber ich meine, wenn es seine persönliche Aussage ist, was will er dann damit sagen?«
»Ach, Michael, das glaub ich jetzt nicht; ich glaube, du willst mich auf den Arm nehmen. Wenn er es hätte sagen können, hätte er es nicht malen müssen. Na los, gehen wir, bevor wir …«
»Nein. Moment. Hör zu: Ich kapiere es immer noch nicht. Und es ist sinnlos, mir das Gefühl zu geben, ich wäre zu dumm dafür, Liebling, denn das wirkt nicht.«
»Ich glaube, das redest du dir selbst ein«, sagte sie. »Wenn du dich so benimmst, weiß ich nicht mal, wie ich mit dir reden soll.«
»Also, überleg dir besser mal was Neues, Liebling, sonst wird alles bloß noch schlimmer. Denn weißt du, was los ist, wenn du diese herablassende kleine Radcliffe-Nummer abziehst? Dann gehst du mir total auf die Nerven. Das meine ich ernst, Lucy …«
Doch als sie jetzt, hier in Paul Maitlands Atelier, als seine sorgfältig eingemummte, angenehm müde Frau zu ihm kam und die Hand unter seinen Arm schob, ließ er sich gern von ihr zur Tür lotsen. Es würde andere Gelegenheiten geben. Vielleicht würde er, wenn er erst genug von Paul Maitlands Werk gesehen hatte, anfangen, es zu verstehen.
Als sie hinter Bill Brock und Diana die kalte, schmutzige Treppe zur Delancey Street hinunterstapften, wandte sich Bill gut gelaunt um und rief: »Hoffentlich seid ihr auf einen kleinen Spaziergang gefasst – denn in dieser Gegend finden wir todsicher kein Taxi.« Und schließlich gingen sie mit eiskalten Füßen und triefender Nase die ganze Strecke zu Fuß.
»Die beiden sind irgendwie … ungewöhnlich, oder?«, sagte Lucy später in der Nacht, als sie und Michael allein waren und sich bettfertig machten.
»Wer?«, fragte er. »Diana und Bill?«
»O Gott, nein, doch nicht Bill. Der ist bloß ein großmäuliger Klugscheißer – eigentlich habe ich ihn allmählich ein bisschen satt, du nicht auch? Nein, ich meine Diana und Paul. An den beiden ist etwas Besonderes, oder? Etwas irgendwie … Übernatürliches. Etwas Zauberhaftes.«
Und er wusste sofort, was sie meinte, hätte es vielleicht aber anders ausgedrückt. »Ja, schon«, sagte er. »Ich meine, ich weiß, was du meinst.«
»Und ich habe ein ganz seltsames Gefühl gegenüber den beiden«, sagte sie. »Als ich heute Abend dasaß und sie beobachtete, dachte ich ständig: Solche Menschen wollte ich ein Leben lang kennenlernen. Ach, wahrscheinlich will ich bloß sagen, dass ich mich danach sehne, von ihnen gemocht zu werden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen, und es macht mich nervös und traurig, dass sie es wohl nicht tun werden oder, falls doch, dass es nicht von großer Dauer sein wird.«
Sie wirkte verloren, wie sie da in ihrem Nachthemd auf der Bettkante saß, der Inbegriff eines armen kleinen reichen Mädchens, und ihre Stimme klang, als bräche sie jeden Moment in Tränen aus. Wenn sie zuließ, dass sie über so etwas weinte, dann würde sie sich mit Sicherheit schämen, und das würde alles bloß noch schlimmer machen.
Und so sagte er ihr in dem tiefsten, beruhigendsten Ton, den er zustande brachte, dass er ihre Ängste verstand. »Ich meine, ich stimme dir nicht unbedingt zu – warum sollten sie dich nicht mögen? Warum sollten sie uns beide nicht mögen? –, ich will bloß sagen, dass ich weiß, was du meinst.«
3. KAPITEL
Die White Horse Tavern in der Hudson Street wurde ihr liebster Treffpunkt. Meistens waren sie zu viert – Bill, Diana und die Davenports –, doch erstaunlich oft gab es auch andere, schönere Abende, an denen Paul Maitland mit Peggy uptown kam, um mit ihnen an einem der großen, feuchten braunen Tische zu trinken, zu reden und lachen, ja sogar zu singen. Michael sang schon immer gern; er rühmte sich, die Texte aller möglichen unbekannten Lieder zu kennen und gewöhnlich ein Gespür dafür zu haben, wann es genug war, doch an manchen Abenden musste Lucy die Stirn runzeln oder ihn mit dem Ellbogen anstoßen, um ihn zum Schweigen zu bringen.
Das war kurz bevor der Tod von Dylan Thomas das White Horse berühmt machte. (»Und wir haben ihn dort nicht mal gesehen«, beklagte sich Michael noch jahrelang. »Ist das nicht unglaublich? Hab fast jeden Abend im Horse rumgesessen und den Mann nie bemerkt – wie konnte man dieses Gesicht bloß übersehen? Verdammt, ich hab nicht mal gewusst, dass er in Amerika war, als er gestorben ist.«)
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!