
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Jungbrunnen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ansichtskarten, die ein kleines Mädchen in den 1930er Jahren in einem Album gesammelt hat, sind der Ausgangspunkt für diesen außergewöhnlichen Roman, in dem Fiktion und Wahrheit aufeinandertreffen. Die Autorin ist der Spur der Karten gefolgt, hat jahrelang recherchiert, mit Zeitzeugen gesprochen, hat Fakten kunstvoll mit einer Geschichte verwoben. Leny Goldstein wird am 23. November 1929 in Breda, einer Stadt in den Niederlanden, geboren. 1942, einen Tag vor ihrem dreizehnten Geburtstag, wird sie im Konzentrationslager Auschwitz Birkenau ermordet. Dazwischen spannt sich das Leben eines jüdischen Mädchens, seiner Familie und Freunde, anfangs optimistisch und zuversichtlich, mit den besten Voraussetzungen für eine glückliche Zukunft. Obwohl nach dem Einmarsch der Deutschen die Repressalien der Nationalsozialisten immer stärker werden, fliehen die Goldsteins nicht und tauchen auch nicht unter – sie können nicht glauben, wozu Menschen fähig sind und dass es immer noch schlimmer kommen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rachel van Kooij
Eine Handvoll Karten
Rachel van Kooij
wurde 1968 in Wageningen in den Niederlanden geboren. Im Alter von zehn Jahren übersiedelte sie nach Österreich. Nach der Matura studierte sie Pädagogik und Heil- und Sonderpädagogik an der Universität Wien.
Rachel van Kooij lebt in Klosterneuburg und arbeitet als Behindertenbetreuerin und Autorin.
Folgende Bücher von Rachel van Kooij sind bei Jungbrunnen lieferbar:
Das Vermächtnis der Gartenhexe (2002), Kein Hundeleben für Bartolomé (2003), Der Kajütenjunge des Apothekers (2005), Nora aus dem Baumhaus (2007), Klaras Kiste (2008)
ISBN 978-3-7026-5817-5
eISBN 978-3-7026-5988-2
1. Auflage 2010
Einbandgestaltung: Christian Hochmeister
© Copyright 2010 by Verlag Jungbrunnen Wien
Alle Rechte vorbehalten – printed in Austria
Druck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. Stefan
Gedruckt auf Munken Print 1,8, 90g von
Rachel van Kooij
Eine Handvoll Karten
Jungbrunnen
Abkürzungsverzeichnis, Begriffserklärungen und chronologischer Überblick ab Seite 250
Inhalt
Vorwort
Das Ende
Die letzten Minuten
Die ersten Tage
Die ersten Jahre
Die Jahre vor dem Krieg
Krieg
Der Anfang vom Ende
Das letzte Jahr
Die letzten Tage
Anhang
Chronologie
Danksagung
Vorwort
Als ich das Album entdeckte, war ich acht Jahre alt und zu Besuch bei meinen Großeltern in Breda, einer Stadt im Süden der Niederlande, nahe der belgischen Grenze. Der blaue Umschlagkarton des Albums war brüchig und fleckig. Auf der Vorderseite waren ein paar rote und orangefarbene Blumen abgebildet, mit langen, grünen Stielen. In zierlicher goldener Schrift geprägt stand daneben: Album für Ansichtskarten.
Vorsichtig schlug ich die vergilbten Seiten auf. Sie lösten sich aus dem Buchrücken, wenn man nicht aufpasste. Auf jedem Blatt war Platz für vier Ansichtskarten. Ich betrachtete die Karten. Viele waren langweilige Schwarz-Weiß-Fotos. Einige waren anscheinend im Nachhinein mit blassen Farben bemalt worden, um sie attraktiver zu machen. Etwas, das ich seltsam und ziemlich hässlich fand. Und dann kam ich zu einer Seite, in der bunt gezeichnete Karten mit fröhlichen Kindern und Tieren steckten.
Ich zeigte das Album meiner Mutter und fragte, ob sie oder meine Tante Netty diese Karten als Kinder erhalten hatten.
Ihre knappe Antwort habe ich nie vergessen.
„Dieses Kartenalbum gehörte Leny. Leny war eine Freundin, und sie wurde ermordet.“
Ich habe damals nicht nachgefragt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil ich so erschrocken war.
Jahre nach dem Tod meiner Großeltern, Mutter und Tante räumte ich einen Schrank aus und fand das Album zum zweiten Mal.
Ich blätterte darin, stieß auf die bunten Kinderkarten und erinnerte mich wieder an diese zwei Sätze.
Da beschloss ich herauszufinden, wer Leny war und was mit ihr passiert ist.
Das Ende
Montag, 23. November 1942Birkenau
Jetzt
Aschengrauer
Schnee hinter Stacheldraht
Leben
von Stiefeln zertreten
Zukunft
im Rauch vergangen
Die letzten Minuten
Sonntag, 22. November 1942Birkenau
Wie soll sie sich in dem Gedränge waschen? Sie kann nicht einmal ihre linke Hand hochheben, die sich an die Seife klammert, einen kleinen, steinharten, grauen Klumpen mit schwarzen Rissen.
Wie silbrigschuppige Sardinen in der Konserve stehen sie nackt aneinandergepresst. Außer Carry hat Leny noch nie jemanden ganz ohne Kleidung gesehen. Und nun wird Carry von der Menschenmenge gegen sie gedrückt. Draußen schreien die Männer und bellen die Hunde.
Sie sollen sich das Stückchen Seife teilen, hat Mams gesagt.
Mams …
Sie steht hinter ihnen. Leny fühlt Mams’ Hand auf ihrer rechten Schulter. Die Finger drücken sich schmerzhaft in ihre Haut.
Leny hat weggeschaut, als ihre Mutter sich in der langen Holzbaracke ausgezogen hat. Sie wollte nicht sehen, wie diese sich, wie die anderen um sie herum, in eine fremde Gestalt aus bleicher, schwabbeliger Haut verwandelte. Wenn sie sich jetzt nur zu ihr umdrehen und ihr Gesicht tief in Mams’ Bauch versenken könnte. Es gelingt ihr nicht. Noch immer schieben sich Menschen in den kahlen Raum, angetrieben von harschen Befehlen, die sie nicht versteht. Mehr und mehr Menschen, obwohl längst kein Platz mehr ist. Neben sich spürt sie, dass ihre jüngere, pummelige Schwester am ganzen Körper bebt. Vor ihr versucht eine Mutter noch ein weinendes Kind hochzuheben, obwohl sie bereits einen Säugling und einen kleinen Jungen trägt. Als sie unweigerlich alle ein Stück weitergeschoben werden, rutscht das Kind ihr wieder von der Hüfte herunter. Einen Augenblick lang treffen sich Lenys Augen mit denen des Mädchens, zwei weit aufgerissene Löcher in einem von Tränen und Rotz verschmierten Gesicht. Dann ist das Mädchen weiter unten, und Leny merkt, wie es zwischen ihr und der fremden Mutter immer fester zusammengedrückt wird. Sie kann sich nicht bücken, um es hochzuziehen. Das Gedränge von hinten wird immer schlimmer, und der Arm mit der Seife, den sie nach oben hält, steckt auf einmal fest, als ob sie in der Schule eifrig aufzeigen würde.
Leny streckt den Hals nach hinten und blickt hinauf. Mams schaut zu ihr hinunter. Das Gesicht, das Leny sieht, ist ihr gleichzeitig vertraut und furchtbar fremd. Mams’ Lippen bewegen sich, aber Leny versteht nichts. Das Schreien, Stöhnen und Weinen um sie herum übertönt alles. Über Mams’ Kopf kann sie eine Brause an der Decke sehen, ein grau glänzender Fleck mit kleinen schwarzen Löchern.
Ob das Wasser kalt sein wird?
Die ersten Tage
Samstag, 23. November 1929Breda, Sankt Ignatiuskrankenhaus
„Leny Caroline“, sagt Silvain Goldstein. „Nach meiner Mutter und deiner Mutter.“
Rosa nickt.
„Möchtest du sie halten?“, fragt sie.
Silvain schaut auf das Kind in Rosas Armen. So klein, so zart. Mit seiner Hand könnte er das Köpfchen mit dem Flaum dunkler Haare mit Leichtigkeit umfassen.
„Barukh attah Adonai eloheinu melekh ha-olam, she-hecheyanu v’ki-yemanu v’higianu lazeman hazeh“, betet er lautlos und wippt dabei kaum merkbar auf und ab.
„Gesegnet bist du, Herr unser Gott, König des Universums, der uns das Leben gibt, uns erhält, der uns diese Freude schenkt.“
Dieses Gebet hat er sich vorgenommen. Er hat es sich heute nach dem Dienst vom Rabbiner aufschreiben und übersetzen lassen. Sonst ist er nicht so traditionell fromm, aber das war ihm wichtig.
Dann erst beugt er sich über seine Frau und nimmt vorsichtig das Bündel in den Arm.
Leny schläft. Silvain sieht, wie bei jedem Atemzug die Augenlider ein klein wenig flattern. Und das Näschen zuckt hie und da. Er kann sich an dem kleinen Wunder nicht sattsehen. Schließlich drückt er ihr zart einen ersten Kuss auf die Stirn.
„Leny Caroline Goldstein. Ich werde alles dafür tun, dass du eine schöne, nein, eine wunderbare Zukunft hast“, verspricht er ihr feierlich.
Montag, 25. November 1929 Breda, Sankt Ignatiuskrankenhaus
„Frau Goldstein?“ Schwester Perpetua kommt herein. Ihre gestärkte Schürze raschelt, als sie geschäftig an das Krankenhausbett tritt.
„Kaum zwei Tage alt und schon ihre erste eigene Post.“ Sie reicht Rosa eine Ansichtskarte und einen Brief. Auf der Vorderseite der Karte bläst ein kleiner Kutscher in sein Posthorn, und ein pausbäckiges Mädchen im gelben Kleid steht verlegen lächelnd daneben.
Rosa dreht die Karte um. Von Jacques und Olga. Silvain muss seinem Bruder gleich vorgestern die Geburt telegrafiert haben.
„Der kleine Louis wird es bei der nächsten Familienfeier schwer haben“, denkt sie zufrieden. Bei ihrer Hochzeit letztes Jahr war Olga als strahlende junge Mutter aufgetreten und hatte allen stolz ihren kleinen, rothaarigen Jungen präsentiert. Rosa war sich umso pummeliger vorgekommen in dem Kleid, das trotz aller Bemühungen der Schneiderin immer noch unter den Achseln zwickte und zu straff über ihren Hüften lag.
Rosa betrachtet nochmals eingehend die Vorderseite.
Es würde sie nicht wundern, wenn Olga in dem Kutscher ihren Louis sähe und das Mädchen mit dem schüchternen Augenaufschlag Leny sein sollte.
„Ach, immer diese Eifersucht“, schilt sie sich. Das sollte sie endlich lassen. Jetzt hat sie schließlich keinen Grund mehr.
Sie legt die Karte beiseite und reißt den Briefumschlag auf. Er ist von Alie. Die Frau ihres Bruders Victor gratuliert ihr kurz und herzlich. Kein Wort verliert sie über ihre eigene schwierige Situation. Dabei weiß Rosa nur zu gut, wie sehr Alie kämpfen muss, um sich und die drei Kinder über Wasser zu halten. Auf Victor kann sie nicht zählen. Rosa betrachtet Leny, die neben ihrem Bett in der Wiege schläft. Woher kann man wissen, was aus einem Kind wird? Ist alles vorgegeben, und hat ihr Bruder von Anfang an keine Chance gehabt, ein verantwortungsbewusster Erwachsener zu werden wie sie selbst und die zwei anderen Geschwister? Richard hat studiert und ist als Chemiker nach Ostindien gezogen, hat seine Martha geheiratet und zwei Kinder bekommen, Ellen und Freddy. Seit sie selbst nicht mehr in Ostindien wohnt, kennt sie die beiden nur mehr von den Fotos, die Martha und Richard den Briefen beilegen. Ada, die jüngere Schwester, ist ihrem Emile nach Frankreich gefolgt, und ihre beiden Kinder Ernest und Denise sind echte kleine Franzosen. Sie selbst hat als Lehrerin vergeblich versucht, nach der Ausbildung eine dauerhafte Anstellung daheim zu finden, und sich schließlich für einen Posten in Ostindien beworben. Sie hat doch auch nicht verzagt, nur weil es nicht so lief, wie sie gehofft hatte.
„Warum also schafft Victor es nicht, aus seinem Leben etwas zu machen?“, grübelt Rosa. Dabei haben die Eltern ihn immer mehr unterstützt als seine Geschwister.
Nein, hadert Rosa, Victor ist so geworden, weil ihre Eltern ihm alle Hindernisse aus dem Weg geräumt und ihn verhätschelt haben. Vage kann sie sich noch an Hetty erinnern, die kränkelnde kleine Schwester, die mit kaum einem Monat plötzlich leblos in ihrer Wiege lag. Zum Glück ist Leny kerngesund und kräftig. Das hat der Arzt ihr mehrmals versichert.
Das Weinen der Mutter damals und die langen Wochen, in denen sie kaum mit ihren drei lebenden Kindern gesprochen, sie nicht geherzt und geküsst hat, sind jedoch in ihre Erinnerung als dunkle, einsame Zeit eingebrannt. Noch jetzt kann sie die Erleichterung nachempfinden, die sie spürte, als die beiden unverheirateten Tanten ins Haus kamen und das Ruder übernahmen. Die praktische Tante Henriette und die lebenslustige Tante Emilie. Tante Henriette kochte wieder richtige Mahlzeiten, stopfte die Socken und wusch die Wäsche. Tante Emilie jedoch zog Rosa und die kleine Schwester Ada auf den Schoß und sang ihnen Lieder vor, erzählte Geschichten und hörte geduldig zu, wenn Richard endlos über seine kleinen Schulsorgen berichtete.
Erst, als im Frühjahr darauf der kleine Bruder Victor auf die Welt kam, wurde die Mutter wie früher und gingen die Tanten wieder ihrer eigenen Wege.
Rosa faltet den Brief zusammen. Sie wird Alie schreiben, sobald sie zu Hause ist, und vorsichtig nachfragen, ob sie und Silvain irgendwie helfen können. Alie gibt nicht gerne zu, dass Victor kaum einen Gulden nach Hause bringt. Sogar das Fahrradgeschäft, das er unbedingt haben wollte und für das Mutter und Vater einen Teil ihrer Ersparnisse hergegeben hatten, ging nach wenigen Jahren in Konkurs. Rosa, gerade auf Heimaturlaub, hatte Alie in der Küche getröstet und aus ihrer Schwägerin herausgelockt, dass Victor, nachdem der erste Eifer verflogen war, sich nicht hatte aufraffen können, hinaus auf die Straßen zu gehen, um Kunden für seine Fahrräder finden. Aber vor allem hätte er die Reparaturaufträge prompt und sorgfältig erledigen müssen.
„Ich habe es versucht, Rosa, wirklich“, hatte Alie ihr müde versichert, während sie den kleinen Appie stillte, „aber ich konnte Elsi und Line doch nicht stundenlang alleine in der Wohnung lassen. Sie sind noch so klein.“
Elsi ist mittlerweile in der zweiten Klasse und Rosa schämt sich plötzlich, dass sie sich bis jetzt keine Gedanken gemacht hat, wie Alie das Schulgeld und all die zusätzlichen Ausgaben bezahlt. Sie zieht an der Klingelschnur. Sie wird Schwester Perpetua bitten, ihr gleich Papier und eine Füllfeder zu bringen. Jetzt, wo sie selbst so glücklich ist, darf es nicht sein, dass Alie vielleicht vor Sorgen nicht schlafen kann.
Während sie auf die Schwester wartet, betrachtet sie Leny. Der Säugling schlummert unter der Decke.
„Du wirst es besser haben als deine Cousinen und Cousins“, denkt Rosa.
Die ersten Jahre
Mittwoch, 29. Juni 1932Breda, Sankt Ignatiuskrankenhaus
An Paps’ Hand steht Leny neben dem Krankenbett.
„Jetzt hast du eine Schwester. Eine richtige, kleine Schwester“, sagt Silvain stolz. „Sie heißt Caroline Emilie.“
Er hebt Leny hoch und setzt sie vorsichtig am Fußende auf die Bettdecke. Leny betrachtet nachdenklich das Baby, das, fest in eine flauschige, weiße Decke eingewickelt, in Mams’ Armen liegt.
Sie hat es kaum erwarten können, endlich eine große Schwester zu werden. Ganz zappelig vor Aufregung ist sie mit Paps ins Krankenhaus spaziert. Kein einziges Mal hat sie gebettelt, getragen zu werden, weil sie weiß, dass große Schwestern flink und tüchtig beim Marschieren sind.
Aber nun macht das Baby die Augen nicht auf, um sie zu begrüßen, und hübsch ist es auch nicht, mit dem roten Gesicht.
Leny runzelt die Stirn. Eigentlich möchte sie Mams ganz fest küssen und mit ihr kuscheln.
Nur geht das leider nicht, weil das neue Kind im Weg ist. Und drüberklettern, um näher zu Mams zu gelangen, darf sie bestimmt nicht. Auf einmal ist es gar nicht mehr so schön, eine große Schwester zu sein!
Ihre Unterlippe zittert. Mams merkt es.
„Was ist denn, Kätzchen?“, fragt sie behutsam.
„Darfst du das Baby auch ein bisschen weglegen?“, flüstert Leny kleinlaut.
Ende September 1932 Breda
In der Veemarktstraat bleibt Silvain wie zufällig vor der Musikalienhandlung Bender stehen. Das macht er oft. Andere verweilen vor den Auslagen von Möbelgeschäften, Zuckerbäckern oder Fotografen. Für ihn jedoch sind die Regale mit den Noten und die polierten Pianos so unwiderstehlich wie eine Stange Wurst für einen Hund. Herr de Groot, der Filialleiter, ändert wöchentlich das Schaufenster, sodass es jedes Mal etwas anderes zu betrachten gibt. Aber heute wird Silvain nicht hier draußen stehen bleiben.
Schon als Kind hat sich sein musikalisches Talent gezeigt und sein Vater hat ihn deshalb zu Fräulein Emilie Foyer in die Klavierstunde geschickt. Als sie ihm, dem Zehnjährigen, bei den Fingerübungen streng den Takt auf den Klavierdeckel klopfte, hätte er nie geglaubt, dass er eines Tages ihre Nichte Rosa heiraten würde. Er lächelt, als er daran denken muss, wie sie ihm später bei jedem seiner Besuche in Maastricht vorgeschwärmt hat, wie tüchtig Rosa wäre und was für eine fantastische Arbeit sie dort im fernen Java leistete. Und als Rosa schließlich auf Heimaturlaub im Elternhaus verweilte, hatte Fräulein Foyer darauf bestanden, dass Silvain zum Kaffee eingeladen wurde.
Und so war aus dem Junggesellen doch noch ein Familienvater geworden. Als Zehnjähriger hatte er allerdings ganz andere Zukunftspläne gehabt. Pianist und Organist wollte er damals werden. Vor allem Organist. Das mächtige Instrument mit den Hunderten Pfeifen hatte ihn so in den Bann gezogen, dass er wochenlang gebettelt hatte, es erlernen zu dürfen. Schließlich hatte sein Vater nachgegeben und auch den Orgelunterricht bezahlt. Erst, als Silvain nach der Handelsschule keine Arbeit fand, begannen die Auseinandersetzungen zwischen ihnen.
„Stundenlanges Klavierspielen, davon wird niemand satt“, schimpfte Meyer Goldstein. „Such dir endlich eine vernünftige Arbeit. Willst du als Bettelmusikant durch die Straßen ziehen? Oder glaubst du etwa, als gefeierter Konzertpianist deinen Lebensunterhalt verdienen zu können?“
Auch heute noch kann Silvain den spottenden Tonfall hören.
Vergeblich hatte er versucht, seinen Traum durchzusetzen.
„Carla durfte auf das Konservatorium. Warum ich nicht?“, hatte er seinem Vater mehrmals an den Kopf geworfen. Aber Meyer Goldstein hatte über solcherart Flausen nur lachen können. Musik war eine schöne Liebhaberei, etwas für die Freizeit im Leben eines Mannes. Er selbst war seit Jahren ein angesehenes Mitglied im Maastrichter Männerchor.
„Deine Schwester singt außerordentlich gut, damit kannst du dich nicht vergleichen, und wenn sie vor der Ehe ein paar Jahre lang dieses Talent bei Konzertabenden und kleinen Opernaufführungen entfalten kann, ist das ein Gewinn. Aber glaubst du, ich würde je zulassen, dass sie ihren Unterhalt davon bestreiten müsste? Nein, ich sorge dafür, dass sie sich zur rechten Zeit mit dem Richtigen verbindet.“
Der Richtige war Frans de Vries gewesen, stark, athletisch, vierfacher holländischer Meister im Boxkampf und bald über beide Ohren in Carla verliebt. Bei einem Gesellschaftsabend im Hotel Momus hatten sie sich das erste Mal gesehen.
„Sie singt bezaubernd, wie eine Göttin. Wenn ich sie höre, vergesse ich alles um mich herum. Ein Talent, das nur wenige besitzen. Die Welt sollte ihr zu Füßen liegen“, hat Frans Silvain gegenüber einige Wochen später geschwärmt.
Aber nach der Verlobung war es ihm nicht recht, dass Carla weiterhin vor Publikum auftrat.
„Wenn du für mich singst, ist es genug“, entschied Frans, und Carla fügte sich. Sie hängte ihre Abendkleider und Stolen in den Schrank, band sich die Schürze um und sang von diesem Zeitpunkt an in der Küche ihre Arien und Lieder.
Frans war zufrieden, und Meyer umso mehr, denn sein tüchtiger Schwiegersohn hatte auch für seine beiden Söhne, Silvain und Jacques, Arbeitsstellen als Vertreter gefunden. Und statt die Finger über die Klaviertasten gleiten zu lassen, musste Silvain mit dem Auto quer durch das Land fahren, um Leinen und andere Stoffe zu verkaufen. Die einzige Musik, die nun zählte, war das Klirren der Münzen in der Kasse.
Nur hie und da konnte er, wenn er nach Maastricht musste, auch bei Fräulein Foyer vorbeischauen und auf ihrem Klavier spielen, oder sich den Schüssel für die Kirchenorgel organisieren. Ein paar heimliche Stunden, in denen er seinen alten Traum ein wenig zum Leben erweckte.
Aber ab heute soll sich das ändern. Er hat endlich genug gespart, und Rosa ist einverstanden.
Er öffnet die Tür. Das Glockenspiel schellt. Von hinten, aus dem Büro, tritt ein Mann, klein gewachsen und mit einem freundlichen Lächeln. Er hinkt leicht.
„Guten Nachmittag. De Groot, was kann ich für Sie tun?“
Silvain lüftet seinen Hut.
„Goldstein. Ich würde gerne ein Pianino kaufen“, sagt er schlicht, als ob er so eine Anschaffung täglich machte. Dabei hat er den Satz mehrmals heute Vormittag beim Rasieren vor dem Spiegel geprobt und jedes Mal die Vorfreude genossen, die er dabei spürte.
Sie gehen von Pianino zu Pianino. Vier Stück stehen im Geschäft. Hübsche, ordentliche Instrumente mit festem Klang, und doch … Silvain kann es nicht benennen. Etwas fehlt bei jedem.
„Ich hätte da noch drei weitere im neuen Magazin gleich gegenüber“, schlägt Herr de Groot vor. „Wenn Sie Zeit haben?“
Gemeinsam queren sie die Gasse. Herr de Groot sperrt ein Tor auf. Dahinter liegt ein großer Garten. Eine Frau sitzt mit einer Decke im Liegestuhl vor einem Maulbeerbaum und liest ein Buch. Daneben spielt ein kleines Mädchen eifrig in einer Sandkiste und singt dabei selbstvergessen ein Lied.
„Wie Leny“, denkt Silvain und nickt der fremden Dame und dem Mädchen freundlich zu.
„Meine Gattin Marie und mein Töchterchen Lidy“, sagt Herr de Groot und geht zu einem festen Holzschuppen, der an die Gartenmauer angebaut wurde.
Er sperrt die Tür auf und lässt den Kunden eintreten. Drinnen ist der Holzboden frisch gewachst. Die Wände sind in einem kräftigen Grün tapeziert, mit einem hellgrünen Abschlussrand. Auch die zwei Holzsäulen, die die Decke in der Mitte stützen, sind hellgrün. An der Wand entlang stehen Pianinos. Herr de Groot geht auf sie zu, aber Silvains Blick bleibt an einem Flügel aus schwarzem Holz hängen, der den Raum zwischen den beiden Säulen ausfüllt.
Er kann sich keinen Flügel leisten. Außerdem fehlt ihnen in der Wohnung der Platz für so ein Instrument. Dennoch sitzt er wenig später davor, schlägt den Deckel zurück und spielt.
Die Akustik im Magazin lässt zu wünschen übrig, aber Silvain kann sich den Klang vorstellen, und er weiß, dass er genau danach gesucht hat.
Herr de Groot lässt ihn spielen. Erst als Silvain langsam den Deckel schließt, meint er: „Ein Pleyel, aus dem Jahr 1929. Nicht mehr ganz neu, aber von seinem Vorbesitzer sorgfältig gepflegt.“
Silvain nickt. Er weiß, dass er eines der Pianinos kaufen sollte. Bestimmt wird er sich daran gewöhnen können.
Er hört wieder die Stimme seines Vaters: „Junge, es ist und bleibt eine Liebhaberei! Zuerst musst du deinen anderen Verpflichtungen nachkommen.“
„Er ist natürlich teurer als ein Pianino, aber ich kann Ihnen einen günstigen Preis machen“, sagt Herr de Groot.
Silvain legt seine Hand auf den Flügel. Es ist bereits die Geste eines Besitzers.
„Ich nehme ihn“, sagt er rasch, bevor er es sich anders überlegen muss. „Jawohl, ich nehme ihn.“
Ab jetzt wird er eben auf ein Haus sparen, und bis dahin werden sie enger zusammenrücken. Rosa wird es verstehen.
Sonntag, 16. Oktober 1932, abendsBreda
Liebe Mutter, lieber Vater,
auf diese Weise eine kleine Plauderstunde! Hier ist alles gut. Carry wächst und hat zwei Kilo zugenommen. Auch Leny isst brav. Der Lebertran tut ihr gut. Außerdem hat ihr der Arzt abends eine Tablette Dohyfial, ein Vitamin-D-Präparat, verschrieben. Heute hat bei uns der Jahrmarkt angefangen. Am Nachmittag sind wir trotzdem zuerst noch im Wald gewesen, obwohl Silvain viel lieber bei seinem Flügel geblieben wäre. Mein unvernünftiger Ehemann hat sich einen Flügel gekauft, dabei haben wir kaum den Platz für ein Pianino. Deshalb sitzen wir nun im Wohnzimmer beinahe aufeinander, und wenn wir mehr als zwei Gäste einladen, müssen wir entweder den Esstisch oder die bequemen Sessel in der Küche verschwinden lassen. Ihr solltet jedoch Silvain sehen. Er ist um zehn Jahre verjüngt. Am liebsten würde er Tag und Nacht spielen. Aber ich lasse ihn nicht. Gerade jetzt, im Herbst, sind die wenigen sonnigen Tage auszunützen. Carry bekommt von der Waldluft rote Wangen, und Leny genießt es, durch die Blätter zu stapfen. Jede Kastanie oder Eichel wird von ihr aufgehoben und von allen Seiten wie ein kleines Wunderwerk betrachtet. Als wir schließlich auf dem Rückweg aus dem Bus stiegen, haben wir den kurzen Umweg über den Großen Markt gewählt und beim Karussell zugesehen. Zuerst konnte Leny kein Wort herausbringen, so beeindruckt war sie von den bunt bemalten Holzpferden, aber dann ist sie doch zusammen mit Silvain eine Runde gefahren. Jetzt, zu Hause, müssen sich die Puppen auf meinem runden Teetablett im Kreis drehen. Dazu spielt Silvain die Melodie, die sie am Jahrmarkt gehört hat. Stellt euch vor, Leny konnte sie fast zur Gänze richtig nachsummen!
Ist unser Kätzchen nicht ein kleiner, süßer Schatz?
Liebe Grüße von uns allen an euch beide,
Rosa
Post scriptum
Ich habe letzte Woche endlich wieder einen Brief von Martha und Richard erhalten. Freddy ist krank gewesen. Auf Dauer wird das feuchte, heiße Klima auf Java für die Kinder nicht gut sein. Gegen Monatsende werden sie für drei Wochen nach Semarang fahren. Wenn ihr Ellen eine Geburtstagkarte schreibt, bitte schickt diese deshalb an das Hotel Jansen. Die Adresse habt ihr bestimmt noch von meiner Zeit dort.
Frühjahr 1935Maastricht
Zum ersten Mal trifft Leny ihre Cousine, Ellen. Die ist acht Jahre alt, und hat ihr ganzes bisheriges Leben in Ostindien verbracht. Erst vor einem Monat ist sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder Freddy von Java nach Holland gezogen, und heute ist Leny mit Mams, Paps und Carry nach Maastricht gefahren, um diese fremden Verwandten zu besuchen, die sie nur aus Briefen und Erzählungen kennt. Carry hat sofort Freundschaft mit Onkel Richard geschlossen und reitet begeistert auf seinen Knien.
Mams und Tante Martha plaudern. Mams, weiß Leny, hat früher auch in dem heißen, fernen Land gewohnt, wo die Elefanten und Affen aus dem Zoo frei herumlaufen. Mit halbem Ohr lauscht sie dem Gespräch, das voller seltsam klingender Namen ist, während sie verlegen Ellen und Freddy beobachtet, die so tun, als ob sie in ein Brettspiel vertieft seien, weil sie ihrerseits auch nicht recht wissen, was sie mit der jüngeren Cousine, die steif und stumm neben ihnen sitzt, anfangen sollen.
„Nach dem schrecklichen Erlebnis mit Ellens Arm wurde uns bewusst, dass das schöne Leben dort auch seine Schattenseiten hat“, erzählt Tante Martha. „Die medizinische Versorgung ist schlecht. Jetzt erst fangen die Wunden an, richtig zu verheilen. Nur, die Verkrüppelung wird bleiben. Und Freddy soll nächstes Jahr ins Gymnasium kommen, wenn er die Aufnahmeprüfung schafft. Die bessere Zukunft für die Kinder liegt hier in Europa und nicht in Ostindien.“
Ellen verzieht das Gesicht zu einer widerwilligen Grimasse. Ihre Mutter hat Unrecht. Daheim war es viel schöner als in diesem nasskalten Land. Und sie kann es nicht leiden, wenn ihre Mutter vor Fremden über ihren Arm spricht. Und fremd sind diese Verwandten, auch, wenn es Fotos gibt, die sie als Baby auf Tante Rosas Schoß zeigen. Aber daran kann sie sich nicht erinnern.
Ellens Arm. Leny schielt darauf. Die Cousine trägt einen dicken Verband. Freddy, der Zwölfjährige, fängt ihren verstohlenen Blick auf.
„Ein Tiger hat sie gebissen“, flüstert er, „und Papa und ich mussten ihn erschießen, damit er loslässt. Willst du ihn sehen?“
Bevor Leny Nein sagen kann, haben Ellen und Freddy sie plötzlich bei der Hand gefasst und kichernd hinauf in den ersten Stock geführt. Vor der Tür zum Schlafzimmer seiner Eltern bleibt Freddy stehen.
„Wartet hier“, kommandiert er ernst. Er öffnet die Tür einen Spalt und schlüpft durch. Gleich darauf ist die Tür wieder fest verschlossen. Leny tritt von einem Bein auf das andere. Sie möchte wieder hinunter zu Mams.
„Du brauchst keine Angst zu haben“, beruhigt Ellen sie. „Es ist nur ein Spaß.“ Das kann Leny nicht recht glauben. Sie weiß aus Mams’ Erzählungen, dass es in Indien jede Menge gefährlicher Tiere gibt.
„Jetzt kannst du aufmachen!“ Freddys Stimme klingt unheimlich dumpf. Leny klammert sich an Ellens gesunden Arm.
„Ich muss die Tür öffnen, und das geht nur, wenn du mich loslässt.“
Sie schüttelt die Cousine ab und drückt die Klinke hinunter. Im selben Augenblick wird die Tür von innen aufgestoßen. Leny erstarrt vor Angst. Ein richtiger, lebendiger Tiger steht vor ihr, und als das Tier auch noch anfängt zu knurren, schreit sie auf und flüchtet die Stiege hinunter.
„Oben ist ein Tiger“, stammelt sie weinend und vergräbt ihr Gesicht in Paps’ Schoß.
Onkel Richard bricht in schallendes Gelächter aus, aber Tante Martha schimpft: „Dieser Unsinn mit dem Tigerfell muss jetzt sofort aufhören. Freddy hat Oma Leen damit an den Rand eines Herzinfarktes gebracht. Als sie aus der Toilette kam, stand der Tiger vor ihr und starrte sie mit seinen Glasaugen an.“
„Kommt runter, Kinder!“, ruft Onkel Richard. „Und nehmt das Fell mit, damit Onkel Silvain und Tante Rosa sehen können, wovor Leny sich fürchtet.“
Da steht Freddy dann, das Tigerfell noch immer umgehängt, und lächelt halb schuldbewusst und halb zufrieden über seinen gelungenen Scherz.
„Der hat wirklich Ellens Arm zerbissen?“, traut sich Leny zu fragen und krault vorsichtig den Tigerkopf.
„Wer hat dir diesen Bären aufgebunden?“ Tante Martha schaut Ellen und Freddy streng an.
„Ellen ist mit dem Fahrrad gestürzt und so unglücklich gefallen, dass der Arm doppelt gebrochen war. Durch die feuchte Hitze haben sich die Wunden rasch entzündet und schließlich hat sich die Entzündung auf den gebrochenen Knochen ausgeweitet“, erklärt Tante Martha sachlich. „Unter dem Gips haben die Ärzte das nicht rechtzeitig bemerkt und deshalb wird Ellens Arm steif bleiben.“
Als sie gegen Abend endlich mit dem Zug heimfahren, gesteht Leny: „Ich habe wirklich zuerst geglaubt, dass es ein echter Tiger sei. Bestimmt werde ich mich nie wieder vor etwas so fürchten.“ Und dann kuschelt sie sich an Mams und flüstert ihr verschämt ins Ohr: „Ich habe mir fast in die Hose gemacht, solche Angst hatte ich. Aber das darfst du niemandem verraten, nicht einmal Paps.“
11. bis 31. August 1935Heyst aan Zee, Belgien
Der erste richtige Familienurlaub. Sie haben sich in einem kleinen Hotel am Boulevard einquartiert. Rosa genießt die Ruhe und dass sie rundherum verwöhnt werden. Leny planscht stundenlang im seichten Wasser. Mit ihrem kleinen Netz fischt sie nach Garnelen und Muscheln und schreit panisch, wenn sie eine Qualle erwischt. Durch das Stapfen im lockeren Sand fängt Carry endlich an, richtig fest auf den Beinen zu stehen.
„Es ist, als ob in diesen zwei Wochen nur die Sonne scheine“, denkt Rosa und lehnt sich im Strandkorb zurück. Vor acht Jahren hat sie noch ganz alleine und weit weg von Europa als Lehrerin in Ostindien gelebt, wohin sie ihrem Bruder Richard gefolgt war, der als Chemiker auf einer Zuckerplantage arbeitete. Dann hat sie sich mit Silvain verlobt, den sie kaum kannte. Vor zehn Jahren, bei einem langen Heimaturlaub, war sie ihm in Maastricht begegnet. Tante Emilie hatte es schlau eingefädelt.
„Willst du wirklich, so wie ich, als ältliches Fräulein übrig bleiben?“, hatte sie ihr zugeredet.
Rosa und Silvain hatten sich auf Anhieb gut verstanden, und als Rosas Aufenthalt in Holland zu Ende war und sie nach Ostindien zurückkehrte, hatten sie sich geschrieben. Irgendwann hatte sie bemerkt, dass ihr Leben sich in ein Warten auf die Post von Silvain verwandelt hatte. Und als dieser wenig später schriftlich um ihre Hand bat, hatte sie postwendend „ja“ geantwortet.
Sie hatten die Verlobung in der Zeitung bekannt gegeben: Fräulein Rosa Hermine Egger in Pati (Ostindien) und Herr Silvain Goldstein in Maastricht.
Kaum war sie mit dem Schiff in Holland angekommen, hatten sie geheiratet. Und jetzt hat sie zwei Töchter. Ein Lebensglück, das sie sich eigentlich nicht mehr erhofft hatte.
Das Rauschen der Wellen lullt sie ein, und die steife Brise treibt den Sand wie tausend kleine Nadelstiche gegen Gesicht und Arme. Sie hievt sich aus dem Strandkorb und dreht ihn so, dass sie im Windschatten sitzt. Dann schließt sie die Augen. Anna, das Dienstmädchen, passt auf Carry auf, und Leny ist mit Silvain davongezogen, um nochmals auf dem Esel zu reiten, der geduldig den ganzen Tag von einem Jungen am Strand auf und ab geführt wird.
„Wie wird es in zehn Jahren sein?“, überlegt sie, bevor sie einschläft. „Oder in zwanzig Jahren? Da könnte ich sogar schon Großmutter sein.“
Freitag, 5. Juni 1936Maastricht
„So, ihr beiden.“ Opa Meyer setzt sich mit einem lauten Seufzer neben Leny und ihren Cousin Louis auf das Plüschsofa im Foyer des Hotels. „Für einen alten Mann wie mich ist das Feiern zu anstrengend.“ Er schaut hinüber zu einem bequemen Sessel, der halb hinter einer Zimmerpalme verborgen in der Ecke steht. „Am liebsten würde ich dort ein friedliches Nickerchen machen.“ Er lockert mit den Fingern seine Krawatte und zwinkert seinen beiden Enkeln zu. „Was meinst du, Leny?“
„Oma Leen wird das nicht mögen“, antwortet Leny besorgt.
Opa Meyer seufzt. „Ich fürchte, du hast recht, aber wenigstens dieses Jackett könnte ich ablegen.“ Er nestelt mit seinen dicken Fingern ungeschickt am obersten Knopf.
„Behalt das schön an, Meyerchen!“ Oma Leen trippelt mit kurzen Schritten herbei und droht mit ihrem Finger. „Dachte ich mir doch, dass ich dich nicht aus den Augen lassen sollte.“
„Ich schwitze“, murrt Opa.
„Wie ein Bauer benimmst du dich“, empört sich Oma Leen. „Dabei bist du ein Geschäftsmann.“
„Ach was!“ Opa Meyer lacht. „Das Geschäft bist du. Ich habe da nichts zu sagen.“
„Das ist wohl auch besser so. Du würdest mir jeden Cent zum Kartenspielen forttragen, wenn ich dich ließe.“ Opa steht widerwillig auf und lässt sich zurück in den Saal ziehen.
„Jetzt gib mir mal ordentlich den Arm“, hört Leny Oma schimpfen. „Sonst denken die Leute noch, dass ich dich zwingen muss.“
Opas Antwort kann sie nicht verstehen, aber bestimmt hatte er etwas zu erwidern.
Die ganze Woche logiert sie schon bei den Großeltern, und heute Vormittag sind Mams und Paps mit Carry nachgekommen, um bei der Hochzeit von Tante Bila, Paps’ jüngerer Schwester, dabei zu sein. Auch Louis ist deswegen mit seinen Eltern, dem jovialen Onkel Jacques und der damenhaften Tante Olga, aus Den Haag angereist.
Leny hat die Woche bei Oma und Opa genossen, obwohl das Häuschen klein ist, sie im Wohnzimmer auf dem Sofa schlafen muss und Oma immer in ihrem Laden zu tun hat. Im großen Zimmer vorne zur Straße hinaus befindet sich nämlich das Geschäft der Großeltern, das jede Stunde, in der Oma wach ist, auch geöffnet ist.
„Der kleine Gewinn“, heißt es. Entlang der Wand stehen hohe Kommoden mit dutzenden kleinen Laden, von denen jede mit einer Nummer sorgfältig beschriftet ist. Oma weiß haargenau, was sich in welcher befindet: Knöpfe, Ösen, Nähgarn, Gummiband … Wenn Oma Leen alles mit atemberaubender Geschwindigkeit aufzählt, klingt es wie die Gebete, die Paps manchmal an den Feiertagen in einem halblauten Singsang vorträgt.
Am liebsten mag Leny die Knopfkarten, Kartonblätter, auf die Knöpfe ordentlich mit einem festen Faden aufgenäht sind. Wenn Oma gut aufgelegt ist, darf sie damit spielen.
„Aber nichts herunterreißen!“, mahnt diese.
Als ob Leny das täte.
Sie hat sich das Spiel selbst ausgedacht. Sie dreht alle Karten um und zieht blind eine. Sie zählt die Anzahl der Knöpfe. Zwei Reihen mit acht macht sechzehn, drei Reihen mit vier ergibt zwölf. Eigentlich müsste man das Spiel zu zweit spielen, aber Oma hat keine Zeit.
„Kind, wenn Kundschaft kommt und mich beim Spielen ertappt. Was sollen sich die Leute denken?“
Und Opa hat bei Lenys Erklärungen abgewinkt. Deshalb spielt sie das Spiel mit ihrer Puppe Helene. Wer die Karte mit den meisten Knöpfen erwischt, darf beide Knopfkarten behalten. Manchmal, wenn Leny eine Pechsträhne beim Ziehen der Karten hat, versucht Helene zu schummeln. Sie verzählt sich absichtlich, und aus zwei Reihen mit sechs Knöpfen werden zehn Knöpfe.
Aber Leny lässt ihr das nicht durchgehen.
„Das Leben hat nicht nur Butterseiten“, belehrt sie Helene. „Man muss auch manchmal in trockenes Brot beißen.“ Sie ahmt dabei Fräulein Boon nach, ihre Lehrerin in der ersten Klasse.
„Was lächelst du so komisch?“, dringt Louis’ Stimme zu ihr durch. Leny erschrickt und lächelt noch mehr. Das ist ihre schlechte Angewohnheit.
Fräulein Boon hat sie schon mehrmals in diesem ersten Schuljahr darauf aufmerksam gemacht: „Du willst doch nicht, dass jemand glaubt, du seist dumm, oder noch schlimmer, frech?“
Aber Leny weiß nicht, wie sie das ändern soll. Es passiert ihr einfach. Wenn sie mit den Gedanken woanders ist, wenn sie erschrickt, wenn sie schüchtern ist, immer ziehen die Mundwinkel nach oben.
Als sie deswegen einmal zu Hause weinte, hat Paps tröstend gemeint, dass niemand ihr Lächeln auf diese Weise missverstehen könne. Aber Paps ist nicht Fräulein Boon.
„Mir ist langweilig“, klagt Louis neben ihr. „Wenn ich später einmal heirate, dürfen Kinder nach dem Essen nach Hause oder auf den Spielplatz gehen. Auf jeden Fall müssen sie nicht irgendwo ordentlich sitzen und ruhig warten, bis auch die Erwachsenen genug haben.“ Er schlenkert mit den Beinen.
„Das ist keine schlechte Idee“, denkt Leny. Drinnen, im großen Saal, hat Paps alte Schulfreunde getroffen und Mams plaudert seit Ewigkeiten mit Tante Ada. Das ist Mams’ Schwester, die Leny nur von Fotos kennt. Tante Ada ist mit Onkel Emile und ihren drei Kindern, den beiden großen, Ernest und Denise, und der kleinen Janine, aus Frankreich gekommen.
„Spiel doch mit Ernest und Denise“, hat Mams ihr zugeredet. Aber Ernest, der Älteste, steht nur stumm neben seinem Vater und hört den Gesprächen zu, obwohl er nichts davon versteht. Und auch Denise spricht kein Wort holländisch und hat sich, nachdem sie sich ein paar Minuten verlegen angestarrt haben, mit einem Buch hingesetzt.
Tante Ada hat rasch ein paar unverständliche Sätze gesagt, aber Denise hat nur unwillig den Kopf geschüttelt und ihre Nase noch tiefer zwischen die Seiten gesteckt.
„Ich sollte ihr das Buch wegnehmen“, hat Tante Ada halbherzig gemeint. Es aber zum Glück nicht getan. Denn Leny hätte nicht gewusst, was sie mit der fremden Cousine spielen sollte.
„Ich gehe zu Louis“, hat sie erleichtert gesagt, als sie ihn zwischen den Leuten entdeckte.
Und nun sitzen sie zu zweit hier auf dem Sofa und warten.
„Lass uns Opa Mauritz suchen“, schlägt Louis vor, „vielleicht mag er mit uns spazieren gehen.“
Opa Mauritz ist Louis’ anderer Opa, und in Lenys Augen ein vornehmer Mann. Er besitzt eine Metzgerei und eine goldene Uhrkette. Außerdem hat er vor langer Zeit der Königin die Hand geschüttelt, als diese dem Männerchor, bei dem Opa Meyer und Opa Mauritz mitsingen, nach einer Aufführung, der sie beiwohnte, eine Audienz gewährt hat.
„Diese hier“, sagt Opa Mauritz, wenn man ihn danach fragt, „hab ich ihr gegeben. Höchstpersönlich.“ Leny hat, als sie die Geschichte zum ersten Mal hörte, ehrfürchtig auf die großen, starken Finger geschaut. Oma Sophie hat ihren Blick bemerkt und lachend gemeint, dass sie nachher heilfroh gewesen sei, dass Opa seine Hand von Ihrer Majestät auch zurückbekommen habe.
„Stell dir vor, sie hätte sie behalten. Dann hätte er nie mehr eine Wurst richtig stopfen können“, sagte sie.
Sonntag, 23. August 1936Breda
„Jetzt machen wir einen Erkundungsspaziergang“, schlägt Silvain nach dem Mittagessen vor. Es ist der erste richtige Tag im neuen Haus.
„Ohne mich“, erwidert Rosa sofort. „Anna und ich haben noch genug zu tun. Unten müssen die Gardinen aufgehängt werden, und ich weiß nicht, wie viele Kartons unausgepackt herumstehen.“
„Das kann warten“, meint Silvain und schaut durch die offene Flügeltür zum vorderen Wohnzimmer, das von Rosa stolz „der Salon“ genannt wird. „Die wichtigsten Sachen sind ja erledigt.“
„Die wichtigsten Sachen.“ Rosa folgt seinem Blick. „Du meinst ja bloß, dass der Flügel an seinem Platz steht.“
Silvain nickt zufrieden.
„Sag jetzt nicht, dass du darüber nicht froh bist.“
„Natürlich bin ich das! Wer wäre das nicht, wenn er vier Jahre lang um einen Flügel herumwohnen musste, der angeschafft wurde, obwohl das Zimmer dafür zu klein war. Ahnst du eigentlich, wie oft ich ihn in Stücke hacken wollte?“ Ihre Stimme klingt gereizt.
Leny schaut entsetzt. Wie kann Mams so etwas behaupten? Leny findet, dass Paps vollkommen recht hat. Der Flügel ist das Allerwertvollste, was sie besitzen. Seit zwei Jahren darf sie selbst darauf spielen. Zuerst haben Paps und Mams ihr ein paar Übungen gezeigt. Und bald danach, als sie in Maastricht bei den Großeltern waren, haben die Eltern sie zu Tante Emilie gebracht. Das ist Mams’ Tante und Paps’ alte Klavierlehrerin.
„Ohne sie hätte es dich und Carry nicht gegeben“, hat Paps geheimnisvoll gemeint.
Leny hatte zuerst Angst vor der alten vornehmen Frau mit dem langen mageren Hals und dem Lavendelgeruch, aber Paps schüttelte ihr herzlich die Hand und Mams küsste sogar das faltige Gesicht. Dann sagte Paps: „Tante Emilie, das ist unsere kleine Leny. Wenn du einmal schauen könntest, ob sie bereits alt genug für richtigen Unterricht ist?“
Tante Emilie nickte gnädig und Paps hob Leny auf den Klavierhocker.
„Nun zeige, was du kannst“, spornte Mams sie an, und Leny lächelte verlegen.
„Wir glauben, dass sie talentiert ist“, sagte Mams stolz. Etwas, das Leny noch nervöser machte.
„Komm schon Kätzchen. Das Stück von Mozart. Du weißt schon. Da da di dum, dum …“ Paps beugte sich über sie. „Du hast es gut geübt.“
„Jetzt ist aber Schluss“, mischte sich Tante Emilie ein. „Ihr beide geht eine Runde mit Carry, und Leny und ich kümmern uns um das Klavier.“ Und das taten sie. Tante Emilie rückte einen Sessel neben Leny und fing an zu spielen. Leny schaute fasziniert auf die langen dünnen Finger, die mit Leichtigkeit über die Tasten tanzten. Tante Emilie spielte, Leny hörte zu und wippte mit den Füßen im Takt. Und als Mams und Paps mit Carry zurückkamen, sagte Tante Emilie lediglich: „Wenn sie selbst möchte, dann soll sie.“
Und ob Leny das wollte.
„Leny, träumst du?“
Leny fährt hoch.
„Ich musste an den Flügel denken.“
„Dass ich ihn am liebsten zu Brennholz gemacht hätte? Das war nur ein Scherz, Leny“, sagt Mams kopfschüttelnd.
Sie steht vom Tisch auf und fängt an, das Geschirr in die Küche zu tragen, wo Anna, das Mädchen, bereits die Töpfe scheuert.
„Am besten, ihr bleibt eine ganze Weile weg“, ruft sie über die Schulter. „Damit wir in Ruhe arbeiten können.“
„Jawohl!“, antwortet Paps gehorsam.
Wenig später gehen sie zur Küchentür hinaus und quer über das kleine Rasenstück. Paps schiebt hinten den Riegel des Gartentors zur Seite, und sie treten auf einen schmalen Fußweg hinaus. Carry und Leny halten Paps’ Hand fest.
„Wer weiß, wo der hinführt“, murmelt Paps interessiert.
„Es ist unheimlich“, sagt Carry.
„Nicht unheimlich. Spannend!“, widerspricht Paps. „Wahrscheinlich landen wir mitten in Afrika bei den Elefanten.“
Carry schaut ihn mit großen Augen zweifelnd an.
Aber Leny muss nun doch lachen. Jetzt, wo sie bald in die zweite Klasse gehen wird, durchschaut sie Paps’ Scherze.
„Ich glaube, ich kann schon einen riechen. Hinter diesem Zaun muss er stehen“, spielt sie mit.
Paps streckt sich und schaut hinüber.
„Tatsächlich, ein ganz kleiner. Magst du ihn auch sehen?“
„Nein, nein!“, ruft Carry ängstlich. „Ich will zurück zu Mams.“
„Nichts da!“ Paps hebt sie schwungvoll hoch, damit sie über den Zaun blicken kann. Auf der anderen Seite spielt ein kleiner Junge allein mit einem Ball. Zaghaft winkt Carry.
„Wir haben dich angeschwindelt“, sagt Paps, als er Carry wieder auf dem Boden absetzt, und drückt ihr einen Kuss auf die Backe. „Wenn wir nach Afrika wollten, hätten wir vorher nach links abbiegen müssen. Aber dort ging der Weg nicht weiter. Und deshalb sind wir nun wo?“
Sie haben mittlerweile die Straße erreicht und Paps zeigt auf ein Straßenschild.
„Sankt Ignatiusstraat“, liest Leny flott, obwohl es ein schwieriges Wort ist, das bis jetzt nicht im Lesebuch vorgekommen ist.
„Das ist nicht in Afrika?“, fragt Carry trotzdem.
„Nein“, sagt Paps. „Denn sonst würden dort keine weißen, sondern schwarze Kinder miteinander spielen.“
Eine ganze Gruppe Kinder spielt mitten auf der Straße. Sie stehen im Kreis und machen Bewegungen zu einem Lied. Paps bleibt mit Leny und Carry auf dem Gehsteig stehen, und sie schauen zu. Als das Lied aus ist, dreht ein größeres Mädchen sich zu ihnen um.
„Wollt ihr auch mitspielen?“, fragt es mütterlich.
Leny will schon den Kopf schütteln, aber Paps kommt ihr zuvor.
„Das ist Leny und das ist Carry. Wir wohnen seit heute auf dem Wilhelminasingel 36.“ Er gibt den beiden einen sanften Stoß.
Die Kinder machen bereitwillig Platz im Kreis.
Ein Junge fasst Lenys Hand.
„Ich heiße Hansi. Hast du auch ein Tretauto?“, sagt er. Leny verneint stumm.
„Einen Roller?“
„Ja“, haucht sie verlegen. Einen Roller hat sie letztes Jahr zum Geburtstag bekommen.
„Meine Schwester hat auch einen“, teilt Hansi ihr mit. „Aber ich fahre mit meinem roten Tretauto.“
Silvain zündet sich eine Zigarre an. So hat er sich das vorgestellt. Ein Haus, in dem endlich genug Platz ist, in einer Gegend, wo Leny und Carry Freunde finden können.
Ein Samstagnachmittag, Frühling 1937Breda
Carry steht am Fenster des Salons und schaut auf den Wilhelminasingel hinaus. Sie wartet auf Leny, die mit Mams bald aus der Musikschule kommen muss. Dann können sie endlich gemeinsam spielen. Aber als sie Mams in der Ferne ausmacht, sieht sie, dass neben ihr zwei Mädchen gehen, eines links und eines rechts. Leny hat Lidy eingeladen, nach dem Unterricht mit ihr zu kommen. Lidy ist die Tochter von Herrn de Groot, der öfter zu Besuch ist, weil Paps und er gerne vierhändig auf dem Flügel musizieren. Lidy schiebt ihren Roller. Carry verzieht enttäuscht das Gesicht. Jetzt wird sie nicht mitspielen können. Sie hat keinen eigenen Roller, und Leny und Lidy werden sich bestimmt Hansi und Cornelia anschließen. Die beiden Kinder aus der Nachbarschaft kurven bereits um den Häuserblock. Hansi in seinem Tretauto und Cornelia auf dem Roller.
Carry behält recht. Leny stellt ihre Notentasche zum Flügel und rennt, ohne Carry zu beachten, nach hinten in den Garten hinaus, wo ihr Roller an der Hausmauer lehnt. Vorne auf der Straße bewundert Lidy inzwischen Cornelias Roller. Der glänzt blitzblau. Cornelias Vater, Herr van Dongen, der die Autowerkstatt ein paar Häuser weiter besitzt, hat ihn neu lackiert.
Als Leny mit ihrem Roller erscheint, hupt Hansi laut, und zu viert fahren sie davon. Carry blickt ihnen sehnsüchtig nach.
„Soll ich dir eine Geschichte vorlesen?“, fragt Mams, als sie Mantel und Hut abgelegt hat. Carry schüttelt den Kopf. Sie packt ihre Puppe, die dicke Mimi, und geht in den Garten.
„Du bist noch zu klein, um mit dem Roller unterwegs zu sein“, tröstet sie ihre Puppe.
Sie versucht, mit Mimi zu spielen, aber es ist langweilig so ganz alleine. Da hört sie eine laute, hohe Mädchenstimme hinter dem Zaun: „Ich habe nichts als Scherereien mit euch beiden!“
Carry springt auf und läuft zum Gartentor. Während sie noch den Riegel zurückschiebt, ruft sie: „Felicia, bist du das? Magst du zu mir in den Garten kommen?“
Auf dem kleinen Weg hinter den Häusern steht ein gleichaltriges Mädchen mit zwei steifen Zöpfen und einem entschlossenen Gesicht. Es ist tatsächlich Felicia, die in der Loopschansstraat, der Parallelstraße hinter dem Singel, wohnt. Schon ein paar Mal haben sie gemeinsam gespielt. Felicia hat ihren Puppenwagen dabei. Zwei Puppen liegen ohne Decke darin.
„Sie wollen nicht schlafen“, beschwert sich das Mädchen. „Deshalb muss ich mit ihnen spazieren gehen. Kommst du mit?“
Carry muss ihre dicke Mimi tragen, weil diese so gerne die Gegend betrachtet, und weil Carry keinen eigenen Puppenwagen besitzt.
Felicia schiebt ihren Wagen neben Carry her.


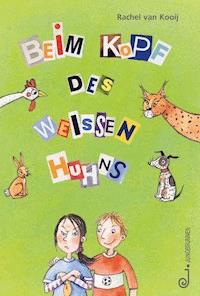













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












