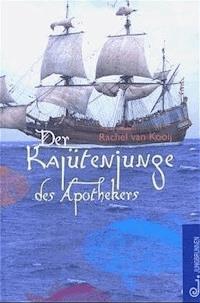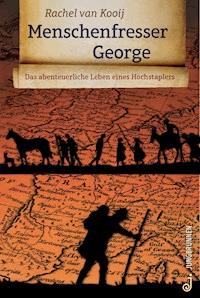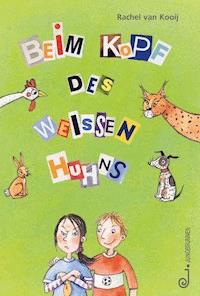18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Jungbrunnen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Erster Weltkrieg, Schauplatz Belgien. Der zwölfjährige Thierry will sich für den Tod seiner Mutter an den deutschen Besatzern rächen und schließt sich "den zwölf verwegensten Jungen Belgiens" an. Ein Sabotageversuch scheitert und die Jungen werden eingesperrt. Thierrys Großvater kann ihn herausholen, aber der Junge muss sofort die Stadt verlassen und wird bei seiner Großtante in Geel untergebracht. Hier leben seit Jahrhunderten Menschen mit psychischen Einschränkungen als Gäste in Pflegefamilien. So auch Albert, der psychisch instabil ist. Er kann hervorragend zeichnen und arbeitet an der "weltwichtigsten Briefmarke", die er dem belgischen König schenken will. Thierry stiftet ihn an, die deutschen Truppenbewegungen zu zeichnen und bringt Albert damit in große Gefahr. Um ihn zu retten, wollen Thierry und seine Freundin Elsie Albert in die neutralen Niederlande bringen – aber die Grenze wird durch Soldaten und den elektrischen "Todesdraht" gesichert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Ähnliche
Rachel van Kooij
wurde 1968 in Wageningen in den Niederlanden geboren. Im Alter von zehn Jahren übersiedelte sie nach Österreich. Nach der Matura studierte sie Pädagogik und Heil- und Sonderpädagogik an der Universität Wien.
Rachel van Kooij lebt in Klosterneuburg und arbeitet als Behindertenbetreuerin und Autorin.
Folgende Bücher von Rachel van Kooij sind bei Jungbrunnen lieferbar:
Der Kajütenjunge des Apothekers (2005), Klaras Kiste (2008), Menschenfresser George (2012, nur als E-Book), Die andere Anna (2014, nur als E-Book), Beim Kopf des weißen Huhns (2016), Herr Krähe muss zu seiner Frau (2019)
Gefördert durch
ISBN 978-3-7026-5971-4
eISBN 978-3-7026-5972-1
1. Auflage 2022
Einbandgestaltung: b3k
© 2022 Verlag Jungbrunnen Wien
Alle Rechte vorbehalten – printed in Europe
Druck und Bindung: FINIDR, Český Těšín
Wir legen Wert auf nachhaltige Produktion unserer Bücher und arbeiten lokal und umweltverträglich: Unsere Produkte werden nach höchsten Umweltstandards gedruckt und gebunden. Wir verwenden ausschließlich schadstofffreie Druckfarben und zertifizierte Papiere.
Rachel van Kooij
Die weltwichtigste Briefmarke
Sieh ab Seite 333 nach, wenn dir ein Wort nicht vertraut ist.
Inhalt
April 1918: Eine Nacht an der Grenze
Der Totendraht hat kein Loch
Oktober bis Dezember 1917: Geraardsbergen
Als der Tod auf dem Markt lauerte
Doktor Plötzl
Zum Wolf werden
Unsichtbare kleine Mörder
Die zwölf verwegensten Jungen Belgiens
Die Heldentat
Ein Geständnis
Ramdohr und Zahn
Ein Beweisstück
Verrat
Ein Abendessen wird nicht zu Ende gegessen
Im Keller
Ramdohrs Methoden
Doktor van Klaarsbeeck muss um einen Gefallen bitten
Einzelhaft
Eine Anordnung von Oberleutnant Schwarz
Eine überstürzte Abreise
Eine Nacht im April 1918: An der Grenze
Thierry, der Mörder?
Einer muss es versuchen
Winter 1917/1918: Geel
Pflichterfüllung
Eine Prüfung Gottes
Erinnerung an Hotte
Unser Albert
Der fremde Junge
Ein Freundschaftsangebot
In der guten Stube
Alberts Zimmer
Im Salon
Ein Wasserklosett
Wie Cher Ami
Der Taubenmann
Ein Porträt von Rittmeister von Osterroth
Charles Kortemanns geheime Machenschaften
Bilder aus der Luft
Eine Büchse Regenwürmer
Eine Nacht im April 1918: An der Grenze
Dienst am Totendraht
Sjowke und Towke
Schatten am Zaun
Frühjahr 1918: Geel
Nicht länger untätig bleiben
Schauen ist nicht verboten
Frühjahrsputz
Der Soldat mit dem Skizzenblock
Sankt Dymphna
Ertappte Spione
Die dicke Bertha
Zu viele Soldaten
Die Einquartierung
Der Leutnant und der Koch
Alberts ganz eigener Entschluss
Franktireurs
Alberts Zeichnungen
Eine Nacht im April 1918: An der Grenze
Hans im Glück
Frühjahr 1918: Geel
Alberts Beichte
Latrinenangeln
Nach Drinnen
Die Flucht
Teunis’ Petroleumquelle
Die sechste Schleuse
Auf Schmuggelfahrt
Langer Franz
So einer ist kein Gauner
Das Loch
Eine Nacht im April 1918: An der Grenze
Wenn wir doch nur reden könnten
Alberts Briefmarken lügen nicht
Der Blitzschlag
Die weltwichtigste Briefmarke
Was ist wahr an dieser Geschichte?
Glossar
April 1918: Eine Nacht an der Grenze
Der Totendraht hat kein Loch
„Der Totendraht hat gar kein Loch“, dachte Thierry entsetzt, als ihm klar wurde, dass sie den ganzen Abschnitt, den ihnen Langer Franz so penibel beschrieben hatte, vergeblich auf und ab gegangen waren. Jeden einzelnen Meter hatten sie kontrolliert, aber das versprochene Loch unter dem Zaun zwischen der Weggabelung und der niedergebrannten Scheune hatten sie nicht gefunden. Mittlerweile hatte er jegliches Zeitgefühl verloren. Die Angst, dass ihnen die Zeit bis zur Entdeckung wie Sand in der Sanduhr unaufhaltsam davonrann, wurde immer größer und drückender. Kurz nach Mitternacht waren sie aufgebrochen. Langer Franz hatte sie ein Stück weit in Richtung Grenze geführt und ihnen dann noch eine Taschenlampe in die Hand gedrückt.
„Für euch. Die hat ein Soldat nach einer Einquartierung liegen lassen. Aber seid um Gottes Willen vorsichtig damit. Wer sieht, kann auch gesehen werden. Also immer schön nach unten auf den Boden richten.“ Langer Franz hatte so fürsorglich geklungen.
Nach Elsies Plan hätten sie jetzt längst drüben sein müssen. Panik stieg in Thierry hoch und verstärkte das bleierne, müde Gefühl in seinen Beinen. Seine Kleidung klebte tropfnass vom Regen an seinem Körper. Er fror. Was konnten sie jetzt noch machen?
„Genau hinter den Weiden“, hatte Langer Franz gesagt. „Nicht zu verfehlen, wenn man weiß, dass es da ist.“ Mit seinem ehrlichen, freundlichen Gesicht hatte er sie angelogen. Weiden gab es hier überall. Wie dunkle, zwielichtige Gestalten standen sie grüppchenweise Wache, nicht weit von dem schmalen Wassergraben entfernt, der die Grenze zwischen Belgien und Holland markierte.
„Früher“, dachte Thierry, „hat sich keiner darum geschert.“ Bestimmt hatten die Bauern links und rechts vom Wassergraben ihre Felder. Früher war es egal gewesen, wo die Kühe das Gras fraßen. Früher sprangen Kinder wie Elsie und er mit einem Hüpfer unbekümmert zwischen den beiden Ländern hin und her.
Er wünschte sich, es wäre wieder wie früher. Aber sofort verbannte er diesen Gedanken aus seinem Kopf. Nur kleine Kinder und vielleicht Albert glaubten, dass man sich so etwas Albernes wünschen konnte. So verdammt albern war das, dass ihm die Tränen in die Augen schossen. Wütend wischte er sie mit dem Handrücken weg, dann warf er einen raschen Blick zu Elsie. Hatte sie es gesehen? Er glaubte nicht. Obwohl das flackernde Licht der Taschenlampe zwischen ihnen das Grau der Nacht bloß etwas heller färbte, konnte er erkennen, dass sie auf den Graben und den Zaun davor starrte, der ihnen den Weg in die Freiheit versperrte.
Heute war dieser schmale Graben die Grenze zwischen Tod und Leben. Und damit keiner, der aus Belgien abhauen musste, dem Tod einfach so mit einem kurzen Anlauf und einem beherzten Sprung ein Schnippchen schlagen konnte, hatten die Deutschen hinter dem Wassergraben den Totendraht errichtet.
Die Deutschen waren seit mehr als drei Jahren die Herren über Leben und Tod in Belgien. Und Albert, der seit zwei Nächten und einem Tag gehorsam wie ein Hund hinter Elsie her trottete, war dem Tod versprochen.
Obwohl sie den Grenzstein, der die Stelle mit dem Loch markierte, nicht gefunden hatten, waren sie dennoch wegen Albert an allen möglichen anderen Stellen bis zum Zaun gekrochen, ängstlich darauf bedacht, den Draht ja nicht zu berühren. Eigentlich waren es sogar drei Drahtzäune hintereinander, aber nur der Mittlere zählte, denn der stand unter Strom und war tödlich. Die davor und dahinter sollten wohl nur die Milchkühe davon abhalten, sich selbst umzubringen.
Jedes Mal waren Elsie oder er vorsichtig unter dem ersten Drahtzaun ein Stück durchgekrochen, nur um zu sehen, dass es vor dem zweiten Zaun kein Loch im Boden gab. Sie waren beide mittlerweile schlammverschmiert, kein Wunder bei dem Regen, der seit Stunden wie aus Eimern vom Himmel fiel. Wenigstens war es nahezu ausgeschlossen, bei diesem Wetter von einer deutschen Patrouille überrascht zu werden. Und jetzt schien dennoch alles umsonst gewesen zu sein!
In diesem Augenblick hasste Thierry Albert. Er hasste dessen Wunderfinger, die auf winzigen Stückchen Papier Kunstwerke erschufen. Diese Wunderfinger, die ihn dazu verleitet hatten, Alberts Leben aufs Spiel zu setzen. Thierry wusste, dass das ungerecht war. Aber es fiel ihm leichter, Albert und seine Wunderfinger zu hassen, als sich selbst.
Oktober bis Dezember 1917: Geraardsbergen
Als der Tod auf dem Markt lauerte
Die Bomben fielen um zehn Uhr vormittags auf den Marktplatz, aus zwei Flugzeugen, die wie übergroße Libellen hoch oben über der Stadt schwirrten.
Alle hatten überrascht die Köpfe in den Nacken gelegt, aber der dichte Bodennebel ließ eine Sicht auf den strahlend blauen Novemberhimmel nicht zu. Nur das brummende Geräusch der Flugzeugmotoren war deutlich zu hören. Sogar die beiden deutschen Soldaten, die über den Markt flanierten, als gäbe es keinen Krieg, hatten die Gefahr nicht kommen sehen. Als ein Kind auf die schwarzen Schatten zeigte, die plötzlich den Nebel durchdrangen, war es für die Marktbesucher bereits zu spät gewesen, noch Deckung zu suchen.
Frau van Klaarsbeeck hatte gerade vor dem Gemüsestand einen Grünkohl bezahlen wollen. Sie hatte die Geldbörse schon in der Hand und während sie die passenden Münzen aus der Börse zusammensuchte, dachte sie besorgt, wie sehr die Preise in den letzten Wochen wieder in die Höhe geschnellt waren. Für diesen Betrag hätte sie im letzten Herbst noch einen Korb voll Gemüse und einen Laib Brot einkaufen können.
Nach dem Bombenabwurf musste man der Toten die Finger verbiegen, um die Geldbörse aus der Hand herauszulösen.
„Die Bomben fielen aus heiterem Himmel wie Taubenschiss“, erzählte die Bäckersfrau später, obwohl sie gar nicht dabei gewesen war. Ein Taubenschiss, der die Marktstände und zwei Häuser zertrümmerte und sechzehn Menschen tötete.
Normalerweise hätte Mama gar nicht dort sein sollen. Normalerweise wäre Dina gegangen, das Mädchen aus dem Waisenhaus der Nonnen, das ihr im Haushalt zur Hand ging. Aber Dina war unpässlich gewesen und hatte stöhnend mit einem warmen Ziegelstein im Bett gelegen.
Seitdem eine Nachbarin ihm weinend über die Bomben und Mamas Tod berichtet hatte, konnte Thierry an nichts anderes mehr denken. Sogar Mamas Stimme hallte noch als Echo in seinem Kopf, wie sie nach dem Frühstück verschmitzt gesagt hatte: „Meine zwei Männer müssen doch jeden Tag reichlich und gesund essen“, bevor sie resolut mit dem Korb am Arm das Haus verlassen hatte und dem Tod entgegengegangen war, ohne es zu ahnen.
„Meine zwei Männer“, auch diese Worte taten Thierry noch immer weh. Großvater und er waren damit gemeint. Denn einen Vater hatte er seit der Wegführung im letzten Jahr nicht mehr. Da hatten die Deutschen auf dem Hof der Catharinenschule mehrere hundert Männer zusammengetrieben und zur Zwangsarbeit abgeführt. Die meisten waren Arbeiter. Einige von ihnen hatten die Besatzer direkt aus der Zündholzfabrik in der Gentsestraat abgeführt. Papa in seinem Laborkittel war ihnen im Auftrag des Direktors hastig nachgelaufen, um sie freizubitten. Wie sollte denn ein Krieg ohne Zündhölzer auskommen? Das mussten die Deutschen doch einsehen. Aber da hatte der Direktor sich geirrt. Für ihn war das nicht weiter schlimm gewesen. Papa jedoch hatten die Deutschen einfach auch mitgenommen. Einen Chemiker konnte man im Krieg gut gebrauchen. Die Männer müssten, so hieß es, unter schrecklichen Bedingungen an der Front Gräben ausheben und viele von ihnen wären nach einem Jahr so geschwächt, dass sie sich kaum mehr auf den Beinen halten konnten. Die Frau des Bäckers prophezeite mittlerweile jedem, der es hören wollte, dass nur ein Wunder diese Männer noch vor dem gewissen Tod retten könne.
Der Großvater mahnte Thierry und seine Schwiegertochter mehrmals, dass sie nicht auf das lose, dumme Mundwerk der Bäckersfrau achten sollten.
„Gewiss“, behauptete er, „ist mein Sohn als studierter Chemiker viel zu wichtig, um mit einer Schaufel im Schlamm zu stehen.“ Nein, der Arzt Doktor van Klaarsbeeck zweifelte keinen Augenblick daran, dass sein Sohn in Deutschland in einem Labor arbeitete und dass er ihn nach dem Krieg wieder heil und gesund in die Arme schließen würde.
„Als ob das gut wäre!“, dachte Thierry genauso hartnäckig. Wusste Großvater denn nicht, was die Menschen so redeten über jene, die den Deutschen halfen? Was würden alle anderen sagen? Was würden Joseph, Henri und Félicien sagen, wenn sie wüssten, dass Thierrys Vater in einem geheizten, trockenen Labor für den Feind forschte, während ihre eigenen Väter im Dreck jämmerlich verreckten? Und Gaston erst. Sie hatten seinen siebzehnjährigen Bruder Martin mitgenommen, und niemand hatte mehr etwas von ihm gehört.
„Aber tot ist er bestimmt nicht. Das soll keiner behaupten. Der ist kräftiger, als er ausschaut“, sagte Gaston ein wenig zu oft. Niemand widersprach ihm, aber jeder, auch Gaston selbst, wusste, dass Martin es immer schon mit der Lunge gehabt hatte.
Thierry würde es niemals laut sagen, aber einen Vater, der, wenn auch gezwungen, dazu beitragen musste, den Deutschen zum Kriegserfolg zu verhelfen, so einen Vater wollte er eigentlich nicht zurückhaben. Er war kein ahnungsloses Kind mehr. Er wusste, was Chemiker forschten und wozu sie jetzt im Krieg gebraucht wurden. Das hatte nichts mit der richtigen Beschichtung von Zündholzköpfen zu tun. Nein, so naiv war er nicht. Da ging es um Gas und Bomben.
Gleich nach der schrecklichen Nachricht war Thierry blindlings hinauf in sein Zimmer gerannt. Dina, durch das Rufen der Nachbarin aus dem Bett geholt, hatte wenig später zu ihm hineingeschaut. Tränenüberströmt berichtete sie, dass die Nachbarin versprochen hatte, sogleich jemanden ins Lazarett zu Doktor van Klaarsbeeck zu schicken.
„Er wird bestimmt bald da sein“, hatte sie geschluchzt. Thierry hatte betäubt genickt, und Dina hatte unschlüssig noch einen Augenblick auf der Türschwelle ausgeharrt. Aber als Thierry stumm geblieben war, hatte sie die Tür geschlossen. Sie war erst sechzehn und wäre jetzt gerne davongelaufen. Doktor van Klaarsbeeck hatte sie vor elf Monaten auf Empfehlung der Nonnen aus dem Waisenhaus geholt, und Dina wusste, dass sie dorthin nicht mehr zurückkehren konnte. Also hatte sie sich eine Weile auf die Treppe gesetzt, sich die Tränen immer wieder aus dem Gesicht gewischt und gelauscht, ob der Junge nicht doch anfing zu weinen. Dann, nahm sie sich vor, wollte sie zu ihm gehen und ihn in die Arme schließen. Im Waisenhaus hatte sie das auch gemacht, wenn ein neues Mädchen um seine Eltern weinte. Aber hinter der Tür blieb es still. Schließlich ging sie in die Küche hinunter und fing an, Kartoffeln für das Abendessen zu schälen, obwohl sie sich nicht vorstellen konnte, dass jemand sie heute Abend essen würde.
Thierry saß oben auf der Bettkante und wartete darauf, dass sein Großvater endlich kam. Warum dauerte es so lange? Er hatte das Gefühl, dass das Haus um ihn herum immer kälter und kälter wurde. Irgendwann fror er so stark, dass er sich in die Bettdecke hüllte. Unten in der Küche würde es warm sein. Aber dort war Dinas Reich, und weil er nicht wusste, was er mit dem heulenden Hausmädchen reden sollte, blieb er lieber oben.
Wenige hundert Meter vom stattlichen Haus von Doktor van Klaarsbeeck entfernt traf Oberleutnant Schwarz, deutscher Kommandant von Geraardsbergen, nach dem Bombenabwurf rasch seine Entscheidungen.
Vierzehn Einheimische und auch zwei deutsche Soldaten, die sich zufällig ein wenig die Beine am Markt vertreten hatten, waren auf der Stelle tot gewesen. Die vierzehn Belgier bedeuteten ihm nichts, aber dass zwei seiner Männer umgekommen waren, konnte er nicht so einfach hinnehmen.
Zwarte Lieske, die als Übersetzerin für die Deutschen auf der Kommandantur arbeitete, wusste später zu berichten, dass Oberleutnant Schwarz das Teeservice, das eigentlich den Nonnen des Mädchenpensionats gehörte, zerschlagen hatte. „Scherben überall“, erzählte sie. „Ich hatte sogar Angst, dass er mir vor Wut eine Tasse an den Kopf wirft.“
Kein aufrechter, das Vaterland liebender Bürger der Stadt konnte Zwarte Lieske leiden, aber als Quelle verlässlicher Auskünfte über die Besatzer war sie für alle unentbehrlich. Oder wie die Frau des Bäckers gerne ein wenig philosophisch sagte: „Nach dem Krieg werden wir unsere Hühnchen mit ihr rupfen, aber bis dahin soll sie uns gefälligst die Eier legen.“
Das Teeservice konnte die Empörung des Kommandanten nicht mildern. Deshalb ließ er durch die beiden Gendarmen Ramdohr und Zahn zwanzig Männer verhaften und abführen. Genau für solche Vorfälle hatte er schließlich in seiner Schreibtischschublade längst eine Liste bereitliegen mit Namen von jenen Männern, die immer wieder in der kleinen Stadt für Unruhe sorgten. Wohin er die zwanzig Männer bringen ließ, erfuhr keiner, nicht einmal Zwarte Lieske.
Zehn für den einen Soldaten und zehn für den anderen. So wurde im Krieg gerechnet. Zehn und zehn machte zwei. Es war eine Rechnung, die Thierry, als er Tage später davon hörte, wie ein ständiges Echo über all seinen Gedanken und Gefühlen liegen bleiben sollte. Eine Rechnung, die für Thierry mit der Zeit zu einer weiteren Rechnung führte. Wenn das Leben zweier Soldaten nur mit zwanzig Leben aufgewogen werden konnte, sollte es der Gerechtigkeit halber auch andersrum gelten. Dann müssten für vierzehn Belgier hundertvierzig deutsche Soldaten geradestehen.
An jenem Nachmittag allerdings wusste Thierry nur, dass seine Mama niemals wiederkommen würde, und als er nach ein paar Stunden anfing zu fürchten, dass vielleicht auch etwas Schreckliches mit seinem Großvater geschehen war, hörte er endlich dessen schwere Schritte auf der Treppe. Jeder Schritt klang wie ein langsamer, dumpfer Trommelschlag.
Es fiel Doktor van Klaarsbeeck unendlich schwer, die Stufen hinaufzusteigen. Was sollte er dem Jungen sagen? Wie konnte er sich um ihn kümmern, wenn er täglich von früh bis spät im Lazarett versuchte, Verwundete am Leben zu erhalten? Am liebsten wäre er jetzt auch dort gewesen. Wenn er operierte, hatte er keine Zeit, an etwas anderes zu denken als an die Verletzungen, die er vor sich auf dem Operationstisch sah.
„Ich bedauere es zutiefst“, hatte der deutsche Arzt Werner Plötzl am frühen Nachmittag müde zu ihm gesagt, „aber ohne Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten am Operationstisch sind diese vier Männer verloren. Der Krieg fordert nun einmal von uns allen grausame Opfer, Klaarsbeeck. Ich kann es Ihnen leider nicht ersparen.“
Im ersten Augenblick war Doktor van Klaarsbeeck wütend gewesen. So eine Herzlosigkeit war kaum zu fassen. Aber mit jedem Schnitt, den er an diesem Tag noch setzte, mit jeder Naht, die er knüpfte, musste er sich mehr und mehr eingestehen, dass er froh war, dass die Deutschen es ihm nicht gestattet hatten, gleich nach Erhalt der schrecklichen Botschaft nach Hause zu eilen.
Doktor van Klaarsbeeck war ein pflichtbewusster Mann. Während er langsam die Treppe hinaufstieg, war er sich im Klaren, dass er jetzt seinen eigenen Kummer und sein Entsetzen zur Seite schieben musste, um seinen Enkel trösten zu können. Er holte Luft, überwand mit drei raschen Schritten die letzten Stufen und klopfte an. Als Thierry nichts erwiderte, drückte Doktor van Klaarsbeeck die Tür auf.
Der Junge saß auf der Bettkante, eingewickelt in die Decke, und starrte bewegungslos zu dem kleinen Fenster hinüber. Nicht einmal den Kopf drehte er. Doktor van Klaarsbeeck ging auf ihn zu und blieb neben ihm stehen. Er merkte, dass seine sonst so feste Hand zitterte. Deshalb legte er sie lieber nicht auf die Schultern seines Enkels. Er musste jetzt stark sein. Er musste ihm sagen, dass das Leben trotz allem weitergehen würde. Der Junge schaute nicht auf. Doktor van Klaarsbeeck räusperte sich.
„Thierry.“ Doktor van Klaarsbeeck bemühte sich, seine Stimme überzeugend klingen zu lassen. „Thierry, es ist ganz schnell gegangen. Zu schnell, als dass sie es richtig spüren konnte. Das musst du mir glauben, mein Junge. Sie hat nicht gelitten. Es war vorbei, bevor sie es wusste.“
Das, was er da sagte, klang selbst in seinen eigenen Ohren unpassend. Aber er wusste nicht, wie er seine Gefühle in Worte fassen sollte. Der Junge war erst mit seiner Mutter zu ihm ins Haus gezogen, als sein Sohn nach Deutschland verschleppt worden war. Eigentlich kannte er ihn gar nicht richtig. Was so ein Junge in diesem Alter wohl dachte? Überfordern durfte er ihn nicht. Vielleicht hätte er besser zuerst Pfarrer Raamaker um Rat fragen sollen. Der Geistliche wusste bestimmt besser, wie man einem Kind über den Tod seiner Mutter hinweghelfen konnte. Aber für diese Erkenntnis war es jetzt zu spät.
In seinem Kopf grub er nach Sätzen. Doch Sätze, die wirklich trösten würden, fielen ihm nicht ein. Deshalb wiederholte er ein wenig lauter: „Thierry, sie hat nicht gelitten. Wirklich nicht.“ Er sagte es immer und immer wieder, bis Thierry schließlich den Kopf zu ihm wandte und ihn anschaute.
Thierry sah, dass das Gesicht seines Großvaters blass war und dass seine schmalen, aber kräftigen Chirurgenhände zitterten.
„Hör auf zu reden! Geh weg! Ich will, dass Mama zu mir kommt“, wollte Thierry ihm entgegenschreien, aber es war so eng und heiß in seiner Brust, dass er keinen Ton herausbrachte.
„Sie hat nichts gespürt, Junge. Wirklich nichts. Das kannst du mir glauben.“
Doktor van Klaarsbeeck hatte es schon so oft gesagt, dass er nicht verhindern konnte, dass es nun ein wenig ungeduldig klang.
„Er glaubt es selbst nicht“, dachte Thierry. „Aber er will, dass ich es glaube.“ Er zwang sich, seinen Kopf auf und ab zu bewegen. Wenn Großvater es so wollte, konnte er es als „Ja“ deuten.
Doktor van Klaarsbeeck war erleichtert. Endlich hatten seine Worte den Jungen erreicht und beinahe hätte er sich jetzt auf die Bettkante neben ihn gesetzt und ihn fest umarmt. Aber ihm fiel rechtzeitig ein, dass er sich noch nicht die Zeit genommen hatte, saubere Kleidung anzuziehen. Denn obwohl er bei den Operationen immer einen langen Kittel trug, gelangten dennoch Blutspritzer auf seine Hosen.
„Vielleicht solltest du jetzt schlafen gehen. Brauchst du noch etwas?“, sagte er stattdessen.
Thierry verneinte es wortlos. Das, was er brauchte, würde nie wiederkommen.
„Ich werde Dina sagen, dass sie dir eine Wärmflasche bringen soll und eine Tasse warmer Milch.“ Doktor van Klaarsbeeck erinnerte sich, dass seine Frau das immer gemacht hatte, wenn eines der Kinder krank gewesen war.
„Danke“, flüsterte Thierry. Der Brocken in seiner Kehle brannte, aber weil sein Großvater nicht weinte, konnte er es auch nicht, und weil Großvater ihn nicht in die Arme nahm, verschränkte Thierry seine eigenen Arme vor der Brust. Eigentlich wünschte er sich nur, dass Großvater endlich aufhörte zu reden und verschwände. Dann könnte er sich ganz unter die Decke verkriechen und versuchen einzuschlafen. Im Schlaf gab es keinen Krieg. Im Schlaf, so hoffte er, würde er ein paar Stunden vergessen können, dass er ab heute keine Mutter mehr hatte.
„Jetzt müsste ich den Jungen umarmen“, dachte Doktor van Klaarsbeeck im selben Moment. Aber das hatte er noch nie gemacht, und so, wie das Kind in die Bettdecke gehüllt auf der Bettkante dasaß, schien es so unnahbar zu sein wie ein kleiner Igel. Außerdem sollte er sich wirklich zuerst umziehen. Nicht auszudenken, wenn der Junge gerade in dieser Situation die unvermeidlichen Blutspritzer auf seiner Hose bemerken würde. Deshalb sagte er bloß heiser: „Ich gebe Dina Bescheid. Sie wird dir gleich alles bringen.“ Er zögerte und fügte unbeholfen hinzu: „Also, dann … schlaf gut.“
Doktor Plötzl
Drei Tage später standen sie nebeneinander, und doch jeder für sich ganz allein, am offenen Grab, zwei versteinerte Figuren, eine groß und eine klein. Eine überschaubare Traube von Menschen hatte sich in einigem Abstand hinter ihnen zusammengefunden. Der Himmel war wolkenverhangen und es regnete. Tropfen fielen auf Thierrys Haare und Gesicht, kullerten wie Tränen, die er selbst nicht weinen konnte, seine Wangen hinunter.
Pfarrer Raamaker sprach salbungsvoll von einer Tragödie und dass nur Gott wisse, warum er einem Kind zuerst für unbestimmte Zeit den sorgsamen Vater und nun auch für immer die liebende Mutter genommen habe. Ein kleiner Ministrant, es war Gaston, Thierrys Schulfreund, stand neben dem Pfarrer und hielt den Weihwasserkessel umklammert. Er hätte Thierry gerne zugenickt, vielleicht auch zugelächelt. Aber er verkniff es sich. Es gehörte sich nicht auf einem Begräbnis. Der Pfarrer wählte ihn doch gerade deswegen aus, weil keiner der anderen Ministranten so rührend traurig dreinschauen konnte.
Als der Sarg endlich von vier Totengräbern in die Grube hinabgesenkt worden war, regnete es in Strömen. Rasch schoben sich die wenigen Trauergäste an Doktor van Klaarsbeeck und seinem Enkel vorbei und murmelten ihr Beileid, bevor jeder von ihnen nach Hause eilte. Als nur mehr Thierry und sein Großvater übrig waren, legte dieser eine Hand auf die Schulter des Enkels.
„Gehen wir nach Hause“, sagte er müde.
„Nach Hause“, dachte Thierry bitter. „Das gibt es doch gar nicht mehr.“
In diesem Augenblick trat ein älterer Mann in deutscher Uniform hinter einem Grabstein hervor. Offenbar hatte er in einiger Entfernung, unsichtbar für die anderen, dem Begräbnis beigewohnt. Mit langsamen Schritten kam er auf sie zu. Es war Doktor Plötzl, der deutsche Arzt aus dem Lazarett.
„Was hat der hier zu suchen“, schoss es Doktor van Klaarsbeeck durch den Kopf. Gleich darauf begriff er, dass Plötzl wohl aus Respekt für den Kollegen gekommen war. Etwas, was in Friedenszeiten, als es noch nicht diese schreckliche Einteilung in Feind und Freund gegeben hatte, selbstverständlich gewesen war. In seiner eigenen Jugend hatte er in Aachen in einem Krankenhaus gearbeitet. Niemals wäre er damals auf die Idee gekommen, dass die Menschen um ihn herum eines Tages seine Feinde werden würden. Er nahm sich vor, Thierry bald etwas darüber zu erzählen. Der Junge sollte sein Herz nicht mit Hass vergiften. Er sollte verstehen, dass nicht ganze Völker gut oder böse waren, sondern dass es immer auf den einzelnen Menschen ankam.
Er wollte ihm aber nicht nur davon erzählen. Er musste ihm ein Vorbild sein, auch wenn es ihm heute am Grab seiner Schwiegertochter schwerfiel. Es wäre besser gewesen, wenn der deutsche Arzt nicht auf dem Friedhof aufgetaucht wäre. Aber das ließ sich nun nicht mehr ändern. Doktor van Klaarsbeeck straffte sich, überwand den Widerwillen, den er dennoch spürte, und streckte die Hand aus. Während Doktor Plötzl seinen Regenschirm über die tropfnasse Gestalt seines belgischen Chirurgen hielt, ergriff er dessen Hand und schüttelte sie.
„Mein Beileid“, sagte er ernst auf Französisch, obwohl sein Kollege auch Deutsch verstand. „Für uns Ärzte ist so ein Tod besonders sinnlos und grausam.“ Er sprach langsam. Er hasste den Krieg, und er bereute längst den Tag, an dem er sich trotz seines Alters noch freiwillig für den Dienst im Lazarett gemeldet hatte.
„Es geht mir einzig und allein darum, Leben zu retten“, hatte er seiner Frau gesagt. „Wie kann ich den Menschen hier zu Hause noch in die Augen schauen, wenn ich weiß, dass ich ihre Söhne in der Fremde retten könnte.“
„Der Krieg wird dich herzlos machen“, hatte sie ihm prophezeit. Sie hatte recht behalten. Das hatte er gespürt, als er Doktor van Klaarsbeeck vor drei Tagen verbieten musste, sofort nach Hause zu gehen. Der Händedruck heute war sein Versuch, sich dafür zu entschuldigen.
„Danke, Herr Doktor“, erwiderte Doktor van Klaarsbeeck seinerseits förmlich auf Deutsch, und er war erleichtert, als sein deutscher Kollege seine Hand freigab.
Thierry, der die längste Zeit seine Schuhspitzen in der immer größer werdenden Regenpfütze betrachtet hatte, blickte auf, als er die deutschen Worte hörte, und konnte es nicht fassen. Ein Deutscher in Uniform und sein Großvater schüttelten sich die Hände. Von einem Augenblick zum anderen verschwand sein Kummer und er wurde wütend. Ausgerechnet an diesem Tag musste sein Großvater freundlich sein zu einem Deutschen. Schämen sollte er sich! Ohne sich zu überlegen, was er da tat, spuckte er dem Deutschen vor die Füße und rannte davon.
„Er ist noch ein Kind“, sagte Doktor van Klaarsbeeck erschrocken zu Doktor Plötzl. Dieser nickte nachdenklich und sagte: „Es waren zwei englische Flugzeuge. Das sollten Sie ihm sagen.“
Zum Wolf werden
In den ersten beiden Wochen nach dem Begräbnis versuchten Großvater und Thierry, so gut es ging, miteinander zu leben. Doktor van Klaarsbeeck bemühte sich, nicht bis spät am Abend im Lazarett zu bleiben. Aber auch wenn er zum Abendessen schon zu Hause war, merkte Thierry nur zu deutlich, dass dieser mit den Gedanken meistens noch bei seinen Kranken und Verwundeten verweilte.
Wenn Großvater abends überhaupt etwas zu ihm sagte, tat er es erst, wenn sie zu zweit an dem viel zu langen Tisch saßen. Es waren Sätze wie: „Ich finde, Dina hat sich mit dem Essen Mühe gegeben“, „Die Suppe schmeckt gut“ oder „Wie kommst du in der Schule voran? Kann ich dir bei etwas helfen?“ Thierry antwortete jedes Mal nur einsilbig mit „Ja“ und „Nein“. Oft sagte Thierry, sobald er den letzten Bissen gekaut und geschluckt hatte: „Kann ich auf mein Zimmer gehen?“ Großvater schaute ihn dann an, aber er fragte nicht „Warum?“, sondern sagte bloß „Natürlich, geh nur.“ Thierry vermutete, dass Großvater genauso froh war, wieder allein zu sein, wie er selbst.
Mit Mama hatte sich das große Haus seines Großvaters wie ein Zuhause angefühlt. Jetzt kam er sich wie ein Gast in einem Hotel vor, ein Gast, der nicht besonders gern gesehen wurde.
Noch schlimmer waren die Sonntage, wenn Großvater ihn förmlich bat, nach dem Mittagessen mit ihm in den Salon zu wechseln. Großvater ließ sich von Dina einen Kaffee und für Thierry eine Limonade bringen, dann räusperte er sich und fing an zu erzählen. Beim ersten Mal meinte Thierry sich zu verhören. Großvater sprach von seiner Zeit als Assistenzarzt in einem deutschen Spital.
„Vielleicht hat es“, dachte Thierry, „früher, als Großvater jung war, tatsächlich ein paar nette deutsche Menschen gegeben, aber die, die es heute gibt, sind böse und gemein. Da kann Großvater erzählen, was er will.“
Zum Glück stellte Großvater keine Fragen und erwartete keine Antworten. Es genügte ihm offenbar, diese Geschichten wie eine Predigt in der Kirche vorzutragen, und Thierry lernte, seine Limonade zu trinken und währenddessen an andere Sachen zu denken.
Dina, die nun den Haushalt führte und mit sechzehn noch kaum eine Ahnung davon hatte, sagte zur Bäckersfrau: „Es täte dem jungen Herrn gut, wenn der Herr Doktor ihn mal fest umarmen würde. So ein Kind muss doch endlich mal weinen können.“
Die Bäckersfrau nickte und meinte: „Und auch dem Doktor würde es nicht schaden. Es ist wahrlich keine Schande für einen Mann, um seine Schwiegertochter zu trauern.“
Aber Thierry konnte nicht weinen. Dabei versuchte er es spät nachts mit dem Kopf unter dem Kissen. Mehr als ein leises Wimmern brachte er nicht zustande. Zu groß war die Angst, dass Großvater es hören könnte und ins Zimmer kommen würde.
Und dann? Thierry konnte sich vorstellen, dass Großvater diese Tränen übertrieben fände. Schließlich war er ein Arzt in einem Lazarett und sah täglich die schrecklichsten Tode. Im Vergleich dazu war ein lautes Wehklagen in seinen Augen vermutlich maßlos übertrieben. Denn Mama war auf der Stelle tot gewesen. Sie hatte nicht wie diese Soldaten furchtbar gelitten.
„Wenn das Wundbrandfieber sich unaufhaltsam in den Körper frisst“, hatte er Großvater einmal zu Mama sagen hören, „ist nichts mehr zu machen. Da stehe ich neben dem Bett eines solchen armen Menschen und muss ohnmächtig zuschauen, wie er elend zugrunde geht.“
Damals, als Mama noch gelebt hatte, war Thierry beeindruckt gewesen von der tiefen Betroffenheit in Großvaters Worten. Jetzt war er klüger und er hatte längst selbst die Rechnung, die Kommandant Schwarz angestellt hatte, zu Ende gerechnet. Hundertvierzig Soldaten bräuchte es. Aber seinem Großvater schien dieser so naheliegende Gedanke überhaupt nicht zu kommen. Hundertvierzig wurde für Thierry eine magische Zahl. Die Zahl der Gerechtigkeit. Was Thierry sich nicht eingestehen wollte, war, dass er es tunlichst vermied, sich diese Zahl genauer vorzustellen, aber manchmal ertappte er sich bei Gedanken darüber. Hundertvierzig: So viele Menschen würden sonntags die Kirche zur Hälfte füllen oder hundertvierzig Schüler würde man in vier Klassen unterrichten. Aber Soldaten durfte man nicht mit dieser Zahl vergleichen. Hundertvierzig Soldaten waren eine dunkle, böse, gesichtslose Masse.
In den ersten Wochen wartete Thierry darauf, dass Großvaters unausgesprochene Trauer in Wut umschlagen würde. Er war überzeugt, dass er eines Abends von seiner Arbeit im Lazarett nach Hause kommen und mit Genugtuung in der Stimme über den Tod deutscher Soldaten berichten würde. Viele Verwundete starben schließlich, auch, wenn Großvater sie noch operieren konnte.
Aber Abend für Abend aßen sie zusammen, ohne dass sein Großvater auch nur ein Wort darüber verlor, wie er sich fühlte, und an den Sonntagnachmittagen im Salon zählte nur die Vergangenheit, in der Großvater offenbar wunderbar glückliche Tage in einem deutschen Spital verbracht hatte.
„Es ist“, dachte Thierry zunehmend verzweifelt über diese Gefühllosigkeit, „als hätte es die Bombe und Mama nie gegeben.“ Es war, als verstünde Großvater nicht, dass die Deutschen letztendlich an allem schuld waren.
Schließlich hielt er es nicht mehr länger aus. „Müssen jetzt viele Verwundete im Lazarett sterben?“, fragte er geradeheraus.
„Ja“, antwortete Großvater einsilbig und blickte nicht einmal von seinem Teller auf. Stur kaute er das Fleisch. Seine Kiefer mahlten.
„Auch deutsche Soldaten?“, ließ Thierry nicht locker. „Oder nur unsere? Ich meine unsere, die Briten und die Franzosen. Sterben die etwa mehr, weil du gezwungen wirst, dich immer zuerst um die Deutschen zu kümmern?“
Großvater schluckte zuerst noch den Bissen hinunter und schaute ihn dann lange an. Thierry hielt seinem Blick stand und hoffte, dass Großvater jetzt endlich einsah, dass Mama nur deshalb tot war, weil die Deutschen diesen Krieg begonnen hatten. Aber alles, was Großvater schließlich bedächtig sagte, war: „Junge, Gott fragt an der Himmelstür nicht, woher du kommst. Warum sollte ich es denn tun?“
Das war zu viel.
„Gott ist überhaupt nicht so. Hat er nicht die Erde unter Wasser gesetzt, als die Menschen ihm unerträglich wurden? Hat er nicht die Kinder der Ägypter getötet?“, rief Thierry aufgebracht über Großvaters gleichgültige Milde. Warum wollte Großvater es denn nicht einsehen, dass diese Deutschen bestraft gehörten für all das Leid, das sie nicht nur ihnen, sondern ganz Belgien zufügten?
Doktor van Klaarsbeecks Mund verzog sich zu einem bitteren Lächeln. Ihm wurde plötzlich bewusst, dass der Junge trotz all der Sonntagnachmittage nichts verstanden hatte von dem, was er ihm hatte vermitteln wollen. Dabei hatte er geglaubt, wie ein geduldiger Gärtner die Samen der Nächstenliebe und der Achtung vor dem Leben in Thierrys Herz zu säen, damit sie dort keimen und einen guten Menschen aus ihm machen würden. Vergebens war das gewesen.
„Ich sollte ihm jetzt direkt sagen, dass Trauer nicht durch Hass getröstet wird und dass ein solcher Hass nur das eigene Herz vergiftet. Ich muss ihm dafür die Augen öffnen, bevor es ihn kaputt macht“, dachte Doktor van Klaarsbeeck. Aber die Arbeit im Lazarett war so schrecklich und mit niemandem konnte er darüber reden. Er war, gestand er sich ein, zu müde und zu alt, um sich richtig um ein Kind zu kümmern.
Deshalb sagte er bloß: „Ah, du kennst deine Bibel recht ordentlich, Thierry. Aber hast du auch das Neue Testament so fleißig studiert? Und hörst du nicht Pfarrer Raamaker am Sonntag bei der Predigt aufmerksam zu?“
Dann nahm er die Gabel wieder zur Hand und aß Bissen für Bissen schweigend weiter. Alles, was Thierry begriff, war, dass sein Großvater die Trauer lieber hinunterschluckte.
Was den Pfarrer betraf, fiel es Thierry leicht, sich ein eigenes Urteil zu bilden. In der Sonntagsmesse predigte dieser zwar unermüdlich über die Nächstenliebe, aber Thierry war überzeugt, dass der ängstliche Mann das deshalb so übertrieben tat, weil ihm nicht nur die Gemeinde, sondern auch der deutsche Oberleutnant Schwarz zuhörte. Breitbeinig saß dieser an jedem Sonntag in Uniform in der vordersten Reihe, während irgendwo weiter hinten „der Weiße“ und „die Brille“ alles im Auge behielten.
„Der Weiße“ und „die Brille“, so wurden die beiden deutschen Gendarmen genannt. Der junge, große, weißblonde Max Ramdohr und der ältere, schmale, kleine Ernst Zahn mit seinen kreisrunden Augengläsern ließen keine Gelegenheit aus, in Geraardsbergen Verstöße gegen die zahlreichen Verordnungen aufzuspüren und streng zu bestrafen.
„Die verstehen doch kein Wort Flämisch. Da kann der Pfarrer ruhig mal deutlicher werden“, sagte Thierry nach einer Messe zu Gaston. Der müsste ihn verstehen. Schließlich hatten die Besatzer seinen großen Bruder weggeführt.
„Was meinst du?“
„Ich meine, dass Gott es nicht gut finden kann, wenn ihretwegen meine Mutter und andere getötet wurden. Ich meine, dass ein Pfarrer laut darum beten sollte, dass die, die diesen Krieg nach Belgien gebracht haben, bestraft werden. Ja, das meine ich. In der Hölle sollte er sie schmoren lassen.“
Die Wut zuzulassen und endlich auch auszusprechen, tat so gut.
Gaston riss die Augen auf und schaute sich hastig um. Zum Glück standen der Weiße und die Brille nicht in ihrer Nähe.
„Wenn er das laut sagt und die verstehen ihn doch, wird er erschossen“, flüsterte er.
„Er ist feige“, urteilte Thierry hart. „Und ich sage dir was: Wenn ein Pfarrer zu so etwas nur schweigt, statt Gott um eine Strafe zu bitten, müssen die Menschen eben selbst handeln.“
„Was hast du vor?“ Gaston wollte die Antwort lieber gar nicht wissen, aber er fragte trotzdem.
„Weiß ich noch nicht genau“, gestand Thierry. „Aber ich schwöre dir, mir wird schon etwas einfallen. Jeden Abend denke ich darüber nach. Zwanzig Männer haben sie verhaftet und weiß der Teufel wohin gebracht. Vielleicht sind sie längst tot. Zwanzig für zwei Soldaten. So rechnen die und so rechne ich auch. Für meine Mutter und die dreizehn anderen sollen deshalb hundertvierzig von ihnen büßen müssen. Und wenn kein anderer dafür sorgt, werde ich es tun.“
„Was wird dein Großvater dazu sagen?“, flüsterte Gaston beklommen. Thierry wusste doch auch, dass, wer etwas gegen die Deutschen unternahm und dabei erwischt wurde, ein schreckliches Schicksal hatte. Eine Gefängnisstrafe war da noch das Harmloseste.
„Rede nicht von meinem Großvater. Der ist genauso feige wie der Pfarrer. Dabei hätte er im Lazarett genug Gelegenheit, es unauffällig selbst zu erledigen. Ein Schnitt zu tief bei einer Operation, einen verschmutzten Verband nicht rechtzeitig wechseln, zu viel, zu wenig oder die falsche Medizin. Zu alledem bräuchte er nicht einmal großen Mut, nur manchmal ein bisschen Geschick und meistens würde es auch genügen, einfach nichts zu tun. Aber mein Großvater versucht stattdessen, jedes Mal dem Tod auch noch die Todgeweihten aus den Armen zu reißen.“
„Er muss das doch. Er ist Arzt“, traute sich Gaston zu widersprechen. Er hatte große Achtung vor dem freundlichen, alten Doktor.
„Finde ich nicht. Was passiert denn, wenn er die deutschen Soldaten gesund macht? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Die werden deshalb keine guten Menschen. Nein, die setzen sich in einen Zug, fahren wieder an die Front und kämpfen weiter gegen uns. Großvater sollte sie lieber ihrer gerechten Strafe zuführen. Aber weißt du, was er mir Sonntag für Sonntag sagt?“ Thierry war froh, dass er es jemandem erzählen konnte.
„Nein?“ Gaston wäre jetzt viel lieber nach Hause gelaufen, aber Thierry war sein Freund und als solchen wollte er ihn nicht einfach stehen lassen.
„Er behauptet, dass die Deutschen nicht immer so schrecklich gewesen sind, und dass ein Krieg die Menschen, egal woher sie kommen, in Wölfe verwandelt.“
„Wölfe? Das sagt er?“
„Ja, aber das stimmt überhaupt nicht. Die Deutschen sind gemeiner und niederträchtiger als die Belgier, Franzosen und Engländer. Das kannst du doch mit eigenen Augen sehen. Glaubst du etwa, dass Martin oder dein Vater, wenn sie Soldaten wären, auf unschuldige Menschen schießen würden, wie die Deutschen es tun?“
Gaston schüttelte den Kopf. „Niemals.“
„Siehst du“, sagte Thierry. „Die würden nicht zu Wölfen werden. Die hätten sich nicht in ein Flugzeug gesetzt, um über einem Marktplatz voll mit Menschen Bomben abzuwerfen.“
Dass die Bomben, die seine Mutter getötet hatten, aus einem britischen Flugzeug abgeworfen worden waren, wollte Thierry nicht gelten lassen. Es waren die Deutschen, die mit dem Krieg angefangen hatten. Ohne sie müssten auch englische Flugzeuge keine Bomben abwerfen.
Gaston fand es beeindruckend, dass Thierry sich so viele Gedanken über den Krieg gemacht hatte, während er selbst immer nur an die ganz alltäglichen Sachen in seinem Leben gedacht hatte.
„Du willst wirklich gegen die Deutschen kämpfen?“, fragte er ungläubig. „So richtig?“
Thierry nickte entschlossen. „Ich muss mir nur noch überlegen wie. Ich möchte in ein Flugzeug steigen und es Bomben regnen lassen. Oder heimlich die Front im Süden überqueren und mich freiwillig unseren Truppen anschließen. Ich kann bestimmt mit einem Gewehr umgehen.“
Er sagte das so überzeugt, dass Gaston es sich im ersten Moment tatsächlich auch vorstellen konnte. Dann aber sah er, wie absurd das war. Kinder wie Thierry und er konnten höchstens Soldaten spielen, mit Stöcken als Gewehre und Schulkappen als Helme.
„Das geht doch nicht“, sagte er vernünftig.
„Das weiß ich auch“, antwortete Thierry verdrossen. „Aber warte ab. Irgendetwas wird mir schon einfallen.“
Unsichtbare kleine Mörder
Während er Gaston seine Gedanken mitgeteilt hatte, war Thierry bewusst geworden, dass er einen Plan brauchte, den er selbst ohne Hilfe von anderen ausführen konnte. Seine abendlichen Fantasien, dass er in ein Flugzeug stieg und Bomben abwarf oder heimlich die Front querte, schob er zur Seite. Das war Kinderkram. Stattdessen fing er an, sich ernsthaft zu überlegen, welche Möglichkeiten er tatsächlich hatte.
Dina aber war es, die ihn schließlich auf die richtige Spur führte.
„In deinem Alter“, schimpfte sie, als sie ihn wieder einmal ertappte, wie er mit erdigen Schuhen über ihre frisch gewischten Fliesen stapfte, „habe ich längst im Waisenhaus zupacken müssen. Statt zu spielen musste ich die Kleinen versorgen, sie waschen, ihre Schlafsäle putzen und ihre Kleidung flicken. Sogar die Nachttöpfe habe ich ausgeleert. Ich habe mit zwölf Jahren bereits genauso hart gearbeitet wie heute die Krankenschwestern in den Lazaretten. Das kannst du mir glauben.“
Thierry zuckte mit den Schultern.
„Beim nächsten Mal kannst du den Schmutz selbst wegputzen!“, drohte sie. „Es würde dir nicht schaden zu spüren, was harte Arbeit ist.“
„Du wirst dafür bezahlt, und ich bin kein Waisenmädchen“, sagte Thierry ungerührt, aber gleichzeitig hatte er das Gefühl, dass Dina soeben etwas Nützliches gesagt hatte.
„Na warte!“, rief Dina empört und drohte ihm mit der Bürste. „Das werde ich deinem Großvater erzählen. Wenn es nach mir ginge, solltest du ab jetzt hier im Haushalt mitarbeiten, statt nach der Schule draußen herumzulaufen und den Dreck nach Hause zu tragen.“
Das war es. Mitarbeiten! Thierry strahlte Dina an. „Danke für deinen Vorschlag!“, rief er und ohne weiter auf sie zu achten, rannte er die Treppe hinauf in sein Zimmer. Er warf sich auf sein Bett, ohne sich um seine schmutzigen Socken und Hosenbeine zu kümmern. Jetzt wusste er, was er tun konnte. Er musste nur noch alles genau planen.
„Ich möchte dir bei der Arbeit helfen“, sagte Thierry eines Abends, als er überzeugt war, dass sein Plan keine Schwachstellen mehr hatte.
Großvater ließ den Löffel überrascht zurück in die Suppe sinken. „Helfen?“
„Im Lazarett. Ich möchte von dir lernen.“ Die Lüge kam Thierry glatt über die Lippen, so gut hatte er sie geübt.
„Lieb von dir, aber da kannst du nicht helfen und gefährlich ist es auch. Diese teuflische Influenza geht um, mein Junge“, antwortete Großvater freundlich. Es lag ihm auf der Zunge hinzuzufügen, was er wirklich sagen wollte: „Schrecklich, wenn dir auch noch etwas passiert. Was soll ich dann deinem Vater sagen, wenn er wieder da ist.“ Aber er durfte den Jungen nicht verängstigen. Der hatte schon viel zu viel mitgemacht für ein Kind seines Alters. Andererseits freute er sich auch. Seine Befürchtung, dass sein Enkel die Deutschen hassen würde, hatte sich also doch nicht bewahrheitet. Dennoch, das Lazarett war kein Ort für Kinder. Thierry konnte sich nicht vorstellen, mit welch grauenhaften Verwundungen und tragischen Schicksalen sein Großvater täglich konfrontiert wurde.
„Ich kann auf mich aufpassen. Ich weiß, wie man sich vor Ansteckung schützt. Das hast du mir beigebracht!“ Thierry hoffte, dass sein Großvater, der selbst so weit weg von jeglichen wölfischen Gedanken war, nicht durchschaute, was er in Wahrheit plante: dass er nämlich genau diese seltsamen Verursacher der Influenza, diese unsichtbaren, winzig kleinen Mörder, wie Großvater sie nannte, in den Betten der deutschen Soldaten platzieren wollte, damit sie daran krepierten.
„Wahrscheinlich fühlt sich der Junge in diesem großen Haus ein wenig einsam und sehnt sich nach Abwechslung.“ Doktor van Klaarsbeeck meinte, Thierrys Wunsch richtig zu deuten. „Vielleicht erhofft er sich auch, von den Verletzten spannende Heldengeschichten zu hören.“
Was der Grund auch sein mochte, es kam nicht in Frage, dass Thierry im Lazarett mithalf, und so sehr dieser darum bat, mitkommen zu dürfen, so hartnäckig lehnte sein Großvater es ab.
„Thierry, mein Nein bleibt ein Nein und jetzt reden wir nicht mehr darüber“, beendete Doktor van Klaarsbeeck schließlich die Sache.
Mit rotem Kopf fuhr Thierry von seinem Stuhl auf, so dass dieser zu Boden fiel.
„Ich darf auch gar nichts! Du hast ja keine Ahnung, wie es ist, wenn du jeden Tag diesen Mördern auf der Straße begegnen musst!“, schleuderte er seinem Großvater entgegen und rannte vom Esstisch weg.
Doktor van Klaarsbeeck schaute seinem Enkel entgeistert nach und zuckte zusammen, als oben im zweiten Stock die Tür zum Kinderzimmer krachend zugeschlagen wurde.
„Ich dachte, er wollte helfen?“, murmelte er verwirrt. Was, um Gottes Willen, hatte er da missverstanden? Er faltete umständlich seine Serviette und legte sie neben den Teller. Auch ihm schmeckte das Essen nicht mehr. „Vielleicht“, dachte er, „sollte ich mit dem Pfarrer sprechen. In einem Internat unter Gleichaltrigen ist der Junge möglicherweise besser aufgehoben.“
Die zwölf verwegensten Jungen Belgiens
Thierry hätte nichts davon erfahren, wenn sich Gaston nicht in einer Schulpause verplappert hätte.
„Haben sie dich auch gefragt?“ Gaston trat vor Aufregung von einem Bein auf das andere. Schon gestern, nachdem Robert ihn nach der Schule auf dem Nachhauseweg beiseite genommen hatte, wäre er am liebsten sofort zu Thierry gerannt. Aber die Vorstellung, vor dem großen vornehmen Haus des Doktors zu stehen, zu klingeln und dann bestimmt einer Dienstbotin sein Anliegen vorbringen zu müssen, hatte ihn davon abgehalten. Daheim in der kleinen Wohnung neben dem Bahnhof hatten sie zu sechst nur zwei Zimmer und eine Küche. Das Klo teilten sie sich mit drei anderen Familien und gebadet wurde reihum am Samstagabend in der Wanne vor dem Küchenherd. Auch wenn sie in der Schule Freunde waren, so lebten sie doch in völlig unterschiedlichen Welten.
„Was?“ Thierry schaute seinen Freund überrascht an.
„Dich haben sie nicht gefragt? Ich habe gedacht … Weil du dich doch …“ Gaston geriet ins Stocken. Robert hatte ihm dreimal gesagt, dass es sich bei der Sache um eine höchst geheime Angelegenheit einiger weniger Eingeweihter handelte. Aber Gaston war davon ausgegangen, dass Thierry auf jeden Fall zu diesem kleinen Kreis der Mitwisser gehörte.
„Was gefragt?“
„Das darf ich eigentlich nicht sagen. Ehrlich, Thierry, wenn du nicht dabei bist, will ich auch nicht. Ich habe doch bloß Ja gesagt, weil ich dachte, dass du auch …“ Gaston stotterte herum. Wie konnte es sein, dass sie ihn schon und Thierry nicht gefragt hatten? Der war doch der kräftigere, der mutigere von ihnen beiden. Während er selbst, der schüchterne Gaston, so gar nicht dafür geeignet war, bei solch gefährlichen und geheimen Dingen mitzumachen.
„Jetzt red schon!“ Thierry packte ihn grob am Arm.
„Aua! Ich kann doch nichts dafür.“
Thierry ließ den Kleineren los. Gaston schaute sich verstohlen um. Sie standen etwas abseits im Schulhof, und keiner der anderen Jungen achtete auf sie.
„Wir sollen uns wehren“, flüsterte er. „Es gibt einen geheimen Plan.“
Thierry fühlte eine Welle der Aufregung durch sich hindurchströmen. Endlich jemand, der handeln wollte.
„Wer ist wir?“, fragte er hastig.
„Ich weiß nicht, ob ich dir das verraten darf, wenn sie dich nicht gefragt haben“, zweifelte Gaston.
„Komm schon, wer ist wir?“, zischte Thierry, und Gaston wusste, dass er keine Chance hatte. Wenn er nicht den Mund aufmachte, würde Thierry ihn in den Schwitzkasten nehmen. Deshalb zeigte er auf einen der älteren Jungen und hauchte: „Marcel van Waeyenberg. Er hat eine Truppe gegründet. Und Robert darf mitmachen.“
Robert war Marcels jüngerer Bruder und ging mit Thierry und Gaston in dieselbe Klasse.
„Marcel hat dich gefragt?“ Thierry konnte das nicht ganz glauben. Marcel war vierzehn, hatte bereits ein paar Härchen über der Lippe und gab sich grundsätzlich nicht mit den Jüngeren ab.
Gaston schüttelte den Kopf. „Nein, nicht Marcel. Robert. Weil … Ach, ich weiß doch auch nicht, warum ich mitmachen soll. Ich, ich dachte, dass er dich zuerst gefragt hatte und du vielleicht gesagt hättest, dass ich auch dabei sein soll. Na ja, und dann wollte ich nicht …“
Gaston stand da wie ein Häufchen Elend. Ein Widerstandskämpfer, der bei der erstbesten Gelegenheit seine Bande verriet. Pfui! Was würde Robert dazu sagen und Marcel erst?
„Nein, er hat mich nicht gefragt.“ Thierry ärgerte sich. Er hatte doch genauso gute Gründe, gegen die Deutschen zu kämpfen wie Gaston. Nein, sogar bessere. Seine Mama war tatsächlich tot, bei Gastons Bruder vermuteten das alle nur.
„Gehen wir zu Robert“, forderte Thierry den Freund auf. „Ich muss auch in diese Truppe.“
„Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, sich selbst anzumelden. Ich glaube, das geht so nicht“, gab Gaston zu bedenken.
Aber Thierry hatte ihn bereits stehengelassen und war zu Robert hinübergelaufen. Er zog ihn von ein paar anderen Jungen weg.
„Ich weiß von Marcels Truppe“, sagte er ohne Umschweife. „Ich will auch dabei sein.“
Robert nickte überrumpelt, dabei war es sein Bruder, der die Entscheidungen traf.
Wenig später betrachtete Marcel Thierry nachdenklich in einer stillen Ecke des Schulhofes. Gaston hatte er nur deswegen ausgesucht, weil dieser ihm Informationen über die Züge verschaffen sollte, und Robert durfte mitmachen, weil sie Brüder waren. Aber mehr von den kleinen Jungen wollte er eigentlich nicht dabeihaben. Die anderen waren alle schon mindestens dreizehn. Zwölf war zu jung.
„Lass mich auch mitmachen. Ich habe schließlich einen guten Grund. Meine Mutter ist tot, oder?“ Thierry schaute Marcel herausfordernd an.
Dieser überlegte. Es stimmte. Thierrys Mutter war beim Bombenabwurf umgekommen. Außerdem war er Gastons Freund. Marcel war klug genug, um zu ahnen, dass der ängstliche Gaston die Schwachstelle in seinem Plan darstellte. Thierry hatte Einfluss auf Gaston und konnte verhindern, dass der Kleine schlapp machte.
„Na, gut. Aber nur, wenn du auf mich hörst“, verlangte er. „Ich allein gebe hier die Befehle. Ich bin euer Kommandant. Du gehorchst mir ohne Widerrede.“
„Sicher“, sagte Thierry rasch. „Ich mache alles, was du sagst. Da kannst du dich drauf verlassen.“
Dass Marcel selbst noch ein Schüler war, spielte keine Rolle. Wenn er als Einziger bereit war, gegen die Deutschen etwas zu unternehmen, würde Thierry ihm dabei helfen.
Am nächsten Nachmittag nach der Schule trafen sich die Jungen im Wäldchen hinter der Abtei von Hunnegem. Auf der anderen Seite der hohen Mauer konnten sie die hellen Stimmen der Mädchen hören, die dort im Pensionat waren, damit sie von den Nonnen zu Damen der Gesellschaft erzogen wurden.
Marcel ließ sie in einer Reihe vor der Mauer antreten und musterte sie wie ein Offizier seine Soldaten.
„Keiner weiß, dass ihr hier seid?“, vergewisserte er sich.
Sie schüttelten die Köpfe.
„Höchste Geheimhaltung über das, was ich euch jetzt sage. Verstanden?“
Sie nickten. Das gefiel Marcel nicht. Er hatte viel Zeit damit verbracht, die Deutschen zu beobachten. Er wusste, wie ein Offizier seine Mannschaft führte.
„Ich möchte was hören! Ab jetzt bin ich euer Kommandant, und ihr seid meine Soldaten. Ihr müsst antworten ‚Jawohl, mein Kommandant‘“, verlangte er.
Die Jungen warfen sich verstohlene Blicke zu. Sie wussten nicht genau, ob Marcel das wirklich ernst meinte. Er war doch auch nur einer von ihnen.
„Ich höre nichts!“, blaffte Marcel.
Robert starrte ihn an. Er kannte seinen Bruder: Er meinte es todernst. Wenn er sich jetzt nicht durchsetzen konnte, würde er die ganze Sache bleiben lassen und beleidigt davon marschieren. Dann war es aus mit diesem aufregenden Plan. Dann war er selbst in Marcels Augen wieder nur der nutzlose Kleine.
Deshalb straffte er sich, stand ganz stramm und brüllte: „Jawohl, mein Kommandant!“ Die anderen taten es ihm nach und versuchten ihn noch an Lautstärke zu übertreffen. Auf der anderen Seite der Mauer verstummten die Mädchenstimmen und gleich darauf keifte eine Nonne: „Schert euch weg von der Mauer, ihr Lümmel, oder muss ich rüberkommen und euch Beine machen!“
Die Jungen lachten, aber Marcel legte einen Finger an die Lippen und deutete mit dem Kopf in Richtung Wäldchen. Er marschierte los, und sie folgten ihm. Bei den ersten Bäumen blieb er stehen. Zufrieden registrierte er, dass sie sich ohne Aufforderung wieder in Reih und Glied aufstellten.
„Also, passt auf“, sagte er. „Es kann verdammt gefährlich werden. Kämpfen ist etwas für Männer und nicht für Kinder.“ Dabei schaute er besonders Gaston, Thierry und Robert an, die am Ende der Reihe nebeneinanderstanden, alle drei mindestens einen Kopf kleiner als die anderen.
„Ihr Kleinen, ihr könnt noch nach Hause gehen. Ich bin euch nicht böse.“
Das war gelogen. Gut, auf Robert und Thierry konnte er verzichten. Sie waren zwar ganz offensichtlich sehr begierig darauf, dabei zu sein, aber wer wusste, ob sie sich nicht in die Hose machten, wenn es zur Sache ging. Gaston jedoch brauchte er für seinen Plan. Ohne ihn würde es kompliziert werden, wenn nicht sogar unmöglich. Zu dumm, dass ausgerechnet er so ängstlich war. Allein die Art und Weise, wie er sich an Thierry drängte, zeigte das offensichtlich.
„Du hast gesagt, wir dürfen dabei sein“, unterbrach ihn Robert böse.
„Ich habe nicht mal vor dem Teufel höchstpersönlich Angst“, prahlte Thierry, „Und Gaston übrigens auch nicht. Der ist viel tapferer, als er ausschaut“, fügte er hinzu, weil er es gewohnt war, für seinen Freund mitzureden.
Gaston sagte nichts. Er wollte nach Hause laufen, aber das ging nicht. Er hatte das Gefühl, dass Thierrys deutliche Begeisterung für diese unbekannte gefährliche Sache auch ihn festhielt.
„Ruhe Robert, und den Teufel lässt du mal schön in der Hölle, Thierry“, befahl Marcel. „Ich habe übrigens nicht gesagt, dass ihr gehen müsst. Ihr könnt bleiben, aber ab jetzt heißt es mitgefangen, mitgehangen. Haben das alle verstanden?“
„Jawohl, mein Kommandant!“, riefen alle bis auf Gaston gleichzeitig. Dieser machte zwar den Mund auf, brachte aber keinen Laut über die Lippen.
„Wir gehen folgendermaßen vor.“ Marcel senkte seine Stimme zu einem dramatischen Flüstern. Er hatte es heimlich vor dem Spiegel geübt, und es verfehlte bei den Jungen nicht die Wirkung. Sie beugten sich alle angespannt nach vorne, sogar Gaston.
„Wir werden einen Zug mit Soldaten entgleisen lassen.“
Er genoss das ungläubige Staunen der anderen.
„Ja, ihr hört richtig. Wir werden einen Zug entgleisen lassen. Ich habe alles geplant.“
Marcel legte eine Hand auf Gastons Arm. Der kleine Junge schaute ihn verschreckt an.
„Gaston“, sagte er ernst.
„Ja?“ Gaston zwinkerte nervös mit den Augen.
„He, du brauchst dich nicht zu fürchten.“ Marcel lächelte ihm zu. „Für dich habe ich eine besondere Aufgabe. Sie ist sehr wichtig, aber nicht gefährlich. Du wirst jeden Abend deinen Vater nach den Zügen für den nächsten Tag aushorchen. Das ist nicht schwer, oder? Nur ein bisschen reden.“
Marcel bemühte sich, es besonders harmlos und einfach klingen zu lassen.
„Ich?“ Gastons Augen weiteten sich.
„Ja, wer sonst.“ Ein ungeduldiger Tonfall stahl sich in Marcels Stimme. „Dein Vater ist doch ein Bahnwärter. Der weiß das. Wir brauchen einen Transportzug, der ganz in der Früh voll mit Soldaten vorbeifährt.“
„Aber ich frage meinen Vater nie nach den Zügen. Das wird ihm vielleicht komisch vorkommen.“ Gaston konnte das Zittern in seiner Stimme nicht länger verbergen.
„So eine Memme“, dachte Marcel abschätzig, aber er lächelte aufmunternd weiter.
„Dann wirst du dich ab jetzt eben für Züge interessieren. Frag ihn halt auch nach anderen Sachen, wie … wie nach unterschiedlichen Arten von Lokomotiven, und wie viel Kohle so ein Zug braucht. Das wird deinem Vater gefallen und so nebenbei stellst du dann unauffällig die Frage nach den Zügen in der Früh.“
So wie Marcel es sagte, klang es auch für Gastons Ohren einfach. Aber dieser kannte seinen Vater nicht. Der kam abends nach Hause, ließ sich die Schuhe von den geschwollenen Füßen ziehen und setzte sich mit der Zeitung zum Ofen. Wenn seine Mutter etwas fragte, was sie nicht oft tat, bekam sie, solange er die Zeitung nicht ausgelesen hatte, als Antwort meistens nur eine knappes „Ja“, „Nein“, „Mach nur“ oder oft auch bloß ein desinteressiertes Knurren. Gaston konnte sich nicht vorstellen, dass es bei ihm anders sein würde. Nein, es wäre besser zu warten bis nach dem Abendessen. Da war sein Vater gesprächiger. Dann erzählte er gerne, was er gerade aus der Zeitung erfahren hatte. Ob er sich da auch in ein Gespräch über Züge verwickeln ließe? Es war so kompliziert. Gaston hätte gerne laut geseufzt, aber das traute er sich nicht.
„Du schaffst das schon“, flüsterte Thierry ihm zu, der es schade fand, dass er das nicht statt Gaston erledigen konnte.
„Das ist deine Aufgabe, Soldat, verstanden? Wir alle verlassen uns auf dich“, sagte Marcel.
Gaston sah, dass die anderen Jungen eifrig nickten.
„Ja“, stimmte er zögerlich zu und schluckte das „aber“ hinunter.
„Gut! Dann der nächste Punkt.“ Marcel wandte sich wieder allen zu. „Wir brauchen die richtigen Waffen, um den Zug außer Gefecht zu setzen. Robert und ich besorgen uns Zangen aus der Werkstatt meines Vaters. Damit werden wir die Signaldrähte durchschneiden. Ihr müsst eine Menge großer Steine sammeln, männerfaustgroße. Hinten im Wäldchen legen wir ein geheimes Munitionsdepot an. Ich zeige euch die Stelle. Mit diesen Steinen werden wir die Weichen blockieren. Außerdem müssen wir das Anschleichen üben und auch das Überwinden von Hindernissen und das Verstecken, falls man uns nachher verfolgt. Los geht’s!“
Er rannte los, ohne auf seine Soldaten zu warten. Diese blickten sich überrascht an und dann liefen sie hinter ihm her. Thierry versuchte, der Schnellste zu sein. Marcel sollte sehen, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, ihn in die Truppe aufzunehmen.
„Und das Gute ist“, erklärte Marcel selbstsicher, nachdem er seine Truppe eine Stunde lang im Wäldchen hinter der Abtei von Hunnegem über Stock und Stein gejagt hatte und nun alle um ihn herum auf der Erde saßen und sich ausruhten, „dass sie niemals Kinder verdächtigen werden. Denn deutsche Kinder sind feige. Deshalb kommen sie nicht auf die Idee, dass wir belgische Kinder den Mut mit der Muttermilch getrunken haben.“
Alle elf Jungen nickten eifrig, sogar Gaston. Beim Laufen und Schleichen und Ducken und Springen war er genauso gut wie die anderen gewesen. Marcel hatte ihn sogar ein paar Mal besonders gelobt.
„Vielleicht“, dachte Gaston überrascht über sich selbst, „ist das Soldatsein doch auch etwas für mich. Vielleicht steckt, ohne dass ich es ahne, tief in mir drinnen ein tapferes Soldatenherz, das bis zu dieser Stunde bloß noch nicht die Gelegenheit gehabt hat, sich zu zeigen.“
„Wir sind jetzt eine richtige Truppe“, verkündete Marcel großspurig, weil keiner an diesem Nachmittag an seiner Offiziersrolle gezweifelt hatte. „Wir werden alles vorbereiten und dann zuschlagen.“ Als hätte er bereits ein echtes Gewehr mit einem aufgesetzten Bajonett in der Hand, tat Marcel so, als würde er links und rechts vor ihm feindliche Soldaten erschießen. Robert fing unwillkürlich an zu kichern, weil es in seinen Augen so ausschaute, als ob sein Bruder wie eine Kuh mit ihrem Schwanz die Fliegen verscheuchte. Marcel fuhr zu ihm herum.
„Wenn du noch immer glaubst, dass wir hier nur die Soldaten spielen, irrst du dich. Dann kannst du jetzt gleich nach Hause gehen und an Mutters Rockzipfel hängen!“
„Nein, nein, Marcel!“ Robert schaute ihn erschrocken an. „Ich weiß, dass es kein Spiel ist, ehrlich. Schick mich nicht nach Hause. Ich will ein richtiger Soldat sein.“
„Dann benimm dich wie einer“, schimpfte Marcel, und, den anderen drohend, fügte er hinzu: „Glaubt vielleicht noch einer, dass wir bloß spielen wollen?“
Sie schüttelten alle heftig die Köpfe. Marcel ließ sie aufstehen und die Hand auf die Brust legen. „Wir“, sagte er, „wir sind die zwölf verwegensten Jungen Belgiens.“
„Wir sind die zwölf verwegensten Jungen Belgiens!“, wiederholten sie, und Thierry spürte, wie gut diese Worte taten. Er hatte das Gefühl, plötzlich um ein paar Zentimeter zu wachsen.
Mit erhobenen Häuptern liefen sie danach als geschlossene Gruppe hinter Marcel her zurück in die Innenstadt, quer über den Markt auf das Gebäude der Kommandantur zu. Es war ein Umweg, aber es musste so sein. In seiner Fantasie sah sich Marcel als Feldherr, der seine Männer furchtlos in das Herz des feindlichen Gebiets führte. Seiner Vorstellung nach sollte die Truppe im Gleichschritt mit schwingenden Armen wie echte Soldaten marschieren, aber das zu befehlen, traute er sich dann doch nicht.
Als sie auf Höhe der Kommandantur waren, drehte er sich kurz zu ihnen um und lächelte verschwörerisch. „Die haben keine Ahnung da drinnen, was ihnen blühen wird“, meinte das Lächeln. Thierry erwiderte es, und als sie weiterrannten, ließ er seine Füße ein bisschen fester als notwendig auf dem Straßenpflaster aufstampfen.
An diesem Abend fragte Thierry Großvater nicht, ob er auf sein Zimmer gehen durfte. Nein, er holte sein Buch von oben und setzte sich zu ihm in den Salon.
Während Großvater seine Illustrierte Zeitung studierte – eine deutsche Zeitung, denn man müsse alle Seiten der Berichterstattung kennen, um sich ein ausgewogenes Urteil über etwas bilden zu können, hatte Großvater ihm erklärt –, tat Thierry, als würde er lesen. In Wahrheit jedoch konnte er nur an das denken, was Marcel ihnen nachmittags erklärt hatte. Sobald sie erfuhren, wann ein Zug in aller Frühe voll mit Soldaten an Geraardsbergen vorbeifahren würde, würden sie in der Nacht davor die Signaldrähte durchschneiden und die Weichen mit Steinen blockieren. Das war ganz allein Marcels Idee gewesen. Kein Erwachsener hatte seine Finger dabei im Spiel gehabt.
Thierry warf einen Blick auf seinen Großvater. Dieser schien in den letzten Wochen kleiner geworden zu sein, kleiner und älter. Ihm wurde klar, dass er auf Großvater nicht böse sein musste. Er war nicht feige, sondern einfach zu alt, um noch gegen die Deutschen zu kämpfen. Das war jetzt Thierrys Aufgabe geworden und nach dem Krieg – irgendwann mussten die Deutschen ihn verlieren – würde man ihn und die anderen Jungen dafür ehren. Dann würden sie zwischen den Kriegshelden stehen, die an der Front gekämpft hatten.
Thierry merkte erst, dass er seinen Großvater anlächelte, als dieser das Lächeln erwiderte. Rasch senkte er seinen Blick wieder in das Buch. Großvater sollte nicht anfangen, Fragen zu stellen.