
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Jungbrunnen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Niki ist intergeschlechtlich und sorgt sich darum viel weniger, als Nikis Eltern es tun. Eines Tages steht ein scheinbar Fremder vor der Tür und bringt in der Familie alles durcheinander. Niki geht der Sache auf die Spur und lernt so Onkel Raimund kennen. Neun Jahre war der im Gefängnis, ohne Kontakt zu seinem Bruder oder seiner Mutter, und ist nun einsam und unglücklich. Niki kümmert sich um Raimund – wissend, wie es ist, nicht der Norm zu entsprechen, zwischen den Stühlen zu sitzen und dem eigenen Gespür nicht immer trauen zu können. Dafür nimmt Niki sogar noch mehr Ärger mit dem eigenen Vater in Kauf, als sowieso schon in der Luft liegt. Ein Fußballspiel soll schließlich für gute Stimmung sorgen, doch bleibt Nikis Auftritt in einer reinen Mädchenmannschaft nicht unbemerkt. Und niemand anderer als Raimund setzt sich für Niki ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Rachel van Kooij
wurde 1968 in Wageningen in den Niederlanden geboren. Im Alter von zehn Jahren übersiedelte sie nach Österreich. Nach der Matura studierte sie Pädagogik und Heil- und Sonderpädagogik an der Universität Wien. Rachel van Kooij lebt in Klosterneuburg und arbeitet auch als Behindertenbetreuerin.
Folgende Bücher von Rachel van Kooij sind bei Jungbrunnen lieferbar: Der Kajütenjunge des Apothekers (2005), Klaras Kiste (2008), Menschenfresser George (2012, nur als E-Book), Die andere Anna (2014, nur als E-Book), Beim Kopf des weißen Huhns (2016), Herr Krähe muss zu seiner Frau (2019).
Gefördert durch
eISBN 978-3-7026-5993-6
1. Auflage 2024
Einbandgestaltung: vielseitig.co.at (Artwork: Silvia Wahrstätter)
© 2024 Verlag Jungbrunnen Wien
Alle Rechte vorbehalten – printed in Europe
Druck und Bindung: Florjančič, Maribor
Wir legen Wert auf nachhaltige Produktion unserer Bücher und arbeiten lokal und umweltverträglich: Unsere Produkte werden nach höchsten Umweltstandards gedruckt und gebunden. Wir verwenden ausschließlich schadstofffreie Druckfarben und zertifizierte Papiere.
Rachel van Kooij
Niemand so wie ich?
Jungbrunnen
Inhalt
1. Ein Fremder
2. Nur ein paar Worte
3. Ein Niemand
4. Pizza
5. Auf dem Bahnhof
6. Nächstenliebe
7. Einfach nur Niki
8. Kaminfeuer im Hochsommer
9. Ein Blatt Papier mit schwarzem Rand
10. Fotos
11. Wir reden nicht darüber
12. Donut und Kaffee
13. Zwei Leben
14. Papa
15. In der Zwickmühle
16. Der Mörderonkel
17. Die ganze Geschichte
18. Kind bleibt Kind
19. Schnecken
20. Anruf aus dem „Grünen“
21. Der Weltwanderer
22. Die Hundert-Euro-Wette
23. Morgen wieder
24. Ein Zimmer für Oma
25. Ayers Rock
26. Das Feuer
27. Auswählen
28. Häkeln
29. Stricken
30. Noch eine geteilte Pizza
31. Der Fußballverein
32. Katis Plan
33. Training
34. Eislaufmutter am Fußballplatz
35. Platzwechsel
36. Ausfallschritt
37. Halbzeit
38. Schnecki
39. Mädchenmannschaft
40. Hassen?
41. Ein böser Onkel
42. Onkel Raimund hinter mir
43. Oma und die Zeitung
44. Ser
45. Das Neue Blatt
46. Sowohl als auch
47. Zehn Jahre waren lange genug
1. Ein Fremder
Das erste Mal, als ich ihn sah, stand er vor der Haustür, viel zu nah, ein wenig nach vorne gebeugt und schwer atmend, als wären die wenigen Meter durch unseren kleinen Vorgarten ein steiler Berghang, den er sich mühsam hinaufgequält hatte.
„Ja?“, fragte ich und betrachtete ihn genauer.
Er trug einen grauen, zerknitterten Anzug. Das Jackett stand offen, und zwischen der Knopflochreihe und der Knopfreihe (ein Knopf fehlte, wie ich nebenbei feststellte) lugte ein dunkelblauer Rollkragenpullover hervor, der seinen Hals eng umschloss. Dabei war es Hochsommer und viel zu heiß für einen Anzug und einen Rollkragenpullover.
Überhaupt wirkte der Fremde altmodisch und ungebügelt, als hätte er seine Kleidung aus der Altkleidersammelbox neben dem Supermarkt gefischt.
Der Mann hüstelte, stellte den kleinen braunen Koffer neben sich auf die Betonplatte und nahm seinen Hut ab. Wie einen Schild hielt er ihn mit beiden Händen krampfhaft vor der Brust. Wer trug heutzutage noch Hut?
Der Mann war älter und hatte kurzes graues Haar, Falten im Gesicht und eine Knollnase, aus deren Löchern Härchen sprießten. Auf der einen Wange klebten zwei kleine Pflaster und die andere Wange war ziemlich stoppelig. Er hatte wohl versucht, sich zu rasieren, aber nach den Unfällen auf der linken Seite die rechte lieber bleiben lassen.
Vielleicht war er eigentlich nicht alt, sondern wirkte nur so. Alt, müde und traurig.
„Wir kaufen nichts“, sagte ich, als der Mann beharrlich schwieg. „Und wir geben auch nichts“, fügte ich hinzu, obwohl das in meinen Ohren gemein klang. Papa hatte mir das eingeschärft.
„Ich verdiene mein Geld im Schweiße meines Angesichts und wir müssen sparen, für später, für dich“, hatte er erklärt. Also rückte Papa nichts heraus, keinen Cent. Mama manchmal schon. Und das war gut so.
Ich war erst elf und von mir aus konnte alles so bleiben, wie es eben war. Aber jedes Mal, wenn ich das Papa sagte, schüttelte er den Kopf und antwortete ernst, dass ich in ein paar Jahren ganz anders darüber denken würde und dass er dafür sorgte, dass ich mich dann ganz unbekümmert für die eine oder die andere Richtung entscheiden könnte, egal, wie viel es kostete.
Bei Papa klang es immer so, als wäre ich ein Wegweiser, der noch nicht wusste, in welche Richtung er zeigen sollte. Und irgendwie stimmte das wohl auch, nur mit dem Unterschied, dass Papa offenbar immer daran denken musste, wie teuer es werden würde, mich in die richtige Position zu bringen, während ich mir die allermeiste Zeit keine großen Gedanken über die Richtung machte. Außer es hatte wieder einmal eine blöde Situation gegeben, wie vor zwei Jahren im Bad, als ich noch nicht kapiert hatte, dass es dumm war, blaue Badeshorts mit einem glitzernden gelben Bikinioberteil zu kombinieren.
„Mit so einem Outfit geht doch niemand ins Freibad“, hatte Vanessa aus meiner Klasse gesagt.
Kati hatte zurückgerufen, dass es auch dämlich sei, mit einer Sonnenbrille im Schatten zu liegen, und Julian hatte mir kumpelhaft in die Rippen geboxt und gesagt, solche Tussis wie Vanessa, die sogar beim Fußballtraining mit lackierten Fingernägeln auftauchten, seien einfach nur blöd.
Das tat gut, aber recht hatte Vanessa trotzdem, wie ich feststellte. Niemand im Freibad war so angezogen wie ich.
Wäre ich tatsächlich ein Wegweiser, würde Wort für Wort das draufstehen: Niemand so wie ich.
Das traf genau auf mich zu. So lange, bis ich meine Entscheidung traf und Papa das ersparte Vermögen der Familie Kallender ausgeben würde, damit ich so werden konnte wie alle anderen.
Auf jeden Fall machte sich Papa viel mehr Gedanken darüber als ich, und deshalb gab er kein Geld her, und deshalb sagte ich dem Fremden gehorsam, dass wir nichts zu geben hatten.
„Leider auch kein Wurstbrot“, fügte ich bedauernd hinzu, weil er so mager war und wahrscheinlich Hunger hatte. Aber Papa stand in der Küche und richtete das Abendessen. Da konnte ich nicht unauffällig zwei Brotscheiben abschneiden, dick mit Wurst und Käse belegen, einwickeln und aus der Küche spazieren.
„Vielleicht probieren Sie es bei der Nachbarin?“, schlug ich vor. „Die hat schon einmal einen Staubsauger von der Straße weg gekauft, weil der Vertreter ihr versprach, dass der Apparat alle Katzenhaare aus dem Teppich saugen könnte.“
Ich schaute auf den Koffer und überlegte, was dieser Mann anbieten konnte. Katzenfutter? Das würde er bestimmt bei Frau Hartling loswerden.
Der Mann hüstelte: „Ist mein …“ Er klang heiser. „Ist, ist Herr Kallender zu sprechen?“ Er sprach es richtig aus, mit einem kurzen A und deutlichem L. Das überraschte mich, denn die meisten ziehen das A in die Länge und die Witzbolde fragen, ob ich mit Vornamen vielleicht April oder Juli oder August heiße.
Ich finde das überhaupt nicht lustig. Man sollte keine Witze über etwas so Persönliches wie Namen oder Aussehen machen.
„Jakob Kallender?“, präzisierte der Mann.
Ich war verwirrt. Woher kannte dieser Fremde meinen Vater?
„Er, er steht in der Küche“, sagte ich. „Er macht Nudelsalat für das Abendessen.“ Als ob das eine äußerst heikle Tätigkeit wäre, die man unmöglich unterbrechen konnte. „Soll ich ihm etwas ausrichten?“
Irgendwie spürte ich, dass Papa keine Lust haben würde, mit diesem Fremden zu reden. Papa ist kein Mann der vielen Worte.
Der Fremde dachte kurz nach, dann setzte er abrupt seinen Hut wieder auf, packte den Koffer und wollte schon gehen, als er es sich plötzlich anders überlegte, den Koffer wieder abstellte, den Hut vom Kopf nahm und in den Händen drehte.
„Ich muss, bitteschön, ich muss wirklich einen kurzen Moment mit Herrn Kallender sprechen“, stotterte er. „Bitte, nur eine Minute oder zwei.“
In diesem Augenblick kam Mama die Treppe herunter und sah mich bei der offenen Tür stehen. Sie hatte geduscht und roch frisch und blumig. „Wer ist es denn?“, fragte sie.
„Ein Mann.“
„Ein Mann?“ Mamas Stimme klang misstrauisch. „Was will er?“ Und bevor ich antworten konnte, dass er Papa sprechen wollte, hatte sie mich zur Seite gedrängt.
Letztes Jahr im Winter waren völlig unerwartet und natürlich uneingeladen zwei Reporter auf der Schwelle gestanden, mit Kamera und Mikrofon.
„Zum Glück“, hatte mir Mama nachher gesagt, „hast nicht du den beiden geöffnet, sondern ich.“
Und: „Zweitausend Euro haben sie geboten, für ein Bild von dir und ein Interview. Ich habe sie zum Teufel geschickt.“
Und: „Keine Ahnung, wer da blöd geplaudert hat“, hatte sie auch gesagt.
Es war übrigens nicht so, dass wir ein richtiges Geheimnis aus meiner Situation machten, aber an die große Glocke hängten wir es auch nicht. Nach meiner Geburt hatten Mama und Papa die Sache zuerst einmal für sich behalten. Auf meinem Geburtskärtchen, das sie verteilt hatten, steht bloß: „Wir sind überglücklich über Niki, unser erstes Kind.“ Jetzt wussten es die meisten unserer Freunde, aber den Rest der Welt ging es nichts an.
2. Nur ein paar Worte
Mama starrte den Mann abweisend an. Der schien unter ihrem Blick noch krummer und älter zu werden.
„Ja, bitte?“ Mama klang so eisig, dass niemand sich getraut hätte, sie überhaupt um etwas zu bitten, nicht einmal um ein Glas Wasser.
Der Mann packte wieder seinen Koffer, und mit einem unendlich traurigen Seufzer wandte er sich zum Gehen.
Aber auch wenn in Mamas Stimme die Eiszapfen geklirrt hatten, ihr Herz war nicht tiefgefroren. „Entschuldigen Sie“, rief sie dem Mann schuldbewusst nach. „Was wollen Sie denn?“
Der Mann blieb mitten auf dem Weg zwischen Haustür und Gartentor stehen.
Er drehte sich langsam um.
„Meine Handtasche“, sagte Mama rasch zu mir, als er zögernd zurückkam.
Ich gab sie ihr. Sie öffnete den Schnappverschluss und holte die Geldbörse heraus.
„Ich kann Ihnen zehn Euro geben, hilft Ihnen das?“, fragte sie eifrig und hielt ihm auch schon den Geldschein hin. Den Arm ganz ausgestreckt, so wie ich es tat, wenn ich das Pferd auf der Koppel am Ende der Straße mit unserem alten Brot fütterte. Es hatte riesige Zähne, und ich fürchtete mich jedes Mal aufs Neue, dass es viel lieber in meine rosigen Finger als in das harte Brot beißen würde.
„Er möchte Papa sprechen“, mischte ich mich ein. Obwohl er wie ein Bettler aussah, hatte er mich nicht um Geld gebeten, und es war mir peinlich, dass Mama ihm diese zehn Euro entgegenstreckte.
Niemand wird gerne für einen Bettler gehalten.
„Papa sprechen?“, wiederholte Mama. Sie trat einen Schritt näher heran, runzelte die Stirn.
Der Mann räusperte sich. „Ja, bitte. Nur einen Augenblick. Herr Kallender wohnt doch hier?“, fragte er unsicher.
„Ja, mein Mann wohnt hier“, antwortete Mama steif.
Der Fremde stellte den Koffer wieder neben sich und streckte seine Hand aus. Die Finger hatten gelbbraune Flecken.
Mama stopfte den Geldschein zurück in die Börse und ließ den Taschenverschluss zuschnappen, gleichzeitig tat sie so, als sähe sie die ausgestreckte Hand nicht.
Der Mann zog sie rasch zurück.
„Entschuldigen Sie, ich habe ein lausiges Namensgedächtnis“, sagte er und lächelte zaghaft. „Marlies, nein, Lisbeth, oder?“ Er hatte eine Zahnlücke in der oberen Reihe. Ich kannte keine Erwachsenen mit Zahnlücken, und auch Oma hatte ich nie ohne ihr Gebiss gesehen.
„Wir kennen uns?“ Mamas Gesichtsgedächtnis ist auch nicht sonderlich gut.
„Du hattest immer einen Pferdeschwanz“, hatte sie einmal als Entschuldigung zu einer Klassenkollegin gesagt, als diese sie bei einer zufälligen Begegnung auf der Straße herzlich begrüßt und Mama sie nicht erkannt hatte.
Das Lächeln des Mannes erstarb. „Ja, wir haben uns allerdings nicht sehr oft gesehen. Das, das lag eher an mir und es ist, wie gesagt, lange her und – ich habe mich wohl zu sehr verändert“, stotterte er.
Ich konnte Mama ansehen, dass sie sich bemühte, den Fremden zu erkennen, es ihr aber nicht gelingen wollte.
„Wie gesagt, ich möchte nicht stören, nur einen kurzen Augenblick mit Jakob Kallender sprechen.“
So verworren, wie der Mann sprach, und so ungepflegt, wie er aussah, wusste ich, dass Papa bestimmt nicht mit ihm reden wollte. Wenn ich mit Papa unterwegs war, machte er immer einen großen Bogen um Straßenmusikanten, Zeitungsverkäufer, Jugendliche mit rasierten Köpfen, Obdachlose … Eigentlich machte er um ziemlich viele Menschen einen großen Bogen, um jeden, der ein bisschen anders aussah.
Zum Glück machte er um mich keinen Bogen. Er war der beste Papa, den man sich wünschen konnte. Vielleicht half es ihm auch zu wissen, dass mein Anderssein nicht für immer bleiben musste. Und vielleicht sparte er deshalb so eisern, damit ich nachher wirklich äußerlich so aussehen könnte wie alle anderen auch.
„Wir werden uns den besten Chirurgen leisten, damit jeder Millimeter genau richtig wird“, versprach er mir oft. „Wir machen das auf jeden Fall privat, nicht über die Krankenkasse.“
Das alles ging mir durch den Kopf, so dass Mama mich zweimal auffordern musste, Papa aus der Küche zu holen.
„Nur ein paar Worte“, sagte der Mann ängstlich. „Wirklich nur ein paar Worte. Mehr nicht.“
3. Ein Niemand
„Nein“, sagte Papa in dem Augenblick, als er den fremden Mann sah.
„Jakob“, sagte der Fremde mit zittriger Stimme.
Papa schlug ihm die Tür vor der Nase zu.
Mama und ich starrten Papa verdattert an.
Der riss die Tür sofort wieder auf und schrie: „Verschwinde von hier! Ich habe dich nicht gebeten herzukommen, oder? Das ist mein Leben, meine Familie, mein Haus und du machst mir nicht noch einmal alles kaputt!“
Papa war rot im Gesicht und beim Schreien sprühten kleine Tropfen aus seinem Mund. Dann schmiss er die Tür ein zweites Mal zu.
„So was!“
Und: „Was glaubt der eigentlich!“
Und: „Wie kann er es nur wagen!“
Und: „Hat uns schon einmal ruiniert!“ Lauter halbe Sätze, die ich überhaupt nicht verstand.
Papa schaute uns an. Aber er schien uns nicht richtig zu sehen, als wären wir durchsichtig.
Er schwieg.
„Jakob? War das etwa …?“ Mama legte ihre Hand auf seinen Unterarm.
Papa zuckte zusammen.
„War er das?“, fragte Mama. „Nach all den Jahren steht er …“
„Niemand war das“, unterbrach er sie. „Absolut niemand.“
„Niemand?“
„Ja, niemand“, sagte Papa knapp. „Niemand, mit dem einer von uns auch nur irgendetwas zu tun haben möchte.“
Er ließ uns stehen und marschierte in die Küche zurück.
„Ekelhaft“, hörte ich ihn schimpfen und dann folgte ein Geräusch, das nur bedeuten konnte, dass er den Nudeltopf vom Herd genommen und den Inhalt mitsamt Wasser in die Mülltonne gegossen hatte.
Wir liefen in die Küche.
„Sieben Minuten“, belehrte Papa uns. „Sieben Minuten müssen sie kochen und nicht länger. Ist sonst nicht mehr zu essen. Der Appetit ist mir jetzt sowieso vergangen.“
Er setzte sich an den Küchentisch und raufte sich die Haare, bis ihn Mama an der Schulter packte.
„Wir reden darüber“, sagte sie streng. Ich wusste nicht genau, ob sie die Nudeln in der Mülltonne meinte – Mama hasste es, wenn Essen weggeworfen wurde – oder Papas Benehmen an der Haustür.
Papa seufzte laut, und es klang genauso wie der traurige Seufzer des fremden Mannes.
„Jakob, du musst mir das jetzt erklären. War er das?“
Wer? Das wollte ich auch wissen. Ich setzte mich an den Tisch. „Er hat unseren Namen richtig ausgesprochen, ist euch das aufgefallen?“, sagte ich.
Mama schaute zu mir und dachte dabei offensichtlich an etwas anderes. Dann ließ sie die Handtasche aufschnappen, holte aus ihrer Geldbörse den Zehneuroschein und sagte: „Du gehst dir etwas zu essen kaufen.“
Sie musste mir den Schein in die Hand stopfen, so überrumpelt war ich. Noch nie hatte sie mich einfach losgeschickt, um mir irgendwo irgendetwas zum Essen zu besorgen. Sie war eine gesunde Mutter und Fastfood stand ganz unten auf ihrer Liste möglicher Nahrungsmittel.
„Und du solltest auch noch ein bisschen auf den Spielplatz gehen“, fügte sie mit besorgtem Blick auf Papa hinzu.
Papa hatte inzwischen seinen Kopf einfach so neben den geschnittenen Paprika und den gewürfelten Tomaten auf den Küchentisch gelegt.
„Aber …“, wandte ich ein.
„Los“, befahl Mama. „Du wirst doch in der Lage sein, bei der Pizzeria um die Ecke eine Pizza zu kaufen und sie bei den Picknicktischen auf dem Spielplatz zu futtern. Verstanden?“
Natürlich hatte ich das verstanden und auch, dass sie mich nicht dabeihaben wollte, wenn sie sich Papa vorknöpfte.
4. Pizza
Ich öffnete vorsichtig die Haustür. Es hätte ja sein können, dass der Fremde noch immer mit seinem Koffer auf dem Gartenweg stand. Aber der Weg war leer. Und als ich auf der Straße nach links und nach rechts spähte, war auch keine Spur mehr von dem Mann zu sehen. Als hätte er sich mit seinem kleinen braunen Koffer in Luft aufgelöst.
Ich trabte zur Pizzeria und kaufte mir eine Margherita. Mit der Pizzaschachtel ging ich in den kleinen Park. Eigentlich ist es nur ein Rasen mit struppigen Büschen und einem Blumenbeet, auf dem ein Paar Picknicktische stehen. Links vom Rasenstück befindet sich die Wiese für die Hunde, rechts der Spielplatz. Beide Plätze sind eingezäunt, so dass Menschen, die Hunde und Kinder gleichzeitig besitzen, die einen auf dem Spielplatz und die anderen auf der Hundewiese frei herumlaufen lassen können und sich gemütlich auf eine der Bänke setzen können.
Auch jetzt, kurz vor sechs, waren zwei der drei Tische mit plaudernden Erwachsenen besetzt. Der dritte Tisch, der bei den Büschen, ist nicht beliebt, weil er ein wenig abseits steht und es dort komisch riecht.
„Nach Pisse“, hatte Kati, meine beste Freundin, festgestellt.
Da saß nur einer, also war noch Platz für mich und meine Pizza. Ich querte den Rasen und bemerkte erst unmittelbar vor dem Tisch, dass die Person, die dort saß, einen alten, grauen Anzug trug und neben sich auf dem Boden einen braunen Koffer abgestellt hatte. Es war der fremde, alte Mann, der meinen Papa nur einen Augenblick hatte sprechen wollen, und dem Papa die Tür direkt vor der Knollnase zugeschmissen hatte.
Der Mann schaute ernst und traurig zugleich. Ich traute mich nicht, an ihm einfach vorbeizugehen, als hätte ich nie vorgehabt, die Pizza an diesem Tisch zu essen. Ich senkte den Kopf, stellte die Schachtel an das andere Ende der Tischplatte und setzte mich im größtmöglichen Abstand von dem Mann hin.
Schnell aufessen und dann ab nach Hause, dachte ich und machte die Schachtel auf. Die Pizza war vorgeschnitten in acht gleich große, spitze Dreiecke. Eines hob ich heraus. Der Käse hing in langen Fäden seitlich herunter und meine Finger bekamen rote Flecken von der Tomatensauce. Ich beugte mich über die Schachtel. Tomatenflecken sind hartnäckig.
Es ist schwierig, mit den Händen Pizza zu essen, und wenn man sich dabei beobachtet fühlt, wird es nicht einfacher. Ich biss ab und die Sauce tropfte von meinem Kinn hinunter.
„Pizza Margherita“, sagte der Mann am anderen Ende des Tisches. „Eine Pizza Margherita aus der Schachtel habe ich zehn Jahre lang nicht gegessen.“
Ich schaffte es nicht, einen weiteren Bissen zu machen, so hungrig klang der Fremde.
„Zehn Jahre.“ Er lachte leise in sich hinein, als wäre es eigentlich unmöglich, zehn Jahre lang keine Pizza aus einer Schachtel zu essen.
Vor zehn Jahren war ich gerade einmal eins, ging es mir durch den Kopf. Ich schob ihm die Schachtel hin. „Bitteschön“, murmelte ich. Seltsamerweise fühlte ich mich nach diesem einen Bissen so satt, als hätte ich die gesamte Pizza gegessen.
„Ich sollte nicht“, sagte der Mann, und nach einigem Zögern fügte er hinzu: „Dein Vater würde es nicht wollen.“
Er hatte mich also erkannt. Ich lächelte verlegen. Ob er es mir übelnahm, dass ich einen Vater hatte, der ihm mit der Tür beinahe die Nase zertrümmert hatte?
„Sie können sie haben, wirklich“, versicherte ich ihm.
„Nein, es ist besser, wenn du sie selbst isst. So kommen wir beide nicht in Schwierigkeiten“, betonte er und schob die Schachtel wieder zu mir. „Und Schwierigkeiten sind das Letzte, was ich verursachen möchte.“
Ich schaute ihn an, aber er starrte weiter auf die Pizza.
„Papa muss es nicht erfahren“, sagte ich mit Nachdruck und gab der Schachtel wieder einen Schubs in seine Richtung.
„Ein Stück“, gab der Mann nach. Schon hatte er ein Dreieck in der Hand und stopfte es sich in den Mund, während die andere Hand automatisch nach einem zweiten Stück griff. Er kaute, schluckte, kaute, schluckte.
Er aß, bis die Schachtel leer war, sogar mein angebissenes Stück.
„Danke“, sagte er. „Danke sehr. Ich habe nicht gewusst, wie sehr man das vermissen kann.“
Ich schob ihm die Mineralwasserflasche zu, die man in der Pizzeria bekommt, wenn man eine Pizza zum Mitnehmen kauft.
Er nahm sie wortlos und trank.
„Danke“, sagte er wieder, als auch die Flasche leer war.
„Bitte“, murmelte ich.
„Jetzt gehst du besser nach Hause“, meinte der Mann.
„Und Sie?“, fragte ich.
Der Mann schwieg.
„Gehen Sie auch nach Hause?“
„Ja, natürlich“, sagte er, aber es klang gelogen, und als er aufstand, seinen Koffer nahm und sich langsam über den Rasen davonmachte, sah er nicht aus wie jemand, auf den ein Zuhause wartete.
5. Auf dem Bahnhof
Ich folgte ihm. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich neugierig war. Außerdem machte es mir Spaß, hinter ihm herzuschleichen, ihn zu beschatten, immer bereit, mich zwischen zwei parkenden Autos wegzuducken, wenn er sich umdrehen sollte.
Der Mann ging zum Bahnhof.
Natürlich, so dumm von mir, dachte ich. Er war gar nicht aus dieser Stadt. Deshalb der Koffer. Er war angereist, weil er irgendetwas mit Papa hatte besprechen wollen. Und jetzt musste er unverrichteter Dinge den Zug zurück nehmen.
Beinahe wäre ich wieder umgekehrt, um selbst nach Hause zu laufen. Aber ich tat es nicht. Vielleicht, weil jemand, der einen Zug erwischen möchte, nicht vorher hungrig auf einer Bank im Park sitzt, vielleicht, weil so einer auch nicht langsam und mit einem großen Umweg zum Bahnhof schlendert und dabei niemals auf die Uhr schaut.
Ich folgte ihm in die Halle. Er querte sie, ohne auch nur einen Blick auf die Anschlagtafel zu werfen. Er löste auch keinen Fahrschein bei einem der Automaten, sondern ging zielstrebig vorbei an den Rolltreppen und Stiegen, die zu den Gleisen führten, bis zum allerletzten Ende, wo sich die Toiletten befanden.
Er kramte umständlich in seiner Hosentasche nach einer Münze für das Drehkreuz und verschwand hinter der Tür der Männertoilette. Ich überlegte nicht lang und schlüpfte durch die Öffnung, die für Kinder bestimmt ist. Kinder müssen nicht zahlen, wenn sie müssen. Vorsichtig spähte ich in den weiß gefliesten Raum. Niemand bei den Waschbecken und auch nicht beim Pissoir. Er musste also in einer der beiden Klokabinen sitzen.
Es war komisch, aber ich ging nicht gerne auf Männerklos, wahrscheinlich wegen der Pissoirs. Sich nebeneinander hinstellen und gemeinsam pinkeln fand ich unmöglich.
Ich ging in die andere Kabine. Gerade rechtzeitig. Neben mir wurde die Spülung gezogen. Das Wasser gurgelte laut durch den Abfluss. Ich hörte die Tür aufgehen und Schritte zum Waschbecken.
Ich öffnete meine eigene Tür einen Spalt. Der Mann hatte den Koffer auf den Boden neben dem Waschbecken abgestellt und aufgeklappt.
Keine Dosen mit Katzenfutter, stellte ich fest. Er hätte also auch bei Frau Hartling keinen Erfolg gehabt. Der Mann schob zwei Bücher nach links, darunter lag ein Pyjama, weiß-blau gestreift. Gleich darauf hielt er einen Waschbeutel in der Hand, zippte ihn auf und holte Zahnbürste und Zahnpasta heraus.
Ich konnte es nicht glauben. Wer putzt sich die Zähne in einer Bahnhofstoilette? Das tat man abends zu Hause, bevor man schlafen ging.
Aber vielleicht hatte er ja tatsächlich kein Zuhause, ging es mir durch den Kopf. Kein Zuhause, um Abend zu essen, kein Zuhause, um sich zu waschen und Zähne zu putzen und eben auch kein Zuhause, um den Vorhang zuzuziehen und ins Bett zu schlüpfen.
Ich schloss leise meine Tür und setzte mich aufs Klo.
Was sollte ich tun? Was tat man, wenn man mit jemandem seine Pizza geteilt hatte und dann bemerkte, dass er nicht nur keinen Esstisch hatte, sondern auch keine Wohnung rundherum?
Papa sagte immer, mein eigenes Problem sei von einer solchen Dimension, dass ich mich nicht auch noch um die Wehwehchen und Sorgen anderer kümmern solle. Mama fand das nicht. Sie sagte, das sei eine selbstsüchtige Einstellung und dass sie mich nicht zu einem egoistischen Menschen erziehen wolle.
Sie konnten richtig darüber streiten, aber nur wenn sie glaubten, dass ich ihnen nicht zuhörte.
6. Nächstenliebe
Das half mir jetzt überhaupt nicht weiter. Es war ein Problem, wenn man eine Bahnhofstoilette als Badezimmer benutzen musste. Und es war sicher auch nicht genug gewesen, dass ich dem Fremden meine Pizza überlassen hatte. Er brauchte viel mehr und außer mir war keiner da, der das wusste.
Als ich hörte, wie der Mann den Toilettenraum verließ, kam ich aus meinem Versteck heraus und folgte ihm weiter.
Diesmal ging er die Rolltreppe hinunter zu den Gleisen eins und zwei, obwohl oben ein Schild deutlich darauf hinwies, dass wegen Gleisarbeiten überhaupt keine Züge von diesem Bahnsteig abfuhren.
Der Mann setzte sich auf eine Bank. Ich stellte mich hinter eine Litfaßsäule und beobachtete ihn.
Er hatte den Koffer auf die Bank gelegt und holte nun eines seiner beiden Bücher heraus. Er griff in die Innenseite seines Jacketts nach einer Lesebrille und fing an zu lesen.
Ich warf einen Blick auf die Bahnhofsuhr. Kurz vor sieben. Lange konnte ich hier nicht stehen bleiben. Ich musste nach Hause, sonst würden sich meine Eltern Sorgen machen. Wenn der Fremde wirklich vorhatte, auf dieser Bank zu schlafen, konnte ich ihn morgen ganz in der Früh wieder hier finden. Ich konnte ihm Frühstück bringen. Samstags standen meine Eltern erst spät auf. Sie würden gar nicht bemerken, wenn ich in der Küche ein Paar Brote schmierte und eine angefangene Packung Milch aus dem Kühlschrank mitnahm.
Bevor ich mir jedoch alles genau überlegt hatte, kam ein Mann in Uniform die Treppe herunter. Der Stationsvorsteher wahrscheinlich. Er sah mich nicht, sondern ging zielstrebig auf die Bank zu.
Er sprach so laut, dass ich alles verstehen konnte.
„Hier fährt kein Zug ab“, sagte er streng.
„Nein, Sie können hier nicht sitzen bleiben“, sagte er auch, und: „Nein, auch nicht, wenn Sie nur sitzen und lesen.“
Ich konnte nur vermuten, was der Fremde dazwischen antwortete, aber egal, was es gewesen war, er wurde mitsamt Koffer von der Bank vertrieben und das machte mich wütend. Es konnte dem Stationsvorsteher doch egal sein, ob jemand auf einem unbenutzten Bahnsteig saß und las. Es konnte ihm auch egal sein, ob dieser jemand, weil er kein Bett hatte, auf der Bank einschlief. Er nahm schließlich niemandem den Sitzplatz weg!
Mit seinem Koffer in der Hand schlurfte der Fremde an der Litfaßsäule vorbei zur Rolltreppe. Ich konnte ihm nur nachschauen, wie er hinauffuhr und verschwand. Ich fühlte mich miserabel.
„Und du?“
Eine Hand legte sich auf meine Schulter. Ich zuckte zusammen.
„Wo sind deine Eltern?“, fragte der Stationsvorsteher. Er musste sich angeschlichen haben.
„Zu Hause“, stotterte ich.
„Zu Hause wo? Musst du noch mit dem Zug irgendwohin fahren? Alle Züge, die sonst von hier abfahren, sind jetzt auf Gleis drei und vier. Hast du das nicht gelesen?“
„Doch“, sagte ich.
„Also wohin?“, fragte der Mann.
„Nirgendwohin“, gab ich kleinlaut zu.
„Und was treibst du dich dann hier herum?“ Seine Stimme klang genauso streng wie zuvor bei dem Fremden.
„Ich weiß nicht.“ Ich war eingeschüchtert.
„Dann nimm mal deine Beine in die Hand und verschwinde! Für einen Penner wie der vorhin bist du mir noch ein bisschen zu jung. So einen solltest du dir nicht als Vorbild nehmen!“
Ich nickte.
„Na, dann!“
„Der hat kein Zuhause, oder?“, fragte ich, statt dem auffordernden Blick zu gehorchen und zu gehen.
„Wer?“
„Der Mann auf der Bank. Ich habe ihn … beobachtet.“
Der Stationsvorsteher lachte. „Du hast Detektiv gespielt. Habe ich früher auch gerne gemacht.“
„Ja, der Mann – warum durfte er nicht auf der Bank sitzen bleiben?“, beharrte ich. „Da muss doch heute kein anderer mehr sitzen.“
„Der Penner?“ Der Stationsvorsteher schüttelte entrüstet den Kopf. „Wenn ich es einem erlaube, spricht es sich herum. Dann habe ich hier bald eine ganze Kolonie solcher Typen. Alles wird verdreckt und die Reisenden werden belästigt. Nein, mein Bahnhof ist Sperrgebiet für Penner. Die müssen sich einen anderen Platz suchen.“
„Und wohin geht so einer?“
„Keine Ahnung. Im Sommer meistens in den Park, die legen sich irgendwo in die Büsche.“ Er zuckte mit den Schultern. „Ist aber überhaupt nicht mein oder dein Problem, oder?“
„Nein“, gestand ich, obwohl es irgendwie doch mein Problem war. Wenigstens fühlte es sich so an. Denn es war eindeutig, dass es zwischen meinen Eltern und dem Fremden eine Verbindung, ein Geheimnis gab, von dem ich nichts wissen sollte. Ob sie es mir, wenn ich nach Hause kam, erzählen würden? Da war ich mir nicht so sicher. Aber wenn ich nun dem Fremden half, würde er es mir vielleicht selbst verraten.
„Gibt es denn gar keine andere Möglichkeit für so jemanden?“, hakte ich deshalb nach.
„Na ja, da gibt es schon Obdachlosenheime, aber viele wollen dort gar nicht hin, habe ich mal gehört.“
Obdachlosenheim – ob der Fremde dort hingehen würde? Irgendwie wirkte er nicht so, wie ich mir einen Obdachlosen vorstellte. Er hatte kein schmutziges, zerrissenes Gewand und er schleppte sein Zeug auch nicht in großen Plastiktaschen mit sich herum. Er schien mir mehr wie ein Reisender, dem unterwegs das Ziel abhandengekommen war.
„Und wenn er da nicht hinwill? Gibt es nichts anderes? Vielleicht ist er nicht richtig obdachlos, sondern kann nur gerade nicht nach Hause.“
„Du bist hartnäckig“, sagte der Stationsvorsteher. „Ehrlich gesagt fällt mir nur der Schlosskeller ein.“
Schlosskeller! Das klang schon besser.
„Was ist das?“
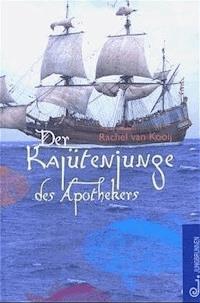



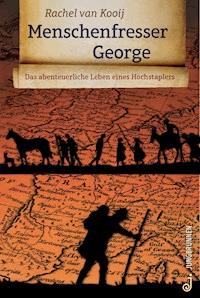
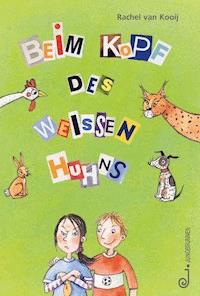













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









