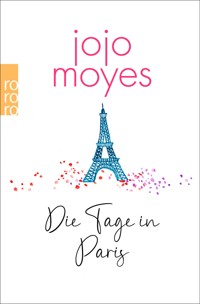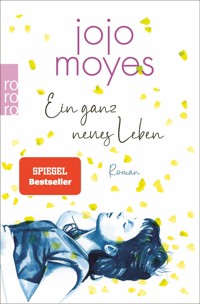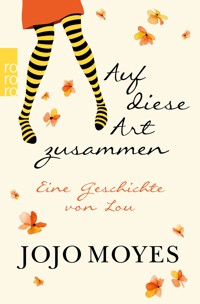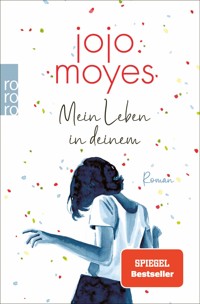Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine dramatische Liebesgeschichte aus der Feder von Bestsellerautorin Jojo Moyes über die Leidenschaft, die Worte entfachen können, und die Kraft einer Liebe, die Jahrzehnte und Schicksalsschläge überdauert. Prominent verfilmt - mit Shailene Woodley, Felicity Jones und Callum Turner. Als Jennifer Stirling 1960 in einem Krankenhausbett aufwacht, kann sie sich an nichts erinnern. Nicht an den tragischen Autounfall, der sie hierher gebracht hat, nicht an ihren Ehemann, noch nicht einmal an ihren eigenen Namen. Alles fühlt sich fremd an, bis sie auf einen leidenschaftlichen Liebesbrief stößt, unterschrieben nur mit "B", der sie bittet, ihren Mann zu verlassen. Jahrzehnte später fällt dieser Brief der jungen Journalistin Ellie in die Hände. Die geheimnisvolle Liebesgeschichte rührt Ellie zutiefst. Gab es ein Happyend für die Liebenden? Das Happyend, das sie sich für ihr eigenes Leben so dringend wünscht? Sie stellt Nachforschungen an und stößt auf eine Frau, die alles verloren hat. Alles, außer einer Handvoll kostbarer Worte.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jojo Moyes
Eine Handvoll Worte
Roman
Über dieses Buch
Du sollst wissen, dass du mein Herz in deinen Händen hältst.
1960. Jennifer Stirling müsste eigentlich glücklich sein: Sie führt ein sorgloses Leben an der Seite ihres wohlhabenden Mannes. Doch ihr Herz gehört einem anderen – und er bittet sie, alles für ihn aufzugeben.
2003. Ellie Haworth hat ihren Traumjob gefunden: Sie ist Journalistin bei einer der führenden Zeitungen Londons. Eigentlich müsste sie glücklich sein. Doch der Mann, den sie liebt, gehört einer anderen.
Eines Tages fällt Ellie im Archiv ein jahrzehntealter Brief in die Hände: Der unbekannte Absender bittet seine Geliebte, ihren Ehemann zu verlassen und mit ihm nach New York zu gehen. Als Ellie diese Zeilen liest, ist sie erschüttert. Was ist aus den beiden und ihrer Liebe geworden? Sie stellt Nachforschungen an und stößt auf Jennifer: eine Frau, die alles verloren hat. Alles, außer einer Handvoll kostbarer Worte.
Wer die Liebe nicht kennt, kennt nichts. Wer sie hat, hat alles.
«Ein großartiger, gefühlvoller und berührender Roman.» Sophie Kinsella
«Eine dramatische und romantische Geschichte von verschollenen Briefen, gebrochenen Herzen und der Hoffnung auf ein glückliches Ende.» Marie Claire
«Man bekommt richtig Lust, wieder einmal selbst einen Liebesbrief zu schreiben.» Glamour
«Ein hinreißend romantisches Buch, über das man fast seinen eigenen Liebsten vergisst.» Independent on Sunday
«Voller Emotionen und packend ab der ersten Seite.» Woman
Vita
Jojo Moyes, geboren 1969, hat Journalistik studiert und für die «Sunday Morning Post» in Hongkong und den «Independent» in London gearbeitet. Der Roman «Ein ganzes halbes Jahr» machte sie international zur Bestsellerautorin. Zahlreiche weitere Nr.-1-Romane folgten. Jojo Moyes lebt mit ihrer Familie auf dem Land in Essex.
Weitere Informationen zur Autorin
Erfahren Sie mehr über Jojo Moyes und entdecken Sie spannende Hintergrundinformationen und spannende Aktionen auf www.jojo-moyes.de
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel «The Last Letter From Your Lover» bei
Hodder & Stoughton/An Hachette UK Company.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2012 in der Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, Augsburg.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Last Letter from Your Lover» Copyright © 2010 by Jojo Moyes
Covergestaltung SO YEAH DESIGN, Gabi Braun
Coverabbildung Silke Schmidt
ISBN 978-3-644-52951-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Charles, der alles mit einer Notiz auf einem Stück Papier in Gang setzte
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Anbei dein Geburtstagsgeschenk, das dir hoffentlich gefällt …
Heute denke ich besonders an dich … weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass ich nicht in dich verliebt bin, obwohl ich dich liebe. Ich habe nicht das Gefühl, dass du der von Gott für mich Ausersehene bist. Trotzdem hoffe ich sehr, dass dir mein Geschenk gefällt und du einen wunderschönen Geburtstag hast.
Frau an Mann, per Brief
Prolog
Bis später x
Ellie Haworth hat ihre Freunde in der dichtgedrängten Menge entdeckt und bahnt sich einen Weg durch die Bar. Sie stellt die Tasche neben ihren Füßen ab und legt ihr Handy auf den Tisch. Die anderen sind schon ziemlich angeheitert – man merkt es an ihren lauten Stimmen, den ausholenden Armbewegungen, dem kreischenden Gelächter und den leeren Flaschen auf dem Tisch.
«Zu spät.» Nicky streckt ihr das Handgelenk mit der Armbanduhr entgegen und droht mit dem Zeigefinger. «Lass mich raten. Du musstest noch einen Artikel zu Ende schreiben!»
«Interview mit der betrogenen Ehefrau eines Abgeordneten. Tut mir leid. Es war für die Ausgabe morgen», sagt Ellie, lässt sich auf einen freien Stuhl fallen und schenkt sich aus einer angebrochenen Weinflasche ein Glas ein. Sie schiebt ihr Handy über den Tisch. «Okay. Das Unwort des Abends: ‹später›.»
«Später?»
«Als Schlussformel. Bedeutet das, er meldet sich morgen oder heute noch? Oder ist es nur so eine grässliche Floskel, die eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat?»
Nicky schaut auf das leuchtende Display. «Da steht ‹Bis später› und ein ‹x›. Das ist wie ‹Gute Nacht›. Ich würde sagen, es heißt morgen.»
«Auf jeden Fall morgen», sagt Corinne. «‹Später› heißt immer morgen.» Sie hält kurz inne. «Es könnte auch übermorgen bedeuten.»
«Jedenfalls klingt es sehr unverbindlich.»
«Unverbindlich?»
«Das könnte man auch dem Postboten schreiben.»
«Du würdest deinem Postboten einen Kuss schicken?»
Nicky grinst. «Kann schon sein. Er sieht toll aus.»
Corinne betrachtet die Nachricht auf dem Display. «Das ist nicht gerade fair. Es könnte doch einfach nur heißen, dass er in Eile war und noch etwas anderes vorhatte.»
«Ja. Mit seiner Frau zum Beispiel.»
Ellie wirft Douglas einen warnenden Blick zu.
«Was denn?», verteidigt er sich. «Ich meine ja bloß: Seid ihr nicht über den Punkt hinaus, an dem du stundenlang eine SMS dechiffrieren musst?»
Ellie kippt ihren Wein herunter und beugt sich dann über den Tisch. «Okay. Ich brauche noch was zu trinken, wenn ich mir jetzt Vorträge anhören muss.»
«Wenn du mit jemandem so vertraut bist, dass du in seinem Büro Sex mit ihm hast, dann solltest du ihn doch bitten können klarzustellen, wann ihr euch zum Kaffee trefft.»
«Was steht denn sonst noch in der SMS? Und sag mir jetzt bitte nicht, es geht um Sex in seinem Büro.»
Ellie schaut auf ihr Handy und scrollt durch die Textnachricht. «‹Schwierig, von zu Hause anzurufen. Dublin nächste Woche, Planung aber noch nicht sicher. Bis später x.›»
«Er hält sich alles offen», sagt Douglas.
«Außer die genaue Planung ist wirklich noch nicht sicher.»
«Dann hätte er gesagt ‹Rufe aus Dublin an›. Oder auch ‹Ich fliege mit dir nach Dublin›.»
«Nimmt er seine Frau mit?»
«Macht er nie. Das ist eine Geschäftsreise.»
«Vielleicht nimmt er eine andere mit», murmelt Douglas in sein Bierglas.
Nicky schüttelt nachdenklich den Kopf. «Mein Gott, war das Leben nicht einfacher, als die Männer dich noch anrufen und mit dir sprechen mussten? Da konnte man wenigstens am Klang ihrer Stimme erkennen, woran man war.»
«Ja», schnaubt Corinne. «Und man konnte stundenlang zu Hause neben dem Telefon sitzen und darauf warten, dass sie anrufen.»
«Oh, all die Abende, die ich damit zugebracht habe …»
«… das Freizeichen zu prüfen …»
«… und dann den Hörer aufzuknallen für den Fall, dass er genau in diesem Augenblick doch anruft.»
Ellie hört sie lachen und weiß, dass ihre Scherze einen wahren Kern haben, denn insgeheim wartet auch sie darauf, dass das Display plötzlich aufleuchtet, weil jemand anruft. Aber dieser Anruf wird in Anbetracht der späten Uhrzeit und des Umstands, dass es gerade «schwierig zu Hause» ist, nicht kommen.
Douglas begleitet sie heim. Er ist der Einzige von ihnen, der mit jemandem zusammenlebt, doch Lena, seine Freundin, macht als Pressesprecherin in einem Technologieunternehmen Karriere und ist abends oft bis zehn oder elf im Büro. Lena hat nichts dagegen, wenn er mit seinen alten Freundinnen ausgeht – sie hat ihn ein paarmal begleitet, aber für sie ist es schwer, die Wand aus Insiderwitzen und Anspielungen zu durchbrechen, die sich in fünfzehn Jahren Freundschaft aufgebaut hat; meistens lässt sie ihn deshalb allein kommen.
«Und was gibt es bei dir Neues?» Ellie stupst ihn an, während sie einem Einkaufswagen ausweichen, den jemand auf dem Bürgersteig vergessen hat. «Du hast überhaupt nichts von dir erzählt. Es sei denn, ich habe alles verpasst.»
«Nicht viel», sagt er und zögert. Er schiebt die Hände in die Hosentaschen. «Na ja, eigentlich stimmt das nicht ganz. Ähem … Lena will ein Kind.»
Ellie schaut zu ihm auf. «Wow.»
«Und ich auch», fügt er hastig hinzu. «Wir sprechen seit Ewigkeiten darüber, aber jetzt haben wir entschieden, dass wir es auch gleich hinter uns bringen können, der perfekte Zeitpunkt kommt eh nie.»
«Du alter Romantiker.»
«Ich … freue mich darauf … ehrlich. Lena wird ihren Job behalten, und ich werde mich zu Hause um das Kind kümmern. Vorausgesetzt natürlich, dass alles gutgeht und …»
Ellie versucht, ihrer Stimme einen neutralen Klang zu geben. «Und das möchtest du auch so?»
«Ja. Mir gefällt mein Job ohnehin nicht. Schon seit Jahren nicht mehr. Sie verdient ein Vermögen. Ich glaube, es wird ganz nett, den ganzen Tag mit einem Kind herumzuhängen.»
«Elternschaft ist ein bisschen mehr als nur herumhängen …», beginnt sie.
«Das weiß ich. Vorsicht … auf dem Bürgersteig.» Sacht steuert er sie um einen Hundehaufen herum. «Aber ich bin dazu bereit. Ich muss nicht jeden Abend in den Pub. Ich freue mich auf die nächste Phase meines Lebens. Das soll nicht heißen, dass ich nicht gern mit euch ausgehe, aber manchmal habe ich mich schon gefragt, ob wir nicht alle … verstehst du … ein bisschen erwachsener werden sollten.»
«O nein!» Ellie gibt ihm einen Klaps auf den Arm. «Du bist zur dunklen Seite übergewechselt.»
«Na ja, mir geht es mit meinem Job nicht so wie dir. Dir bedeutet er alles, oder?»
«Fast alles», gesteht sie.
Schweigend gehen sie weiter, lauschen den Sirenen in der Ferne, zuschlagenden Autotüren und anderen gedämpften Geräuschen der Stadt. Ellie gefällt dieser Teil des Abends, das Gefühl von Freundschaft; für einen Augenblick spielt es keine Rolle, wie ungeklärt die Dinge sonst in ihrem Leben sind. Sie hat einen schönen Abend im Pub hinter sich und wird zu ihrer gemütlichen Wohnung gebracht. Sie ist gesund. Sie hat eine Kreditkarte, Pläne fürs Wochenende, und sie ist die Einzige unter ihren Freundinnen, die noch kein graues Haar auf ihrem Kopf entdeckt hat. Das Leben ist schön.
«Denkst du jemals an sie?», fragt Douglas.
«An wen?»
«Johns Frau. Glaubst du, sie weiß es?»
Schon ist Ellies Glücksgefühl verschwunden. «Das weiß ich nicht.» Und als Douglas schweigt, fügt sie hinzu: «Ich bin mir sicher, wenn ich an ihrer Stelle wäre, wüsste ich es. Er sagt, die Kinder sind ihr wichtiger als er. Ich rede mir ein, sie ist im Grunde ihres Herzens froh, dass sie sich um ihn keine Gedanken machen muss. Darum, ihn glücklich zu machen, verstehst du?»
«Das ist jetzt aber Wunschdenken.»
«Kann sein. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann lautet die Antwort nein. Ich denke nicht an sie, und ich fühle mich nicht schuldig. Weil ich glaube, es wäre nicht passiert, wenn sie glücklich miteinander gewesen wären oder … verstehst du … verbunden.»
«Ihr Frauen habt wirklich merkwürdige Ansichten über Männer.»
«Also denkst du, er ist glücklich mit ihr?» Sie sieht ihn forschend an.
«Das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass er unglücklich mit seiner Frau sein muss, um mit dir zu schlafen.»
Die Stimmung ist umgeschlagen, vielleicht lässt Ellie deshalb seinen Arm los. «Du hältst mich für einen schlechten Menschen. Oder ihn.»
Jetzt ist es ausgesprochen. Dass dieser Gedanke ausgerechnet von Douglas kam, dem unvoreingenommensten unter ihren Freunden, versetzt ihr einen Stich.
«Ich halte niemanden für schlecht. Ich denke nur an Lena und daran, was es für sie bedeuten würde, mein Kind zu bekommen und dann von mir betrogen zu werden, nur weil sie sich dafür entschieden hat, meinem Kind die Aufmerksamkeit zu schenken, die ich für mich beanspruche …»
«Also hältst du ihn doch für einen schlechten Menschen.»
Douglas schüttelt den Kopf. «Es ist bloß …» Er bleibt stehen und schaut in den Abendhimmel, bevor er antwortet. «Du solltest vorsichtig sein, Ellie. All diese Versuche, zu interpretieren, was er meint, was er will, das ist doch bescheuert. Du verschwendest deine Zeit. Meiner Erfahrung nach ist es im Grunde ganz einfach. Jemand mag dich, du magst ihn, ihr werdet ein Paar, und damit hat es sich auch schon.»
«Du lebst in einem schönen Universum, Doug. Schade nur, dass es mit dem echten Leben nichts zu tun hat.»
«Okay, lass uns das Thema wechseln. Blöde Idee, so was nach ein paar Drinks anzusprechen.»
«Nein.» Ihr Ton wird schärfer. «In vino veritas und so. Alles in Ordnung. Wenigstens weiß ich jetzt, was du wirklich denkst. Und von hier aus kann ich allein weitergehen. Grüß Lena von mir.» Die letzten beiden Straßen bis zu ihrem Haus legt sie im Laufschritt zurück, ohne sich noch einmal nach ihrem alten Freund umzudrehen.
Die Nation wird Kiste für Kiste eingepackt, um in das moderne, verglaste Gebäude an einem neu bebauten Kai im Osten der Stadt umzuziehen. Das alte Büro ist von Woche zu Woche leerer geworden: Wo sich einst Presseerklärungen, Akten und archivierte Zeitungsausschnitte türmten, sind nur noch abgeräumte Schreibtische, unerwartet glänzende Kunststoffoberflächen, dem kalten Schein der Neonröhren ausgesetzt. Andenken an vergangene Reportagen sind ans Tageslicht gekommen wie archäologische Beutestücke bei einer Ausgrabung, Flaggen von königlichen Jubiläen, verbeulte Metallhelme aus fernen Kriegen und gerahmte Urkunden für längst vergessene Auszeichnungen. Überall liegen Kabel herum, Teile des Teppichs wurden herausgerissen, große Löcher in die Decken geschlagen, was theatralische Auftritte von Gesundheits- und Sicherheitsexperten und unzählige Besucher mit Klemmbrettern unterm Arm nach sich gezogen hat. Die Bereiche Werbung, Kleinanzeigen und Sport sind schon an den Compass Quay umgesiedelt worden. Das Samstagsmagazin und das Ressort Wirtschaft & Finanzen bereiten sich auf ihren Umzug in den nächsten Wochen vor. Die Abteilung für Reportagen, für die Ellie arbeitet, wird dann zusammen mit den Nachrichten folgen, und zwar in einer so sorgfältig geplanten Aktion, dass die Samstagsausgabe noch in den alten Büros an der Turner Street entstehen wird, die Montagsausgabe aber wie durch Zauberei schon an der neuen Adresse.
Das Gebäude, in dem die Zeitung fast hundert Jahre untergebracht war, sei nicht mehr zweckdienlich, hat es geheißen. Der Geschäftsleitung zufolge spiegelt es die dynamische, stromlinienförmige Natur moderner Nachrichtenerfassung nicht wider. Es hat wohl zu viele Stellen, an denen man sich verstecken kann, bemerken die Journalisten schlecht gelaunt, während sie von ihren Plätzen gepflückt werden wie Napfschnecken, die sich hartnäckig an einen durchlöcherten Stängel klammern.
«Wir sollten es feiern», ruft Melissa, die Chefin von Ellies Ressort, aus ihrem fast leeren Büro. Sie trägt ein weinrotes Seidenkleid. An Ellie würde es aussehen wie das Nachthemd ihrer Großmutter; bei Melissa sieht es nach dem aus, was es ist – Haute Couture.
«Den Umzug?» Ellie wirft einen Blick auf ihr Handy, das stumm geschaltet neben ihr liegt. Die Kollegen um sie herum schweigen, die Notizblöcke auf den Knien.
«Ja. Gestern Abend habe ich mit einem der Archivare gesprochen. Er sagte, es gibt jede Menge Akten, in die jahrelang niemand einen Blick geworfen hat. Ich möchte etwas von früher auf den Frauenseiten bringen, etwas von vor fünfzig Jahren. Wie hat sich das Lebensgefühl seither verändert, die Mode, das, womit Frauen sich beschäftigen? Wir machen eine Gegenüberstellung: damals und heute.» Melissa schlägt eine Mappe auf und zieht verschiedene Fotokopien im A3-Format heraus. Sie spricht mit der Selbstsicherheit eines Menschen, der es gewohnt ist, dass man ihm zuhört. «Zum Beispiel aus unserem Kummerkasten: Was kann ich nur tun, damit meine Frau sich schicker anzieht und attraktiver zurechtmacht? Mein Einkommen beträgt 1500 Pfund jährlich, und ich fange gerade an, mich in einem Handelsunternehmen hochzuarbeiten. Ich werde sehr oft von Kunden eingeladen, aber in den letzten Wochen musste ich ihnen stets absagen, weil meine Frau, ehrlich gesagt, unmöglich aussieht.»
Rundum wird leise gelacht.
«Ich habe versucht, es ihr schonend beizubringen, aber sie sagt, sie mache sich nichts aus Mode oder Schmuck oder Make-up. Offen gestanden, sieht sie nicht aus wie die Frau eines erfolgreichen Mannes – aber genau das wünsche ich mir von ihr.»
John hat Ellie einmal erzählt, seine Frau habe nach der Geburt der Kinder das Interesse an ihrem äußeren Erscheinungsbild verloren. Er wechselte das Thema, kaum dass er es angeschnitten hatte, als hätte er das Gefühl, seine Worte wären ein noch größerer Betrug als mit einer anderen Frau zu schlafen. Ellie ärgerte sich über diesen Anflug von ritterlicher Loyalität, doch gleichzeitig bewunderte sie ihn ein wenig dafür.
Aber es hat ihre Phantasie angeregt. Sie hat seine Frau vor sich gesehen: Schlampig gekleidet in einem fleckigen Nachthemd, ein kleines Kind an sich gedrückt, steht sie da und mäkelt an ihm herum. Am liebsten hätte Ellie ihm gesagt, sie würde ihn nie so behandeln.
«Diese Fragen könnte man auch einer modernen Kummerkastentante stellen.» Rupert, Redakteur des Samstagsmagazins, beugt sich vor und späht auf die anderen Fotokopien.
«Da bin ich mir nicht so sicher. Hör mal, wie die Antwort lautet: Vielleicht ist Ihrer Frau nicht klar, dass sie Teil Ihrer Außenwirkung ist. Falls sie überhaupt über so etwas nachdenkt, sagt sie sich womöglich, dass sie als verheiratete Frau sicher und zufrieden ist, warum sollte sie sich also Mühe geben?»
«Ah», sagt Rupert. «Der sichere Hafen der Ehe.»
«Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so etwas bei einem jungen unverheirateten Mädchen, das sich verliebt, genauso rasch geschehen kann wie bei einer Frau, die sich in einer langjährigen Ehe eingerichtet hat. Gerade noch sieht sie aus wie aus dem Ei gepellt, kämpft heroisch um eine schmale Taille und gerade sitzende Nähte und ist sorgsam mit Parfüm bestäubt. Und dann muss nur irgendein Mann ‹Ich liebe dich› zu ihr sagen, und schon wird aus dem reizenden Mädchen eine zufriedene Schlampe.»
Einen Moment ertönt höfliches, anerkennendes Gelächter im Büro.
«Na, Mädels, wofür entscheidet ihr euch? Der heroische Kampf um die schlanke Taille oder die zufriedene Schlampe?»
«Ich glaube, ich habe vor kurzem einen Film mit diesem Titel gesehen», sagt Rupert. Sein Lächeln verschwindet, als er merkt, dass das Gelächter verstummt ist.
«Mit diesem Material können wir viel anfangen.» Melissa deutet auf die Mappe. «Ellie, kannst du heute Nachmittag ein bisschen recherchieren? Vielleicht findest du noch was. Wir blicken vierzig, fünfzig Jahre zurück. Hundert wären zu viel. Der Chefredakteur möchte, dass wir die Vergangenheit in einer Weise beleuchten, die unsere Leser anspricht.»
«Ich soll das Archiv durchforsten?»
«Ist das ein Problem?»
Nicht, wenn man gern in dunklen, mit schimmelndem Papier vollgestopften Kellern sitzt, welche von geistesgestörten Typen mit stalinistischer Denkweise bewacht werden, die offensichtlich seit dreißig Jahren kein Tageslicht mehr gesehen haben. «Ganz und gar nicht», verkündet Ellie strahlend. «Ich bin sicher, dass ich etwas finden werde.»
«Hol dir ein paar Praktikanten, die dich unterstützen, wenn du willst. Ich habe gehört, in der Moderedaktion sind wieder zwei.»
Bei dem Gedanken, den neuesten Trupp von Anna-Wintour-Verschnitten in die Untiefen der Zeitung hinabzuschicken, huscht ein Ausdruck boshafter Befriedigung über das Gesicht ihrer Chefin, doch Ellie bemerkt ihn nicht, sie hat nur einen Gedanken: Mist, da unten hat mein Handy keinen Empfang.
«Ach, übrigens, Ellie, wo warst du heute Morgen?»
«Wie?»
«Heute Morgen. Ich wollte, dass du den Artikel über Kinder und Trauerbewältigung umschreibst. Niemand wusste, wo du warst.»
«Ich habe ein Interview geführt.»
«Mit wem?»
Ein Experte für Körpersprache, denkt Ellie, hätte Melissas gleichmütiges Lächeln zu Recht als Zähnefletschen gedeutet.
«Mit einem Anwalt. Ein Informant. Ich hatte gehofft, etwas über Sexismus in Kanzleien herauszufinden.»
«Sexismus in the City. Klingt nicht sehr originell. Sieh zu, dass du morgen rechtzeitig an deinem Schreibtisch sitzt. Spekulative Interviews sind deine Privatsache. Ja?»
«Okay.»
«Gut. Ich möchte eine Doppelseite für die erste Ausgabe, die am Compass Quay erscheint. Etwas in der Richtung Plus ça change.» Sie kritzelt etwas in ihr ledergebundenes Notizbuch. «Freizeitbeschäftigungen, Alltagsprobleme, Werbeanzeigen … Bring mir noch heute Nachmittag ein paar Seiten, und wir schauen, was wir daraus machen können.»
«Wird erledigt.» Ellie lächelt am professionellsten von allen, als sie hinter den anderen das Büro verlässt.
Den heutigen Tag habe ich in einem neuzeitlichen Äquivalent des Fegefeuers verbracht, tippt sie und hält inne, um einen Schluck Wein zu trinken. Im Zeitungsarchiv. Sei froh, dass du dir nur Sachen ausdenkst.
Er hat ihr über seinen Hotmail-Account eine Nachricht geschickt. Er nennt sich Bürohengst; ein Scherz zwischen ihnen. Sie verschränkt die Beine unter ihrem Stuhl, wartet und versucht, den Computer kraft ihres Willens dazu zu zwingen, ihr eine Antwort zu schicken.
Du bist eine schreckliche Barbarin. Ich liebe Archive, lautet dann die Nachricht auf dem Bildschirm. Erinnere mich daran, dass ich dich bei unserem nächsten heißen Date mit in die British Newspaper Library nehme.
Sie grinst. Du weißt, wie man eine Frau glücklich macht.
Ich gebe mir die größte Mühe.
Der einzige halbwegs freundliche Archivar hat mir einen Riesenstapel lose Blätter gegeben. Nicht gerade eine spannende Bettlektüre.
Aus Angst, das könnte zu sarkastisch klingen, setzt sie ein Smiley an den Schluss und flucht, als ihr einfällt, dass John einmal einen Essay für die Literary Review geschrieben hat, in dem es darum ging, dass Smileys Sinnbild für alles seien, was mit der modernen Kommunikation nicht stimmt.
Das war ein ironisches Smiley, fügt sie hinzu und beißt sich in die Faust.
Moment. Telefon. Auf dem Bildschirm regt sich nichts mehr.
Telefon. Seine Frau? Er sei in einem Hotelzimmer in Dublin, mit Blick über das Wasser, hat er gesagt. Dir würde es gefallen. Was sollte sie dazu sagen? Dann nimm mich nächstes Mal mit? Zu anspruchsvoll. Da bin ich mir sicher? Klingt fast sarkastisch. Ja, hat sie schließlich geantwortet und dabei einen langen, ungehörten Seufzer ausgestoßen.
Ihre Freundinnen sagen, sie sei selbst schuld. Dem kann sie ausnahmsweise nicht widersprechen.
Sie hat ihn auf einem Literaturfestival in Suffolk kennengelernt. Sie hatte den Auftrag, dort einen Thrillerautor zu interviewen, der ein Vermögen verdient, seit er seine eher literarischen Ambitionen aufgegeben hat. Sein Name ist John Armour, und seine Hauptfigur, Dan Hobson, wirkt fast wie eine Karikatur altmodischer männlicher Eigenschaften. Sie hat ihn beim Lunch interviewt und eine fade Verteidigung des Genres erwartet, vielleicht ein wenig Nörgelei über das Verlagswesen – sie fand es bisher immer ziemlich ermüdend, Schriftsteller zu interviewen. Sie hatte mit einem dicklichen Mann mittleren Alters gerechnet. Doch der große, sonnengebräunte Mann, der sich dann vom Tisch erhob, um ihr die Hand zu schütteln, war schlank und sommersprossig und glich eher einem südafrikanischen Farmer als einem Buchautor. Er war witzig, charmant, selbstironisch und aufmerksam. Er drehte das Interview um, stellte ihr Fragen zu ihrer Person und legte ihr dann seine Theorien über den Ursprung von Sprache dar und darüber, dass Kommunikation immer kraftloser und hässlicher zu werden drohe.
Als der Kaffee kam, merkte sie, dass sie fast vierzig Minuten lang nichts notiert hatte.
«Aber mögen Sie nicht auch den Klang?», fragte sie, als sie das Restaurant verließen und zum Veranstaltungsort zurückgingen. Das Jahr neigte sich dem Ende zu, und die Wintersonne war bereits hinter den Gebäuden der ruhiger werdenden Hauptstraße untergegangen. Sie hatte zu viel getrunken und den Punkt erreicht, an dem sie nicht mehr nachdachte, bevor sie sprach. Sie hatte das Restaurant nicht verlassen wollen.
«Den Klang wovon?»
«Spanisch. Und vor allem Italienisch. Ich bin mir sicher, dass mir nur deshalb die italienischen Opern so gut gefallen und ich die deutschen nicht ausstehen kann. Diese vielen harten, gutturalen Laute.» Er dachte darüber nach, und sein Schweigen machte sie nervös. Sie stammelte: «Ich weiß, es ist furchtbar altmodisch, aber ich liebe Puccini. Mir gefallen die Gefühlswallungen, das gerollte R, das Stakkato der Worte …» Sie verstummte, als sie merkte, wie lächerlich hochtrabend sie sich anhörte.
Er blieb in einem Hauseingang stehen, blickte sich kurz um und wandte sich dann wieder ihr zu. «Ich mag keine Opern», sagte er. Dabei sah er sie direkt an. Als wollte er sie herausfordern. Tief in ihrem Inneren spürte sie, wie etwas nachgab. O Gott, dachte sie.
«Ellie», sagte er, nachdem sie fast eine Minute dort gestanden hatten. Zum ersten Mal sprach er sie mit ihrem Vornamen an. «Ellie, ich muss noch etwas aus meinem Hotelzimmer holen, bevor ich zum Festival zurückgehe. Möchtest du vielleicht mitkommen?»
Noch bevor er die Zimmertür hinter ihnen zumachte, fielen sie übereinander her, pressten sich aneinander, küssten sich gierig, während ihre Hände der drängenden, fieberhaften Choreographie des Ausziehens folgten.
Danach hat sie ihr Verhalten staunend als eine Art Aussetzer betrachtet. Hunderte Male hat sie die Szene vor ihrem geistigen Auge noch einmal ablaufen lassen, hat dabei die Bedeutung, das überwältigende Gefühl ausgeblendet und sich nur noch an Einzelheiten erinnert. Ihre Unterwäsche, unangemessen alltäglich, über einen Hosenbügler geworfen; wie sie danach auf dem Boden lagen unter der bunt gemusterten Hotelbettdecke und wahnsinnig kicherten; wie er später fröhlich und mit unangebrachtem Charme seinen Schlüssel bei der Empfangsdame abgab.
Zwei Tage später rief er an, als bei ihr die Euphorie jenes Tages gerade in ein vages Gefühl von Enttäuschung überging.
«Du weißt, dass ich verheiratet bin», sagte er. «Du liest ja meine Artikel.»
Ich habe alles gelesen, was ich bei Google über dich finden konnte, dachte sie.
«Ich war noch nie … untreu. Ich kann noch immer nicht ganz in Worte fassen, was passiert ist.»
Sie zuckte zusammen. «Ich gebe der Quiche die Schuld», scherzte sie.
«Irgendwas bewirkst du in mir, Ellie Haworth. Ich habe achtundvierzig Stunden lang kein Wort geschrieben.» Er machte eine Pause. «Du lässt mich vergessen, was ich sagen will.»
Dann bin ich verloren, dachte sie, denn in dem Augenblick, als sie seine Nähe gespürt hatte, seinen Mund auf ihrem, da hatte sie – trotz allem, was sie zuvor zum Thema verheiratete Männer gesagt hatte, trotz allem, was sie zuvor für richtig hielt – gewusst, dass es um sie geschehen sein würde, wenn er auch nur im Geringsten anerkannte, was zwischen ihnen passiert war.
Ein Jahr danach hatte sie noch immer nicht begonnen, nach einem Ausweg zu suchen.
Fast eine Dreiviertelstunde später ist er wieder online. In der Zwischenzeit ist sie aufgestanden, hat sich noch einen Drink gemacht, ist ziellos in der Wohnung herumgelaufen, hat ihre Haut im Badezimmerspiegel unter die Lupe genommen, dann verstreute Socken eingesammelt und in den Wäschekorb gesteckt. Sie hört das «Ping» einer neuen Nachricht und lässt sich auf ihren Stuhl fallen.
Tut mir leid. Sollte nicht so lange dauern. Hoffe, morgen reden zu können.
Keine Anrufe auf dem Handy, hat er gesagt. Handyrechnungen listen die einzelnen Verbindungen auf.
Bist du jetzt im Hotel?, tippt sie rasch. Ich könnte dich in deinem Zimmer anrufen. Das gesprochene Wort ist ein Luxus, eine seltene Gelegenheit. Aber, Gott, sie muss unbedingt seine Stimme hören.
Muss zu einem Dinner, meine Schöne. Tut mir leid – bin schon spät dran. Bis später x
Und weg ist er.
Sie starrt auf den leeren Bildschirm. Inzwischen wird er mit langen Schritten das Hotelfoyer durchqueren, die Empfangsdamen bezaubern und in einen Wagen steigen, der ihm von der Festivalleitung zur Verfügung gestellt wird. Heute Abend wird er beim Dinner eine Rede aus dem Stegreif halten und dann wie üblich der witzige, leicht schwermütige Gesprächspartner für alle sein, die so glücklich sind, mit ihm an einem Tisch zu sitzen. Er wird da draußen sein und sein Leben genießen, während sie das ihre anscheinend dauerhaft zum Stillstand gebracht hat.
Was zum Teufel macht sie da?
«Was zum Teufel mache ich da?», sagt sie laut und schaltet den Computer aus. Sie schreit ihren Frust an die Schlafzimmerdecke und wirft sich auf ihr großes, leeres Bett. Sie kann ihre Freundinnen nicht anrufen: Sie haben diese Gespräche schon zu oft über sich ergehen lassen, und sie kann sich denken, wie ihre Antwort lauten wird – wie sie nur lauten kann. Was Doug ihr gesagt hat, war schmerzhaft. Aber sie selbst würde jedem ihrer Freunde dasselbe sagen.
Sie setzt sich aufs Sofa und schaltet den Fernseher ein. Schließlich wirft sie einen Blick auf den Papierstapel neben sich, hievt ihn auf ihren Schoß und verflucht dabei Melissa. Ein Stapel Vermischtes, hat der Archivar gesagt, Artikel, die kein Datum tragen und keiner Kategorie zuzuordnen sind – «Ich habe keine Zeit, sie alle durchzusehen. Wir haben so viele Stapel wie diesen.» Er war der einzige Archivar da unten, der jünger als fünfzig war. Flüchtig hat sie sich gefragt, warum er ihr bisher noch nie aufgefallen ist.
«Schauen Sie, ob Sie davon irgendetwas gebrauchen können.» Er hat sich verschwörerisch vorgebeugt. «Und was Sie nicht wollen, werfen Sie einfach weg, aber sagen Sie nichts dem Chef. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, an dem wir es uns nicht mehr leisten können, jedes einzelne Blatt Papier zu überprüfen.»
Bald wird ihr klar, was er gemeint hat: Da sind einige Theaterrezensionen, die Passagierliste eines Kreuzfahrtschiffs, ein paar Speisekarten von diversen Festessen der Redaktion. Sie überfliegt sie und wirft hin und wieder einen Blick auf den Fernseher.
Es ist nichts dabei, das Melissa begeistern wird.
Jetzt blättert sie in einem Stapel, der nach Krankenakten aussieht. Ausschließlich Lungenkrankheiten, stellt sie abwesend fest. Hat irgendetwas mit Bergbau zu tun. Sie will den ganzen Kram schon in den Mülleimer werfen, als ihr Blick auf einen hellblauen Zipfel fällt. Sie zieht mit Zeigefinger und Daumen daran und bringt einen handbeschriebenen Umschlag zum Vorschein. Er ist geöffnet worden, und der Brief darin trägt das Datum 4. Oktober 1960.
Meine einzige, wahre Liebe,
was ich gesagt habe, war auch so gemeint. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der einzige Weg nach vorn darin besteht, dass einer von uns eine kühne Entscheidung trifft.
Ich bin nicht so stark wie du. Als ich dir zum ersten Mal begegnet bin, hielt ich dich für zerbrechlich, für jemanden, den ich beschützen muss. Jetzt ist mir klar, dass ich mich getäuscht habe. Du bist stärker als ich, kannst ein Leben mit dieser Liebe ertragen, die wir niemals ausleben dürfen.
Ich bitte dich, mich nicht wegen meiner Schwäche zu verurteilen. Ich kann das alles nur an einem Ort aushalten, an dem ich dich nie sehen werde, nie von der Möglichkeit gequält werde, dich mit ihm zu sehen. Ich muss irgendwo sein, wo es unumgänglich ist, dass ich dich in jeder Minute, jeder Stunde aus meinen Gedanken vertreibe. Das wird hier nie passieren.
Ich werde die Stelle annehmen. Am Freitagabend werde ich um 7:15 Uhr am Bahnhof Paddington sein, Gleis 4, und nichts auf der Welt würde mich glücklicher machen, als wenn du den Mut fändest, mit mir zu gehen.
Wenn du nicht kommst, werde ich wissen, dass das, was wir füreinander empfinden, nicht ganz ausreicht. Ich will dir keinen Vorwurf machen, Liebling. Ich weiß, die letzten Wochen haben dich unerträglich unter Druck gesetzt, und ich spüre diese Belastung deutlich. Ich verabscheue den Gedanken, ich könnte dich unglücklich machen.
Ich werde ab Viertel vor sieben auf dem Bahnsteig warten. Du sollst wissen, dass du mein Herz, meine Hoffnungen in deinen Händen hältst.
B
Ellie liest den Brief ein zweites Mal und stellt fest, dass ihre Augen sich unerklärlicherweise mit Tränen füllen. Sie kann den Blick nicht von der großen, geschwungenen Handschrift lösen; die Dringlichkeit der Worte berührt sie, auch wenn sie über vierzig Jahre verborgen waren. Sie dreht das Blatt um und sucht auf dem Umschlag nach Hinweisen. Der Brief ist adressiert an Postfach 13, London. Das könnte ein Mann oder eine Frau sein. Wie hast du dich entschieden, Postfach 13?, fragt sie im Stillen.
Dann steht sie auf, steckt den Brief vorsichtig wieder in den Umschlag und geht an ihren Computer. Sie öffnet die Mailbox und klickt auf «aktualisieren». Nichts seit der Nachricht, die sie um 19:45 Uhr erhalten hat.
Muss zu einem Dinner, meine Schöne. Tut mir leid – bin schon spät dran. Bis später x
Teil eins
Ich kann das alles nur an einem Ort aushalten, an dem ich dich nie sehen werde, nie von der Möglichkeit gequält werde, dich mit ihm zu sehen. Ich muss irgendwo sein, wo es unumgänglich ist, dass ich dich in jeder Minute, jeder Stunde aus meinen Gedanken vertreibe. Das wird hier nie passieren.
Ich werde die Stelle annehmen. Am Freitagabend werde ich um 7:15 Uhr am Bahnhof Paddington sein, Gleis 4, und nichts auf der Welt würde mich glücklicher machen, als wenn du den Mut fändest, mit mir zu gehen.
Mann an Frau, per Brief
Kapitel 1
1960
«Sie wacht auf.»
Ein schleifendes Geräusch, ein Stuhl wurde über den Boden gezogen, dann das helle Klicken von Ringen auf einer Vorhangstange. Zwei leise Stimmen.
«Ich hole Mr. Hargreaves.»
Während des kurzen Schweigens, das folgte, wurde sie sich langsam einer anderen Geräuschebene bewusst – Stimmen, durch die Entfernung gedämpft, ein vorbeifahrendes Auto: Eigenartig, es schien ein ganzes Stück unter ihr zu sein. Sie lag da und nahm alles in sich auf, ließ es Gestalt annehmen, ordnete ein Geräusch nach dem anderen seiner Quelle zu.
Plötzlich bemerkte sie den Schmerz. Er arbeitete sich in kleinen Etappen hoch: zunächst ihr Arm, ein scharfes Brennen vom Ellbogen bis zur Schulter, dann ihr Kopf, dumpf, unbarmherzig. Der Rest ihres Körpers tat so weh, wie zu dem Zeitpunkt, als sie …
Als sie …?
«Er kommt sofort. Wir sollen die Gardinen schließen.»
Ihr Mund war trocken. Sie presste die Lippen aufeinander und schluckte unter Schmerzen. Sie wollte um Wasser bitten, doch die Worte kamen einfach nicht. Sie öffnete die Augen einen Spaltbreit. Zwei undeutliche Schemen bewegten sich um sie herum. Jedes Mal, wenn sie glaubte, herausgefunden zu haben, was sie waren, bewegten sie sich wieder. Blau. Sie waren blau.
«Du weißt, wer gerade unten eingeliefert wurde, ja?»
Eine der Stimmen wurde leiser. «Eddie Cochranes Freundin. Die den Autounfall überlebt hat. Sie hat Songs für ihn geschrieben. Vielmehr im Gedenken an ihn.»
«Sie wird nicht so gut sein, wie er war, jede Wette.»
«Den ganzen Morgen hat sie Zeitungsleute bei sich gehabt. Die Oberschwester ist mit ihrem Latein am Ende.»
Sie konnte nicht verstehen, was sie sagten. Der Schmerz in ihrem Kopf war zu einem pochenden Geräusch geworden und wurde noch intensiver, bis sie nur noch die Augen schließen und darauf warten konnte, dass es aufhörte oder sie das Bewusstsein verlor. Dann kam das Weiß, brach über sie herein wie eine Woge. Dankbar stieß sie leise den Atem aus und ließ sich von ihm umfangen.
«Sind Sie wach, Liebes? Sie haben Besuch.»
Sie nahm eine flackernde Reflexion über ihr wahr, ein Trugbild, das sich schnell bewegte, hierhin und dorthin. Plötzlich erinnerte sie sich an ihre erste Armbanduhr, wie sie das Sonnenlicht mit dem Glasgehäuse an die Decke des Spielzimmers reflektiert und hin und her bewegt hatte, bis ihr kleiner Hund anfing zu bellen.
Da war das Blau wieder. Sie sah, wie es sich bewegte, begleitet von dem schleifenden Geräusch. Dann war eine Hand an ihrem Arm, ein kurzer, schmerzhafter Stich, bei dem sie aufschrie.
«Ein bisschen vorsichtiger mit dieser Seite, Schwester», schalt die Stimme. «Das hat sie gespürt.»
«Tut mir sehr leid, Mr. Hargreaves.»
«Der Arm muss noch einmal operiert werden. Wir haben ihn an mehreren Stellen genagelt, aber er ist noch nicht in Ordnung.»
Am Fußende ihres Bettes ragte eine dunkle Gestalt auf. Sie bot ihre ganze Willenskraft auf, um die Gestalt zu fixieren, doch wie bei den blauen Formen wollte es ihr nicht gelingen, und so ließ sie die Augen wieder zufallen.
«Sie können sich zu ihr setzen, wenn Sie wollen. Mit ihr sprechen. Sie kann Sie hören.»
«Wie sehen ihre … anderen Verletzungen aus?»
«Es wird Narben geben, fürchte ich. Besonders am Arm. Und sie hat einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen, daher kann es eine Weile dauern, bis sie wieder die Alte ist. Aber in Anbetracht der Schwere des Unfalls können wir wohl sagen, dass sie einigermaßen glimpflich davongekommen ist.»
Kurzes Schweigen.
«Ja.»
Jemand hatte eine Schüssel mit Obst neben sie gestellt. Sie hatte die Augen wieder geöffnet und richtete ihren Blick darauf, bis Form und Farbe sich verfestigt hatten und sie zufrieden begriff, dass sie erkannte, was es war. Weintrauben, dachte sie. Und noch einmal wälzte sie das Wort stumm in ihrem Kopf: Weintrauben. Das erschien ihr wichtig, als würde es sie in dieser neuen Realität verankern.
Dann waren die Trauben so schnell wieder verschwunden, wie sie gekommen waren, ausgelöscht von der dunklen, blauen Masse, die sich neben ihr niedergelassen hatte. Als diese näher an sie heranrückte, nahm sie schwachen Tabakgeruch wahr. Die Stimme, die dann ertönte, war zögernd, vielleicht sogar ein wenig verlegen. «Jennifer? Jennifer? Kannst du mich hören?»
Die Worte waren so laut, seltsam aufdringlich.
«Jenny, Liebes, ich bin’s.»
Sie fragte sich, ob man ihr noch einmal einen Blick auf die Weintrauben gewähren würde. Es erschien ihr notwendig, sie noch einmal zu sehen; kräftig, purpurrot, fest. Vertraut.
«Sind Sie sicher, dass sie mich hören kann?»
«Ziemlich, aber mag sein, dass sie die Kommunikation noch zu sehr erschöpft.»
Sie vernahm ein Murmeln, das sie nicht zu deuten wusste. Vielleicht hatte sie auch einfach nur den Versuch aufgegeben. Nichts schien klar. «Können … Sie …», flüsterte sie.
«Aber ihr Verstand ist nicht zu Schaden gekommen? Bei dem Unfall? Sie wissen sicher, dass es keine bleibenden …?»
«Wie gesagt, ihr Kopf hat einen ordentlichen Stoß abbekommen, aber medizinisch gesehen gibt es keinen Grund zur Sorge.» Papier raschelte. «Kein Bruch. Keine Hirnschwellung. Aber man kann das nicht immer vorhersehen, und jeder Patient reagiert anders. Sie müssen daher einfach ein wenig …»
«Bitte …» Ihre Stimme war ein kaum hörbares Murmeln.
«Mr. Hargreaves! Ich glaube, sie versucht tatsächlich zu sprechen.»
«… ich möchte …»
Ein verschwommenes Gesicht kam zu ihr herab. «Ja?»
«… sehen …» Die Weintrauben sehen, darum bettelte sie. Ich möchte einfach noch einmal die Weintrauben sehen.
«Sie möchte ihren Gatten sehen!» Die Schwester sprang auf. «Ich glaube, sie möchte ihren Gatten sehen.»
Es wurde still, dann beugte sich jemand zu ihr. «Ich bin hier, Liebes. Alles ist … alles ist in Ordnung.»
Der Körper zog sich zurück, und sie hörte, wie eine Hand ihm auf die Schulter klopfte. «Sehen Sie? Sie kommt schon wieder zu sich.» Wieder eine Männerstimme. «Schwester? Bitten Sie doch die Oberschwester, etwas zu essen für heute Abend zu organisieren. Nichts allzu Gehaltvolles. Etwas Leichtes, was gut zu schlucken ist … Vielleicht könnten Sie uns auch eine Tasse Tee bringen.» Sie vernahm Schritte, leise Stimmen, die sich neben ihr unterhielten. Gatte?, war ihr letzter Gedanke, bevor das weiße Licht sie wieder umfing.
Später, als man ihr sagte, wie lange sie im Krankenhaus gewesen war, konnte sie es kaum glauben. Die Zeit schien ihr zerstückelt, unbeherrschbar, kam und ging in chaotischen Klümpchen. Dienstag, Frühstückszeit. Jetzt war Mittwoch, Mittagessen. Offensichtlich hatte sie achtzehn Stunden geschlafen – das wurde missbilligend festgestellt, als wäre es unhöflich, so lange abwesend zu sein. Dann war Freitag. Wieder einmal.
Manchmal war es dunkel, wenn sie wach wurde. Dann schob sie den Kopf auf dem gestärkten weißen Kissen ein wenig höher und beobachtete die beruhigenden Bewegungen der Nachtwache; das leise Schlurfen der Schwestern, die auf den Fluren auf und ab liefen, hin und wieder ein gemurmeltes Gespräch zwischen einer der Schwestern und einem Patienten. Wenn sie wolle, könne sie an den Abenden fernsehen, sagten ihr die Schwestern. Ihr Mann zahle die Privatbehandlung – sie könne fast alles haben, was sie wolle. Sie sagte stets nein, danke. Auch ohne das unablässige Geplapper aus dem Kasten in der Ecke war sie durch die beunruhigende Informationsflut schon verwirrt genug.
Als die Wachperioden länger wurden und an Häufigkeit zunahmen, wurden ihr die Gesichter der anderen Frauen auf der Station langsam vertraut. Die ältere Frau zu ihrer Rechten, deren pechschwarze Haare mit viel Haarspray makellos zu einer starren Skulptur auf ihrem Kopf hochgesteckt waren: Ihre Gesichtszüge drückten unablässig milde, überraschte Enttäuschung aus. Sie hatte offensichtlich in einem Film mitgespielt, als sie jung war, und ließ sich dazu herab, jeder neuen Schwester davon zu berichten. Sie hatte eine Kommandostimme und bekam nur selten Besuch. Und da war die füllige junge Frau auf der gegenüberliegenden Seite, die in den frühen Morgenstunden leise weinte. Eine forsche ältere Frau – womöglich das Kindermädchen? – brachte jeden Abend für eine Stunde kleine Kinder zu ihr. Die beiden Jungen kletterten auf das Bett und klammerten sich an sie, bis die Kinderfrau ihnen sagte, sie sollten wieder herunterkommen, aus Angst, sie könnten ihrer Mutter «Schaden zufügen».
Die Schwestern nannten ihr die Namen der anderen Frauen, hin und wieder auch ihren eigenen, aber sie konnte sie nicht behalten. Sie vermutete, dass sie deswegen von ihr enttäuscht waren.
Ihr Gatte, wie ihn alle bezeichneten, kam an den meisten Abenden. Er trug einen gutgeschnittenen Anzug aus dunkelblauem oder grauem Wollstoff, drückte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange und setzte sich für gewöhnlich ans Fußende ihres Bettes. Fürsorglich sprach er über Belanglosigkeiten, fragte, wie ihr das Essen schmecke oder ob er ihr irgendetwas anderes schicken solle. Hin und wieder las er einfach nur eine Zeitung.
Er war ein gutaussehender Mann, vielleicht zehn Jahre älter als sie, mit hoher, gewölbter Stirn und ernstem Blick. Tief im Innern wusste sie, dass er wohl derjenige war, der zu sein er behauptete, dass sie tatsächlich mit ihm verheiratet war, aber es war verblüffend, nichts zu empfinden, obwohl alle ganz offensichtlich eine andere Reaktion von ihr erwarteten. Manchmal starrte sie ihn an, wenn er gerade nicht hinschaute, und wartete auf einen Anflug von Vertrautheit. Manchmal, wenn sie wach wurde, stellte sie fest, dass er dort saß, die Zeitung auf dem Schoß, und sie betrachtete, als ginge es ihm ähnlich.
Mr. Hargreaves, der Arzt, kam täglich, überprüfte ihre Krankenblätter, fragte, ob sie ihm den Tag, die Uhrzeit, ihren Namen nennen könne. Inzwischen konnte sie ihm die richtigen Antworten geben. Sie brachte es sogar fertig, ihm zu sagen, dass der Premierminister Mr. Macmillan hieß und wie alt sie war, siebenundzwanzig. Sie hatte jedoch Schwierigkeiten mit den Schlagzeilen in der Zeitung, mit Ereignissen, die stattgefunden hatten, bevor sie hier eingeliefert worden war. «Das wird schon wieder», sagte er dann und tätschelte ihr die Hand. «Versuchen Sie nicht, es zu erzwingen.»
Dann war da noch ihre Mutter, die kleine Geschenke mitbrachte, Seife, gutes Shampoo, Zeitschriften, als ob all das den richtigen Anstoß geben könnte, dass sie wieder zu der Person wurde, die sie offensichtlich einmal gewesen war. «Wir haben uns solche Sorgen gemacht, Jenny, Liebes», sagte sie und legte ihr eine kühle Hand an den Kopf. Es fühlte sich gut an. Nicht vertraut, aber gut. Gelegentlich begann ihre Mutter einen Satz und murmelte dann: «Ich darf dich nicht mit Fragen erschöpfen. Alles wird wiederkommen. Die Ärzte sagen das. Also musst du dich nicht sorgen.»
Sie sei nicht besorgt, wollte Jenny ihr sagen. In ihrer kleinen Seifenblase war es friedlich. Sie spürte nur eine vage Traurigkeit, dass sie nicht die sein konnte, die alle in ihr sahen. An diesem Punkt wurden ihre Gedanken dann zu verworren, und sie schlief unweigerlich wieder ein.
Schließlich wurde sie nach Hause entlassen, an einem Morgen, an dem es so kalt war, dass sich die Rauchfahnen über der Stadt wie kahles Geäst am hellblauen Winterhimmel abzeichneten. Inzwischen konnte sie hin und wieder durch die Station gehen und Zeitschriften mit den anderen Patienten austauschen, die mit den Schwestern plauderten und gelegentlich Radio hörten, wenn sie Lust dazu hatten. Ihr Arm war ein zweites Mal operiert worden und verheilte gut, wie man ihr sagte, obwohl die lange rote Narbe dort, wo sie die Platte eingesetzt hatten, sehr empfindlich war, und Jenny versuchte, sie unter einem langen Ärmel zu verbergen. Ihre Augen hatte man einem Test unterzogen, ihr Gehör war untersucht worden, ihre Haut war an den unzähligen, durch Glassplitter verursachten Schnittwunden verheilt. Die Prellungen waren verblasst, und die gebrochene Rippe und das Schlüsselbein waren so gut zusammengewachsen, dass sie im Liegen schmerzfrei die Position wechseln konnte.
Im Grunde genommen, behaupteten sie, sehe sie wieder aus «wie die Alte», als würde sie sich daran erinnern, wer das war, wenn man es nur oft genug wiederholte. Ihre Mutter durchwühlte unterdessen Stapel von Schwarzweißfotos, um Jennifer ihr altes Leben wieder in Erinnerung zu bringen.
Sie erfuhr, dass sie seit vier Jahren verheiratet war. Kinder gab es keine – aus dem Tonfall ihrer Mutter schloss sie, dass alle ein wenig enttäuscht darüber waren. Sie wohnte in einem sehr schicken Haus in einem sehr guten Stadtteil Londons, mit Haushälterin und Chauffeur, und jede Menge junger Damen leckten sich offensichtlich die Finger danach, nur halb so viel zu haben wie sie. Obwohl ihr Mann ein hohes Tier im Bergbau und oft unterwegs war, ging seine Hingabe an sie so weit, dass er seit dem Unfall mehrere sehr wichtige Geschäftsreisen verschoben hatte. Die Hochachtung, mit der das Krankenhauspersonal über ihn sprach, bewies ihr, dass er tatsächlich recht wichtig war, und sie vermutete, dass sie infolgedessen ebenfalls einen gewissen Respekt erwarten konnte, auch wenn ihr das widersinnig vorkam.
Niemand hatte darüber gesprochen, wie sie hierhergekommen war, aber einmal hatte sie einen verstohlenen Blick auf die Notizen des Arztes geworfen und wusste daher, dass sie einen Autounfall gehabt hatte. Als sie ihre Mutter danach gefragt hatte, war diese rot angelaufen, hatte ihre dicke kleine Hand auf Jennifers gelegt und sie gedrängt: «Denk nicht darüber nach, Liebes. Es war alles … furchtbar aufregend.» Ihre Augen hatten sich mit Tränen gefüllt, und da Jennifer sie nicht aus der Fassung bringen wollte, hatte sie das Thema fallenlassen.
Ein geschwätziges Mädchen mit einer aufwendigen Frisur in leuchtendem Orange war aus einer anderen Abteilung des Krankenhauses gekommen, um Jennifer die Haare zu schneiden. Danach, so sagte ihr die junge Frau, würde sie sich viel besser fühlen. Jennifer hatte am Hinterkopf Haare verloren – sie waren abrasiert worden, um eine Wunde nähen zu können –, und die junge Frau verkündete, sie wäre großartig darin, solche Wunden zu verbergen.
Eine gute Stunde später hielt sie triumphierend einen Spiegel hoch. Jennifer betrachtete die Frau, die ihr daraus entgegenstarrte. Ziemlich hübsch, dachte sie mit einer Art distanzierter Befriedigung. Zerschrammt, ein wenig blass, aber es ist ein annehmbares Gesicht. Mein Gesicht, verbesserte sie sich selbst.
«Haben Sie Ihre Kosmetika griffbereit?», fragte die Friseurin. «Ich könnte Sie schminken, falls Ihr Arm noch zu sehr weh tut. Ein bisschen Lippenstift tut jedem Gesicht gut, Madam.»
Jennifer starrte weiter in den Spiegel. «Meinen Sie?»
«O ja. Eine hübsche Frau wie Sie. Ich kann es sehr dezent machen … aber danach werden Ihre Wangen schimmern. Warten Sie, ich gehe mal eben runter und hole meinen Kosmetikkoffer. Ich habe ein paar herrliche Farben aus Paris bekommen und einen Charles-of-the-Ritz-Lippenstift, der ist wie für Sie geschaffen.»
«Sie sehen einfach reizend aus! Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn eine Dame anfängt, wieder Make-up zu tragen», sagte Mr. Hargreaves kurz darauf, als er seine Runde drehte. «Und, freuen wir uns darauf, nach Hause zu kommen?»
«Ja, danke», antwortete sie höflich. Sie hatte keine Ahnung, wie sie ihm beibringen sollte, dass sie nicht wusste, was dieses Zuhause war.
Einen Moment lang betrachtete er ihr Gesicht, vielleicht versuchte er abzuschätzen, wie groß ihre Verunsicherung war. Dann setzte er sich auf die Bettkante und legte ihr eine Hand auf die Schulter. «Ich verstehe, das alles muss ein wenig befremdlich wirken, Sie sind noch nicht ganz wieder Sie selbst, aber seien Sie nicht allzu beunruhigt, wenn vieles noch unklar ist. Nach einer Kopfverletzung kommt es häufig zu einer Amnesie. Sie haben eine Familie, die Sie unterstützt, und ich bin sicher, sobald Sie von vertrauten Dingen umgeben sind, Ihre alten Gewohnheiten wieder aufnehmen, Freunde treffen, einkaufen gehen und Ähnliches, werden Sie feststellen, dass alles wieder an seinen Platz rückt.»
Sie nickte folgsam. Sie hatte schnell herausgefunden, dass alle damit glücklicher waren.
«Ich würde Sie gern in einer Woche wiedersehen, damit ich die Heilung Ihres Arms überprüfen kann. Sie werden Physiotherapie brauchen, um ihn wieder voll einsatzfähig zu bekommen. Die Hauptsache ist aber, dass Sie sich einfach Ruhe gönnen und sich nicht allzu viele Sorgen machen. Verstehen Sie?»
Er war schon im Begriff zu gehen. Was hätte sie noch sagen können?
Ihr Mann holte sie am Abend ab. Die Schwestern hatten sich im Empfangsbereich aufgestellt, um sich von ihr zu verabschieden, makellos sauber in ihren gestärkten Schwesternschürzen. Sie war noch immer eigenartig schwach und unsicher auf den Beinen und nahm dankbar den Arm, den er ihr anbot.
«Vielen Dank für die Fürsorge, die Sie meiner Frau haben zukommen lassen. Schicken Sie die Rechnung bitte an mein Büro», sagte er zu der Oberschwester.
«Es war uns ein Vergnügen», erwiderte diese, schüttelte ihm die Hand und strahlte Jennifer an. «Es ist schön, Sie wieder gesund und munter zu sehen. Sie sehen wunderbar aus, Mrs. Stirling.»
«Mir geht es … viel besser. Danke.» Sie trug einen langen Kaschmir-Mantel und einen dazu passenden Pillbox-Hut. Er hatte ihr drei Kombinationen schicken lassen. Sie hatte sich für die unauffälligste entschieden; sie wollte keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Sie blickten auf, als Mr. Hargreaves den Kopf aus seinem Büro streckte. «Meine Sekretärin sagt, draußen stehen ein paar Zeitungsreporter – die wollen das Cochrane-Mädchen sehen. Vielleicht möchten Sie lieber den Hintereingang nehmen, um den Trubel zu vermeiden.»
«Das wäre vorzuziehen. Würden Sie bitte meinen Fahrer auf die andere Seite schicken?»
Nach Wochen in der Wärme der Station war die Luft draußen erschreckend kalt. Sie hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten, ihr Atem kam in kurzen Stößen, dann saß sie auf der Rückbank eines großen schwarzen Wagens, versunken in riesigen Ledersitzen, und die Türen fielen mit einem satten Klacken ins Schloss. Leise schnurrend fädelte sich der Wagen in den Londoner Verkehr ein.
Sie sah aus dem Fenster, betrachtete die Zeitungsleute, die auf der Vordertreppe standen, und die Fotografen, die ihre Objektive einstellten. In den Straßen Londons drängten sich die Menschen, sie eilten vorüber, die Mantelkragen gegen den Wind hochgeschlagen, die Männer hatten ihre Hüte tief in die Stirn gezogen.
«Wer ist das Cochrane-Mädchen?», fragte sie und wandte sich ihm zu.
Er sprach gerade leise mit dem Fahrer. «Wer?»
«Das Cochrane-Mädchen. Mr. Hargreaves hat von ihr gesprochen.»
«Ich glaube, sie war die Freundin eines populären Sängers. Sie waren in einen Autounfall verwickelt, bevor …»
«Alle haben über sie gesprochen. Die Schwestern im Krankenhaus.»
Anscheinend hatte er das Interesse verloren. «Ich setze Mrs. Stirling zu Hause ab, und sobald sie sich eingerichtet hat, fahre ich ins Büro», teilte er dem Chauffeur mit.
«Was ist ihm zugestoßen?», fragte sie.
«Wem?»
«Cochrane, dem Sänger.»
Ihr Gatte schaute sie an, als würde er etwas abwägen. «Er ist gestorben», sagte er. Dann wandte er sich wieder an seinen Fahrer.
Langsam ging sie die Stufen zu dem weißen Haus mit Stuckfassade hinauf, und als sie oben ankam, öffnete sich die Tür wie durch Zauberhand. Der Fahrer stellte ihren Koffer vorsichtig in der Diele ab und zog sich zurück. Ihr Gatte, hinter ihr, nickte einer Frau zu, die dort stand, offenbar um sie zu empfangen. Sie war schon älter, hatte das dunkle Haar zu einem festen Knoten im Nacken zusammengebunden und trug ein marineblaues Kostüm. «Willkommen zu Hause, Madam», sagte sie und streckte eine Hand aus. Ihr Lächeln war echt, und sie sprach mit deutlichem Akzent. «Wir sind ja so froh, dass es Ihnen wieder gutgeht.»
«Danke», erwiderte Jenny. Am liebsten hätte sie die Frau mit Namen angeredet, aber es war ihr unangenehm, danach zu fragen.
Die Frau nahm ihnen die Mäntel ab und verschwand damit durch den Flur.
«Bist du müde?» Er neigte den Kopf, um ihr Gesicht zu betrachten.
«Nein, ist schon gut.» Sie schaute sich im Haus um und wünschte, sie könnte ihre Bestürzung verbergen, denn ihr war, als hätte sie es nie zuvor gesehen.
«Ich muss jetzt wieder ins Büro. Kommst du mit Mrs. Cordoza allein zurecht?»
Cordoza. Das klang nicht ganz fremd. Eine Anwandlung von Dankbarkeit überkam sie. Mrs. Cordoza. «Ja, danke. Mach dir um mich bitte keine Sorgen.»
«Ich werde um sieben wieder hier sein … wenn du sicher bist, dass es dir gutgeht …» Offensichtlich hatte er es eilig fortzukommen. Er beugte sich zu ihr herunter, küsste sie auf die Wange und war nach einem kurzen Zögern verschwunden.
Sie stand in der Diele, hörte, wie sich seine Schritte auf der Treppe draußen entfernten, dann das leise Brummen des Motors, als sein Wagen abfuhr. Plötzlich kam ihr das Haus wie eine Höhle vor.
Sie berührte die seidige Tapete, nahm den glänzenden Parkettboden wahr, die schwindelerregend hohe Decke. Mit präzisen, überlegten Bewegungen zog sie ihre Handschuhe aus. Dann beugte sie sich vor, um die Fotos auf dem Dielentischchen näher zu betrachten. Das größte war ein Hochzeitsfoto in verziertem, auf Hochglanz poliertem Silberrahmen. Darauf war sie zu sehen in einem enganliegenden weißen Kleid, das Gesicht halb verdeckt von einem weißen Tüllschleier, ihr Ehemann mit breitem Lächeln an ihrer Seite. Ich habe ihn tatsächlich geheiratet, dachte sie. Und dann: Ich sehe so glücklich aus.
Sie fuhr zusammen. Mrs. Cordoza war zurückgekommen und stand mit verschränkten Händen vor ihr. «Ich habe mich gefragt, ob ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee bringen soll. Ich habe im Wohnzimmer den Kamin für sie angezündet.»
«Das wäre …» Jennifer warf einen Blick durch den Flur auf die verschiedenen Türen. Dann schaute sie erneut auf das Foto. Es dauerte einen Moment, bis sie wieder etwas sagte. «Mrs. Cordoza … würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich mich bei Ihnen unterhake? Nur bis ich sitze. Ich bin noch etwas unsicher auf den Beinen.»
Später konnte sie nicht genau sagen, warum sie nicht wollte, dass die Frau merkte, wie wenig ihr vom Grundriss ihres eigenen Hauses in Erinnerung war. Sie hatte einfach das Gefühl, wenn sie die Erinnerung vortäuschte und alle ihr glaubten, würde sich die gespielte Rolle am Ende als Wahrheit herausstellen.
Die Haushälterin hatte das Abendessen zubereitet: einen Auflauf aus Kartoffeln und Prinzessbohnen. Sie habe ihn im Backofen stehen lassen, sagte sie. Jennifer musste auf ihren Mann warten, bevor sie etwas auf den Tisch stellen konnte: Ihr rechter Arm war noch schwach, und sie hatte Angst, den schweren gusseisernen Topf fallen zu lassen.
Sie hatte die Stunde, in der sie allein war, damit verbracht, durch das geräumige Haus zu schlendern, sich damit vertraut zu machen. Sie hatte Schränke geöffnet und Fotos betrachtet. Mein Haus, sagte sie sich immer wieder. Meine Sachen. Mein Mann. Ein- oder zweimal schaltete sie ihre Gedanken aus und ließ sich von ihren Füßen dorthin tragen, wo sie ein Bad oder ein Arbeitszimmer vermutete, und stellte dankbar fest, dass ein Teil von ihr dieses Haus noch kannte. Sie betrachtete die Bücher im Wohnzimmer und bemerkte mit leiser Befriedigung, dass sie, obwohl ihr hier so vieles fremd war, den Inhalt von den meisten im Kopf hatte.
Am längsten hielt sie sich in ihrem Schlafzimmer auf. Mrs. Cordoza hatte ihren Koffer ausgepackt und alles eingeräumt. Zwei Einbauschränke enthielten eine große Anzahl akkurat gestapelter Kleidung. Alles passte ihr perfekt, selbst die abgetragensten Schuhe. Ihre Haarbürste, Parfüms und Puder standen aufgereiht auf einer Frisierkommode. Die Düfte waren ihr angenehm vertraut. Die Farben der Kosmetika passten zu ihr: Coty, Chanel, Elizabeth Arden, Dorothy Gray – ihr Spiegel war umgeben von einem kleinen Bataillon kostspieliger Cremes und Salben.
Sie zog eine Schublade auf, hielt Schichten aus Chiffon hoch, Büstenhalter und andere Miederware aus Seide und Spitze. Ich bin eine Frau, die auf ihr Äußeres Wert legt, stellte sie fest. Sie setzte sich, starrte sich im dreiteiligen Spiegel an und begann, sich die Haare in langen, gleichmäßigen Strichen zu bürsten. Solche Dinge tue ich, sagte sie sich mehrmals.
Immer, wenn sie von Fremdheit überwältigt wurde, beschäftigte sie sich mit kleinen Aufgaben: Sie ordnete die Handtücher in dem Gästebadezimmer im Erdgeschoss neu oder holte Teller und Gläser heraus.
Er kam kurz vor sieben Uhr wieder zurück. Sie wartete in der Diele auf ihn, hatte ihr Make-up aufgefrischt und Nacken und Schultern mit einem leichten Parfüm besprüht. Sie sah ihm an, dass ihm dieser Anschein von Normalität gefiel. Sie nahm ihm den Mantel ab, hängte ihn an die Garderobe und fragte, ob er etwas trinken wolle.
«Das wäre wunderbar. Danke», sagte er.
Sie zögerte, die Hand an eine Karaffe gelegt.
Er drehte sich um und bemerkte ihre Unsicherheit. «Ja, das ist es, Liebling. Whisky. Zwei Fingerbreit, mit Eis. Danke.»
Beim Abendessen saß er rechts von ihr an dem riesigen, polierten Mahagonitisch, der zum großen Teil leer und ungedeckt war. Sie verteilte das dampfende Essen auf Teller, und er stellte sie an die Plätze. Das ist mein Leben, dachte sie plötzlich, während sie seine Handbewegungen beobachtete. Das machen wir an den Abenden.
«Ich dachte, wir könnten am Samstag die Moncrieffs zum Essen einladen. Fühlst du dich dazu gut genug?»
Sie nahm einen kleinen Happen von ihrer Gabel. «Ich glaube, schon.»
«Gut.» Er nickte. «Unsere Freunde haben immer wieder nach dir gefragt. Sie möchten gern sehen, dass du … wieder ganz die Alte bist.»
Sie brachte ein Lächeln zustande. «Das wird … nett werden.»
«Ich dachte, wir unternehmen ein, zwei Wochen nicht zu viel. Erst, wenn dir danach ist.»
«Ja.»
«Das hier schmeckt sehr gut. Hast du es gekocht?»
«Nein. Mrs. Cordoza.»
«Aha.»
Schweigend aßen sie weiter. Sie trank Wasser – Mr. Hargreaves hatte von stärkeren Getränken abgeraten –, aber sie beneidete ihren Mann um das vor ihm stehende Glas. Der Alkohol hätte das beunruhigende Gefühl von Fremdheit vielleicht verschleiert, ihm die Schärfe genommen.
«Und wie läuft es in … deinem Büro?»
Er hatte den Kopf gesenkt. «Ganz gut. In den kommenden Wochen muss ich die Bergwerke besuchen, aber ich möchte sichergehen, dass du zurechtkommst, bevor ich fahre. Du hast natürlich Mrs. Cordoza, die dir hilft.»
Der Gedanke, allein zu sein, erleichterte sie ein wenig. «Ich bin mir sicher, dass ich es schaffe.»
«Und danach, dachte ich, könnten wir für ein paar Wochen an die Riviera fahren. Ich habe dort geschäftlich zu tun, und du könntest die Sonne genießen. Mr. Hargreaves meinte, sie würde deine … die Narben …» Er verstummte.
«Die Riviera», wiederholte sie. Plötzlich die Vision einer Küste im Mondschein. Gelächter. Das Klirren von Gläsern. Sie schloss die Augen und brachte all ihre Willenskraft auf, um das flüchtige Bild deutlicher werden zu lassen.
«Ich dachte, wir fahren diesmal mit dem Wagen hin, nur wir beide.»
Das Bild war verschwunden. Sie vernahm ihren Pulsschlag in den Ohren. Bleib ruhig, sagte sie sich. Alles kommt wieder. Mr. Hargreaves hat es gesagt.
«Du scheinst dort immer glücklich zu sein. Vielleicht ein wenig glücklicher als hier in London.» Er sah sie an und wandte dann den Blick ab.
Da war es wieder, das Gefühl, dass sie einer Prüfung unterzogen wurde. Sie zwang sich, zu kauen und zu schlucken. «Wie du meinst.»
Schweigen senkte sich über den Raum, man hörte nur noch das langsame Kratzen seines Bestecks auf dem Teller, ein erdrückendes Geräusch. Das Essen erschien ihr mit einem Mal nicht zu bewältigen. «Ich bin doch müder, als ich dachte. Würde es dir sehr viel ausmachen, wenn ich nach oben gehe?»
Er stand auf, als sie sich erhob. «Ich hätte Mrs. Cordoza sagen sollen, dass ein Abendessen in der Küche reicht. Soll ich dir hinaufhelfen?»
«Bitte, mach dir keine Umstände.» Sie schlug den ihr dargebotenen Arm aus. «Ich bin nur ein bisschen erschöpft. Morgen geht es mir bestimmt besser.»
Um Viertel vor zehn hörte sie, wie er ins Zimmer kam. Sie hatte im Bett gelegen und bewusst die Laken um sich herum wahrgenommen, das Mondlicht, das durch die langen Vorhänge drang, die fernen Geräusche des Verkehrs, die Taxis, die anhielten, um ihre Kunden abzusetzen, einen höflichen Gruß von jemandem, der einen Hund ausführte. Sie hatte ganz still gelegen und darauf gewartet, dass etwas einrastete, dass die Leichtigkeit, mit der sie sich physisch wieder in ihre Umgebung eingepasst hatte, allmählich zu ihrem Geist vordrang.
Dann war die Tür aufgegangen.
Er machte das Licht nicht an. Sie vernahm das Klappern von Holzbügeln, als er sein Jackett aufhängte, das leise Geräusch, als er die Schuhe von den Füßen streifte. Und plötzlich erstarrte sie. Ihr Mann – dieser Fremde – würde in ihr Bett kommen. Sie hatte sich so sehr darauf konzentriert, jeden einzelnen Augenblick zu überstehen, dass sie das nicht in Betracht gezogen hatte. Sie hatte damit gerechnet, dass er im Gästezimmer übernachten würde.
Sie biss sich auf die Lippe, die Augen fest geschlossen, und zwang sich, langsam zu atmen und so zu tun, als schliefe sie. Sie hörte, wie er im Bad verschwand, das Rauschen des Wasserhahns, heftiges Zähneputzen und kurzes Gurgeln. Auf bloßen Füßen tappte er über den Teppich und glitt dann unter die Decke, woraufhin die Matratze einsank und das Bettgestell protestierend knarrte. Eine Minute blieb er reglos liegen, und sie zwang sich, ihre gleichmäßigen Atemzüge beizubehalten. Oh, bitte, noch nicht, beschwor sie ihn still. Ich kenne dich kaum.
«Jenny?», fragte er.
Sie spürte seine Hand auf ihrer Hüfte und bemühte sich, nicht zusammenzufahren.
Er bewegte sie zaghaft. «Jenny?»
Sie stieß absichtlich einen langen Atemzug aus, um das unschuldige Vergessen des Tiefschlafs vorzutäuschen. Seine Hand hielt inne, und dann sank er, ebenfalls seufzend, schwer auf sein Kissen.