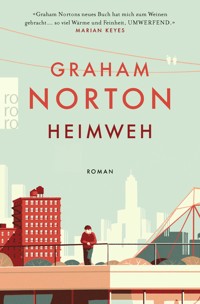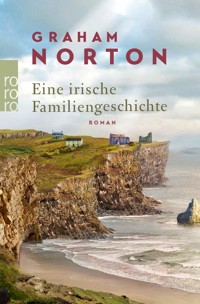
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein sehr irischer Familienroman voller Sehnsucht und voller Geheimnisse, ein Buch voller Dunkelheit und Licht. Elizabeth Keane kehrt zum ersten Mal seit Jahren in die irische Heimat zurück. Ihre Mutter ist gestorben, Elizabeth muss den Haushalt auflösen. Auch ihre Mutter Patricia hatte als junge Frau den Ausbruch gesucht, mit einem Verlobten, den keiner je zu Gesicht bekam. Monate später war sie zurückgekehrt. Ohne Mann, und mit einem Säugling im Arm. Wer ihr Vater war, hat Elizabeth nie erfahren. Doch dann findet sie unter den Hinterlassenschaften ihrer Mutter ein Bündel Liebesbriefe … Elizabeth macht sich auf die Suche. Ihr Weg führt zu einer windumtosten Farm am Fuße einer Burgruine über der rauen Keltischen See….
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Graham Norton
Eine irische Familiengeschichte
Roman
Über dieses Buch
Dies ist die Geschichte zweier Frauen. Elizabeth Keane kehrt zum ersten Mal seit Jahren in die irische Heimat zurück. Ihre Mutter ist gestorben, Elizabeth muss den Haushalt auflösen. Gerne tut sie das nicht; die Enge des Örtchens Buncarragh hat sie damals in die Flucht getrieben, nach New York, wo das Glück auch nicht auf sie wartete.
Schnell hat der Trübsinn der Heimat sie eingeholt, die Sprachlosigkeit, die über allem hängt. Auch ihre Mutter Patricia hatte als junge Frau den Ausbruch gesucht, mit einem Verlobten, den keiner je zu Gesicht bekam. Monate später war sie zurückgekehrt. Ohne Mann, wortlos und mit einem Säugling im Arm.
Wer ihr Vater war, hat Elizabeth nie erfahren. Doch dann findet sie unter den Hinterlassenschaften ihrer Mutter ein Bündel Briefe, handgeschrieben mit blauer Tinte und bebend vor Worten der Liebe.
Elizabeth macht sich auf die Suche. Ihr Weg führt an einen Ort, so wunderschön wie furchteinflößend einsam: Castle House, die windumtoste Farm am Fuße einer Burgruine über der rauen Keltischen See …
Ein Buch voller Sehnsucht und voller Geheimnisse, ein Buch voller Dunkelheit und Licht.
Vita
Graham Norton, Schauspieler, Comedian und Talkmaster, ist eine der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten der englischsprachigen Welt. Geboren wurde er in Clondalkin, einem Vorort von Dublin, aufgewachsen ist der Sohn einer protestantischen Familie aber im County Cork im Süden Irlands. Sein erster Roman «Ein irischer Dorfpolizist» überraschte viele durch seine Wärme und erzählerische Qualität, er avancierte in Irland und Großbritannien zum Bestseller, wurde mit dem Irish Book Award 2016 ausgezeichnet und wird nun auch zu einer Fernsehserie. «Möglicherweise war es Verschwendung, dass der Mann die ganzen Jahre im Fernsehen war», schrieb denn auch Bestsellerautor John Boyne in der «Irish Times».
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel «A Keeper» bei Hodder & Stoughton, An Hachette UK Company.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg bei Reinbek, April 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg bei Reinbek
«A Keeper» Copyright © 2018 by Graham Norton
Redaktion Katharina Naumann
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke und Cordula Schmidt
Umschlagabbildung Peter Bartels
ISBN 978-3-644-30049-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Jono
Zuvor
Er sehnte sich nach Stille. Das Brüllen des Windes verschmolz mit dem rauschenden Rhythmus der Wellen und erfüllte seinen Kopf. Jeden Morgen wachte Edward mit diesen Geräuschen auf, und wenn er am Abend mit schmerzenden Armen die Decke über sich zog, füllte derselbe Lärm seine Träume. Wann würde er Frieden finden?
Edward Foley kauerte auf dem kleinen Felsvorsprung, der Grenze zwischen der Wiese vor dem Haus und dem Meer. Wolken versteckten die Sterne und den Mond am Nachthimmel, wodurch sich die dunkle Haube aus Geräuschen noch undurchdringlicher anfühlte. Seine Tränen waren getrocknet, aber nun war sein Gesicht von dem salzigen Nebel aus Gischt benetzt, den die heranhämmernden Wellen versprühten. Hinter ihm waren gelegentlich Stimmen und das leise Schlagen einer Autotür zu hören.
Wenn er doch nur denken könnte. Er musste über die Zukunft nachdenken. Was sollte er als Nächstes tun? Niemand hätte ihn als jungen Mann bezeichnet, trotzdem konnte man sein Leben mit einundvierzig nicht für beendet erklären. Er dachte an seinen Bruder James, der vor langer Zeit von den Wellen verschlungen worden war. Er selbst hatte sich den Luxus aufzugeben nicht leisten können, aber genau das war es, was Edward jetzt wollte. Sitzen bleiben und seine Knie umklammern, bis die Flut kam und ihn mitnahm.
Durch das Prasseln des Regens und das Rauschen der Wellen hindurch hörte er einen Motor starten, und das nasse Gras um ihn herum leuchtete erst rot auf, dann blau. Er wandte den Kopf und sah, wie der Krankenwagen langsam auf dem Weg davonfuhr, am Obstgarten vorbei auf die Straße zu. Er kam sich so dumm vor. Welches Recht hatte er, Glück zu erwarten? Dies hier fühlte sich plötzlich an wie das Ende einer Geschichte, die schon vor langer Zeit für ihn geschrieben worden war.
Er stand auf und sah sich zum Haus um. Alle Lichter darin brannten, so sah es jedenfalls aus. Von einem Boot draußen auf dem Meer aus hätte man glauben können, sie feierten ein Fest. Hinter dem hellen Raster der Fenster konnte er den Schatten der Burgruine ausmachen, die dem Haus seinen Namen gab. Die unzähligen Jahrzehnte, in denen Foleys auf diesem Land gelebt hatten. So viel Geschichte, die nun nur noch an einem dünnen Faden an der Zukunft hing.
Er wusste, er sollte wieder hineingehen, aber er konnte den Gedanken nicht ertragen, seiner Mutter zu begegnen. Er stellte sich vor, wie sie am Küchentisch saß. Eine Tasse mit Untertasse vor sich. Sein Teebecher gegenüber. Ihr endloser Strom von Worten würde die Stille ausfüllen, aber es war ihr Gesicht, das ihm verraten würde, was sie wirklich dachte. Irgendwie war all das seine Schuld. Es wäre derselbe Gesichtsausdruck, mit dem sie ihn bedacht hatte, als James gestorben war. Ein Ausdruck, der besagte, dass sie ihn noch immer liebte, ihm aber niemals würde vergeben können.
Seine Mutter war keine Frau, die einen auf den Knien wippte oder an ihre tröstliche Brust zog, wenn einem alles zu viel wurde, aber sie war stark, einfallsreich und entschlossen. Er wusste, wenn er dies hier überstehen wollte, brauchte er sie. Er schlug seinen Kragen im heulenden Wind hoch und ging quer über das Feld auf die Lichter des Hauses zu. Eines war für ihn sicher.
Seine Mutter hatte einen Plan.
Jetzt
1
Zwei Weihnachtslichterketten hingen schlaff über der Hauptstraße. Sie schwangen verloren im strömenden Regen, manche Lichter rot, andere grün, die meisten schon kaputt.
Elizabeth Keane seufzte, als sie mit ihrem kleinen Mietwagen über die Brücke in die Stadt fuhr. Teilweise deshalb, weil der Nachtflug von New York nach Dublin sie erschöpft hatte, hauptsächlich aber wegen der Erinnerungen, die beim Anblick von Buncarragh an einem nassen Nachmittag in der ersten Januarwoche in ihr aufstiegen. Die schon vergessenen Geschenke, die letzten Quality-Street-Bonbons von der Sorte, die man nicht mochte und lustlos auf dem Boden der Dose herumschob, der längst verpuffte Neuigkeitswert der Fernsehfilme am Nachmittag. Jedes Haus war nur noch ein Wartezimmer für die bald wieder beginnende Schule. Sie fragte sich, ob sich in den zwanzig Jahren etwas verändert hatte, seit sie hier weggezogen war. Vermutlich nicht. Bestimmt tippten die Kinder alle auf ihren Telefonen herum, und obwohl es inzwischen Hunderte von Fernsehprogrammen gab, konnte sie die überhitzte Langeweile beinahe spüren, die aus den Reihenhäusern in den Nebenstraßen der Bridge Street strömte.
Sie war überrascht, wie kurz die Fahrt gedauert hatte. Als sie hier aufwuchs, war Dublin für sie eine weit entfernte Metropole gewesen. Doch jetzt, mit der funkelnagelneuen Schnellstraße, lag Buncarragh nur ein paar Ausfahrten nördlich von Kilkenny. War das Land geschrumpft, oder hatte Amerika ihre Wahrnehmung von Entfernungen verändert? Die frischen blauen Verkehrsschilder mit ihrer hellen reflektierenden Schrift und den Kilometerangaben schienen irgendwie nicht zu den Orten zu passen, auf die sie verwiesen. Verschlafene graue Marktflecken, die in der Vergangenheit verwurzelt blieben.
Würde dies das letzte Mal sein, dass sie diese Reise unternahm? Jetzt, wo es ihre Mutter nicht mehr gab, hatte sie keine echten Bindungen mehr an diesen Ort. Natürlich gab es ein paar Cousins und Cousinen und ihren Onkel und ihre Tante, aber sie hatten einander nie nahegestanden. Wenn das Haus erst verkauft war, welchen Grund hätte sie dann, wieder herzukommen? Vor sich auf der linken Seite, hinter dem Geländer der kleinen methodistischen Kirche, sah sie das Familiengeschäft: «Keane and Sons». Der Name hob sich in verschnörkeltem Stuck von der Fassade ab, die, solange sie denken konnte, in einer blassen Farbe gestrichen gewesen war, die an rohes Hähnchenfleisch erinnerte. Sie wurde langsamer, um in die Schaufenster zu spähen. Links der Tür stand ein Wäldchen aus künstlichen Weihnachtsbäumen, die Auslage rechts bestand aus ein paar Flachbildfernsehern und drei neuen schwarzen und chromglänzenden Buggys.
Sie fuhr mit dem Wagen gerade an der Tür vorbei, als diese sich öffnete und eine glamouröse Frau heraustrat, deren Aufzug gar nicht in die Umgebung passte. Scheiße. Es war Noelle, die Frau ihres Cousins Paul. Die beiden führten nun das Geschäft. Hatte sie sie gesehen? Elizabeth blickte in den Rückspiegel und sah einen langen, dünnen, winkenden Arm. Herr im Himmel, die musste ja die Augen eines Habichts haben. Elizabeth stöhnte. Sie hatte gehofft, es unbeachtet bis Convent Hill zu schaffen, doch jetzt war klar, dass sie anhalten musste. Dieser gesamte Teil ihrer Familie hielt sie ohnehin schon für eine hochnäsige Kuh. Sie legte den Rückwärtsgang ein und fuhr vor Noelle an den Straßenrand, die sich eine Plastiktüte von Keane and Sons über den Kopf hielt, um den Regen von ihrem leuchtend blonden Haar abzuhalten. Noelles trug hautenge Jeans und eine kurze gefütterte Jacke, die es allen ermöglichte, ihre schlanke Figur zu bewundern. Wie konnte es sein, dass diese Frau drei Babys hervorgebracht hatte? Elizabeth dachte an ihr eigenes locker sitzendes Sweatshirt, das einiges verzieh, und ihr kurz geschnittenes, dunkles Haar mit den grauen Strähnen, über das ihr Sohn Zach vergnügt sagte, das sei keine Frisur, sondern bloß geschnittene Haare. Sie drückte sinnlos auf ein paar Knöpfen herum, bis das Beifahrerfenster herunterfuhr. Sie lehnte sich hinüber, verdrängte wacker den Gedanken daran, wie schlimm sie mit ihrem ungeschminkten, übernächtigten Gesicht wohl aussah, und rief:
«Hi, Noelle! Schlimmer Tag, was?»
«Und ob. Sehr wahr. Ich dachte doch, dass du das bist! Die Haare sind mir als Erstes aufgefallen.» Noelle stieß ein kleines Kreischen aus, um anzuzeigen, wie sehr sie ihr eigenes Wahrnehmungsvermögen begeisterte. «Das war bestimmt keine schöne Fahrt. Wir wussten gar nicht, dass du kommst.» In ihrer Stimme schwang ein leiser Vorwurf.
«Ich wusste es selber nicht», log Elizabeth. «Zach ist zu Freunden gefahren, da dachte ich, komme ich doch her und räume das Haus aus, bevor das Semester wieder anfängt.» Das war ebenfalls eine Lüge. Ihr Sohn war zu Besuch bei seinem Vater an der Westküste. Sie fragte sich, warum sie nicht einfach die Wahrheit gesagt hatte. Vermied sie damit ihre eigene Betretenheit oder die von Noelle?
«Du hättest uns Bescheid sagen sollen. Wir hätten die Heizung für dich angestellt. Aber du kommst zum Abendessen, oder?»
«Das ist sehr nett von dir, aber nein. Ich habe auf dem Weg aus Dublin raus ein bisschen was gegessen, und alles, was ich wirklich will, ist schlafen. Ich komme morgen vorbei. Du solltest reingehen, Noelle, du wirst pitschnass.»
«Na gut, wenn du meinst, aber falls du dort bist und deine Meinung änderst, komm einfach rüber. Wir essen immer noch Reste von Weihnachten! Wir haben deine Mutter dieses Jahr natürlich vermisst.» Noelle zog ihre knallroten Mundwinkel nach unten, um ein Bedauern zu signalisieren, wie man es einem Kleinkind zeigt, das sich das Knie gestoßen hat. «Willkommen zu Hause jedenfalls!»
Elizabeth zwang sich zu einem Lächeln und winkte. Selbstgerechte Schlampe. Kapierte Noelle nicht, dass sie Elizabeth unmöglich noch mehr Schuldgefühle einflößen konnte, als sie schon hatte? Das schreckliche Gezerre zwischen ihren Pflichten als einziges Kind einer sterbenden Frau und denen einer alleinerziehenden Mutter, die Tausende von Meilen entfernt lebte, war endlich vorüber. Sie musste zugeben, dass sie froh darüber war. Elizabeth legte den ersten Gang ein und fuhr weiter.
Die Straße verbreiterte sich zu etwas, das als The Green bezeichnet wurde, obwohl es sich lediglich um einen schmalen gepflasterten Streifen mitten in der Straße handelte, auf dem eine Parkbank und zwei Mülleimer standen. Kurz dahinter schaltete die einzige Ampel der Gemeinde auf Rot. Elizabeth starrte auf die nasse, leergefegte Straße hinaus, ihre Scheibenwischer schwangen ermattet hin und her, und eine eigenartige Wut blubberte in ihr hoch. Sie schlug mit der Hand heftig auf das Lenkrad. Sie war keine fünf Minuten in Buncarragh, und schon stürzten all die Gefühle wieder auf sie ein, vor denen sie davongelaufen war. Es war völlig egal, wie eifrig sie lernte und wen sie zu ihren Geburtstagspartys einlud, man würde ihr in dieser Stadt immer das Gefühl geben, minderwertig zu sein. Arme Liz Keane. Die ohne Daddy aufwuchs. Es war überraschend, wie oft in einer Klosterschule das Wort «Vater» gesagt wurde, und jedes Mal, wenn das geschah, hatte sie gespürt, dass alle sie ansahen.
Nun, da sie selbst eine alleinerziehende Mutter war – noch schlimmer, Zachs Vater weigerte sich, von der Bildfläche zu verschwinden –, begriff sie, wie stark ihre Mutter gewesen sein musste, um all die Seitenblicke zu ertragen, das Geläster, wenn sie in den Siebzigern ihren Kinderwagen die Straße entlangschob, die Gespräche, die abrupt aufhörten, wenn sie kam. Sie fragte sich manchmal, ob die Demütigung durch ihr eigenes Eheleben eine Art von Strafe dafür war, dass sie als Mädchen so hart über ihre Mutter geurteilt hatte. Oh, wie sie ihre Mutter dafür gehasst hatte, dass sie keinen Mann hatte! Was war das für eine Frau, die es nicht schaffte, sich einen Mann zu angeln? Sie beobachtete die Eltern ihrer Freundinnen. Diese Frauen waren nicht so hübsch wie ihre Mutter, sie hatten ungekämmte Haare und trugen manchmal nicht mal einen Hauch von Lippenstift, und trotzdem hatten sie alle jemanden aufgetrieben, der «Ja, ich will» gesagt hatte, jemanden, der ihre Töchter an der Hand hielt, wenn sie mit ihrer zahlreichen Brut aus der Messe kamen. Die Erinnerung daran, wie sie und ihre Mutter mit klackernden Schuhen den Gehweg entlanggegangen waren, während aus den Fenstern der vorbeifahrenden Autos heraus verschwitzte kleine Gesichter neugierig zu ihnen herüberschauten, verursachte ihr immer noch einen einsamen Schmerz. Dieses Gefühl, irgendwie nicht vollständig zu sein. Kein Daddy, keine Geschwister, kein richtiges Familiengefühl.
Weihnachten. Kein Wunder, dass Elizabeth es so hasste. Zu wissen, dass alle anderen von ausgelassenen Familien umgeben waren, die sich auf zusammengewürfelten Stühlen um einen Tisch zwängten, während ihre Mutter und sie in der Sonntagsstille auf ihren Tellern herumkratzten. Natürlich hatten ihre Tante und ihr Onkel Einladungen ausgesprochen, sie und ihre drei Cousins zu besuchen, doch ihre Mutter hatte stets abgelehnt. «Wir verbringen einfach ein schönes, ruhiges Weihnachten als Familie. Nur wir beide. Lass sie ihre eigene Sache machen.» Als Erwachsene verstand Elizabeth den Stolz ihrer Mutter und all die Schuldgefühle, die sie ausgehalten haben musste, aber als Kind hatte sie das Gefühl gehabt, bestraft zu werden. Sie hatte immer gedacht, ihrer Mutter sei der äußere Schein – das Haus, ihre Frisur, neue Schuhe für die Schule – wichtiger als ihr tatsächliches Glück.
Niemand, und ganz bestimmt nicht ihre eigene Mutter, hatte sich je mit ihr hingesetzt und die Geschichte ihres Vaters in allen Einzelheiten erzählt, doch mit den Jahren hatte sie deren Grundtenor herausbekommen.
Ihre Mutter, Patricia, hatte ihre Großmutter gepflegt, bis diese gestorben war. Zu diesem Zeitpunkt hielten die meisten Leute für sie den Zug in puncto Männer für abgefahren. Sie war eine alte Jungfer, Schwester und Tante, mehr nicht. Aber dann war aus heiterem Himmel das Gerücht aufgekommen, sie treffe sich mit einem Mann, und beinahe bevor die Menschen die Möglichkeit gehabt hatten, diese Tatsache zu verdauen, war von Hochzeit die Rede. Nach verdächtig kurzer Zeit jedoch war sie plötzlich mit dem Baby Elizabeth im Arm zurückgekehrt. Keine Spur von einem Ehemann. Die Gerüchteküche kochte über. Der Mann hatte sie geschlagen, die Schwiegermutter hatte sie aus dem Haus getrieben, es hatte nie eine Hochzeit gegeben. Dass sie den Nachnamen Keane behalten hatte, machte das Geheimnis und den Skandal noch größer. Niemand kannte die Wahrheit. Als Elizabeth älter wurde, hatte sie versucht, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen, was mit ihrem Vater passiert war, und hatte stets dieselbe vorgefertigte Antwort erhalten: «Er ist sehr jung gestorben, aber er war ein wunderbarer Mann, ein liebenswerter Mann.» Wenn Elizabeth hartnäckig blieb, versicherte ihre Mutter ihr, dass er Einzelkind gewesen sei und es keine Familie mehr gab. Sie stellte sich ihren Stammbaum als ein paar nackte Zweige vor, und auf einem von ihnen hockte ein uralter Geier.
Die Beerdigung war erst drei Monate her, aber schon kam ihr der Anblick von Convent Hill seltsam fremd vor. Die Größe der Häuser wuchs mit der Steigung der Straße, bis sie Nummer 62 erreichte. Die Straßenbeleuchtung ging gerade flackernd an, als sie vor dem Haus anhielt, in dem sie aufgewachsen war. Viele freie Parkplätze. Die Leute sind bestimmt noch im Urlaub, dachte sie. Sie spürte den Regen angenehm auf ihrem Gesicht, als sie aus dem Wagen stieg und an dem Haus hinaufblickte, das noch immer imposant wirkte. Es war drei Stockwerke hoch und hatte eine symmetrische Fassade. Ein Bankmanager hatte es erbaut, aber ihr Großvater hatte es gekauft, als sein Laden zu florieren begonnen hatte. Sie erinnerte sich, wie ihre Mutter ihr erzählt hatte, dass Onkel Jerry und besonders seine Frau Tante Gillian es sich nach Grannys Tod unter den Nagel reißen wollten. Aber das Testament ihrer Großmutter war unmissverständlich gewesen: Jerry bekam den Laden, und Patricia bekam das Haus.
Der Regen rann die dunklen Glasfenster hinab und tropfte von den Fensterbänken. Elizabeth hatte Mühe, sich daran zu erinnern, dass sie hier jemals glücklich gewesen war, aber sie wusste, dass sie es gewesen war. Am schwarzen Geländer, welches das Haus von der Straße abgrenzte, hatten Ballons geschwebt, und kleine Mädchen in bonbonfarbenen Kleidern waren von Müttern in schweren Wintermänteln an der Haustür abgegeben worden. Eine ihrer ersten Erinnerungen überhaupt war, wie ihre Mutter sie an der Hand genommen und über die Straße geführt hatte, damit sie zusammen die Lichter ihres eigenen Weihnachtsbaums durch das Esszimmerfenster bewundern konnten. So lange her. Es kam Elizabeth beinahe so vor, als wären es die Erinnerungen einer anderen Person. Ihr Leben spielte sich so weit entfernt von diesem Haus ab, von diesen Menschen, von der Stadt Buncarragh.
Jetzt lebte sie in einer engen Zweizimmerwohnung ohne Fahrstuhl über einem Nagelstudio auf der Third Avenue. Ihr eigenes und Zachs Leben in Räume gepfercht, die zusammengenommen nicht viel größer waren als ihr Kinderzimmer. Sie war froh, dass ihre Mutter niemals zu Besuch gekommen war. Die Wohnung durch ihre Augen zu betrachten hätte sie für Elizabeth verdorben, denn trotz seiner vielen Einschränkungen liebte sie ihr kleines Nest. Das warme Licht der Lampen am Abend, die Morgensonne, die sich durch die Lücken der angrenzenden Gebäude zwängte, um ihre winzige Küche zu erfüllen, Zach, der stolz an seinem klapprigen Schreibtisch saß, den er auf der Straße gefunden und unfachmännisch selbst angestrichen hatte, aber vor allem liebte sie das Gefühl, etwas geschafft zu haben, das die Wohnung ihr gab. Das Leben nach Elliot war nicht leicht gewesen. In manchen schlaflosen Nächten hatte sie gedacht, sie müsse nach Buncarragh zurückkehren. Daher fühlte es sich jedes Mal wie ein Sieg an, wenn sie den Schlüssel in ihre eigene Haustür in Manhattan steckte.
Jetzt suchte sie in ihrer vollgestopften Handtasche nach den Schlüsseln für Convent Hill. Um die abgetretenen Steinstufen herum bemerkte sie einen grünen Rand aus Unkraut. Sie hoffte, dass das Schloss nicht allzu verklemmt war, aber der Schlüssel ließ sich leicht drehen. Vermutlich Tante Gillian, die herumgeschnüffelt hatte, um nachzuschauen, ob es da etwas gab, was sie haben wollte. Elizabeth überlegte gerade, worauf ihre Tante es wohl abgesehen haben könnte, als sie die Abwesenheit zweier Rosenbüsche in Kübeln bemerkte, die auf beiden Seiten der flachen Eingangsterrasse Wache gestanden hatten. Dieses verflixte Weibsbild. Mit einem leisen ärgerlichen Ächzen stieß sie die Tür auf und tastete nach dem Lichtschalter für die Diele. Vor ihr lag ein unsortierter Haufen Post auf dem Boden, und jemand hatte noch mehr Post auf den schmalen Dielentisch gelegt. Alles sah so aus wie immer: Der gold-grün gemusterte Läufer, der die Treppe hinaufführte; Schneewittchen persönlich war über diese Treppe vom Ball geflüchtet, aus Jumbojets waren Popstars über diesen Teppich auf den Asphalt heruntergestiegen und hatten ihren bewundernden Fans zugewinkt. Die gerahmten chinesischen Drucke hingen noch immer rechts und links der Wohnzimmertür, der enge Flur führte noch immer an der Treppe vorbei nach hinten in die Küche, in die sie jeden Tag bei der Heimkehr von der Schule als Erstes gegangen war. So vertraut, als sähe man sein eigenes Gesicht in einem Spiegel, und trotzdem hatte sich etwas verändert. In den tröstlichen Duft nach Möbelpolitur und Kohlenfeuer mischte sich der fremde Geruch von Feuchtigkeit und Vernachlässigung. Niemand wohnte hier mehr, und diese Erkenntnis traf Elizabeth mit weit größerer Wucht, als sie erwartet hatte. Sie hatte das Gefühl, als sei ihr etwas gestohlen worden.
Nachdem sie den Wagen ausgeladen hatte, setzte sich Elizabeth mit einer Schüssel Tomatensuppe an den Küchentisch. Sie fühlte sich eigenartig befangen, als sie den Löffel an den Mund führte, aber natürlich war niemand hier, der sie beobachten konnte. Niemand würde hereinkommen. Ihr fiel auf, dass sie in diesem Haus vermutlich niemals zuvor allein gewesen war. Babysitter, Nachbarn, Schulfreunde und natürlich ihre Mutter – immer war ein zweiter Herzschlag da gewesen. Sie legte den Löffel ab und blickte sich in der Küche um. Jede Oberfläche war vollgestellt mit uraltem Geschirr, das nun mit Staub und Schmutz bedeckt war. Hinter jeder Schranktür aus Kiefernholz standen weitere Teller und Töpfe und Pfannen. Chutney-Gläser und Dosen mit Kapuzinererbsen, die vermutlich älter waren als sie selbst. Unmengen von Zeug, und das hier war bloß ein Raum von vielen. Eine schwere Welle der Erschöpfung schwappte über sie, und sie fühlte sich angesichts der enormen Aufgabe, die vor ihr lag, bereits geschlagen. Sie sah auf die Uhr. Erst acht. Es war ihr egal. Sie würde einfach ins Bett gehen und hoffen, voller Motivation wieder aufzuwachen. Sie griff nach ihrem kleinen Handgepäckkoffer und stieg die Treppe hinauf.
Oben auf dem Treppenabsatz zögerte sie. Wo sollte sie schlafen: in ihrem alten Kinderzimmer oder im Zimmer ihrer Mutter? Die Aussicht auf ihr schmales Kinderbett war nicht besonders einladend, und irgendwie hatte sie das Gefühl, wenn sie dort schliefe, würde es das Zimmer ihrer Mutter noch leerer machen. Zu Hause in New York hatte sie Schuldgefühle gehabt, weil sie ihre Mutter nicht stärker vermisste, aber in diesem Haus fühlte sich ihre Abwesenheit an wie ein körperlicher Schmerz. Sie öffnete die Tür zum Schlafzimmer ihrer Mutter. Das Deckenlicht war viel zu hell, also machte sie stattdessen eine der Nachttischlampen an. Abgesehen von der verwaisten Gehhilfe und dem hässlichen Toilettenstuhl, den ihre Mutter vor ihrem Tod benötigt hatte, war der Raum so, wie sie ihn in Erinnerung hatte. Sie setzte sich auf die schimmernde grüne Tagesdecke, die das Bett bedeckte. Die Federung knarrte unter ihrem Gewicht, und plötzlich war sie wieder ein kleines Mädchen allein in ihrem Zimmer, die dieses Geräusch hörte und wusste, dass ihre Mutter im Bett und sie in Sicherheit war. Sie würde dieses Gefühl nie wieder haben. Überrascht stellte sie fest, dass sie weinte. Sie stützte sich mit den Händen auf die Knie, senkte den Kopf und ließ den Tränen freien Lauf. Ihre Mutter war fort, und sie selbst konnte nie wieder nach Hause kommen. Manche Tränen galten ihrem eigenen Kind. Sie hoffte, dass Zach sich so sicher und geliebt fühlte, wie sie selbst sich gefühlt hatte, bezweifelte es aber. Die Welt war furchteinflößend, und niemand konnte so dumm sein zu glauben, dass eine Dozentin für romantische Dichtung, die in einer winzigen Mietswohnung lebte, jemals in der Lage wäre, einen sensiblen, leicht zu zerstreuenden jungen Mann vor all ihren Gefahren zu beschützen. Sie legte sich zurück und sank in die emotionale Leere, die der Zeitunterschied, der Jetlag und der willkommene Schlaf ihr boten.
2
Das warme Licht der Lampe schien noch immer durch den pfirsichfarbenen Lampenschirm, als sie erwachte. Beim Blick zum Fenster konnte sie kein Anzeichen von Tageslicht erkennen. Sie sah auf die Uhr. Sechs, aber welches Sechs? Hatte sie ihre Armbanduhr umgestellt? Sie konnte sich nicht erinnern. Sie schob die Hand in die Tasche ihrer Jeans und zog das Telefon heraus.
Sechs Uhr morgens. Da sie wusste, dass sie vermutlich nicht wieder einschlafen würde, tapste sie über den Treppenabsatz, um sich die Zähne zu putzen und auf die Toilette zu gehen. Wo auch immer sie hinsah, standen «Sachen». Sinnlose Sachen bedeckten jede Abstellfläche. Als sie beim Zähneputzen den Kopf wandte, sah sie eine Flasche mit Keine-Tränen-Shampoo und ein Schaumbad von Matey dem Seemann. Beides hatte hier vermutlich gestanden, seit sie ein kleines Mädchen gewesen war. Sie öffnete die Spiegeltür des Badschränkchens über dem Waschbecken. Jedes verschriebene Medikament der letzten vierzig Jahre schien dort zwischen die Einlegeböden gequetscht worden zu sein.
Im Schlafzimmer war das Gerümpel nicht auf den ersten Blick zu erkennen, aber Elizabeth wusste, was sie in dem großen Schrank aus Palisanderholz und der dazu passenden Kommode erwartete. Warum hatte sie sich entschieden, das hier selbst zu machen? Gab es auch nur einen einzigen Gegenstand in diesem Haus, den sie haben wollte oder in den letzten zwanzig Jahren vermisst hatte? Sie hätte einfach eine Entrümpelungsfirma bestellen oder Noelle und Tante Gillian freie Hand für die Plünderung geben sollen.
Vorsichtig öffnete sie die Tür des Kleiderschranks. Das Erste, was ihr entgegenblickte, war das Spiegelbild ihrer selbst in Lebensgröße. Lieber Himmel, sie sah scheußlich aus. Sie sah ihr Gesicht an, von dem gewisse Freundinnen sagten, es wäre auf jungenhafte Weise attraktiv. Seltsam, dass diese Frauen üblicherweise stupsnasige Schönheiten mit vollen Lippen waren. Sie fragte sich, wie sie wohl mit ihrem kantigen Kinn und der länglichen, geraden Nase zurechtgekommen wären. Selbst in diesem Licht sah ihre normalerweise gesunde Gesichtsfarbe blass und abgespannt aus. Ihre leuchtenden haselnussbraunen Augen blickten sie aus geschwollenen Lidern und schweren Tränensäcken an. O Gott, war dieser Fleck schon die ganze Reise über auf ihrem Oberteil gewesen, oder war das bloß die Suppe von gestern Abend? Ihr Haar bildete einen eigenartigen Kamm über der gesamten linken Kopfseite. Sie strich ihn glatt, doch das war zwecklos. Als sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Innere des Schranks richtete, brachte sie ein kleines Grinsen zustande. Ja, er war zum Bersten vollgestopft, aber die Hand über die Stange mit Mänteln und Kleidern gleiten zu lassen war wie ein Besuch im Museum ihrer Erinnerungen. Der blaue Tweed dieses Mantels, den ihre Mutter getragen hatte, wenn sie stocksteif am Schultor auf sie wartete, die schmal geschnittenen Kleider, die für ein ganzes Leben voller Taufen und Hochzeiten gekauft worden waren, einschließlich des marineblauen Strick-Zweiteilers, den sie getragen hatte, als Elizabeth in Ann Arbor Elliot geheiratet hatte. Ihre arme Mutter. Der wärmste März, an den man sich in Michigan erinnern konnte. Ihr verschwitztes rotes Gesicht blickte einem von jedem Hochzeitsfoto entgegen. Elliots Mutter neben ihr sah aus, als sei sie aus Marmor gehauen. Elizabeth schauderte bei der Erinnerung an diesen Tag. Wie beide Mütter mit besorgten und argwöhnischen Gesichtern auf sie zugekommen waren. «Keinen Champagner für dich?»
Sie blickte zu dem Einlegeboden über der Kleiderstange hinauf. Auf einer Seite stapelten sich gefaltete Pullover und Strickjacken, in der anderen Hälfte schien ein zusammengerolltes, vergilbendes Federbett zu liegen. Das könnte vielleicht nützlich werden, falls die Heizung nicht ansprang, dachte Elizabeth und zog daran. Es quoll heraus und landete als weicher Haufen vor ihren Füßen. Jetzt, da die Decke weg war, sah sie die Kiste aus dunklem Holz, die ganz nach hinten geschoben worden war. Sie konnte sich nicht erinnern, sie jemals gesehen zu haben, und fasste hinein, um sie herauszuziehen. Sie fühlte sich nicht sehr schwer an, was sie etwas enttäuschte. Sie setzte die Kiste auf dem Boden ab und kniete sich davor. Als sie den Staub vom Deckel gewischt hatte, wurde das dunkel glänzende Holz darunter sichtbar. Walnuss? Die Ecken waren durch kleine Messing-Intarsien geschützt. Sie hoffte, dass sie nicht abgeschlossen war. Nein, der Deckel ließ sich leicht aufklappen. Der erste Blick hinein war ein wenig niederschmetternd: ein winziger gelber, gestrickter Babyschuh und darunter ein kleiner Stapel Briefe, die mit einem uralten cremefarbenen Band verschnürt waren. Elizabeth zog den ersten Brief heraus und begann zu lesen.
Castle House,
Muirinish,
West Cork
30. November 1973
Liebe einsame Lady aus Leinster,
ich bin mir nicht sicher, wie ich anfangen soll. Ich habe noch nie auf eine dieser Anzeigen geantwortet. Vermutlich sollte ich Ihnen einfach ein bisschen von mir erzählen, damit Sie entscheiden können, ob ich so klinge, als könnten Sie mich mögen.
Ich bin einundvierzig, also deutlich unter Ihrem Höchstalter von fünfzig! Ich bin gut 1,80 m groß und habe noch immer den Großteil meiner Haare. Ich lege ein Foto bei, damit Sie einschätzen können, ob ich anständig aussehe oder nicht! Ich bin Bauer, was Sie ja Ihrer Anzeige zufolge suchen. Der Hof liegt in der Nähe von Muirinish in West Cork. Er ist knapp fünfzig Hektar groß, aber wenn ich ehrlich bin, sind davon nur zweiunddreißig zu etwas zu gebrauchen, der Rest besteht aus Marschland. Ich halte Milchvieh, was mir Freude macht, obwohl es einen ein bisschen unfrei macht.
Warum also ist dieser tolle Fang noch zu haben? Tja, die Situation zu Hause war nicht ganz einfach. Mein Bruder hatte den Hof geführt, nachdem mein Vater gestorben war, aber als ich siebzehn war, kam er bei einem Unfall ums Leben. Also musste ich übernehmen und meiner Mutter helfen, so gut ich konnte. Das bedeutete, dass es nicht einfach für mich war, aus dem Haus zu kommen und jemanden zu treffen, und wenn ich ehrlich bin, hat es mich auch etwas scheu gemacht. Die Zeit vergeht ja schnell, und ich bekam das Gefühl, etwas unternehmen zu müssen, um eine Ehefrau zu finden, bevor es zu spät ist.
Wegen des Melkens wäre es für mich schwierig, zu einem Kennenlernen zu Ihnen zu kommen, aber ich würde Sie gern in der Innenstadt von Cork zum Mittagessen oder auf eine Tasse Tee treffen. Falls Sie möchten, dass ich Ihnen das Fahrgeld für den Zug schicke, lässt sich das bestimmt arrangieren. Ich möchte nicht unhöflich klingen, aber es wäre schön, wenn Sie mir ebenfalls ein Foto schicken könnten, damit ich sehen kann, ob Sie so reizend sind, wie Sie klingen!
Ich hoffe, Sie schreiben mir zurück, aber falls nicht, wünsche ich Ihnen in Ihrem Leben alles Gute.
Mit den allerbesten Grüßen
Edward Foley
Castle House,
Muirinish,
West Cork
15. Dezember 1973
Liebe Patricia,
vielen Dank für Ihren Brief. Ich war sehr glücklich, als ich ihn erhalten habe. Danke auch für die Fotografie. Sie sind so schön, wie ich Sie mir vorgestellt habe. Was mein Foto angeht, gut geraten – ja, es ist bei einem Oldtimertreffen in Upton aufgenommen worden!
Mein Beileid zum Tod Ihrer Mutter. Das muss sehr schwer für Sie sein, zumal Weihnachten vor der Tür steht. Es ist bedauerlich, dass Ihr Bruder Ihnen keine größere Hilfe gewesen ist. Ich habe es in meinem letzten Brief nicht erwähnt, aber ich lebe mit meiner Mutter zusammen. Keine Sorge! Wenn ich eine Frau finde, haben wir die Planungserlaubnis für einen Bungalow, also wären Sie die Hausherrin! Was natürlich nicht heißen soll, dass ich schon glaube, meine Schäfchen im Trockenen zu haben.
Ich bin sehr glücklich, dass Sie sich im neuen Jahr mit mir treffen wollen. Meine Mutter sagt, das Metropole Hotel habe ein gutes Fleischbuffet, und es liegt beinahe neben dem Bahnhof. Klingt das dem Anlass angemessen? Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich bin ziemlich nervös deswegen und hoffe, dass ich Ihnen nicht zu still bin.
Ich hoffe, Sie verbringen ein schönes Weihnachten und sind nicht allzu traurig.
Mit allen guten Wünschen
Edward
Castle House,
Muirinish,
West Cork
3. Januar 1974
Liebe Patricia,
vielen Dank für Ihre Karte. Ist die Stadt, die darauf zu sehen ist, Buncarragh? Meine Mutter bedankt sich ebenfalls.
Ich bin sehr aufgeregt wegen nächster Woche. Ich hole Sie vom Zug ab. Hoffentlich erkennen wir einander von unseren Fotografien. Nur für den Fall: Ich stelle mich neben den Kiosk des Cork Examiner gleich neben dem Eingang. Ich werde eine Tweedjacke tragen, weil ich offen gestanden nur diese eine anständige Jacke habe!
Es wird fürs Mittagessen noch ein wenig früh sein, aber wenn das Wetter nicht allzu rau ist, können wir vielleicht zuerst einen Spaziergang am Fluss machen. Wenn ich ein bisschen still bin, denken Sie bitte nicht, es läge daran, dass ich Sie nicht mag. Ich kann nur noch nicht sagen, ob meine Nerven mitspielen.
Also sehen wir uns am Zehnten. Oh, und falls Ihr Zug Verspätung hat, machen Sie sich keine Gedanken, ich werde warten.
Mit allen guten Wünschen
Edward
PS: Falls Sie es sich anders überlegen, lassen Sie es mich bitte wissen.
Castle House,
Muirinish,
West Cork
11. Januar 1974
Liebe Patricia,
mit Worten lässt sich nicht beschreiben, wie herrlich unser Treffen gestern war. Du bist in natura sogar noch schöner und dazu noch lustig und liebenswürdig.
Danach, auf der Fahrt nach Hause, sind mir all die Dinge eingefallen, die ich Dich fragen und die ich sagen wollte. Nächstes Mal! Ich hoffe, Du möchtest, dass es ein nächstes Mal gibt.
Die Sache bei Deiner Ankunft tut mir leid. Ich war nur so furchtbar nervös. Ich hätte Dich nicht vorbeigehen lassen, ohne Dich zu begrüßen – es hatte mir bloß die Sprache verschlagen! Ich habe alles genossen, sogar den stürmischen Spaziergang! Ich fand das Mittagessen gelungen, auch wenn Dein Hühnchen ein wenig trocken aussah, obwohl Du gesagt hast, das sei es nicht gewesen. Du bist zu freundlich.
Ich hoffe, Du findest mich nicht zu forsch, wenn ich sage, dass mir der liebste Teil des Tages unser Abschiedskuss war. Es war wunderbar, wie sich Deine Lippen anfühlten. Ich wünschte, ich hätte Dich länger festgehalten. Seitdem denke ich daran. Wann darf ich Dir einen Begrüßungskuss geben? Ich hoffe, bald.
Meine Mutter sagt, Du bist herzlich eingeladen, uns in Castle House zu besuchen. Sie wird anwesend sein und Aufsicht führen, also besteht keine Gefahr eines Skandals! Sie fragt sich, ob sie an Deinen Bruder schreiben sollte, um ihn in dieser Hinsicht zu beruhigen.
Ich kann nicht lügen. Ich war seit langem nicht mehr so glücklich.
In der Hoffnung, Dich bald wiederzusehen
Edward
Elizabeth legte den Stapel Briefe auf den Boden. Ihr Vater! Edward Foley. Dieser Name war alles gewesen, was sie bisher über ihren Vater gewusst hatte. Sie hob die Seiten wieder auf, und ihre Hand zitterte. Der Mann, den ihre Mutter ihr nie erlaubt hatte kennenzulernen, hatte dieses Papier berührt. Sie wusste, es war lächerlich, aber wenn sie seine ordentliche Handschrift betrachtete, die schwarze Tinte auf dem blauen Briefpapier, fühlte sie sich mit ihm verbunden. Hatte ihre Mutter die Briefe hier aufbewahrt in dem Wissen, dass sie sie finden würde? Waren die Briefe ihr Geschenk aus dem Grab heraus?
Elizabeth las weiter. Ein weiterer Besuch in Cork. Ein Wochenende, das sie in Castle House verbrachten. Die Briefe wurden zu echten Liebesbriefen. Es gab weitere Küsse und sogar eine Anspielung darauf, wie sich die Brüste ihrer Mutter anfühlten. Vielleicht hatte sie sie doch nicht finden sollen. Am Boden des Stapels dann befand sich eine Seite desselben hochwertigen Briefpapiers, aber diese hier war mit blauem Kugelschreiber bekritzelt. Nur zehn große Buchstaben erstreckten sich über die gesamte Seite. Sie waren in dünner, zittriger Handschrift geschrieben, aber Elizabeth war sich sicher, dass das Wort, das sie buchstabierten, VERZEIHUNG hieß.
Damals
1
Die überzählige Schüssel verspottete sie. Die längliche Neonlampe in der Küche spiegelte sich als glänzendes, zahnloses Lächeln im Boden des Tellers, und Patricia Keane beschloss, ihr Leben als alleinstehende Frau hinter sich zu lassen.
Es war beinahe fünf Monate her, seit ihre hochbetagte Mutter gestorben war, und noch immer geschah es, dass sie den Tisch aus Gewohnheit für zwei deckte oder zwei Tassen neben den Wasserkocher stellte. Ihre Mutter war so lange krank, im Grunde kaum noch da gewesen, und trotzdem war Patricia ihr Tod, als er endlich eingetreten war, wie etwas Plötzliches vorgekommen. Der rasselnde Atem der alten Frau war für sie so etwas wie das Ticken der Wanduhr oder das Rauschen der Blätter vor dem Fenster geworden. Man bemerkte es nicht, bis es aufhörte, aber dann war die Stille mächtig und erschreckend. Natürlich war die Leere schnell durch Leute gefüllt worden, die mit Tellern voller belegter Brote vorbeigekommen waren, oder fremde Frauen, die sie kaum kannte, die sich aber gegenseitig darin übertrumpften, die Küche zu wienern. Erst nach der Beerdigung kehrte die Stille zurück. Aber es war mehr als das: Die Räume waren nicht leer, sie waren mit Abwesenheit erfüllt. Die Toten verschwinden nicht, sie bleiben als eingeprägtes Negativ in der Welt bestehen. Patricia hatte in Reader’s Digest einen Artikel darüber gelesen, wie Menschen, die eine Amputation hinter sich hatten, am Stumpf ein Jucken verspüren konnten. Sie stellte sich vor, dass sich das ähnlich anfühlte, wie wenn sie «Tee, Mama?» die Treppe hinaufrief, bevor es ihr wieder einfiel.
Die Idee für die Kontaktanzeige war nicht ihre eigene gewesen. Dieser Geistesblitz war ihrer Freundin Rosemary O’Shea gekommen, dem einzigen anderen Mädchen aus ihrer Klasse in der Klosterschule, das noch immer unverheiratet war. Mit zweiunddreißig waren Patricia und Rosemary definitiv alte Jungfern. Alle schienen einen Mann gefunden zu haben. Selbst die schmuddelige Annie und Niamh Rourke mit ihrem unvorteilhaften Äußeren, deren Spitzname «Zinken» lautete, hatten es geschafft, vor den Traualtar geführt zu werden. Rosemary war anders. Sie schien allein vollkommen glücklich zu sein. Sie arbeitete als Friseurin im Schönheitssalon von Buncarragh, wenn auch nicht einmal die Wohlwollendsten behauptet hätten, dass sie für den Salon ein Publikumsmagnet war. Sie hatte ihre Eltern und vier Brüder draußen auf dem Hof zurückgelassen und sich über Deasy’s, der Apotheke, eine kleine Wohnung gemietet. Im letzten Jahr hatte sie sich sogar ihren eigenen gebrauchten Fiat gekauft. Welche Verwendung hatte sie da noch für einen Mann? Patricia wusste nicht recht, warum, aber sie verließ sich auf Rosemarys Einschätzung. Rosemary hatte zwar nicht allzu viel von der Welt gesehen, aber ihre Überzeugungen waren ansteckend. Es war Rosemary, sie sie überredet hatte, sich die Haare schneiden zu lassen. Die geraden braunen Haare, die sie Zeit ihres Lebens schulterlang getragen hatte, wurden zu einem kurzen Bob getrimmt, dessen Seitenscheitel ihren alten Pony ersetzte. «Du bist nicht mehr in der Klosterschule, du brauchst Haare, mit denen man leben kann», hatte Rosemary argumentiert, und irgendwie hatte Patricia gewusst, was ihre Freundin damit meinte. Es war ebenfalls Rosemary, die ihr die unförmigen Trägerröcke ausgeredet hatte. «Du hast solches Glück – du hast eine Taille!», hatte sie gesagt und dabei auf ihre eigene fülligere Figur angespielt. «Gib damit an!» Ein Stapel Schnittmuster von Simplicity wurde ausgeliehen, und Patricia staubte die Nähmaschine ihrer Mutter ab, um sich ein paar Röcke zu machen, von denen sie zugeben musste, dass sie ihr standen. Rosemary gab ihr das Gefühl, als läge das Leben im Bereich des Möglichen, als müsse man sein Schicksal nicht einfach akzeptieren. Es war eine Lektion, die Patricia dringend nötig gehabt hatte.
Mit achtzehn war ihr Leben völlig neu geschrieben worden. Ein Autounfall tötete ihren Vater, und ihre Mutter war danach nicht mehr in der Lage, allein zurechtzukommen. Und so fand sich Patricia als Vollzeit-Pflegekraft wieder, anstatt auf die Universität zu gehen oder eine schöne, sichere Stelle bei einer Bank anzutreten. Da sie die unverheiratete Tochter war, stand anderes nie zur Debatte, sie musste ihre Vorstellung von einem eigenen Leben begraben und sich eine Schürze umbinden. Die letzten vierzehn Jahre hatte sie damit verbracht, darauf zu warten, dass es ihrer Mutter besserging oder dass sie starb. Jetzt hatte sie nichts. Nun, genau genommen stimmte das nicht. Sie hatte ihr großes Elternhaus in der Stadt geerbt und, solange sie keine Möglichkeit fanden, sich aus dieser Verpflichtung zu winden, auch einen kleinen Zuschuss aus den Einnahmen des Familienunternehmens, das von ihrem älteren Bruder und dessen Frau Gillian geführt wurde. Patricia fühlte sich bereits unter Druck gesetzt, das Haus zu verkaufen oder das Schickliche zu tun und es ihrem Bruder und seiner jungen Familie zu überlassen. «Wozu brauchst du all diese Zimmer?» Aber sie behauptete sich. «Dieses Haus ist deine Belohnung», erinnerte Rosemary sie.
Sie saßen zusammen im Coffee Pot, die größte Annäherung an städtische Kultur, die Buncarragh zu bieten hatte. Eileen Moore, die mit Cathal dem Drucker verheiratet war, besaß und führte den Laden. Nach einer vielgepriesenen Reise nach Paris hatte Eileen beschlossen, ihr eigenes Café zu eröffnen. Eine gewaltige, glänzende Kaffeemaschine war zusammen mit einer riesigen marmornen Bar aus Italien importiert worden. Leider war der Bartresen beim Transport in zwei Teile zerbrochen, aber Eileen hatte eine Vitrine mit Würstchen im Schlafrock auf den gekitteten Riss gestellt, und nun sah man die Reparatur nur, wenn man danach suchte. Es wurden sogar Tische und Stühle auf die Straße hinausgestellt. Patricias Mutter hatte das nie gebilligt. Sie verstand nicht, wie es jemand in Ordnung finden konnte, dass Krethi und Plethi im Vorbeifahren sahen, was man auf dem Teller hatte. Sie wäre sich dabei vorgekommen wie eine Kuh auf dem Feld.
Rosemary teilte ihren Schokoladen-Eclair vorsichtig in zwei Teile. «Na ja, hier gibt es keine Kerle. Keinen, den man nehmen könnte jedenfalls. Alle anständigen sind vom Markt.»
«Cormac Phelan war so ungefähr der Einzige, der mir gefallen hat, und die nuttige Carol hat ihn abgekriegt.»
«Sie ist eine üble Schlampe», stellte Rosemary fest und schleckte sich Sahne aus den Mundwinkeln.
«Schlimm», stimmte Patricia zu, und sie versanken zusammen in nachdenklichem Schweigen. Woher einen Mann nehmen?
«Kilkenny!»
«Das kann ich nicht.»
«Kannst du doch. Ich fahre uns beide an einem Sonntag hin. Da gibt es diese großen Tanzveranstaltungen im Mayfair. Alle meine Brüder sind dort hingefahren, um Mädchen herumzuschieben.»
«Rosemary, schau mich an. Ich bin zweiunddreißig. Man wird mich für eine Mutter halten, die ihre Kinder abholen kommt. Ich kann auf keine Tanzveranstaltung mehr gehen …»
«Doch, kannst du. Du siehst toll aus.» Aber der Entgegnung fehlte die Überzeugungskraft.
«Ich will nur einen netten Bauern. Er muss nicht besonders jung sein. Es macht mir nicht mal etwas aus, wenn er nicht hier in der Gegend lebt. Bäuerin. Klingt das nicht hübsch?»
«Doch.» Rosemary klang nicht überzeugt.
«Ich glaube einfach, man kommt sich dann nützlich vor. Man wäre ein Gespann.»
«Vermutlich.»
«Wie findet man einen Bauern?»
Diese schwierige Frage ließ sie einmal mehr verstummen, aber dann setzte sich Rosemary kerzengerade auf und fächelte sich mit beiden Händen vor dem Gesicht herum. Sie hatte die Lösung!
«Das Journal!»
«Was?»
«Das Farmer’s Journal! Darin gibt es Kontaktanzeigen. Habe ich im Salon gelesen.»
«Ihr habt das Farmer’s Journal im Salon?»
«Die Leute lassen es liegen. Aber der Punkt ist der, es gibt darin Anzeigen, eine Kontaktbörse. Sie besteht aus Bauern und Frauen, die Bauern kennenlernen möchten.»
Patricias Gesicht verriet, dass sie noch immer nicht ganz begriff.
«Auf der Suche nach Liebe und so. Einsame Herzen. Das ist das Beste, was du machen kannst, glaub mir.»
«O Gott, Rosemary. Ich weiß nicht.»
«Es ist jedenfalls einen Versuch wert», sagte Rosemary und stopfte sich das letzte Stück Eclair in den Mund.
Zwei Wochen später gab eine aufgeregte Rosemary alles, um Convent Hill hinaufzuspurten. Ihr violetter Mantel flatterte hinter ihr, und sie hielt eine Zeitung in der einen Hand, während sie mit der anderen versuchte, einer schwarzen Schultertasche aus Leder Herr zu werden. Sie sah aus wie ein Bischof auf der Flucht vor dem Schauplatz eines nächtlichen Fehltritts. Bei Nummer 62 läutete sie und lehnte sich keuchend an die Säule der Eingangsveranda. Als Patricia die Tür öffnete, blickte sie in das Gesicht ihrer Freundin, das noch roter war als sonst, eingerahmt von ihren unbändigen dunklen Locken, die vor Schweiß glänzten. Rosemary sagte kein Wort – sie schob lediglich die zusammengerollte Zeitung in Patricias Hand. Sie blickten beide darauf und begannen dann gleichzeitig zu kreischen. Sie war da!
Am Küchentisch falteten die beiden die Zeitung auf, dann blätterte Rosemary schnell zu dem Teil ganz hinten. Ihr abgekauter Nagel fuhr die verschiedenen Anzeigen entlang, Junggeselle aus Bantry … Mittelgroßer Bauer aus Fermanagh … Romantische Telepathie … da war sie … Einsame Lady aus Leinster! Die Wortwahl ging auf Rosemarys Kappe. Patricia hätte für etwas Diskreteres plädiert, aber ihr wurde in unmissverständlichen Worten dargelegt, dass Diskretion ihr nicht dabei helfen würde, einen Ehemann zu finden. Rosemary hatte auch dazu geraten, ihr Alter zu senken oder ganz zu verschweigen, aber Patricia war hart geblieben. Sie hatte argumentiert, dass sie eine potenzielle Beziehung nicht mit einer Lüge beginnen wolle. Man hatte sich auf «Anfang dreißig» geeinigt, doch wenn Rosemary vollkommen ehrlich war, fand sie, dass das ihre Freundin wie mindestens vierzig klingen ließ.
Nach der anfänglichen Aufregung, die Anzeige tatsächlich gedruckt zu sehen, und nachdem sie einander versichert hatten, wie gut sie aussah und im Vergleich zu den anderen Anzeigen formuliert war, fühlten sich die Frauen eigenartig ernüchtert. Nun blieb nichts zu tun, als zu warten.
Tage, dann eine Woche, dann zwei Wochen vergingen, und immer noch keine Antwort. Jeden Morgen ertappte Patricia sich dabei, wie sie auf den Postboten wartete. An manchen Tagen gar nichts, an anderen Tag das vertraute Klackern des Briefkastens, gefolgt von dem leisen Aufprall eines Briefs auf der Türmatte, aber jeden Tag eine Enttäuschung. Sie verfluchte sich dafür, dass sie auf Rosemary gehört hatte. Das hier war schlimmer, als es vorher gewesen war. In der Zeit vor der Anzeige war sie wenigstens bloß einsam gewesen, jetzt fühlte sie sich auch noch zurückgewiesen. Sie hatte begonnen, Umwege zu machen, um den Schönheitssalon von Buncarragh zu meiden und Rosemarys Gesicht nicht sehen zu müssen, das ihr erwartungsvoll aus dem Fenster entgegenblickte. Sie bildete sich ein, dass die Leute hinter ihrem Rücken feixten, weil sie dahintergekommen waren, dass sie die Einsame Lady aus Leinster war. Sie schalt sich selbst dafür, dass sie zu glauben gewagt hatte, ihr stünde ein Neuanfang offen. Warum hatte sie nicht einfach akzeptiert, was alle anderen schon wussten – sie war eine alte Jungfer. Sie probierte die Bezeichnung aus, als sie sich vor dem Spiegel die Haare kämmte: «Alte Jungfer.» Ihre Haut war noch faltenfrei, und trotzdem kam es ihr beim Wiederholen der Worte so vor, als nähmen ihre Haare eine leichte Graufärbung an.
Es war der Tag, an dem seit dem Abschicken ihrer Anzeige samt Postüberweisung genau drei Wochen vergangen waren, als der leise Aufprall auf der Fußmatte ein kleines bisschen bedeutender klang. Patricia stand erstarrt in der Küche. Sie wollte hinrennen und nachsehen, verabscheute sich aber selbst dafür, sich so leicht demütigen zu lassen. Sie zwang sich zu einem weiteren Schluck Tee, stellte den Becher auf dem Tisch ab und ging gemessenen Schrittes zur Küchentür. Sie lehnte sich an den Türrahmen und reckte langsam den Hals, damit sie um die Ecke in den Eingangsbereich blicken konnte. Ein großer brauner Umschlag. Zu groß für eine Rechnung. Könnte es … sie bewegte sich Zentimeter für Zentimeter vorwärts und beugte sich hinunter, um ihn umzudrehen. Ein Aufkeuchen. Da stand, gestochen scharf, in der linken oberen Ecke der Absender: Farmer’s Journal. Sie hob den Umschlag auf und huschte zurück in die Küche.
Darin befanden sich vier weitere Umschläge. Im ersten befand sich eine Postkarte mit den Ruinen von Ennis Friary vor einem chemisch blauen Himmel. Eine eigenartige Wahl, dachte Patricia. Sie drehte sie um und las: «Du klingst nach einem guten Ritt.» Erschrocken ließ sie die Karte auf den Tisch fallen. Warum in Gottes Namen schrieb jemand so etwas? Warum schickte das Journal