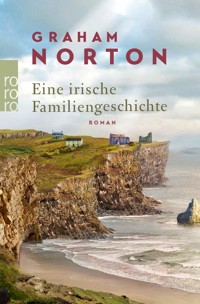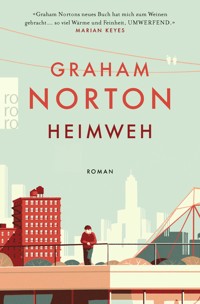
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Sommertag Ende der Achtziger, sechs junge Leute fahren ans Meer. Auf dem Rückweg ein schrecklicher Unfall: Es sterben ein junges Paar, das am nächsten Tag hätte heiraten sollen, und eine Brautjungfer; die andere überlebt schwer verletzt. Kaum blessiert sind Martin, der Arztsohn, und Connor, der eigentlich nicht zur Clique gehörte. Er saß am Steuer. Der ganze Ort Mullinmore ist wie gelähmt. Und nach dem Prozess wird Connor nach England geschickt. Niemand weiß, dass er noch vor etwas ganz anderem flieht. Bald bricht er den Kontakt zu den Eltern ab. Connnors Schwester wird derweil von Martin umworben. Die beiden heiraten, und die Ehe wird für Ellen ein Unglück. Zwanzig Jahre später betritt ein Gast eine Bar in New York. Er versteht sich sofort gut mit dem jungen Barkeeper. Dann stellen sie fest, was sie verbindet. Und jenseits des Atlantiks, in einem kleinen Ort im County Cork, löst dies eine dramatische Kette von Ereignissen aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Graham Norton
Heimweh
Roman
Über dieses Buch
Ein Sommertag in Irland Ende der Achtziger, sechs junge Leute fahren ans Meer. Auf dem Rückweg ein schrecklicher Unfall: Es sterben ein junges Paar, das am nächsten Tag hätte heiraten sollen, und eine Brautjungfer. Kaum blessiert sind Martin, der Arztsohn, und Connor, der eigentlich nicht zur Clique gehörte. Er saß am Steuer.
Der ganze Ort Mullinmore ist wie gelähmt. Und nach dem Prozess wird Connor nach England geschickt. Niemand weiß, dass er noch vor etwas ganz anderem flieht. Bald bricht er den Kontakt zu den Eltern ab.
Zwanzig Jahre später betritt ein Gast eine Bar in New York. Er versteht sich sofort gut mit dem jungen Barkeeper. Dann stellen sie fest, was sie verbindet. Und jenseits des Atlantiks, in einem kleinen Ort im County Cork, löst dies eine dramatische Kette von Ereignissen aus.
«Graham Nortons neues Buch hat mich zum Weinen gebracht … so viel Wärme und Feinheit, UMWERFEND.» Marian Keyes
Vita
Graham Norton, Schauspieler, Comedian und Talkmaster, ist eine der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten der englischsprachigen Welt. Geboren wurde er in Clondalkin, einem Vorort von Dublin, aufgewachsen ist der Sohn einer protestantischen Familie aber im County Cork im Süden Irlands. Sein erster Roman, «Ein irischer Dorfpolizist», überraschte durch seine Wärme und erzählerische Qualität, er avancierte in Irland und Großbritannien zum Bestseller, wurde mit dem Irish Book Award 2016 ausgezeichnet und wird nun auch zu einer Fernsehserie. Auch mit dem zweiten Roman, «Eine irische Familiengeschichte», stürmte die Bestsellerlisten. «Möglicherweise war es Verschwendung, dass der Mann die ganzen Jahre im Fernsehen war», schrieb Autorenkollege John Boyne in der «Irish Times».
Silke Jellinghaus, geboren 1975, ist Übersetzerin, Autorin und Lektorin und lebt in Hamburg. Unter anderem hat sie Jojo Moyes und Olivia Manning übersetzt.
Katharina Naumann ist Autorin, freie Lektorin und Übersetzerin und lebt in Hamburg. Sie hat unter anderem Werke von Jojo Moyes, Anna McPartlin und Jeanine Cummins übersetzt.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «Home Stretch» bei Coronet, Hodder & Stoughton, Hachette Company, UK.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Home Stretch» Copyright © 2020 by Graham Norton
Redaktion Silke Jellinghaus und Katharina Naumann
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg,
nach dem Original von Hodder & Stoughton UK
Coverabbildung Tom Haugomat/handsomefrank.com
ISBN 978-3-644-01008-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Paula und Terry
1987
I.
Bill Lawlor fand sie zuerst.
Seit vier Tagen hatte es nicht mehr geregnet, aber er wusste, dass das nicht mehr lange so weitergehen würde.
Er beschloss, es nicht darauf ankommen zu lassen, und verlängerte seine Arbeitszeit im Gartencenter. Eine Palette mit Torfmoos-Säcken, die am Nachmittag geliefert worden war, musste ins Lager gebracht werden. Eigentlich hätte das der kleine Dunphy erledigen sollen, aber er hatte ihn mit einem solch flehentlichen Blick angesehen, als er gefragt hatte, ob er früher gehen könne. Außerdem hatte sich der Junge extra das Haar mit Wasser aus dem Hahn im Hof geglättet und sein Hemd in die Jeans gesteckt.
«Dann mal raus mit dir. Wir sehen uns morgen früh.»
Der junge Kerl strahlte und stolperte in seiner Hast über die eigenen Füße.
«Danke! Danke, Mr. Lawlor.»
Bill fragte sich, ob wohl ein Mädchen auf ihn wartete. Ob der kleine Dunphy wohl mit seinem Mädchen zum Wehr gehen und sie dann unter die Eisenbahnbrücke locken würde, um ihr einen Kuss oder sogar mehr zu rauben? Er kicherte leise in sich hinein, als er über den Hof ging. Hatte er es damals nicht genauso gemacht?
Als er die Plastiksäcke sicher im Lager verstaut hatte, legte er den Riegel vor das Tor und stieg in sein Auto, um die kurze Strecke bis nach Hause zu fahren. Später versuchte er sich daran zu erinnern, wie er auf den Gedanken gekommen war, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte. Hatte er den Zusammenstoß gehört? Er glaubte nicht. Er konnte sich nur daran erinnern, dass es so unnatürlich still war, als er zu Barrys Kreisel kam. Es waren keine anderen Autos unterwegs, und im frühen Abendlicht wirkte alles ganz flach und ausgewaschen. Ohne sich bewusst dazu entschlossen zu haben, merkte er, dass er langsamer geworden war. Auf der anderen Seite des Kreisels, an der Ausfahrt zur Küstenstraße, sah er zwei Männer, eigentlich eher Jungen. Einer kniete am zugewucherten Straßenrand, sein schwarz-violettes Rugby-Shirt sah vor dem Hintergrund des grünen Grases aus wie ein Bluterguss. Der andere war hochgewachsen und dünn. Er stand über ihm und gestikulierte mit seinen langen, blassen Armen. Hatten sie sich gestritten? Dann bemerkte er die dünnen Rauchfäden, die in die marmeladenrote Abenddämmerung aufstiegen, und rechts der beiden das plattgedrückte Stück Böschung.
Plötzlich ging alles ganz schnell. Bill war schon aus dem Auto gesprungen und rannte auf die Jungen zu.
«Ist alles in Ordnung? Ist jemand …» Aber bevor er den Satz zu Ende sprechen konnte, sah er auch schon die Antwort.
Ein dunkelblauer Kombi steckte im Entwässerungsgraben fest, der unten hinter der Böschung am Kreisel entlangführte. Dem zerbeulten Dach nach zu urteilen, hatte er sich mindestens einmal überschlagen, vielleicht sogar noch öfter. Aus dem Heckfenster ragte ein Arm hervor, weiß wie Porzellan und regungslos. Eine rote Wunde zog sich von der Achselhöhle bis zum Handgelenk. Durch die zerbrochene Windschutzscheibe sah er langes, braunes Haar ausgebreitet auf dem Armaturenbrett, und darunter kroch eine dunkle, zähflüssige Pfütze auf das Lenkrad auf der anderen Wagenseite zu.
«Kommt Hilfe? Wie viele sind dadrin?»
Die beiden Gestalten starrten Bill nur an, als hätte er gerade eine private Unterhaltung unterbrochen.
«Hat jemand einen Krankenwagen gerufen?», fragte Bill. Panik und Furcht stiegen in ihm auf.
Der Junge im Rugby-Shirt schaute auf.
«Vier. Es sind vier.» Sein Gesicht war mit Sommersprossen übersät, und er sah beinahe aus wie ein Kind.
«Sechs», sagte der andere junge Mann jetzt. Seine Stimme klang sicherer, beinahe ruhig. «Insgesamt sechs. Wir beide und noch vier andere im Auto. Sie sind der Erste. Niemand hat einen Krankenwagen gerufen.»
«Gut. Rührt euch nicht von der Stelle», rief Bill und rannte zur Tankstelle hinüber. Seine Beine fühlten sich schwer an, und das Klatschen seiner Sohlen auf dem Asphalt klang irgendwie hoffnungslos.
Maureen Bradley saß gerade unter der Trockenhaube, daher konnte sie die Sirenen nicht hören.
Sie befeuchtete ihre Finger, um die Seiten der Zeitschrift Family Circle umzublättern, die ihr die kleine Yvonne gegeben hatte, damit sie sich damit die Wartezeit vertreiben konnte. Sie las nicht wirklich, sondern genoss einfach die Zeit für sich. Zu Hause fand sie einfach keine Ruhe, weil sie ständig von allen Seiten mit Fragen bestürmt wurde. Sie hasste es, wenn andere Leute in der Küche herumstanden, besonders ihre Schwiegermutter, aber zumindest das würde übermorgen ein Ende haben. Ihre Tochter Bernie würde dann eine verheiratete Frau sein, und im Haus würde es vermutlich so still werden, dass Maureen sich wünschen würde, die ganze Hochzeit noch einmal zu feiern.
Yvonne würde morgen früh ins Haus kommen, um Bernie und die Brautjungfern zurechtzumachen, aber sie hatte gefragt, ob sie sich Maureens Frisur schon heute Abend vornehmen könne. Sie war die Einzige, die sich den Haaransatz nachfärben lassen musste, und das war im Salon einfacher zu bewerkstelligen, wo es die Pinsel, Folien, Fläschchen und Farben gab, die man dafür brauchte.
Alle nannten Yvonnes Frisierstübchen höflich «den Salon», doch im Grunde war es nichts weiter als eine umgebaute Garage neben dem Haus. Man musste Yvonne allerdings zugutehalten, dass sie alles sehr hübsch gestaltet hatte. Der Raum war vollständig gefliest, und nur an den kältesten Wintertagen brauchte man eine Reisedecke, wie Yvonne sie ihren Kundinnen anbot.
Weil sie mit ihrer üppigen Gestalt in den Stuhl gezwängt saß, die Zeitschrift auf der weichen Unterlage ihres Busens abstützte, sah Maureen die junge Frau nicht, die den Hügel hinaufrannte. Und wegen des lauten Brummens der Trockenhaube konnte sie nicht hören, wie die Tür zum Salon aufgerissen wurde. Erst als ihr Yvonne mit finsterem Blick auf die Schulter tippte, blickte sie auf und sah ihre jüngere Tochter Connie, die mit erhitztem Gesicht vor ihr stand. Ihr liefen die Tränen über die Wangen. Sie sagte etwas, aber Maureen konnte sie nicht hören. Yvonne befreite sie unter wiederholten Bitten um Verzeihung von der Trockenhaube.
Connie schluchzte und verschluckte Wörter. Was sie sagte, ergab keinen Sinn.
Maureen wuchtete sich mühsam hoch.
«Was ist los? Was ist passiert?»
Connie schaffte es für einen Moment, ihr heftiges Schluchzen zu bezwingen, und sagte: «Daddy sagt, du sollst sofort nach Hause kommen. Oh Mammy, die Polizei war bei uns zu Hause.» Sie versuchte weiterzusprechen, aber sie hatte den ganzen Mund voller Schnodder und Spucke. Sie warf sich ihrer Mutter in die Arme, und ihre Tränen durchnässten das blassrosa Handtuch, das immer noch um Maureens Schultern lag.
Weniger als anderthalb Kilometer entfernt, hinter der Brücke, in einem kleinen Reihenhäuschen am Ende des Zugangs neben dem Hotel, legte Dee Hegarty fünf Ansteckblumen nebeneinander auf den Küchentisch.
Jede bestand aus einer einzelnen roten Rosenknospe, umrahmt von Schleierkraut. Dee wickelte sie vorsichtig in feuchtes Seidenpapier, um sie dann über Nacht im Salatfach des Kühlschranks zu verstauen. Sie musste beim Anblick ihrer eigenen Hände lächeln. Sie sahen aus, als gehörten sie einer Fremden. Ihre Nägel waren rosa und glänzend wie das Innere einer Muschel. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie zum letzten Mal Nagellack getragen hatte, aber dies war eine besondere Gelegenheit, und sie wollte nicht, dass David glaubte, sie freue sich nicht auf seinen großen Tag. Sie legte die Ansteckblumen wie blumige Sardinen in eine flache Pappschachtel. Dee musste zugeben, dass sie wirklich gut geworden waren. Rot und Weiß waren die Farben von Cork. Das war so ziemlich der einzige Aspekt der Hochzeitsplanungen, an dem sich David beteiligt hatte. Er hatte darauf bestanden, dass alles in den Farben seines Teams zu sein habe. Bernie und ihre Mutter hatten schließlich nachgegeben, zumal er ihnen alle anderen Entscheidungen überlassen hatte.
Dee versuchte, sich keine Sorgen zu machen, warf aber trotzdem einen kurzen Blick auf die Uhr über dem Herd. Schon nach halb sieben. Hoffentlich hatte er sich nicht überreden lassen, noch mit in eine Kneipe zu gehen. Bei all der Aufregung wäre das keine Überraschung, außerdem war es ein wunderschöner Abend. Aber das Letzte, was er morgen gebrauchen konnte, war ein Kater. Er war vielleicht ein schlauer Junge, ein freundlicher Kerl, aber selbst seine eigene Mutter musste zugeben, dass es ihm an gesundem Menschenverstand fehlte. Nicht zum ersten Mal fragte sich Dee, ob es wirklich wohlüberlegt von ihrem Sohn war, jetzt schon vor den Altar zu treten. Er war doch erst dreiundzwanzig. Wozu die Eile? David und Bernie schworen Stein und Bein, dass es keinen heimlichen Grund für die schnelle Hochzeit gab, und Bernies Familie schien Feuer und Flamme zu sein, aber das war ja auch klar. In ein paar Jahren würde David ein fertig ausgebildeter Zahnarzt sein. Dee mochte Bernie und die Bradleys, dennoch nagte immer noch der Zweifel an ihr, was diese Eheschließung anging. Hätte David es vielleicht besser treffen können? Als Freundin war Bernie in Ordnung, aber war sie wirklich die passende Ehefrau und Mutter? Sie war einfach immer so laut. Unter anderen Umständen hätte Dee sie vielleicht sogar als gewöhnlich bezeichnet. Sie verabscheute sich selbst dafür, derartig gemeine Gedanken zu haben, zumal Maureen und Frank Bradley so großzügig gewesen waren. Natürlich war es Tradition, dass die Eltern der Braut die Hochzeit bezahlten, aber daran hielt sich heutzutage doch niemand mehr. Heutzutage legten die Leute zusammen. Aber die Bradleys hatten ihr mit viel Feingefühl zu verstehen gegeben, dass sie nicht von ihr erwarteten, dass sie etwas beisteuerte. Seit dem Tod von Davids Vater war es nicht leicht für sie gewesen, aber sie war zurechtgekommen. Dr. Coulter hatte sie als Rezeptionistin eingestellt, und das kleine Cottage draußen an der New Road, das sie nach dem Verkauf des großen Familienhauses erworben hatte, reichte für David und sie vollkommen aus. Ihr Sohn hatte ihre Vorbehalte vom Tisch gewischt. «Sie können es sich gut leisten, und überleg doch mal, was sie dafür bekommen – mich!» Er lächelte sein breites Lächeln und spannte seine Muskeln an. Dee musste lachen und jagte ihn mit dem Küchentuch aus dem Raum. Ihren großen, albernen kleinen Jungen.
Das Abendlicht verblasste langsam, und Dee war gerade aufgestanden, um das Licht in der Küche anzuschalten, als sie an der Haustür ein lautes, festes Klopfen hörte.
Es war Michael Coulters Lieblingsritual, sich abends zum letzten Mal die Hände zu waschen und abzutrocknen.
Alles erledigt. Er musterte sich im Spiegel, während er sich die Hände wusch. Die Nasenhaare mussten mal wieder gekürzt werden, und er entdeckte ein paar rötliche Äderchen auf seinen Wangen, aber sonst konnte er sich wirklich nicht über das beklagen, was er da zu sehen bekam. Na gut, das Haar an den Schläfen wurde langsam grau, und die Falten auf der Stirn blieben jetzt, ganz gleich, wie sehr er versuchte, seine Gesichtsmuskulatur zu entspannen, aber er war, es war wohl nicht eitel, das zu denken, ein gutaussehender Mann. Es war einfach eine Tatsache. Er war nicht dick geworden wie die meisten seiner Jahrgänger. Vertraue niemals einem übergewichtigen Arzt, hatte Professor Lyons seinen Studenten eingebläut, und Dr. Michael Coulter hatte es nie vergessen.
Er faltete das Handtuch und hängte es sorgfältig auf den Halter neben dem Waschbecken in der Ecke seines Behandlungszimmers. Als die Deckenlampe ausgeschaltet und die Tür zur Straße doppelt abgeschlossen war, ging er durch den Flur zum Wohnhaus hinüber. Er roch, dass dort Fisch gebraten wurde. Obwohl die Praxis an das Haus angebaut worden war, achtete Michael sehr darauf, beide streng voneinander getrennt zu halten. Wenn es sein Sohn als kleiner Junge gewagt hatte, mit seinen Freunden herzukommen und im Flur zwischen seiner Praxis und dem Haus lärmend Fangen zu spielen, hatte er sich den strengsten Tadel seiner Kindheit eingefangen. Abends schloss er die Tür zum Flur prinzipiell ab.
Er drehte gerade den Schlüssel im Schloss, als er hörte, wie das Telefon in der Praxis klingelte. Er seufzte. Diese Anrufe außerhalb der Sprechzeiten kamen grundsätzlich immer von Zeitverschwendern oder Hypochondern, aber er hätte es sich nie verziehen, wenn er einen echten Notfall verpasst hätte. Also öffnete er die dunkle Holztür wieder und begab sich im Laufschritt zu dem hohen, schmalen Tresen im Empfangsbereich.
«Hallo, Dr. Coulter am Apparat.»
«Doktor, hier ist Sergeant Doyle. Tut mir leid, dass ich so spät noch anrufe.»
«Das ist schon in Ordnung. Was kann ich für Sie tun?» Er wurde nicht gern von der Polizei angerufen.
«Unten bei Barrys Kreisel hat es einen Unfall gegeben. Ein Krankenwagen ist schon da, ein zweiter auf dem Weg, aber ich würde sagen, sie können dort jede Hilfe gebrauchen.»
«Natürlich. Ich komme sofort. Ist es sehr schlimm?»
«Eine schreckliche Sache. Ein paar Jugendliche sind in einem Kombi über die Böschung in den Graben gefahren. Es hat Tote gegeben. Gott sei Dank waren nicht noch andere Autos an dem Unfall beteiligt.»
Dr. Coulters Mund war plötzlich ganz trocken.
«War es … war es ein Cortina?»
«Ja, genau.»
«Blau», sagten die beiden Männer wie aus einem Mund.
Caroline O’Connell hatte am Tag vor der Hochzeit gar nicht nach Cork fahren wollen.
Aber es war nun einmal so, dass sie keine Wahl hatte. Warum Declan diese schlichte Tatsache nicht begreifen wollte, verstand sie einfach nicht. Dieses Gesicht. Dieses Schnaufen und Murren auf dem Weg hinaus zum Auto.
«Hast du wirklich nichts anzuziehen?», fragte er ungläubig.
«Nein.» Darüber würde sie nicht mit ihm diskutieren. Sie würde auf keinen Fall das Kleid mit den großen roten und weißen Blumen darauf tragen, wenn das die Farben des Empfangs waren. Die Leute sollten nicht glauben, sie hielte sich für einen Teil der Hochzeitsgesellschaft, nur weil ihre Tochter eine der Brautjungfern war.
Diese Hochzeit hatte bisher nichts als Ärger eingebracht. Ihre Nichte heiratete im nächsten Frühjahr, und sie freute sich darauf, besonders, weil sie jetzt wusste, dass sie dazu das rot und weiß Geblümte würde tragen können. Declan schien dieser Silberstreif am Horizont kein bisschen aufzuheitern, als sie vor der Ampel beim Wilton Einkaufszentrum standen. Er spähte über das Lenkrad und wirkte dabei noch kleiner, als er ohnehin schon war. Seiner Atmung nach zu schließen, würde er vermutlich gleich einen seiner seltenen Wutausbrüche bekommen. Diese verdammte Bernie Bradley und ihr rot-weißer Hochzeitsempfang. Warum Carmel das Farbkonzept nicht früher bekannt gegeben hatte, wusste sie auch nicht. Na ja, eigentlich wusste sie es schon …
Es war mehr oder weniger verboten gewesen, die Hochzeit überhaupt zu erwähnen, seit Bernie beschlossen hatte, Carmel zu ihrer Brautjungfer zu machen und Carolines andere Tochter Linda nicht. Sie verstand es einfach nicht. Die drei waren immer unzertrennlich gewesen. Wenn man drei Brautjungfern hatte, warum dann nicht vier? Sie wollte sich da nicht einmischen, aber Caroline konnte nachvollziehen, dass Linda so verstimmt war.
Es hatte sie gefreut, dass die drei den Tag in Trabinn am Meer verbringen wollten. Seit Wochen zum ersten Mal hatte sie ihre Töchter wieder zusammen lachen gehört. Gut. Niemand wollte an einem so großen Tag böses Blut.
Im hintersten Winkel von Dunnes fand Caroline für sich schließlich ein annehmbares Kleid in Hellblau, zusammen mit einem passenden Mantel mit hübschem Bändchen am Kragen. Sie freute sich über ihren Einkauf und verspürte plötzlich eine Welle von Zuneigung und Mitgefühl für Declan, der zusammengesunken auf einem Stuhl vor den Umkleidekabinen saß und eine Ausgabe des Evening Echo las.
«Was meinst du, wollen wir in die Stadt fahren und uns in Moores Hotel eine gemischte Grillplatte gönnen?»
Declan hob abrupt den Kopf. «Wenn du das gern möchtest», sagte er und hoffte sichtlich, dass sie es sich nicht wieder anders überlegte.
«Ja. Genau das ist es, was ich möchte, und es erspart mir die Kocherei, wenn wir nach Hause kommen.»
Sie nahm seine Hand, und das seltsame Paar, die klassisch schöne Frau und der winzige Mann, traten hinaus auf den Parkplatz.
Niemand war zu Hause, als es bei ihnen an der Haustür klopfte. Das Haus stand in der Dunkelheit und wartete. Später in der Nacht, als Caroline und Declan mit Tüten in der Hand zurückkehrten, mit geröteten Wangen und ein wenig albern von den Drinks im Hotel, war es Declan, der beinahe auf die Postkarte getreten wäre, die auf der Flurmatte lag. Darauf stand, sie sollten die Polizei anrufen, sobald es ihnen möglich sei.
Ellen Hayes blieb auf der Hügelkuppe stehen, um den Moment zu genießen.
Dieses Gefühl, wenn sie die Arbeitswoche hinter sich hatte – aber noch nicht wieder zu Hause war und das Genörgel ihrer Mutter und die heimtückischen Sticheleien ihres Bruders ertragen musste. Sie atmete tief durch. Von dieser Stelle aus sah Mullinmore am besten aus. Die ganze Stadt war in einen sepiafarbenen Glanz gehüllt. Die Abenddämmerung ging in Dunkelheit über, und das bernsteinfarbene Licht der Straßenlaternen flackerte auf. In der Stadtmitte war ein Grünstreifen zu sehen, dort, wo die Bäume den Fluss säumten. Auf dem gegenüberliegenden Hügel markierte die Kirche mit dem leeren, abschüssigen Parkplatz davor den westlichen Rand der Stadt, während der rote Backstein der Klosterschule den östlichen Teil beherrschte. Nach zwei Monaten konnte Ellen immer noch kaum glauben, dass sie dieses Gebäude nie wieder würde betreten müssen.
Am Fuß des Hügels öffnete sich die enge Straße zum Marktplatz, wo ihre Familie einen Pub betrieb. Sie konnte sehen, dass das große Guinness-Schild über der Tür nicht erleuchtet war. Merkwürdig. Vielleicht war die Glühbirne durchgebrannt.
Sie ging so langsam und zögerlich wie möglich hinunter in die Stadt, ohne so sehr zu trödeln, dass es jemand bemerken und sich fragen könnte, ob etwas mit ihr nicht stimmte. Einer ihrer Stammgäste, der alte Mr. Hurley, stand auf seinen Gehstock gestützt vor dem Pub. Sie schenkte ihm ein halbherziges Lächeln und nickte ihm kurz zu, bevor sie gegen die Tür drückte. Sie war verschlossen, und hinter der Milchglasscheibe war alles dunkel. Mr. Hurley räusperte sich und sagte: «Geh mal lieber rein.» Ellen starrte ihn nur an. Das gefiel ihr nicht. Ihre Phantasie sprang sofort an und malte ihr die schlimmsten Dinge aus. Sie erinnerte sich daran, wie sich ihre Mutter über Kopfschmerzen beklagt hatte. Was, wenn das nun ein Hirntumor war? War sie etwa blind geworden? Sie durchwühlte ihre Tasche nach dem selten benutzten Schlüssel für die Haustür, hinter der die Treppe direkt nach oben führte. Sie nahm zwei Stufen auf einmal und rief: «Ich bin’s! Was ist los? Was ist passiert?»
Ihre Mutter saß auf dem Sofa. Ihr Gesicht war tränenüberströmt. Sie schaute auf, als Ellen ins Zimmer trat. Ellens Vater stand am anderen Ende des Zimmers an der Tür zur Küche.
«Ellen, setz dich hin, Schätzchen.» Er sprach leise und sanft. Er klang gar nicht wie er selbst. Ellen spürte, wie ihre Unterlippe zu beben begann und sich hinter ihrer Nase ein Druck aufbaute.
«Oh Daddy», flüsterte sie und setzte sich neben ihre Mutter, die nach ihrer Hand griff.
«Connor ist mit Martin Coulter und ein paar anderen ausgegangen.»
Das ergab überhaupt keinen Sinn. Connor war nicht mit Martin befreundet.
Ihr Vater fuhr fort: «Sie hatten einen Unfall, und mindestens drei von ihnen sind …» Seine Stimme brach. «Sie sind tot.»
Ellen schlug die Hand vor den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken. «O nein. Connor!»
Ihre Mutter drückte ihre Hand. «Deinem Bruder geht es gut, Schätzchen. Er ist nicht verletzt.»
Ellen sah ihre Eltern verwirrt an.
Ihr Vater biss sich auf die Lippen und mied ihren Blick.
«Connor hat den Unfallwagen gefahren.»
II.
Ein Schild im Pubfenster wäre zu merkwürdig gewesen – immerhin hatten die Hayes keinen Verlust zu beklagen –, aber Dan und Chrissie wussten, dass sie nicht einfach so wieder ihre Türen öffnen konnten. Das wäre respektlos gewesen.
Die Polizei war gekommen und wieder gegangen. Danach hatten Dan und Chrissie ihren Sohn selbst noch einmal ins Verhör genommen. Warum hatte Connor am Steuer gesessen? Hatte er etwas getrunken? Warum war er mit dem Coulter-Jungen und dessen Freunden ausgegangen? Connor saß da und hatte die Hände zwischen die Knie geklemmt.
«Ich habe gesagt, dass ich fahre. Ich war der Einzige, der nichts getrunken hatte. Sie haben mich gefragt, ob ich mitwill. Es war sonnig. Der Strand. Ich wollte an den Strand.» Als alle Fragen beantwortet waren, durfte er sich auf sein Zimmer verziehen.
Der Pub blieb bis Dienstag geschlossen. Dann ging Dan einfach nach unten und schaltete das Licht wieder ein, ohne es mit jemandem aus der Familie zu besprechen. Er setzte sich auf einen Hocker hinter der Bar und spielte auf dem Tresen Solitaire mit einem alten Kartenspiel, das er über der Kasse aufbewahrte. Ungefähr gegen neun Uhr kam ein ausländisches Paar herein, Deutsche, vielleicht Holländer, und fragte nach etwas zu essen. Dan schickte sie zum Hotel hinüber. Er wartete bis elf Uhr, dann schloss er die Türen wieder ab und löschte das Licht.
Als er am nächsten Abend in Richtung Treppe ging, schaute Chrissie von ihrem Buch auf. «Willst du dir das wirklich antun?»
Dan seufzte. «Ich glaube schon.»
«Aber hat das irgendeinen Sinn, Liebling? Du könntest auch hier oben die Uhr anstarren.»
«Ich weiß, ich weiß. Ich glaube nur, wir sollten wieder öffnen. Den Leuten zeigen, dass wir uns nicht schämen. Wir haben nichts falsch gemacht.»
Chrissie beugte sich vor und zischte: «Schämst du dich etwa nicht? Also, ich schäme mich.»
Dan wandte sich ab und ging langsam, mit müden Schritten, hinunter in die Bar.
An diesem Abend kam Tadgh Hurley und hielt sich eine Stunde lang an seinem üblichen Pint Murphy’s fest. Der alte Mann war fast jeden Abend da und sagte nie viel, aber heute schien sein Schweigen den ganzen Pub auszufüllen. Er konnte Dan nicht einmal direkt ansehen, als er sich verabschiedete und auf weichen Sohlen zur Tür schlurfte. Gegen halb zehn kam Dr. Coulter herein. Dan stand auf und hielt sich am Tresen fest. Dem Gesichtsausdruck des Arztes nach zu schließen, war er nicht gekommen, um etwas zu trinken.
«Dan.»
«Doktor.»
«Eine schlimme Angelegenheit.»
«Sehr traurig.»
Schweigen. Dr. Coulter räusperte sich.
«Um ehrlich zu sein, komme ich in einem etwas unangenehmen Auftrag.»
«So?» Dan nahm das einsame leere Glas vom Tresen.
«Ja. Es geht um Maureen Bradley.»
Dan wandte den Blick nicht ab. Sollte er wissen, worum es hier ging? Sollte er Fragen stellen? «Ach so.»
«Also, Dan, sie ist heute in meine Praxis gekommen, und, tja, sie würde Connor wohl lieber nicht auf der Beerdigung sehen.»
Der Doktor verstummte und versuchte einzuschätzen, wie seine Nachricht aufgenommen wurde. In Wirklichkeit war Dan beinahe erleichtert. Er war sich nicht sicher gewesen, wie sie damit umgehen sollten, und jetzt hatte man ihnen die Entscheidung abgenommen.
«Verstehe.»
«Sie hat nicht explizit gesagt, dass sie auch schon mit den anderen gesprochen hat, aber es machte den Anschein, als sähen sie es genauso.»
«Verstehe», wiederholte Dan.
«Sie und Ihre Familie sind natürlich bei der Beerdigung willkommen.»
Dan musste wohl verwirrt ausgesehen haben, denn der Doktor fügte erklärend hinzu: «Es geht hier nur um Connor.»
«Danke. Danke, dass Sie uns Bescheid gesagt haben.» Sie nickten beide, um zu bekräftigen, dass sie zwei Männer waren, die einander verstanden.
«Möchten Sie etwas trinken?»
«Möchte ich nicht. Nein. Aber trotzdem danke, Dan. Ich geh dann mal lieber nach Hause.»
«Gut.»
An der Tür drehte sich Dr. Coulter noch einmal um. «Wie geht es Connor?»
Dan dachte an seinen Sohn, der sich seit vier Tagen oben in seinem Zimmer einschloss. Er war sich nicht einmal sicher, ob er überhaupt etwas gegessen oder getrunken hatte.
«Schwer zu sagen. Er ist ein ruhiger Junge. Aber natürlich jetzt sehr durcheinander.»
«Na ja, sagen Sie ihm, dass Martin nach ihm gefragt hat.»
«Das mache ich, Doktor. Danke.»
Die Tür fiel zu.
III.
Trauer ist kein Wettbewerb, aber wenn es einer wäre, dann würde Dee Hegarty die unerwünschte Trophäe gebühren, da war sich die ganze Stadt einig. Es stimmte schon, dass Maureen und Frank Bernie an dem Tag vor ihrer Hochzeit verloren hatten, aber sie hatten immer noch einander und Connie und Kieran, ihre beiden anderen Kinder, für die sie sich zusammenreißen mussten. Die Brautjungfer Carmel war getötet worden, aber Caroline und Declan O’Connell konnten immer noch beten, dass Carmels Schwester Linda wieder genesen oder zumindest überleben würde. Sie hatten Hoffnung. Dee hatte nichts, nur ein weiteres Grab, das sie besuchen musste.
So eine zurückhaltende kleine Frau, keiner von ihnen kannte sie wirklich. Vielleicht war es deshalb so ein Schock, sie auf der Beerdigung zu sehen. Ihre dünne Gestalt war in einen unförmigen schwarzen Mantel gehüllt. Sie ging ganz allein den Gang zwischen den Kirchenbänken hindurch. Ihre Füße steckten in hohen schwarzen Schuhen, die ein paar Nummern zu groß zu sein schienen und vermutlich geliehen waren. Sie ging, als müsste sie zwischen Pfützen hindurchnavigieren. Die Leute stellten sich in einer Reihe auf und murmelten ihre Beileidsworte, aber Dees verschwollene Augen schienen niemanden wahrzunehmen. Ihr die Hand zu schütteln war, als schüttelte man die Pfote eines Hundes. Dann, am Ende des Gottesdienstes, stolperte sie nach vorn, um den Sarg zu küssen, und ein lautes Heulen brach aus ihr heraus. Als sie auf die Knie fiel, wussten die Leute nicht recht, was sie tun sollten. Das hier war eine Trauer, wie man sie vielleicht in Filmen sah. Sie war einfach zu viel, zu roh, und es gab niemanden, der Dee stützen, der sie dazu drängen konnte, sich zusammenzureißen. Wie ein Häuflein zerbrochener Zweige lag sie auf dem Boden. Schließlich kam Dr. Coulter und führte sie zurück zu ihrer Bank. Die Leute fragten sich, wie er sich wohl fühlte. Es war sein Auto gewesen, aber er hatte seinen Sohn Martin immer noch neben sich sitzen, der kaum einen Kratzer davongetragen hatte, während das Herz der armen Dee Hegarty vor den Augen der ganzen Stadt in Stücke gebrochen war.
Maureen hatte vorgeschlagen, dass David und Bernie zusammen in einem Grab beigesetzt werden sollten, aber Pater Deasy fand das ein wenig unangemessen. Dee hatte sich sofort der Meinung des Pastors angeschlossen. Maureen hatte die Augen verdreht und sich später bei ihrem Mann Frank beschwert. «Sie würden doch nicht in Sünde leben! Sie wollten zusammen sein, das wussten wir alle, und jetzt müssen sie die Ewigkeit getrennt voneinander verbringen, nur, weil sie noch nicht die Gelübde abgelegt hatten. Mein armes, einsames Mädchen.» Frank hatte seine Frau noch nie so niedergeschmettert erlebt. Er hatte versucht, für sie stark zu bleiben, aber auf der Beerdigung überwältigte ihn seine eigene Trauer. Woher kamen nur all die Tränen? Taschentuch um Taschentuch durchweichte er damit.
Maureen hatte darauf bestanden, ihr neues Kleid zu tragen, das sie für die Hochzeitsfeier gekauft hatte, allerdings hatte Frank ihr den Hut ausgeredet. Das Kleid war hellblau mit einem passenden Mantel, der am Kragen ein hübsches Bändchen hatte. Caroline O’Connell starrte Maureen durch ihre Tränen hindurch entgeistert an und dachte an das Kleid, das bei ihr zu Hause im Schrank hing. War das mit dem Ausdruck «kleine Gnaden» gemeint?
Pater Deasy hatte Maureen zögernd gestattet, die Hochzeitsblumen für die Beerdigung zu verwenden, daher standen nun große rote und weiße Arrangements vor jedem Fenster und zu beiden Seiten des Altars. Nellie Kehoe, die in den letzten fünfundfünfzig Jahren jede Beerdigung besucht hatte, die in Mullinmore stattgefunden hatte, gefiel das gar nicht. «Will sie uns etwa beim Leichenschmaus Hochzeitstorte zu essen geben?», sagte sie naserümpfend. Die Leute taten, als hätten sie es nicht gehört. Unbeirrt fuhr sie fort: «Und diese jungen Leute. So respektlos. Ein gelb-blauer Anorak auf einer Beerdigung. Schändlich.»
«Bist du wohl still, Nellie?», zischte ihre Freundin Peg ihr zu. «Sie sind doch selbst fast noch Kinder. Wozu brauchen sie Beerdigungskleidung? Es bricht mir das Herz. Schrecklich, einfach schrecklich, dass in den ganzen Bänken nur junge Leute sitzen.» Betroffen holte Nellie ein Leinentaschentuch aus ihrer Handtasche und betupfte sich die Nasenspitze.
Der letzte Beerdigungsgottesdienst wurde für Carmel O’Connell gehalten. Man hatte damit gewartet, weil ihre Schwester Linda so schwere Verletzungen davongetragen hatte, dass die Ärzte sich nicht sicher gewesen waren, ob sie überleben würde. Schließlich überführte man Linda nach Dublin, wo sie im Koma lag.
Ihre Mutter Caroline wechselte von Lindas Bettkante an den Rand von Carmels Grab. Wie war es nur dazu gekommen, dass das hier jetzt ihr Leben war? Sie hatte stets nur zugesehen, wie die Tragödien andere trafen, und war irgendwie davon ausgegangen, dass sie ein Zeichen, eine Warnung erhalten würde, bevor das Unglück über ihre Familie kam. Aber nun war es so, als wäre man durch eine Falltür gestürzt und wüsste immer noch nicht, ob man schon am Boden angekommen war.
Caroline hatte Dee Hegarty gesehen und wusste, dass sie sich selbst nicht so aufführen würde. Sie würde für Declan und für Linda stark bleiben. Sie hätte ohne Scham jedem erzählt, der es wissen wollte, dass nur der Wodka sie durch diesen schrecklichen Tag brachte. Nichts konnte den Schmerz lindern, aber ein paar Schnapsgläser voll Smirnoff sorgten immerhin dafür, dass er sie nicht zu Boden drückte. Declan war auf der Beerdigung ihr Held. Er löste keine Sekunde den Arm von ihrer Taille und schien seine Gehemmtheit wegen ihres Größenunterschieds völlig vergessen zu haben. Er achtete darauf, mit jedem zu sprechen und für die freundlichen Worte zu danken. Mit ihm neben sich würde sie nicht fallen.
Nach der Beerdigung kamen die Leute mit zum Haus. Sie blieben nicht lange. Es war einfach allen zu viel. Sie waren erschöpft von all der Trauer. Im Haus der Coulters baute man zu Davids Ehren ein Buffet auf. Dee war viele Jahre lang die Rezeptionistin des Doktors gewesen, und niemand konnte von ihr erwarten, Leute in ihrem Cottage zu empfangen.
Maureen und Frank hatten den Veranstaltungssaal im Hotel gebucht. Die Leute kamen für ein paar Stunden an die Bar und spülten ihre Sorgen hinunter. Aber sie ließen sich nicht ertränken.
Bei den O’Connells tauchten die Nachbarn mit Tabletts voller Sandwiches auf. Nur wenige nahmen den Whiskey an, den Declan anbot. Mrs. O’Mahony von gegenüber brachte Caroline stillschweigend nach oben und ins Bett, als sie bemerkte, dass sie schwankend im Flur stand. Als alle fort waren, ging Declan durch das Haus, schaltete Lichter aus und verschloss Türen und legte sich dann vollständig bekleidet neben seine schlafende Frau auf die Bettdecke. Er schlang die Arme um sie. Ihre Wärme, ihr gleichmäßiger Atem. Er hielt sie fest, als wollte er das Leben in ihr festhalten, aus Angst, dass es ebenfalls verschwinden könnte.
IV.
Bernie, David und Carmel waren tot. Linda blieb auf der Intensivstation. Martin kehrte an die Universität zurück, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Arzt zu werden. Von denen aus dem Autowrack blieb nur noch Connor in Mullinmore zurück.
Er verbarrikadierte sich in seinem Zimmer über dem Pub, weinte, tat so, als läse er, und dachte über seine Zukunft nach. Die Schule hatte er schon vor zwei Jahren abgeschlossen. Seitdem hatte er bemerkenswert wenige Gedanken daran verschwendet, was er mit seinem Leben anfangen wollte. Er hatte den vagen Plan gehabt, nach Cork zu gehen und sich dort Arbeit in einem Pub zu suchen. Die Stadt war nicht so weit entfernt, aber Connor hoffte, unter Fremden neu anzufangen oder zumindest herausfinden zu können, wer er war, wenn er nicht der Junge war, der hinter dem Tresen im Pub der Hayes’ stand.
Er ärgerte sich, dass er in der Schule nicht besser aufgepasst hatte. All diese öden Predigten über die Wichtigkeit der Zensuren im Abschlusszeugnis hatten sich als zutreffend herausgestellt. Seine Freunde waren mit ihren guten Zeugnissen entweder ans College gegangen oder hatten in den Unternehmen ihrer Familien angefangen, die weit bessere Zukunftsaussichten hatten als ein kleiner Pub in Mullinmore.
Jetzt kam es ihm so vor, dass selbst Bierzapfen alles übertraf, was das Leben ihm zu bieten hatte. Er würde vor Gericht erscheinen müssen. Er würde vorbestraft sein. Dieser Tag, dieser grauenvolle Tag. Er hätte ihn am liebsten aus seinem Leben herausgerissen wie eine unerwünschte Seite in einem Roman. Sein ödes Leben vor Barrys Kreisel kam ihm jetzt vor wie ein heiteres und sonniges Idyll, strotzend vor Möglichkeiten und Verheißungen. Welche Zukunft konnte es für Connor Hayes noch geben?
Sein Vater Dan und der Anwalt sprachen über ihn, als wäre er gar nicht im Zimmer. Seine Mutter war nicht mitgekommen. Sie schien der Meinung zu sein, dass juristische Angelegenheiten Sache der Männer in der Familie waren. Connor hatte Schwierigkeiten, sich auf das zu konzentrieren, was sein Vater und der Anwalt sagten. Er knurrte seine Antworten durch zusammengebissene Zähne, der ungeduldige Dan ergänzte die nötigen Einzelheiten. Das Treffen dauerte über eine Stunde, aber Connor erinnerte sich danach nur noch an den quietschenden Ledersessel, an die glänzenden Fingernägel des Anwalts und an den Rest Zahnpasta im Mundwinkel des ansonsten sehr peniblen Mannes. Sein Interesse war erst wieder erwacht, als sein Vater nach dem Gefängnis fragte. «Unwahrscheinlich» war das Wort, das der Mann auf der anderen Seite des schweren Schreibtischs benutzt hatte. Das klang ganz anders als ein entschiedenes «Nein». Es bedeutete, dass die Möglichkeit, ins Gefängnis zu müssen, immer noch sehr real war. Wie würde er damit zurechtkommen, wenn das passierte? Würde er das überleben? Die Angst kam und drückte auf seine Brust, wenn er in der Dunkelheit lag und auf den Schlaf wartete.
Tagsüber stand Connor manchmal an seinem Fenster und schaute über die Dächer der Stadt hinweg. Rauchfäden kräuselten sich empor, um sich mit dem Himmel zu vereinigen. Das Leben ging eindeutig weiter. Er drückte sein Gesicht gegen die kühle Fensterscheibe und überließ sich seinem Selbstmitleid. Er dachte an die anderen, an die, die tot waren, und ein Teil von ihm beneidete sie. Er lag auf seinem Bett und hörte seine Joshua Tree-Kassette über Kopfhörer, bis das Band ausleierte und Bonos Stimme sich in einen Bariton verwandelte, der sich durch «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» lallte. Er weinte erneut. Die Aufgabe, dieses von ihm selbst geschaffene Netz verschlungener Geheimnisse zu entwirren, erschien ihm unmöglich. Er sah einfach nicht, wie sein Leben weitergehen konnte. Natürlich dachte er daran, allem ein Ende zu setzen. Es würde absolut Sinn ergeben. Wenn er sich einfach von der Erde tilgte, wäre das für so viele Menschen die beste Lösung. Seine Existenz an sich war eine Beleidigung für die Familien, die so viel verloren hatten. Wenn er verschwände, wären seine Eltern von ihrer Scham befreit. Die Leute würden dann vielleicht sogar ein wenig Mitgefühl für sie oder sogar ihn aufbringen, weil er das getan hätte, was ehrenhaft war. Und doch, und doch … Das Problem war das Unbekannte. Den Sprung in dieses dunkle Mysterium zu wagen, ohne eine Hoffnung auf eine zweite Chance oder eine Rückkehr, war einfach zu beängstigend.
Er schaute sich in seinem Zimmer mit den zugezogenen Vorhängen um, die die Welt aussperrten. Alles hier drin wirkte so kindlich und unschuldig. Seine Madonna-Poster, der Stapel mit den glänzenden Jahrbüchern und Comics. Der Connor, der in diesem Zimmer gelebt hatte, kam ihm schon wie eine ferne Erinnerung vor. Er konnte sich kaum noch daran erinnern, wie es sich angefühlt hatte, keine echten Sorgen zu haben. Der einzige Trost, den er finden konnte, war der, dass er seine Situation wenigstens verstand, so schrecklich sie auch war. Jeder hasste ihn, und mit dieser Tatsache würde er leben müssen. Er würde nicht zum Bademantel-Gürtel greifen und ihn zu einer Schlinge knüpfen oder aus dem Badezimmerschränkchen Tabletten stehlen, stattdessen würde er für immer dieses riesige Gewicht aus Scham und Reue tragen, das auf ihm lastete.
Es klopfte fest gegen seine Zimmertür, und bevor Connor reagieren konnte, wurde sie auch schon aufgerissen, und seine Mutter kam herein. Chrissie Hayes hatte nun die Nase voll.
«Also, arbeitest du jetzt nicht mehr für deinen Lebensunterhalt?»
«Ich kann nicht nach unten gehen, Mammy. Ich kann keine Leute bedienen.» Seine Stimme klang wie die eines Kindes, das nicht zur Schule gehen will.
«Es gehört mehr dazu, einen Pub zu führen, als nur Bier zu zapfen. Ich lasse nicht zu, dass du hier vergammelst.»
Schließlich schaffte es seine Mutter, ihn aus dem Zimmer zu lotsen. Er konnte nicht hinterm Tresen arbeiten, aber er konnte sich dennoch nützlich machen. Er war jetzt für das Putzen des Gastraums verantwortlich und musste die Regale neu auffüllen oder die Fässer austauschen, bevor sein Vater öffnete. Nachts zog er sich wieder in sein Zimmer zurück. Er hatte versucht, mit seiner Mutter zusammen fernzusehen, aber alles steckte voller Erinnerungen: Beerdigungen, Beiträge über Verkehrssicherheit, Autorennen. Seine Mutter schaltete jedes Mal kommentarlos um, aber dann trat wieder eine weinende Schauspielerin auf die Bildfläche, oder es wurden Nachrichten gesendet. Allein in seinem Zimmer war alles leichter.
Es war so still. Das Rascheln, wenn jemand an seinem Zimmer vorbeiging, das vorsichtige Knarren der Stufen. Die Menschen wussten nicht recht, was sie zu ihm sagen sollten, also sagten sie lieber gar nichts. Connor und seine Schwester Ellen, die ein Altersunterschied von zwei Jahren trennte und die unterschiedliche Schulen besuchten, waren einander nie besonders nah gewesen. Alles, was irgendwie als Unterhaltung zwischen ihnen hätte durchgehen können, hatte eigentlich immer nur aus harmloser Neckerei oder kleinlicher Zankerei bestanden, aber jetzt war es etwas anderes.
Ellen hatte seit dem Unfall kein einziges Wort mehr mit ihm gewechselt, und er verstand, warum. Sie war jetzt die Schwester des Jungen, der drei Menschen umgebracht hatte, daher lag ihr Leben ebenfalls auf Eis.
Noch ein Grund mehr, ein schlechtes Gewissen zu haben.
V.
Ellen ging durch den leeren Pub, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam, und fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, bis Hayes Bar ihre Türen für immer schließen musste. Es brach ihr das Herz, mit ansehen zu müssen, wie ihre Mutter und ihr Vater so taten, als machten sie sich keine Sorgen. Bei der Arbeit hinter dem Hügel im Süden der Stadt, wo sie in einem Laden Landwirtschaftsbedarfsartikel verkaufte, war sie kommentarlos von ihrem Platz hinter dem Verkaufstresen ins Büro verbannt worden, wo sie ihre Tage damit verbrachte, Rechnungen zu kontrollieren oder Nägel und Schrauben in Tütchen zu sortieren. Die anderen Mädchen waren nicht unfreundlich oder gar feinselig, aber ihre Gespräche verstummten sofort, wenn sie hinzukam. Ellen wusste, dass sie sich an ihrer Stelle ganz genauso verhalten hätte, aber das machte es keineswegs einfacher. Eines Abends auf ihrem Weg den Hügel hinunter sah sie Mrs. Bradley auf sich zukommen. Sie erstarrte in einer für sie ganz unüblichen Mischung aus Furcht und Befangenheit, aber als die ältere Frau sie erkannte, wechselte sie sofort die Straßenseite und achtete darauf, keinen Blickkontakt zu ihr herzustellen. Ellen ging schneller und rannte schon beinahe, als sie beim Pub ankam, aber sie rannte immer noch nicht schnell genug, als dass die Leute nicht gesehen hätten, wie sie auf offener Straße weinte. Sie verwünschte ihre Entscheidung, in dem Jahr vor dem College arbeiten zu gehen. Wie sollte sie das hier zwölf Monate lang durchhalten?
Ellens beste und eigentlich auch einzige Freundin war Catriona, die von allen nur Trinny genannt wurde. Sie arbeitete an den Wochenenden ein paar Stunden im Landwirtschaftsladen, und wenn sie konnten, verbrachten Ellen und sie ihre Mittagspausen zusammen. Normalerweise saßen sie bloß auf den Stühlen vor den Spinden, aber wenn das Wetter schön war, hockten sie auf der Mauer gegenüber der Laderampe. Trinny baumelte mit den Fersen gegen den Backstein, und das ließ sie noch jünger wirken, als sie war.
«Die Sache ist doch die, Ellen: Du hast letztlich niemanden getötet. Niemand ist wütend auf dich. Das spielt sich alles nur in deinem Kopf ab.» Trinny biss herzhaft in ihr Sandwich, um ihr Argument zu untermauern.
«Du weißt nicht, wie es ist. Sie sehen mich, aber sie sehen dabei eigentlich ihn. Mam und Dad können ihn ja nun nicht verstoßen, und deswegen sieht es so aus, als wären wir alle auf seiner Seite, als wäre uns das alles egal oder so.»
Trinny kaute nachdenklich und schluckte dann. «Im Moment ist das vielleicht noch so. Aber das vergeht. Die Leute werden das bald wieder vergessen haben.»
Ellen starrte ihre Freundin an. «Das vergeht? Trinny, es sind Leute gestorben! Ganze Familien trauern. Gibt es irgendwen in Mullinmore, dem nicht das Herz bricht, wenn er die kleine Mrs. Hegarty durch die Stadt schlurfen sieht, so mutterseelenallein auf der Welt?»
«Also, auch wenn es fies ist, ich würde sagen, dass die sowieso schon neben der Spur ist. Ich würde mir um die keine Sorgen machen.»
«Trinny!», rief Ellen aus. Sie war ehrlich schockiert. Ihre Freundin sah ein wenig verlegen aus.
«Ach, du weißt doch, was ich meine. Dieses Theater auf der Beerdigung. Völlig durchgeknallt.» Sie beugte sich über ihr Sandwich und riss einen weiteren Bissen heraus. Ellen schaute einer Möwe zu, die auf einem rostigen Öltank auf und ab marschierte. Trinny zupfte sie am Ärmel, um ihre Aufmerksamkeit zurückzubekommen.
«Hör mal, weißt du, wer sich bald verloben will?»
Offenbar hatte sich das Thema geändert.
Niemand verstand es. Wie sollten sie auch? Ellen selbst hatte Schwierigkeiten, es zu verstehen. Sie wusste, dass es in diesem Drama nicht um sie ging, und doch spürte sie, wie ihr Leben ihr entglitt, wie das Bild, das sie von sich selbst hatte und das andere von ihr hatten, ganz ohne eigene Schuld auf den Kopf gestellt worden war. Sie akzeptierte, dass sie nicht das Recht hatte, Mitgefühl zu fordern. Sie war auf den Beerdigungen gewesen und hatte gesehen, wie echte Trauer aussah, aber nur, weil die anderen mehr verloren hatten, bedeutete das ja nicht, dass sie gar nichts verloren hatte. In der Schule hatte sie sich manchmal über die Ungerechtigkeit ihrer Situation aufgeregt, ständig hatte sie im Schatten von Mädchen gestanden, die hübscher, schlauer oder besser in Sport waren als sie, aber das grelle Licht, das sich nach dem Unfall auf sie und ihre Familie gerichtet hatte, war viel, viel schlimmer. Von der Aufmerksamkeit wurde ihr beinahe körperlich übel, wenn sie durch die Stadt ging. Nach der Arbeit versteckte sie sich jetzt ganz hinten in der Stadtbibliothek und blätterte die großen Fotobände durch. Die Bilder von Leuten, deren Leben einen härteren Eindruck machte als ihr eigenes, spendeten ihr Trost.
Früher hätte sie sich vermutlich ihrer Mutter anvertraut, aber ihre Eltern hatten ihre eigenen Probleme. Connors Gerichtstermin drohte. Er war wegen gefährlichen Fahrverhaltens mit Todesfolge angeklagt. Ellen war sich nicht ganz sicher, wie ernst das war, es bedeutete wohl, dass er womöglich ins Gefängnis musste. Sie hätte gern jemanden gefragt, aber irgendwie fand sie nie die richtige Person oder Gelegenheit. Dunkle Gedanken sammelten sich in ihrem Hinterkopf wie Haare in einem Abfluss. Vielleicht sollte er wirklich besser ins Gefängnis gehen. Das half vielleicht. Vielleicht würden die Leute ihrer Familie vergeben, wenn Connor für alle sichtbar litt. Aber dann dachte sie an ihre Eltern und daran, wie es ihnen ginge, wenn ihr Sohn im Gefängnis wäre. Nein, das durfte sie sich nicht wünschen. Es war zu schrecklich. Sie musste akzeptieren, dass es keine Lösungen gab, nur unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr Leben noch schlimmer werden konnte.
VI.
Das Wetter passte jetzt zur Stimmung in der Stadt. Die langen warmen Spätsommerabende waren vergangen, ein schwerer grauer Winterhimmel hatte sich über die Stadt gelegt. Wenn es nicht gerade regnete, hatte es den Anschein, das sehr bald zu tun. Die Dächer und Straßen glänzten ständig dunkel und nass.
Am Tag der Gerichtsverhandlung kam Ellen von der Arbeit zurück und fand den Pub verschlossen; die Fenster darüber waren dunkel. Sie setzte sich im Mantel in die Küche und wartete darauf, dass die anderen nach Hause kamen. Sie hatte kein Licht angeschaltet, sodass es in der Küche abgesehen von dem Licht von der Straße dunkel war. Lange Schatten bewegten sich über die gegenüberliegende Wand, während sie auf das Geräusch des Schlüssels im Schloss wartete. Irgendetwas musste schiefgegangen sein. Sie hätten schon längst wieder zurück sein müssen. Sie kaute nervös auf einer Haarsträhne herum.
Sie wusste nicht, wie es hatte passieren können, aber sie musste eingeschlafen sein, denn das Nächste, das Ellen bewusst wahrnahm, war, dass sie sich ruckartig aufsetzte, weil die Neonröhre über ihr die Küche mit Licht erfüllte. Connor stand vor ihr. Er trug die Kleidung, die er vermutlich auch auf den Beerdigungen getragen hätte: einen Schlips von seinem Vater, graue Schuluniformhosen und ein Jackett, das ihre Mutter extra für diese Gelegenheit gekauft hatte.
«Und?», fragte sie.
«Zwei Jahre auf Bewährung.» Er wirkte weder erfreut noch bekümmert.
«Eine hohe Geldstrafe?», fragte sie und versuchte, seine Stimmung zu deuten.
«Nein. Keine Geldstrafe», sagte ihr Bruder zum Linoleumfußboden. In diesem Moment trat ihr Vater in die Küche und legte den Arm um Connors nach vorn gesackte Schultern.
«Dein Bruder hat großes Glück. Kein Gefängnis fürs Erste.» Er tätschelte dem Jungen den Rücken und lächelte Ellen an.
«Das ist toll!», erwiderte sie, aber noch während sie es sagte, fragte sie sich, ob es stimmte. Wie konnte man der Fahrer eines Wagens sein, in dem drei Menschen gestorben waren, und dann einfach so mit seinem Leben weitermachen? Das Gesetz sah es vielleicht so vor, aber sie glaubte kaum, dass sich in Mullinmore irgendwer finden würde, dem damit der Gerechtigkeit Genüge getan wäre.
«Großes Glück», fuhr ihr Vater fort. «Der junge Martin Coulter hat ausgesagt und sehr gut gesprochen. Hat Connor als verantwortungsvollen Menschen beschrieben. Der Richter scheint ihm geglaubt zu haben, und natürlich hatte dein Bruder nicht zu viel getrunken, deshalb.» Er unterbrach sich, als wäre er gerade zu einem Schluss gekommen.
Chrissie trat ein. Sie betupfte sich die Augen. Sie hatte eindeutig geweint.
«Geht es dir gut, Mammy?»
«Hast du es nicht gehört?»
«Zwei Jahre auf Bewährung?»
Ihre Mutter wedelte wegwerfend mit dem Taschentuch. «Kein Gefängnis, ja, das stimmt. Aber Connor hat noch andere Neuigkeiten, nicht wahr?» Die beiden Frauen sahen ihn an, aber er hob den Blick nicht vom Boden. Stattdessen räusperte sich sein Vater.
«Connor wird uns verlassen. Die Brennans haben einen Cousin, der ein paar Baustellen drüben in Liverpool leitet. Und dieser Junge hier braucht einen Neuanfang.» Dan unterstrich seine letzten Worte, indem er Connor zwei Mal einen Klaps auf die Schulter gab. Chrissie drückte sich das Taschentuch gegen den Mund und rannte aus der Küche.
Noch Jahre später versuchte Ellen, sich selbst ihre erste Reaktion auf diese Neuigkeit zu verzeihen. Sie war froh, ja förmlich begeistert zu hören, dass ihr Bruder fortging und die anderen so vielleicht eine Chance hatten, ihr Leben weiterzuleben. Vielleicht würde man ihre Schande jetzt vergessen.
VII.
Es war nicht so schlimm, wie Connor erwartet hatte. Er hatte erwartet, dass ihn die Arbeit zugrunde richten würde, aber anscheinend war er doch stärker, als er geglaubt hatte, oder die Schubkarren voller Steine oder Zement waren nicht so schwer, wie er befürchtet hatte. Meistens kümmerte er sich ohnehin nur um Regenrinnen oder Rohre für die Sanitäranlagen, und die bestanden aus Plastik. Es gefiel ihm, dass man ihm sagte, was er zu tun hatte, er mochte es, dass man ihm Zeit und Raum strukturierte. Müde ins Bett zu gehen und traumlos zu schlafen, war eine willkommene Abwechslung zu den vergangenen Wochen in Mullinmore.
Aber fortzugehen war doch schlimmer, als er erwartet hatte. Der Anblick seiner Mutter, wie sie unten an der Treppe kauerte, damit die Leute auf der Straße ihren Zustand nicht sahen. Das Weinen. Wie sie sich mit der Hand an der Wand abstützte. Er dachte an Carmel, Bernie, David und ihre Eltern. Ihre Kinder waren für immer fort, man würde nie mehr etwas von ihnen sehen oder hören. Er dagegen ging nur nach Liverpool, und doch wusste er nicht, wie seine Mutter damit zurechtkommen würde. Sein Vater fuhr ihn nach Cork und setzte ihn an der Bushaltestelle ab. Dan fand keinen Parkplatz, daher umarmte er seinen Sohn zum Abschied nur unbeholfen über den Schaltknüppel hinweg. Dann drückte er ihm einen Umschlag mit einem englischen Zehn-Pfund-Schein und vier Fünf-Pfund-Scheinen in die Hand. Die Autos hinter ihnen hupten bereits. Dan konnte ihm nicht einmal mehr zuwinken, er fuhr einfach weiter und hoffte, dass Connor nicht sah, wie ihm die Tränen kamen.
Seine Reise durch die Nacht erschien Connor endlos. Inzwischen konnte er sich kaum mehr an Einzelheiten erinnern. Ein kleines Mädchen, das den Gang im Bus auf und ab rannte und die wenigen Zeilen von «Molly Malone» sang. Der Mann mit der flachen Mütze, der in einer Duftwolke abgestandenen Urins saß. Das durchdringende, widerhallende Klirren im Hafen von Dublin. Die großen Bogenlampen, die den Hafen aussehen ließen wie ein Filmset. Er schaute hinab auf die dunklen, schweren Wellen zwischen der Fähre und der Kaimauer und stellte sich die Kälte des Wassers vor. An Bord setzte er sich vor lauter Langeweile immer wieder um. Hin und wieder ein Aufbrüllen von der kleinen Gruppe Trinker an der Bar. Wie er sich selbst ganz betrunken fühlte, als er versuchte, zur Herrentoilette zu gehen und mit jeder Woge von Wand zu Wand schwankte. Ein spanisch aussehender Mann auf dem windgepeitschten Deck – ein Lastwagenfahrer vom Kontinent, wie Connor annahm – lächelte ihn an und hielt ihm ein Päckchen Zigaretten hin. War er nur freundlich, oder war da noch etwas anderes? Connor war panisch wieder nach drinnen gehastet. Der Wind hatte ihm die Tür aus der Hand gerissen.
Die Lichter von Liverpool hatten so exotisch und voller Verheißung ausgesehen, als sie am Horizont aufgetaucht waren, aber im Morgengrauen, als sie endlich anlegten, wirkte alles doch wieder so vertraut, dass Connor sich plötzlich noch erschöpfter fühlte, als er war. Das hier unterschied sich nicht groß von dem Ort, den er hinter sich gelassen hatte. Ein leichter Nieselregen befeuchtete sein Gesicht, als er zusammen mit den anderen Passagieren, die ebenfalls zu Fuß auf der Fähre gereist waren, die lange Gangway hinunterging. Junge, Alte, Familien oder Einzelpersonen – er fragte sich, was diese Menschen wohl erwartete. Was hatte sie wohl hierher verschlagen? Einige mühten sich mit schweren Koffern ab, während andere, wie Connor, vollgestopfte Rucksäcke trugen, die über ihre Köpfe hinweg ragten.
Als er im Terminal anlangte, trat ein jüngerer Mann mit dunklem, frühzeitig von grauen Strähnen durchzogenem Haar auf ihn zu. Sofort wurde Connor ganz unruhig und nervös.
«Connor Hayes?» Der Mann hatte einen starken Dubliner Akzent.
«Ja.» Sie schüttelten sich die Hand. Connor war überrascht, wie rau und kalt sich die Hand des Mannes anfühlte. Er nahm an, dass sich seine eigene bald ebenso anfühlen würde.
«Ciaran. Mein Van parkt draußen. Mehr hast du nicht dabei?», fragte er und zeigte auf Connors Rucksack.
«Nein. Mehr nicht.»
«Großartig.»
Ciaran drehte sich um und ging los.