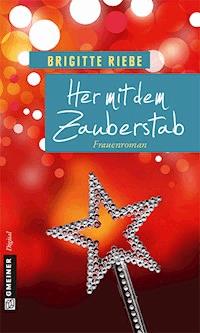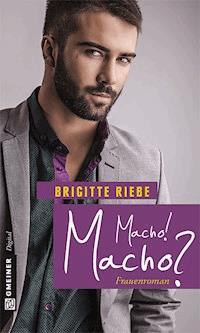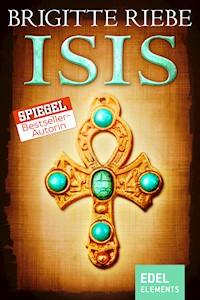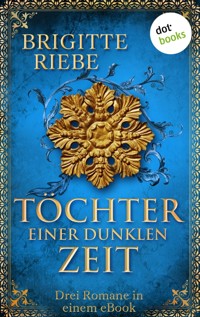Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warmherzig, witzig und unwiderstehlich charmant – der zauberhafte Katzenroman von Bestsellerautorin Brigitte Riebe beweist, dass die pelzigen Geschöpfe ihre ganz eigenen Geheimnisse hüten ... Moon heißt das hinreißende Tigerkätzchen, das in seiner neuen Umgebung zunächst einmal alles und jeden auf den Kopf stellt. Und am Ende zum Glücksbringer für die Familie Hirsch wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brigitte Riebe
Eine Katze namens Moon
Roman
Copyright dieser Ausgabe © 2012 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg. Copyright der Originalausgabe © 1997 by Brigitte Riebe
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-001-2
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Don’t dream it – be it!Frank N. Furter
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Die Nacht war eine frühsommerliche Verheißung, warm, lockend, duftgetränkt. Weit geöffnete Fenster ließen weiche Luft herein, geschwängert mit dem Blütenstaub der Gräser, dem Geruch nach feuchter Erde. Evelyn Hirsch lag in ihrem breiten Bett aus Ahornholz, erschöpft, gleichzeitig aber viel zu überdreht, um endlich wirklich in das Reich der Träume zu gleiten. Immer wenn die Müdigkeit sie zu überwältigen drohte, schreckte sie wieder hoch, als gäbe es da draußen etwas, was sie um keinen Preis der Welt einschlafen lassen wollte.
Sie mußte über sich selbst lächeln. Nichts als Hirngespinste! Früher, als ihre Großmutter Pia noch lebte, hatte im Dachboden des alten Hauses manchmal eine Schar Fledermäuse genistet, aber das war längst vorbei. Das einzige, was jetzt zu hören war, war das Flüstern des Fliederbaumes, in dem der Wind spielte, direkt unter ihnen.
Neben ihr schnarchte Christoph Hirsch, der Mann, mit dem sie seit mehr als sechzehn Jahren Herz, Bett, Kindersorgen und die vielen kleinen Nöte des Alltags teilte. Sein blasses Gesicht war gelöst im Schlaf, ohne die Knitterfältchen um Mund und Augen, die sich in den letzten Monaten fast unauffällig eingekerbt hatten; eine feuchte, rotblonde Locke klebte an seiner Stirn. Er hatte die gleichen sinnlich aufgeworfenen Lippen wie sein Sohn. Jetzt, wo sie ganz entspannt und leicht geöffnet waren, sah er beinahe wieder so unbekümmert aus, wie damals auf dem Segelboot in der Ägäis, als sie sich in einer blauen Sommerdämmerung Hals über Kopf ineinander verliebt hatten, kaum, daß die anderen an Land gegangen waren.
Ein paar gerührte Augenblicke lang kämpfte sie mit sich. Er schlief auf dem Rücken, die Arme ausgebreitet wie ein Kind, und wirkte wehrlos, beinahe unschuldig. Der resignierte Zynismus in seinen Zügen, der sie mehr als alles andere lähmte, war verschwunden. Sollte sie ihn wirklich anstupsen, damit er sich – in der Regel brummend – auf die Seite drehte und zumindest für eine Weile verstummte?
Als sein Atem jedoch unruhiger wurde und er damit begann, stetig ansteigende Knurrlaute auszustoßen, gab sie die Hoffnung, doch noch einzuschlafen, endgültig auf. Seltsamerweise konnte sie gar nicht anders. Sie mußte aus dem Bett! Leise seufzend erhob sie sich, bemüht, so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Natürlich knarzte die Treppe trotzdem wieder, obwohl sie auf Zehenspitzen hinunter in die Küche schlich.
Im Mondlicht konnte man sehen, wie sauber alles war. Und wie abgenutzt. Helle, tausendfach geschrubbte Resopalflächen, ein grau-weiß gewürfelter Plastikboden, knallrote Holzstühle, dreifarbige Glaslampe. Die perfekte Musterküche aus den fünfziger Jahren, seltsam genug in einer renovierungsbedürftigen Jugendstilvilla, mit hellgrauen, kunststoffbeschichteten Einbauteilen, zwischen denen sich der hohe weiße Eisschrank mit integrierter Kühltruhe und die Spülmaschine wie futuristische Fremdkörper ausnahmen. Beides erst jüngere Zugeständnisse an den Partyservice Paradiso, den sie seit knapp zwei Jahren mit ihrer Freundin Maxie Malkowitch betrieb.
Seitdem hatte sie immer weniger Lust, auch noch für die Familie zu kochen. Einfallslose Schnellgerichte waren es, die sie ihr in der Regel vorsetzte. Sie wußte es selbst am besten, obwohl sich keiner je darüber beklagt hatte. Christoph schien oft nicht einmal zu bemerken, was er aß, und Fanny stopfte ohnehin kritiklos in sich hinein, was man ihr vorsetzte. Der einzige, der ihr manchmal einen erstaunten Blick aus schrägen Bernsteinaugen zuwarf und seinen Teller fast unberührt ließ, war Til, ihr Großer. Ein paar Tage lang riß sie sich dann zusammen, zauberte Nudelaufläufe, asiatische Wokgerichte mit duftigem Basmatireis oder, wenn es sie besonders hart getroffen hatte, einen Riesentopf Stifado, den die Kinder bis zum letzten Faserchen mit Brot auskratzten, weil sie ihn über alles liebten. Aber ihr Ehrgeiz erlahmte jedesmal rascher. Seitdem sie ihr Geld mit dem Zubereiten von Speisen auf Bestellung verdiente, schien es, als sei ihr früherer Instinkt, die Familie zu hegen und zu nähren, mehr und mehr zum Erliegen gekommen.
War es das, was ihr heute nacht keine Ruhe ließ?
So wie sie war, in ihrem Nachthemd mit den Spaghettiträgern, setzte sie sich auf einen der ausrangierten Küchenstühle, die winters wie sommers auf der Terrasse standen. All die formlosen, übergroßen T-Shirts, in denen sie die letzten Jahre schlafen gegangen war, hatte sie erst neulich ausgemustert. Sie genoß das Alleinsein, spürte das Mondlicht auf ihrer bloßen Haut. Das Haus nebenan, schon seit Monaten leergeräumt, lag im Dunkeln. Ihre ehemaligen Nachbarn hatten sich auf einen zu hohen Preis festgelegt und fanden trotz aller Bemühungen keine Käufer.
Wieder kein Käuzchenschrei, kein Knacken von Holz, nicht einmal ein ordentlicher Vollmond! Das gelbe Ding, das da träge am unverschämt samtblauen Nachthimmel dümpelte, war seitlich schon ein bißchen angefressen.
Leise schwimmt der Mond durch mein Blut …
Unwillkürlich mußte sie an ihr früheres Lieblingsgedicht von Else Lasker-Schüler denken. Jetzt war ihre Zeit längst viel zu knapp geworden, um sich noch mit Lyrik zu beschäftigen. Meistens vergaß sie sogar, zu bedauern, daß es so gekommen war. Ein wenig fahrig zündete sie sich eine Zigarette an und inhalierte gierig. Unter dem feinen Batist zeichneten sich selbst im Sitzen die Hüftknochen ab. Keine Spur mehr von dem hartnäckigen Speckpolster, über das sie sich jahrelang geärgert hatte!
War sie deshalb so unruhig und nervös?
Angespannt lauschte sie in die Nacht hinaus. Aber da war nichts zu hören außer knirschendem Kies, vermutlich verursacht von einem vorbeifahrenden Fahrrad. In den letzten Monaten war sie richtig dünn geworden. Ihr Gesicht war nicht länger mondrund wie Fannys, sondern oval, eine milchigweiße, geschälte Mandel zwischen altmodisch gescheiteltem Rabenhaar. Pias schöne Korallenkette, die sie inzwischen nicht einmal zum Schlafen auszog, ruhte auf knochigen Schlüsselbeinen, und sie war dazu übergegangen, sich ihre Büstenhalter zwei Größen kleiner zu kaufen. Die schlanke Straffheit ihrer Waden unterstrich sie jetzt am liebsten durch hochhackige Schuhe, und sie trug zu Kleidern mit enger Taille und schwingenden Röcken eine Menge klimpernder Armreifen. Es gab Tage, da fühlte sie sich so leicht wie Luft. Das kam beinahe dem Körper nahe, den sie sich schon als junges Mädchen erträumt hatte!
»Gott, bist du vollkommen!« flüsterte Franz hingebungsvoll, wenn sie die Augen schloß und ihren Rücken durchbog, damit er sie im Stehen lieben konnte, oben in der heißen, vollgerümpelten Mansarde, wenn das Haus endlich leer war, und manchmal glaubte sie es ihm sogar. Dann bekam sie wieder den Kloß im Hals, und ihre Hände wurden flattrig. Bisweilen war ihr in diesen Momenten sogar nach Weinen zumute. Obwohl sie sich gleichzeitig nicht daran satthören konnte.
Natürlich war ihr leidenschaftlicher Liebhaber der wahre Grund der rapide purzelnden Kilos und keineswegs die Reihe soldatisch aufgestellter Magermilchjoghurts im oberen Kühlschrankfach, die den offiziellen Teil ihrer Legende darstellten. Von Tag zu Tag hoffte sie, daß Christoph und die Kinder ihr das Märchen von der wundersamen Dauerdiät auch weiterhin abnehmen würden. Deshalb aß sie in ihrer Gegenwart nur winzige Portionen, beschränkte sich auf Salat, angemacht mit Süßstoff und Zitrone, rosa Grapefruits und gegrillte Fischfilets und ersetzte zwei von drei Abendessen im Kreis der Familie durch ein großes Glas Weinschorle.
War sie allerdings mit Franz zusammen, brach die Gier nach jeder Art von Genuß ungehemmt durch. Dann konnte sie nach Herzenslust essen und trinken, voll dankbarem Erstaunen darüber, daß selbst nach solchen Völlereien der Zeiger der Waage unaufhaltsam nach links wanderte. Es war, als lodere ein unsichtbares Feuer in ihrem Körper, das nach und nach alles Fett verzehrte. Kein pralles, üppiges Fleisch mehr wie früher, das Christoph so anziehend gefunden hatte! Ihr Hals war lang, ihr Rücken straff und sehnig, wie der einer Tänzerin oder Amazone.
Langsam ging sie zurück zum Kühlschrank, goß sich ein großes Glas kalter Limonade ein und leerte es in einem einzigen Zug. Aber was auch immer in ihr brannte, sie konnte es nicht löschen. Sie legte die Hand auf die Brust, und es bummerte darunter so fest, daß die Haut hüpfte.
Wer nur rief sie so dringlich?
Unwillkürlich schaute sie halb über die Schulter in den Garten. Die Kronen der Obstbäume standen in dünngesponnenem Licht, und es war draußen fast beängstigend still. Keine Menschenseele weit und breit! Wahrscheinlich reine Einbildung, sagte sie sich, nichts weiter als eines jener seltsamen Phänomene, mit denen sie es in letzter Zeit schon öfter zu tun gehabt hatte. Denn das war die andere, weniger erfreuliche Seite der ranken Medaille: anhaltende Benommenheit, die niemals ganz von ihr wich und sich, kombiniert mit Schlaflosigkeit und Hitze, gelegentlich zu massivem Schwindel steigern konnte. Zweimal schon hatte sie im dichten Verkehr nur in allerletzter Minute bremsen können, ohne auf den Vordermann zu krachen, und war dann einfach regungslos sitzengeblieben, den Kopf auf dem Lenkrad, bis die Welt wieder stillstand und in ihren Ohren das Rauschen des Blutes leiser wurde.
Niemand ahnte etwas von diesen beunruhigenden Zuständen, nicht einmal Maxie, ihre Partnerin und beste Freundin in einem, die selbst schätzungsweise gut zwei Zentner Lebendgewicht mit Gelassenheit und erstaunlicher Grazie mit sich herumtrug. Und das war natürlich nur ein einziges Glied inmitten einer langen Kette von Halbwahrheiten, Ausreden und Schwindeleien, die nötig waren, um diese unmögliche Liebschaft mit Franz aufrechtzuerhalten – und alles, was dazugehörte, Erstaunt hatte Evelyn feststellen müssen, wie leicht es ihr fiel, jemanden anzulügen, sogar und vor allem die Menschen, die sie am meisten liebte. Inzwischen erzählte sie die erstaunlichsten Geschichten so geschickt, als seien sie Selbstverständlichkeiten. Die meiste Zeit fühlte sie sich dabei nicht einmal mehr richtig schuldig. Lügen waren für sie etwas Alltägliches geworden. Ja, sie empfand sogar ein gewisses Vergnügen daran, sie nach Herzenslust auszuschmücken. So perfekt war ihr das – wenngleich kräftezehrende – Doppelleben bereits in Fleisch und Blut übergegangen.
Seitdem sie vergangenes Silvester zum erstenmal die Werkstatt von Franz Maria Beez betreten und mit ihm zusammen Pias wertvolle, aber leider ziemlich ramponierte Biedermeierkommode vom Anhänger gehievt hatte, um sie von ihm restaurieren zu lassen, war nichts mehr so wie früher. Später behauptete Franz, ihre Füße seien die schönsten, die er je gesehen hätte. Allein deshalb sei er ihr auf Anhieb verfallen.
»Aber ich habe doch Stiefel getragen! Und pelzgefüttert waren sie noch dazu.«
»Eben. Daran siehst du, wieviel Phantasie ich habe!«
Sie dagegen hatte auf sein klassisches Profil gestarrt, die rauchblauen, dichtbewimperten Augen, die sich beim Lachen zu glitzernden Schlitzen verengten, die wirren Locken. Die kräftigen Hände. Sein buntes, mehrfach geflicktes Hemd spannte. Zwischen den Knöpfen konnte sie eine bräunliche, glatte Brust sehen. Er war bestimmt sechs Jahre jünger als sie. Vielleicht auch zehn. Als ob sie all die Jahre über nur geträumt hätte und erst jetzt mit einem Schlag aufgewacht sei! Plötzlich erinnerte sie sich wieder daran, daß sie einen Körper besaß. Und fühlte gleichzeitig in allen Gliedern, in jeder einzelnen Zelle den unbarmherzigen Lauf der Zeit. Sie hatte den Kopf in den Nacken geworfen und einfach losgelacht. Nein, sie verspürte wahrhaft keine Lust, das Leben noch länger als sehnsüchtige Zuschauerin von der Tribüne aus zu betrachten, bis ihr Verfallsdatum unweigerlich abgelaufen war!
Als ihre Hände sich berührten, zufällig oder schon voller Absicht, war es wie ein Stromstoß. An normales Reden war kaum noch zu denken. Und wenn schon! Alles, worum es ihr ging, war, diese Stimmung zu erhalten, die sich wie ein straffes Spinnennetz zwischen ihnen spannte.
Sie hatte es geschafft. Bis zum heutigen Tag. Allein das zählte.
Ein hohes, klägliches Fiepen, das bis ins Innerste drang. Wie ertappt zuckte sie zusammen.
Eines der Kinder?
Von wegen freies, schuldloses Genießen! Was für eine miese Mutter war sie doch seit ein paar Monaten, lüstern, egoistisch, unverschämt selbstbezogen! Dabei wußte sie genau, wie hilflos Tilman in der Brandung der Pubertät ruderte, und daß es Fanny noch immer nicht geschafft hatte, sich in der Schule einzuleben.
Sie lief nach oben und riß die erste Schlafzimmertür auf. Die Kleine hatte sich wie immer tief unter dem Plumeau vergraben und seufzte, als sie sie zärtlich freischaufelte. Evelyn liebte ihre Tochter am meisten, wenn sie schlief. Dann gab es keine Mißverständnisse zwischen ihnen, keine unwillig gestellten Anforderungen, denen Fanny sich nicht gewachsen fühlte, kein tränenreiches Schmollen oder muffiges Auftrotzen.
Wie ähnlich sie ihr sah!
»Dein perfektes Ebenbild«, hatte Christoph gemurmelt, nachdem sie sie geboren hatte. »Wie geklont! Eine zweite, winzig kleine Evelyn!«
Jetzt war ihr dichtes schwarzes Haar schweißnaß, und das bunte Hemdchen klebte am Körper. Wie hatte Evelyn schon wieder vergessen können, ihr die längst versprochene Sommerdaunendecke zu kaufen? Neben dem Bett lag ein verwaistes Schokopapier, natürlich heimlich eingeschmuggelt, weil grüne Äpfel als abendliches Dessert trotz aller Überredungskünste nicht die Zustimmung des Mädchens fanden, daneben Kasimir, Fannys kleiner Stoffhase, ohne den sie seit Babytagen nicht einschlafen konnte. Evelyn legte ihn zurück ins Bett und streichelte kurz über Fannys Haar. Zum Glück war sie nicht aufgewacht, sondern schnarchte friedlich weiter, kaum leiser als ihr Vater im Zimmer gegenüber.
Til, zwei Türen weiter, schlief ebenfalls, das Gesicht in den Armen verborgen. Seine schulterlangen Locken, die sein Vater haßte, Evelyn aber liebte und daher vehement gegen all seine Vorwürfe verteidigte, ringelten sich auf dem Kopfkissen wie rotgoldene Schlangen. Unter seinem Bein lugte eine aufgeschlagene Illustrierte hervor. Nacktes Fleisch. Hochglanz fotografiert. Sie runzelte einen Augenblick die Stirn, dann lächelte sie wieder. Der Junge war erschreckend groß geworden, beinahe schon ein Mann, ob es ihr nun paßte oder nicht!
Er räkelte sich, drehte sich halb auf die Seite und strampelte sich dabei frei, als ob ihm unter ihren indiskreten Blicken plötzlich zu heiß geworden sei. Wie immer im Sommer schlief er nackt. Schon halb im Gehen, erstarrte sie und schaute noch einmal genau hin.
Er hatte es also doch getan!
Auf seiner linken Pobacke prangte eine kleine, formvollendete Rose. Rot mit grünem Beiwerk. Die Tätowierung sah ganz frisch aus. Das hatte sie nun davon, daß sie ihm den Ring in der Nase so strikt untersagt hatte.
Um einiges nachdenklicher verließ sie sein Zimmer. Jeder hier im Haus machte offenbar, was er wollte. Und sie? Ihr blieb nur eine Handvoll gestohlener Momente, die sie zudem auch noch in mühsamer Kleinarbeit aus dem vollgepackten Familienstundenplan herausschinden mußte. Hatte sie, zum Teufel noch mal, nicht den Anspruch auf ein bißchen mehr verbotenes Glück? Bevor sie eine alte Frau wurde und alles endgültig vorbei war?
Das Fiepen wurde lauter. Durchdringend.
Sie lief die Treppe hinunter, durch die Küche, auf die Terrasse hinaus. Nahm die paar Stufen nach unten in den kleinen, verwilderten Garten. Es klang nach einem verletzten Kind. Oder einem Lebewesen in großer Not.
Sie spähte in die Dunkelheit. Und wirklich, unter der großen Tanne, die sie eigentlich schon seit mindestens zwei Jahren fällen lassen wollten, weil sie viel zu viel Licht schluckte, entdeckte sie eine Katze. Mager und klein. Beim Näherkommen erkannte sie die Zeichnung, schwarzgestromt auf rötlichem Untergrund.
Unsere Familienfarben, dachte Evelyn und ging ruhig weiter, Fannys und mein Schwarz und das Rot meiner beiden Männer! Sie versuchte es mit sanften, gurrenden Locktönen, doch das Tier blieb in geduckter Stellung. Allerdings machte es auch keine Anstalten, wegzulaufen.
Als sie dicht vor der Katze stand, ahnte sie weshalb. Ihr rechtes Ohr war eingerissen wie nach einem Kampf. Aus der Nähe war sie klapperdürr, mit eingefallenen Flanken, um die das Fell wie ein zu groß gewordener Mantel schlackerte. Stumpf und schmutzig war es, fast schon räudig. Nicht gerade das, was man von dieser angeblich so reinlichen Spezies erwartete! Ob sie so krank war, wie sie aussah?
Evelyn überwand sich, bückte sich und hob sie vorsichtig hoch. Sie erschien ihr viel zu heiß, ein schnell atmendes Nachtgeschöpf, beinahe ohne Gewicht. Hatte sie Fieber?
Die Katze stieß einen schrillen, empörten Schmerzenslaut aus, wand sich überraschend kräftig in ihren Armen und fuhr dabei die Krallen aus. Das Resultat war ein ordentlicher Kratzer am Dekolleté.
»Mistvieh, verdammtes!« Evelyn ließ sie auf der Stelle wieder fallen.
Die Katze machte zwei Schritte, versuchte aber erstaunlicherweise nicht, weiter fortlaufen. Sie hinkte stark. Ihre linke Hinterpfote war abgeknickt und blutverkrustet.
Sofort war das Mitleid wieder da. Und noch ein seltsames anderes Gefühl, das Evelyn nicht genau benennen konnte. Sie ging ihr behutsam nach, bückte sich abermals und streichelte sie vorsichtig. Gnädig ließ sie es sich gefallen.
»Du brauchst einen guten Tierarzt«, sagte Evelyn leise und setzte sich neben sie. Der Kratzer brannte unangenehm, aber sie kümmerte sich nicht darum. »Und zwar so schnell wie möglich. Bist du irgendwo unter die Räder gekommen? Na ja, sieht auf jeden Fall nicht gerade aus, als hätte sich in letzter Zeit jemand um dich gesorgt. Du selbst allerdings auch nicht, wenn ich dir das in aller Offenheit einmal sagen darf.«
Sie fuhr mit ihrem gleichmäßigen Streicheln fort. Die Katze schien sich unter ihren liebevollen Händen zu entspannen und ließ sich auf die Seite fallen. Ihr Bauch war von einem hellen, beinahe falben Rot. Im hohen, leicht verbrannten Gras, das schon viel zu lange auf den Rasenmäher wartete, sah sie aus wie eine Raubkatze in Miniaturausgabe, die Schutz in der Savanne gesucht hatte. Sie roch sogar ein bißchen streng.
»Eine Schönheit bist du ja nicht gerade, mein Mädchen! Und, ehrlich gesagt, richtig runtergekommen. Hat man dich deshalb aus dem Haus gejagt?«
Das konnte nur ein Weibchen sein! Sie hatte keinen dicken Katerkopf, sondern ein kleines, dreieckiges Gesicht und große Ohren mit dünnen Haarbüscheln. Auf der Stirn mündeten die dunklen Streifen in einem perfekten M, den Körper überzogen sie mit einem regelmäßigen Tigermuster. Die pechschwarze Schwanzspitze zuckte leicht. Sie war auf der Hut, aber nicht mehr ängstlich. Langsam, fast ein wenig feierlich hob sie den Kopf und schaute Evelyn durchdringend an. Mit riesigen, weitgeöffneten Augen, kiwigrün und wunderschön, umrahmt von schwarzen, exakt gezogenen Kajallinien.
In diesem Augenblick geschah etwas Merkwürdiges, beinahe, als würde der Hauptschalter in Evelyns Seele ein für allemal umgelegt. Selbst die makelloseste Katze hätte sie nicht fürsorglicher oder zärtlicher stimmen können. Ganz im Gegenteil, dieses schmächtige Bündel aus Augen und zerzaustem Fell rührte sie mehr als jedes andere Wesen, dem sie bisher begegnet war.
»Oh, tut mir wirklich leid, da habe ich mich wohl gerade gründlich geirrt!« schmeichelte sie, erstaunt über sich selbst. »Ich hoffe, du kannst mir noch einmal verzeihen! Tust du das, ja? Wo kommst du bloß auf einmal her, meine Kleine? Und wie heißt du überhaupt?«
Statt einer Antwort kletterte die Katze schnurstracks in ihren Schoß und rollte sich dort zusammen. Sie drückte ihr Köpfchen gegen Evelyns Arm und setzte zum Milchtritt an, als sei sie noch ein Baby, das an den Zitzen seiner Mutter saugte. Zunächst waren nur leise Schmatzgeräusche zu hören, wenn die rauhe Zunge gegen den gestärkten Stoff fuhr. Nach einer Weile aber begann sie dabei zu schnurren, gleichmäßig und anhaltend wie knisterndes Feuer.
Widersprüchlichste Gefühle überfielen Evelyn ohne Vorwarnung, fast wie damals, als sie nach der Geburt Fanny in den Armen gehalten hatte und nicht damit aufhören konnte, gleichzeitig zu lachen und zu weinen. Sie war alles andere als glücklich gewesen über diese zweite, ganz und gar ungeplante Schwangerschaft. Denn sie hatte schon länger den heimlichen Vorsatz gefaßt, beim nächstgünstigen Zeitpunkt Christoph mitsamt all dem Familienkram hinter sich zu lassen und allein mit ihrem Sohn Til einen Neuanfang zu wagen. In jenen Augenblicken hatte sie nicht einmal ahnen können, wie unendlich lieb sie ihr kleines Mädchen bald schon haben würde! Und wie schwierig es für sie sein würde, mit ihr ohne ständige Reibereien auszukommen.
Natürlich war sie schließlich doch geblieben. Wie es aussah, würde sie vermutlich nie die Kraft haben, um wirklich wegzugehen. Auch wenn es immer wieder vorkam, daß sie intensiv davon träumte. Aber was sie an dieses Haus und seine Bewohner band, war zu stark, zu übermächtig. Diese Nähe, diese ständigen Sorgen, vor allem jedoch dieses seltsame innere Ziehen, das niemals aufhörte, selbst wenn die Kinder langsam groß wurden! Genügte es nicht schon, daß sie diesen undefinierbaren Gefühlsbrei zur Genüge in zweifacher Ausführung kannte? War sie jetzt auch noch dabei, ihn aus freien Stücken auf ein wehrloses Tier zu übertragen?
Unwillkürlich mußte Evelyn grinsen, wie immer, wenn sie sich dabei ertappte, um ein Haar in weltumfassender Tragik zu versinken. Zum Glück war ihr Mutterwitz noch vorhanden, leicht angeschlagen von den unübersichtlichen Strapazen der letzten Zeit, aber dennoch unbesiegbar.
Als die einzige kleine Wolke am Himmel weit und breit vorbeigezogen war, und es wieder mondhell im Garten wurde, wußte sie auf einmal die Antwort, nach der sie zuvor vergeblich gesucht hatte. Sie mußte nicht einmal mehr nach oben schauen.
»Moon«, sagte sie lächelnd, »keine Frage! Wie habe ich nur einen Augenblick zweifeln können? Du bist Moon.«
In diesem Moment hatte sie vollständig vergessen, daß sich die Hirschs keine zwei Tage zuvor in der allwöchentlichen Familienkonferenz einvernehmlich darauf geeinigt hatten, die Zeit der Haustierhaltung sei bei ihnen endgültig vorbei.
Sie blieb so lange sitzen, bis das Schnurren in ihrem Schoß mit einem letzten, tiefen Seufzer ausgeklungen war. Dann hob sie ihr Nachthemd an wie einst Sterntaler und stand bedächtig auf, vom langen Stillsitzen fast ein wenig staksig. So vorsichtig wie möglich trug sie die schlafende Katze ins Haus.
Sie drehte sich nicht um. Vielleicht sogar besser so.
Sonst hätte sie vermutlich die dünne Spur Mondstaub bemerkt, die sie bei jedem Schritt hinter sich ließ.
Fanny erwachte gewohnheitsmäßig am frühesten im Haus, und außerdem hatte sie Hunger. Ihr erster Blick galt dem Schrank, wie jeden Morgen, wenn sie die Augen aufschlug. Zum Glück war er fest geschlossen. Ein verheißungsvolles Zeichen! Klugerweise hatte sie sich die Anziehsachen für heute schon gestern abend herausgelegt, eine Vorsichtsmaßnahme, die allerdings nur bedingt tauglich war, und ihr bei plötzlichem Wetterwechsel schon mehr als einmal Probleme bereitet hatte. Aber heute schien alles unkompliziert. Sonnenlicht tanzte auf dem azurblauen Holzboden, der mit Nixen, Delphinen, Austern und bunten Fischen bemalt war; draußen war es ebenso warm und strahlend wie gestern, und sie konnte guten Gewissens das neue Kleid mit den gelben Entchen anziehen.
Inzwischen war sie wach und mutig genug, um einen zweiten, ausgiebigeren Blick zu riskieren. Keine Spur von dem seltsamen Völkchen, das sich seit dem letzten Winter klammheimlich in ihrem Kleiderschrank breit gemacht hatte! Manche von ihnen hatte sie schon mit eigenen Augen gesehen, andere kannte sie nur von dem Radau, den sie vorzugsweise mitten in der Nacht veranstalteten, wenn das ganze Haus still war. Es gab da den schielenden Riesen, der an seinen wuchernden Warzen litt, die böse Stiefmutter, die fliegen, zaubern und kilometerweit spucken konnte, das enttäuschte Gespenst, das immer alles durcheinander brachte, den traurigen, kahlen Ritter mit nur einem Bein und eine Reihe anderer kurioser Wesenheiten – genau genommen eigentlich alles keine schlechten Kerle, vorausgesetzt, man wußte, in welcher Stimmung man sie antraf. Gelang es Fanny, sich rechtzeitig auf ihre zuweilen ganz schön durchgeknallten Ideen einzustellen, konnte sie sogar richtig Spaß mit ihnen haben. Aber das war beileibe nicht immer so. Manchmal, wenn alles schief lief, machten sie einfach, was sie wollten, ohne sich um sie zu kümmern, und dann bekam Fanny große Angst. Wie hätte sie auch keine kriegen sollen, wenn plötzlich mitten in der Nacht die Schranktüren aufsprangen und eine grüne, glibberige Gestalt durch das Zimmer flog, ihren Kopf mit großen, rotglühenden Räderaugen unter dem Arm? Oder die böse Stiefmutter im Fliederbaum den Giftbecher mischte, die wilden, silbernen Haare schüttelte und dabei mit hoher Stimme lockende Sirenenlieder sang? Von einem viel zu dicken Ritter, der mit seinem eigenen Bein Eishockey spielen konnte und dabei fluchte wie achtzehn Seeräuber zusammen, ganz zu schweigen!
Papa hörte solche Abenteuer gern, Mami aber wurde ärgerlich, wenn sie zuviel davon erzählte und behauptete steif und fest, Fanny sei mit fast acht allmählich wirklich zu groß, um sich derartigen Schwachsinn einzubilden. Einbildung – pah! Wenn die wüßte, was hier manchmal nachts alles los war! Aber leider waren die Schrankleute raffiniert genug, sofort zu verschwinden, sobald die Zimmertür aufging, und nicht einmal einen Mucks zu machen.
Sie seufzte tief, und wußte auf einmal wieder ganz genau, weshalb dieser schöne Morgen sehr bald schon grau und häßlich werden würde. Diktat! Das war so ungefähr das Furchtbarste, was einem Kind zustoßen konnte. Nicht einmal Sterben war schrecklicher. Da war Fanny sich ganz sicher, egal, was die Erwachsenen auch immer behaupteten!
Der Kloß in ihrem Hals schwoll an, und sie betastete ihn vorsichtig. Wenn sie noch ein Weilchen wartete und vor dem Fenster mit offenem Mund so schnell wie möglich weiteratmete, würde sie vielleicht gerade noch rechtzeitig wieder diese schlimmen Halsschmerzen kriegen und den ganzen Tag gemütlich im Bett bleiben dürfen. Andererseits war jetzt Juni und nicht Dezember, und außerdem bekam Mami seit einiger Zeit immer diese strenge Falte auf der Stirn, wenn sie krank wurde. Fanny wußte genau, weshalb. Von der Luke im Dachspitz aus hatte sie nämlich prima Sicht. Und alles genau im Blick.
Es lag an dem Lockenmann, der heimlich zu Besuch kam, wenn Til und sie in der Schule festsaßen und Papa im Laden arbeitete. Er erschien nur, wenn sicher feststand, daß niemand außer Mami im Haus war. Fanny mochte nicht, wie er sie ansah. Wie er mit ihr redete. Und am allerwenigsten, wie er sie anfaßte.
Seitdem machte sie einen Bogen um kräftige Männer mit dunklen, welligen Haaren und blauen Augen, und verkündete, sie seien schlechte, unehrliche Menschen. Manchmal tat es ihr leid, wenn Mami dabei diesen gehetzten Blick und den traurigen Zug um den Mund bekam, aber aus irgendeinem Grund mußte sie es dann erst recht gleich noch ein paarmal hintereinander wiederholen, auch wenn sie sich immer mieser fühlte. Das einzige, was dagegen half, war essen. Kaum hatte sie etwas Weiches, Süßes im Mund, löste sich der schmerzhafte Knoten in ihrer Brust auf, und alles wurde friedlich, tröstlich, still. War ihr Bauch erst einmal voll, schien auch das Leben erträglich.
Wie auf ein Stichwort hin schlüpfte Fanny aus dem Bett und schlich nach unten. Kein Laut war im ganzen Haus zu hören. Gut, daß noch alle schliefen und es früh genug war, um sich zu holen, wonach es sie verlangte – falls sie es einigermaßen geschickt anstellte! Sie war nicht faul gewesen, hatte seit Tagen unauffällig spioniert, und jetzt saß jeder Griff. Inzwischen wußte sie genau, wo Mami den Schlüssel für die Speisekammer versteckte, ganz oben im Küchenschrank nämlich, in der Dose, die noch vor kurzem erfreulicherweise immer mit Lakritzstangen gefüllt gewesen war.
Sie kletterte auf einen Küchenstuhl, streckte sich, tastete und stutzte. Kein Schlüssel! Eher verdutzt als enttäuscht stieg sie wieder herunter und wunderte sich abermals.
Der Schlüssel steckte – und zwar im Schloß!
Langsam drehte sie ihn herum, schaute hinein, und erschrak so sehr, daß sie die Tür beinahe krachend wieder zugeschlagen hätte. Jetzt sah sie Wesen wie die Schrankleute schon am hellichten Tag! Eine strubbelige, halb verhungerte Katze allerdings war noch nie darunter gewesen. Ob sie der bösen Stiefmutter gehörte und sie nächtens bei ihrem wilden Ritt über die Baumkronen begleitete?
Ihr Herz schlug wie wild, und selbst der gerade eben noch nagende Hunger war schlagartig verschwunden. Sie zählte ganz langsam bis zehn, so wie Til es ihr erst neulich für schwierige Situationen geraten hatte, dann öffnete sie die Tür zum zweiten Mal.
Die Katze war noch immer da. Sie lag in Mamis ausrangiertem Einkaufskorb, der nun mit einem Handtuch ausgeschlagen war, und blinzelte ein bißchen. Sie hatte keine Angst, aber etwas schien ihr zu fehlen. Um ihr ungepflegtes Fell und die dünnen Knochen herum war alles grau. Beinahe tot. Nirgendwo konnte Fanny etwas von den leuchtenden Fäden sehen, die, wie sie aus Erfahrung wußte, von Menschen, Tieren und Pflanzen ausstrahlten, die glücklich, gesund und zufrieden waren.
Immerhin war die alte Sägespänekiste in ihrer Nähe, die früher Sponti, das Meerschweinchen, benutzt hatte. Zwei feuchte Vertiefungen zeigten, daß sie genau kapiert hatte, wozu sie gedacht war. Und ein Schälchen mit Wasser und ein Teller standen vor ihr, auf dem kleingeschnittenes, kaltes Hühnchen lag. Unberührt. Jedenfalls soweit man sehen konnte. Und Fanny liebte kaltes Hühnchen!
Aufmerksam sah sie die Katze an. »Ich denke, du bist viel zu krank, um das hier zu fressen«, sagte sie und stopfte sich alles schnell in den Mund. Jetzt war sie erst recht gierig geworden. Am liebsten hätte sie das Gelee darunter auch noch aufgeschleckt. »Außerdem muß ich nachher gleich ein blödes Diktat schreiben. Glaubst du vielleicht, das geht mit knurrendem Magen? Wenn man nur ein bißchen Obstbrei und zwei dünne Scheiben Knäcke mit saurer Gemüsepaste zum Frühstück bekommt? Aber was weißt du schon davon!«
Die Katze gab einen komischen Laut von sich. »Wok-wok«, so ähnlich klang es. Sie begann zu würgen, aber aus ihrem Maul floß nur ein bißchen grünliches Zeug.
»Gefällt mir aber gar nicht!« sagte Fanny streng. Miene und Ton hatte sie von Mami abgeschaut. So klang sie immer, wenn es wieder mehr als zwanzig Fehler in einer einzigen Seite Rechtschreiben waren. Oder sie beim Haltungsturnen am Seil trotz aller Anstrengung nicht mehr als ein paar lächerliche Zentimeter hinaufkam, obwohl Papa der Meinung war, das spiele überhaupt keine Rolle.
Die Katze warf ihr einen müden Blick zu. Schien sie nicht besonders zu interessieren.
»Bist du eines von Mamis Geheimnissen, so wie der Lockenmann?« fragte Fanny weiter. »Aber wieso sperrt sie dich dann in die Speisekammer? Weil du frech geworden bist? Damit dich keiner sieht? Oder weil sie ganz genau weiß, daß du zu krank bist, um etwas hiervon zu stehlen?«
Die Katze fiepte leise und sah aus wie ein Häuflein Elend. Mitgefühl wallte in Fanny auf. Sollte sie sie streicheln? Sie streckte schon die Hand aus, um sie zu berühren, zog sie aber wieder zurück. Die Katze wollte allein sein. Das war es! Fanny wußte es auf einmal ganz genau, als ob sie es ihr gerade gesagt hätte.
Prüfend musterte sie die vollgestellten Regale. Seitdem Mami und Maxie zusammen kochten, wimmelte es hier geradezu von den unterschiedlichsten Köstlichkeiten. Die meisten allerdings waren für fremde Leute bestimmt und wurden, raffiniert weiterverarbeitet, Tag für Tag in Reinen, Töpfen und großen Schüsseln aus dem Haus geschleppt. Sehr zu Fannys Mißbilligung. Normalerweise war alles bestens bewacht. Jetzt aber schien die Gelegenheit ungewohnt günstig. Ganz leicht hätte sie noch von der italienischen Salami abbeißen können. Oder ein paarmal mit einem Suppenlöffel in das große Glas Rhabarbermus fahren. Seltsamerweise tat sie es nicht. Nicht einmal die leckeren Vollkornplätzchen mit den Schokomandeln reizten sie noch.
Sie nickte der Katze kurz zu. »Verstehe! Manchmal kann man einfach niemand um sich haben. Aber in deinem Zustand solltest du trotzdem nicht zu lange allein sein. Deshalb komme ich wieder. Versprochen! Gleich nach dem Frühstück sehe ich noch einmal nach dir!«
Sie war schon halb auf dem Rückzug, da lief sie Til in die Arme. Sie war sich ziemlich sicher, daß sie die Dusche im Kinderbad nicht gehört hatte. Gewaschen oder nicht, er roch gut wie immer, nach einer eigenwilligen Mischung aus heller Haut, Zimt und grünen, ein wenig bitteren Gräsern. Seine langen Haare hatte er heute ausnahmsweise in einem modischen Pferdeschwanz zurückgebunden. Und er trug ein weißes Hemd mit bauschigen Ärmeln, über dem sich eine von Großpapas alten Westen besonders gut machte. Fanny bewunderte ihren großen Bruder. Auch wenn er sie ständig aufzog und seinen Freunden gegenüber so gut wie immer tat, als sei sie lästig, nichts als dicke Luft – für sie war Tilman der Held ihrer Märchen. Ein stolzer, mutiger Prinz, stets bereit, gegen Drachen, Geister und Piraten zu kämpfen. Sie mußte nur höllisch aufpassen, daß er möglichst nichts davon mitbekam. Denn das hätte bestimmt Frotzeleien ohne Ende bedeutet!
Unwillkürlich wischte sie sich mit der Hand über den Mund. Verstohlen, aber er hatte es natürlich bemerkt. Til entging so gut wie nichts.
»Ah, unser Fräulein Fanny, die Naschkatze! Und trotz der frühen Stunde schon wieder heimlich auf Beutezug?« Er lachte, und Tausende von Sommersprossen tanzten in seinem schmalen Gesicht. »Wenigstens erfolgreich, wie ich hoffe!«
»Gar nicht!« protestierte sie. »Und außerdem bist du ganz schön eklig!«
»Bin ich nicht. Das sind nur Babys unter acht. Vor allem, wenn es auch noch Mädchen sind. Was kriege ich, damit ich dicht halte?«
Es war nichts als Spaß, und sie wußte es. Trotzdem machte sie für alle Fälle ein ängstliches Gesicht.
»Ein Geheimnis«, sagte sie vielsagend. »Ich weiß etwas Tolles!«
»Laß hören!«
»Sehen«, verbesserte sie, ging zurück und stieß die Tür der Speisekammer auf. »Da! Was sagst du nun?«
»Hast du die etwa angeschleppt?« Er schien ehrlich beeindruckt. »Mensch, Kleine, du weißt genau, daß du jede Menge Ärger kriegst, wenn Evelyn oder Christoph das hier zu Gesicht bekommen.« Seitdem er letzten Winter fünfzehn geworden war, fand er es cool, die Eltern bei ihren Vornamen zu nennen. Vor allem, wenn sie nicht dabei waren. »Sieht ja eher wie ’ne getaufte Ratte aus! Wo hast du denn bloß dieses erbärmliche Vieh aufgetan? Ich wette, direkt aus der Mülltonne!«
Die Katze ließ ein schwaches, empörtes Maunzen hören, als ob sie ihn genau verstanden hätte. Fanny zwinkerte ihr verschwörerisch zu. Der meint es nicht so, sollte das bedeuten.
Die Treppe knarzte. Fanny und Til zuckten zusammen. Im letzten Moment versetzte Til der Tür den entscheidenden Schubs. Und zu war sie!
»Eine kleine Familienversammlung direkt vor der Speisekammer?« Papa war noch im Schlafanzug und sah blaß und müde aus. Obwohl er immer lange vor Mami ins Bett ging. »Etwa verursacht durch nagende Hungerattacken? Ein zarter Hinweis, daß ich mich beeilen soll? Oder darf ich es so interpretieren, daß ihr heute morgen im Stehen essen wollt?« In letzter Zeit hatte er es übernommen, für das Frühstück zu sorgen. Aber er tat es muffig und sichtlich unwillig. Und die anderen bemerkten es natürlich. Manchmal bekam nicht einmal Fanny einen Bissen herunter, wenn sie so verkrampft nebeneinander am Tisch saßen.
»Ich deck schon mal den Tisch«, sagte Til schnell. Es mußte einiges passieren, daß der um die passende Antwort verlegen war!
»Der Herr Sohn, sieh mal einer an! Heute im topmodischen Mozartlook. Wirklich extravagant, keine Frage!« Papa ging zum Herd und begann umständlich, Wasser aufzusetzen und den Toaster zu beladen. Dann griff er nach Obstkorb und Schälmesser. Jetzt kamen die doofen Äpfel und Bananen für Fannys Müsli an die Reihe! »Und welchem Umstand verdanken wir diesen ungewöhnlichen Eifer? Doch nicht etwa einem diskret verschwiegenen Mathe-Fünfer?«
Fanny zog die dunklen Brauen zusammen. Papa wußte genau, daß Til so gut wie niemals Schulprobleme hatte. Ganz im Gegensatz zu ihr! Das Heft mit der verpatzten Rechenprobe steckte noch immer in ihrem Ranzen. Natürlich ohne Unterschrift. Sie würde sich heute in der Schule schon wieder eine neue Ausrede einfallen lassen müssen. Überrascht drehte sie sich um.
Aus der Kammer kam schwaches, aber unüberhörbares Miauen. Die Katze würde sich doch nicht ausgerechnet jetzt bemerkbar machen! Ob sie hungrig war? Vielleicht hätte sie ihr lieber nicht das ganze Hühnchen wegessen sollen?
»Meine letzte Mathenote war eine Bomben-Zwei«, sagte Til beherrscht, obwohl seine Kinnmuskeln angespannt waren, »falls du dich freundlicherweise noch daran erinnern magst. Die drittbeste Arbeit der Klasse.« Auf einmal war seine helle Haut fast so rot geworden wie sein Haar. »Ich kann nämlich zufällig rechnen!«
Jetzt ging das schon wieder los! Sie würden versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen, bis einer so gekränkt war, daß er seine Fassung verlor. Meistens Papa. Tilman hatte in letzter Zeit große Fortschritte gemacht und wurde in diesem komischen Wettbewerb fast immer Sieger.
»Und was ist mit dir?« raunzte Papa jetzt sie an. »Willst du heute im Nachthemd in die Schule gehen?«