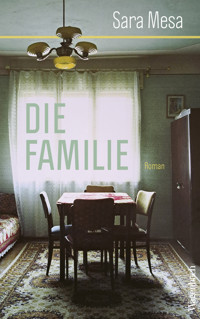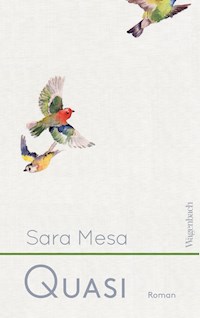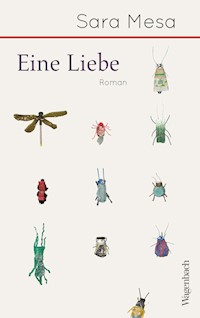
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist keine Liebesgeschichte – oder etwa doch? Sara Mesas preisgekrönter Roman über gemischte Gefühle, ein Dorf auf der Suche nach einem Sündenbock und eine Frau, die auf schmerzhafte Weise in die Eigenbrötlerei findet: beunruhigend, betörend präzise und im besten Sinne merkwürdig. Ist es Flucht? Ausweg oder Neuanfang? Nat kommt nach La Escapa, ein Dorf im spanischen Nirgendwo, und mietet sich dort ein Haus. Was sie an diesen Ort verschlägt, bleibt unklar. Eine alleinlebende junge Frau ist hier selten, und schon bald wird Nat von den Dorfbewohnern neugierig umkreist: einem Althippie, dem Mädchen aus dem Laden, einem alten Ehepaar und einem Mann, der nur »der Deutsche« genannt wird. Der Vermieter ist aufdringlich, kümmert sich aber kaum um den Zustand des Hauses: Es regnet durchs Dach, überall ist Ungeziefer. Nat ist mit dem Land-leben überfordert, fühlt sich beobachtet und doch allein – bis eines Tages »der Deutsche« vor ihrer Tür steht. Er bietet ihr an, das Dach zu reparieren, verlangt aber eine unerwartete Gegenleistung: Für Nat ist es der Auftakt einer Obsession mit dem rätselhaften unbehausten Mann. Im Dorf hingegen gerät sie zusehends in die Rolle der gefährdeten Außenseiterin. Sara Mesa verzichtet auf den Luxus des Details, ihre Sprache besticht durch Knappheit: Prägnant entwirft sie eine unheimliche Welt hinter glasigem Dunst – mit doppelten Böden, unscharfen Grenzen und moralischen Grauzonen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die spanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Un amor bei Editorial Anagrama in Barcelona.
La traducción de esta obra ha contado con la participación de Acción Cultural Española, AC/E. Die Übersetzung dieses Werks wurde gefördert von Acción Cultural Española, AC/E.
E-Book-Ausgabe 2022
© Sara Mesa, 2020 c/o Indent Literary Agency
© 2022 für die deutsche Ausgabe: Verlag Klaus Wagenbach
Emser Straße 40/41 10719 Berlin
Covergestaltung Julie August unter Verwendung von Objekten aus dem »Grossen Insektenkasten 1« (2020, Fundstücke in Objektkasten, 160 x 200 x 14 cm) © Matthias Garff. Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978 3 8031 4354 9
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 3351 9
I
Als es dunkel wird, spürt sie, wie die Last auf sie stürzt, so schwer, dass sie sich setzen muss, um Luft zu holen.
Die Stille draußen ist nicht so, wie sie es erwartet hat. Eigentlich ist es gar keine Stille. Man hört ein fernes Rauschen, wie von einer Straße, obwohl die nächstgelegene – kaum mehr als eine schmale Landstraße – drei Kilometer entfernt ist. Außerdem hört man Grillen, Hundegebell, gelegentlich die Hupe eines Autos und die Rufe eines Nachbarn, der das Vieh zusammentreibt.
Am Meer wäre es besser gewesen, allerdings auch teurer. Jenseits ihrer Möglichkeiten.
Und wenn sie noch eine Weile durchgehalten, etwas mehr Geld gespart hätte?
Sie denkt lieber nicht darüber nach. Sie schließt die Augen und lässt sich aufs Sofa fallen, wo sie nur mit dem halben Körper landet, der Rest ragt über den Rand hinaus, eine unnatürliche Haltung, von der sie Krämpfe bekommen wird, wenn sie sich nicht bald bewegt. Sie merkt es. Legt sich irgendwie zurecht. Wird schläfrig.
Nicht nachdenken ist besser, aber die Gedanken kommen wie von selbst, schweben durch sie hindurch, verbinden sich. Sie versucht, sie so schnell wieder loszuwerden, wie sie in sie eindringen, trotzdem sammeln sie sich in ihr an, ein Gedanke über dem anderen. Schon allein die damit verbundene Anstrengung – ihr Bemühen, sie eindringen zu lassen und wieder loszuwerden, ohne dass sie sich ansammeln – beschäftigt ihren Kopf mehr, als ihr guttut.
Sobald sie den Hund bekommt, wird alles einfacher sein.
Sobald sie ihre Dinge organisiert hat, ihren Tisch aufgestellt und das Gelände rings ums Haus hergerichtet hat. Sobald sie alles ausreichend gewässert und saubergemacht hat. Wie trocken es hier ist! Was für ein Dreck! Sobald es kühler wird.
Sobald es kühler wird, wird alles besser.
Der Vermieter wohnt in Petacas – eine kleine Ortschaft, mit dem Auto braucht man eine Viertelstunde bis dorthin. Er erscheint zwei Stunden später als verabredet. Nat fegt gerade die Veranda, als sie den Jeep hört. Sie blickt auf, kneift die Augen zusammen. Er hat vor ihrem Eingangstor gehalten, mitten auf dem Weg. Jetzt kommt er mit schlurfenden Schritten näher. Es ist heiß. Es ist zwölf Uhr mittags und schon unbarmherzig heiß.
Er entschuldigt sich nicht für die Verspätung. Lächelnd legt der Mann den Kopf schief. Er hat schmale Lippen und tiefsitzende Augen. Sein abgetragener Overall ist voller Ölflecken. Schwer zu sagen, wie alt er ist. Dass er so ramponiert wirkt, liegt nicht an seinem Alter, eher ist es seinem angeekelten Ausdruck geschuldet, der Art, wie er beim Gehen mit den Armen schlenkert und die Knie beugt. Er bleibt vor ihr stehen, stemmt die Hände in die Hüften und sieht sich um.
»Soso, wir legen also los, ja? Und, wie war die Nacht?«
»Gut. Mehr oder weniger. Zu viele Mücken.«
»In der Schublade der Kommode ist so ein Gerät. Mit dem kann man Mücken verscheuchen. Hast du’s nicht gesehen?«
»Doch, aber es war keine Flüssigkeit drin.«
»Tja, tut mir leid.« Lachend breitet er die Arme aus. »So ist das auf dem Land!«
Nat erwidert sein Lächeln nicht. Ein Schweißtropfen rinnt ihr über die Schläfe. Sie wischt ihn mit dem Handrücken fort und zieht aus dieser Bewegung die Kraft, die sie braucht, um zum Angriff überzugehen.
»Das Schlafzimmerfenster schließt nicht richtig, und der Hahn in der Dusche tropft. Außerdem ist alles wahnsinnig schmutzig, viel schlimmer, als ich es in Erinnerung hatte.«
Das Lächeln des Vermieters erstarrt, löst sich auf. Als er antwortet, spannt sich sein Kiefer an. Nat wird klar, dass er ein jähzorniger Mensch ist, am liebsten würde sie jetzt zurückrudern. Mit vor der Brust verschränkten Armen erklärt ihr der Mann, dass sie bei der Besichtigung genau hat sehen können, in welchem Zustand das Haus sich befindet, und wenn sie nicht alles richtig angeguckt hat, ist das ihre Schuld, nicht seine. Er erinnert sie daran, dass er für sie zweimal mit dem Preis runtergegangen ist. Zuletzt sagt er, dass er sich um alle nötigen Reparaturen kümmern wird. Nat hält das für keine gute Idee, sagt aber lieber nichts. Stattdessen nickt sie und wischt sich noch einen Schweißtropfen ab.
»Es ist sehr heiß.«
»Und daran bin wahrscheinlich auch ich schuld, oder?«
Der Vermieter dreht sich um und ruft nach dem Hund, der neben dem Jeep in der Erde scharrt.
»Wie findest du den?«
Der Hund hat bis jetzt noch nicht einmal aufgesehen. Nervös schnüffelt er auf dem Boden herum wie ein Jagdhund auf Fährtensuche. Ein Köter mit struppigem gräulichem Fell, langen Beinen und spitzer Schnauze. Er hat eine leichte Erektion.
»Und, gefällt er dir oder nicht?«
»Weiß nicht«, stammelt Nat. »Ist es ein guter Hund?«
»Natürlich ist das ein guter Hund. Einen Schönheitswettbewerb wird er nicht gewinnen, das siehst du selbst, aber das ist dir ja egal, oder? Hast du nicht gesagt, dass dir das egal ist? Er hat kein Ungeziefer und ist auch sonst in Ordnung. Er ist jung, gesund. Viel fressen tut er nicht, keine Sorge. Er sucht sich selbst hier und da, was er braucht. Er kommt gut allein zurecht.«
»Einverstanden«, sagt Nat.
Sie gehen ins Haus, sehen den Vertrag noch einmal durch, unterschreiben – sie mit einer nachlässigen Kritzelei, er feierlich, den Kugelschreiber kräftig ins Papier gedrückt. Der Vermieter hat nur ein Exemplar des Vertrags mitgebracht. Er steckt es ein und verspricht, Nat ihr Exemplar so bald wie möglich zukommen zu lassen. Nat sagt sich, dass es nicht darauf ankommt, der Vertrag ist sowieso ungültig, nicht einmal die Miethöhe, die darin aufgeführt wird, stimmt. Weder auf die Sache mit dem Fenster noch auf den tropfenden Hahn kommt sie noch einmal zu sprechen. Der Vermieter ebenso wenig. Er hält ihr theatralisch die Hand hin und verengt die Augen zu Schlitzen, als er sie ansieht.
»Besser, man versteht sich gut als schlecht«, sagt er.
Als er in den Jeep steigt und losfährt, rührt der Hund sich nicht. Er schnüffelt weiter an der ausgedörrten Erde vor dem Haus. Nat ruft nach ihm, schnalzt, pfeift, aber er macht keinerlei Anstalten, näherzukommen.
Der Vermieter hat ihr nicht mal gesagt, wie der Hund heißt. Falls er überhaupt einen Namen hat.
Müsste sie erklären, warum sie hier ist, fiele es ihr schwer, eine überzeugende Antwort zu finden. Darum weicht sie aus, als es so weit ist, beschränkt sich darauf, von einem Tapetenwechsel zu sprechen.
»Die halten dich bestimmt alle für verrückt, oder?«
Das Mädchen in dem Laden stapelt Kaugummi kauend die Einkäufe auf die Theke. Es ist der einzige Laden im Umkreis von mehreren Kilometern, er hat nicht mal ein Schild und ist vollgestopft mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln, alles wild durcheinander. Die Sachen sind teuer, und besonders viel Auswahl gibt es nicht, aber noch hat Nat sich nicht dazu durchringen können, mit dem Auto nach Petacas zu fahren. Sie zieht ihr Portemonnaie hervor und zählt die nötigen Scheine ab.
Das Mädchen hat Lust, zu reden. Sie fragt Nat hemmungslos aus, bringt sie in Verlegenheit. Wenn sie könnte, würde sie liebend gern genau das Gleiche machen, nur umgekehrt, sagt sie. Nach Cárdenas ziehen, da ist echt was los.
»Das Leben hier ist einfach nur langweilig. Nicht mal Jungs gibt es!«
Sie erzählt, dass sie früher in Petacas auf die Schule gegangen ist, aber dann hat sie abgebrochen. Das Lernen macht ihr einfach keinen Spaß, sie tut sich in allen Fächern schwer. Jetzt arbeitet sie eben im Laden mit. Ihre Mutter hat ständig Migräne, und ihr Vater muss sich um den Hof kümmern, da passt es gut, dass jemand da ist, der aushilft. Aber sobald sie achtzehn ist, haut sie von hier ab. Sie kann in Cárdenas als Kassiererin arbeiten oder Kinder hüten. Sie kann gut mit Kindern. Also mit den paar hier in La Escapa, fügt sie lächelnd hinzu.
»Dieser Ort hier ist einfach nur langweilig«, sagt sie noch einmal.
Sie klärt Nat über die Leute auf, die in den Häusern und auf den Höfen in der Gegend wohnen. Sie erzählt ihr von der Romafamilie, die bewohnt ein halbverfallenes altes Bauernhaus gleich am Ortsausgang. Die Kinder werden morgens vom Schulbus abgeholt. Es sind die einzigen Kinder, die das ganze Jahr über hier leben. Dann ist da noch das alte Ehepaar in dem kleinen gelben Haus. Sie ist eine Art Hexe, behauptet das Mädchen, sie kann die Zukunft voraussagen und Gedanken lesen.
»Die ist unangenehm, weil sie ein bisschen verrückt ist«, sagt sie lachend.
Sie redet von dem Hippie in dem Holzhaus, einem Mann, den sie den Deutschen nennen, obwohl er gar kein Deutscher ist, vom Dicken und seiner Bar, obwohl, Bar ist vielleicht ein bisschen übertrieben für den Lagerschuppen, gibt sie zu, der Dicke verkauft da Bier in Flaschen. Je nachdem, was es auf den Feldern zu tun gibt, kommen außerdem noch andere Leute hierher: Erntehelfer, die bleiben zwei Wochen, manchmal auch nur ein paar Tage. Und es gibt ganze Familien, die das halbe Jahr woanders leben und in La Escapa in Häusern wohnen, die sie geerbt haben und nicht verkauft bekommen. Aber alleinlebende Frauen sind nie zu sehen. Jedenfalls keine in Nats Alter, ergänzt sie.
»Omas zählen nicht.«
In den ersten Tagen verläuft Nat sich ständig, sie vermischt die Sachen, die das Mädchen erzählt hat – teils, weil sie ihr nicht richtig zugehört hat, teils, weil sie sich hier immer noch nicht gut genug auskennt. Wo genau La Escapa anfängt und endet, ist etwas unklar, es gibt so was wie einen Ortskern – mehrere kleine Häuser, die einigermaßen eng beieinanderstehen, darunter ihres, weiter weg stehen verstreut aber auch noch andere Gebäude, manche bewohnt, manche nicht. Von außen kann Nat nicht erkennen, ob es Wohnhäuser sind oder Schuppen oder auch Ställe, ob dort Menschen leben oder bloß Vieh darin untergebracht ist. Könnte sie sich nicht an dem Laden orientieren, der ihr manchmal vertrauter vorkommt als das Haus, das sie inzwischen seit einer Woche bewohnt, käme sie völlig durcheinander. Hübsch ist die Gegend nicht gerade, wenn abends die Umrisse verschwimmen und das Licht einen goldfarbenen Ton annimmt, entdeckt Nat darin jedoch eine gewisse Schönheit, an die sie sich klammern kann.
Sie nimmt ihre Taschen und verabschiedet sich von dem Mädchen, aber bevor sie rausgeht, dreht sie sich noch einmal um und fragt nach dem Vermieter. Ob sie ihn kenne? Das Mädchen verzieht den Mund und bewegt den Kopf langsam hin und her. Nein, nicht wirklich, sagt sie. Er wohnt schon lange in Petacas.
»Als ich klein war, habe ich ihn öfters hier gesehen, das weiß ich noch. Er war immer mit einer Menge Hunden unterwegs und ständig total schlecht drauf. Später hat er geheiratet, oder er ist mit jemand zusammengezogen, jedenfalls ist er weggegangen. Ich nehme an, seine Frau wollte nicht in La Escapa wohnen, was ich gut verstehen kann. Für Frauen ist es hier noch schlimmer. Andererseits ist Petacas auch nicht so toll. Ich würde da ums Verrecken nicht leben wollen.«
Sie versucht, den Hund mit einem alten Ball, den sie auf einem Haufen Feuerholz entdeckt hat, zum Spielen zu bewegen, aber statt sich den geworfenen Ball zu schnappen und zu ihr zurückzubringen, hinkt das Tier gleichgültig davon. Wenn sie neben ihm in die Hocke geht, um auf Augenhöhe mit ihm zu sein und ihn nicht zu erschrecken, entwischt er mit eingezogenem Schwanz. Weil er so scheu und spröde ist, nennt sie ihn Sieso – hier im Süden heißt das so viel wie Nichtsnutz, Spielverderber, Lahmarsch. Irgendwie muss sie ihn schließlich nennen. Sieso ist aber nicht nur widerspenstig, er ist völlig unzugänglich. Er streunt ums Haus herum, aber es ist, als wäre er gar nicht da. Warum soll sie mit so einem Hund zusammenleben? Selbst der hypernervöse Chihuahua-Mischling aus dem Laden ist da noch sympathischer. Alle Hunde, denen sie unterwegs begegnet – und es sind eine Menge –, kommen angelaufen, wenn sie nach ihnen ruft. Viele sind auf Essen aus, zweifellos, aber gestreichelt werden wollen sie auch. Sie sind neugierig, ja aufdringlich, sie möchten unbedingt wissen, wer die neue Nachbarin ist, die jetzt hier wohnt. Sieso dagegen scheint sich nicht mal fürs Fressen zu interessieren. Wenn sie ihm etwas hinstellt, gut; wenn nicht, auch gut. Was das angeht, hat der Vermieter ihr nichts vorgemacht: Dieser Hund kostet sie kaum Geld. Manchmal schämt Nat sich für ihr Gefühl der Ablehnung. Sie wollte schließlich einen Hund, und jetzt hat sie einen. Da kann – darf – sie doch nicht sagen – ja, nicht mal denken –, dass sie ihn nicht haben will.
Eines Morgens begegnet sie im Laden dem Hippie. So hat das Mädchen ihn genannt, das sie beide jetzt ohne jede Eile bedient. Währenddessen raucht sie seelenruhig eine Zigarette. Der Hippie ist etwas älter als Nat, aber wahrscheinlich noch keine vierzig. Er ist groß und kräftig, hat sonnengegerbte Haut, große, rissige Hände und einen entschlossenen, jedoch friedfertigen Blick. Er hat langes, schlecht geschnittenes Haar und einen leicht rötlichen Bart. Nat fragt sich, warum das Mädchen ihn Hippie nennt. Vielleicht wegen der langen Haare oder weil er, wie Nat, nicht von hier ist, sondern aus der Stadt kommt, was für jemanden, der von klein auf in La Escapa lebt und sich nichts so sehr wünscht, wie von hier abzuhauen, unbegreiflich sein muss. Andererseits lebt der Hippie schon lange hier. Darum stellt er keine Besonderheit mehr dar, anders als Nat, die vorläufig für alle die Neue ist. Nat betrachtet ihn aus dem Augenwinkel, seine abrupten, zielsicheren Bewegungen. Während er darauf wartet, dass er an die Reihe kommt, streicht er der kastanienbraunen Hündin, die ihn begleitet, über den Rücken: eine alte, aber unbestreitbar elegante Labradordame. Sie wedelt mit dem Schwanz und schiebt ihm die Schnauze zwischen die Beine. Alle drei lachen.
»Du bist aber eine Liebe«, sagt Nat.
Der Hippie nickt und hält Nat die Hand hin. Dann überlegt er es sich anders, zieht die Hand zurück und tritt stattdessen auf sie zu, um sie zur Begrüßung auf die Wangen zu küssen. Er belässt es allerdings bei einer, was zur Folge hat, dass Nat anschließend mit vorgebeugtem Kopf dasteht und vergeblich auf den zweiten Kuss wartet. Jetzt sagt der Hippie ihr seinen Namen: Píter. »Das schreibt man mit i«, erläutert er. »Pe-I-Te-E-Er.« Zumindest er schreibt das gerne so, außer wenn es um offizielle Angelegenheiten geht. Je seltener man seinen echten Namen schreibt, desto besser, sagt er scherzend. Den echten Namen braucht man nur, wenn man bei diesen Dieben von der Bank unterschreiben muss.
»Natalia«, stellt sie sich nun vor.
Dann folgt die obligatorische Frage, was sie in La Escapa macht. Er hat sie herumlaufen sehen und auch, wie sie das Gelände rings ums Haus gesäubert hat. Hat sie vor, richtig dort zu wohnen? Allein? Nat wird unruhig. Ihr wäre es lieber, wenn ihr niemand bei der Arbeit zusähe, erst recht nicht, wenn sie nichts davon mitbekommt. Aber was soll sie machen? Das zum Haus gehörende Grundstück ist nur durch einen feinen, nicht von Büschen oder anderen Pflanzen bedeckten Maschendraht von der restlichen Umgebung abgetrennt. Sie sagt, sie bleibe bloß ein paar Monate.
»Den Hund habe ich auch gesehen. Den hast nicht du mitgebracht, stimmt’s?«
»Woher weißt du das?«
Píter gibt zu, dass er den Hund gut kennt. Einer von den vielen Hunden des Vermieters. Wahrscheinlich der schlechteste. Der sammelt die Hunde von überallher ein, bringt ihnen aber nichts bei, lässt sie auch nicht impfen, kümmert sich nicht im Geringsten um sie. Er benutzt sie eine Weile und setzt sie dann wieder aus. Hat sie ihn um einen Hund gebeten? Sie kann sich sicher sein, dass er ihr den überlassen hat, der am wenigsten taugt.
Nat sieht ihn nachdenklich an, und er sagt, sie solle den Hund einfach zurückgeben. Wenn er nicht das ist, was sie will, gibt es keinen Grund, sich mit ihm abzufinden. Außerdem sagt er, der Vermieter sei ein unangenehmer Typ, es sei besser, ihn auf Abstand zu halten. Er spreche nicht gern schlecht über andere Menschen, bekräftigt er, aber bei dem Vermieter sei es etwas anderes. Der denke immer nur darüber nach, wie er die Leute reinlegen könne.
»Wenn du magst, besorg ich dir einen Hund.«
Immer noch unruhig, kehrt Nat nach Hause zurück. Mit einem nicht übermäßig kalten Bier in der Hand – auch der Kühlschrank funktioniert nicht richtig – setzt sie sich vor die Tür und betrachtet Sieso, der am Zaun in der Sonne liegt und schläft. Auf seinem leicht angeschwollenen Bauch voller alter Wundmale lassen sich immer wieder Fliegen nieder.
Mit der Vorstellung, ihn zurückzugeben, kann sie sich nicht im Geringsten anfreunden.
Das niedrige Haus besteht nur aus einem Geschoss, die Fenster setzen sehr tief an, und im Schlafzimmer stehen zwei neunzig Zentimeter breite Betten. Eins davon wäre Nat gerne los, sie braucht es nicht. Stattdessen möchte sie einen Schreibtisch dort hinstellen – ein einfaches Brett und zwei Böcke würden völlig genügen. Sie überlegt, ob sie den Vermieter anrufen soll, damit er das eine Bett abholt, schiebt die Sache aber immer wieder auf. Sie wird ihn darum bitten, wenn sie ihn das nächste Mal sieht – früher oder später wird es sowieso dazu kommen –, bis dahin hat sie eben keinen Schreibtisch. Vorläufig behilft sie sich mit dem einzigen Tisch, den es im Haus gibt. Sie schiebt ihn ans Fenster, selbst bei hellem Tageslicht ist es im Inneren nämlich düster und feucht. Die Küche – nicht viel mehr als ein Herd und eine Arbeitsplatte – ist derart in eine Ecke gezwängt, dass Nat, selbst wenn sie sich bloß einen Kaffee machen will, das Licht einschalten muss. Für draußen gilt das genaue Gegenteil – vom frühen Morgen an knallt die Sonne auf das Grundstück, selbst wenn sie sehr zeitig zu arbeiten beginnt, ist sie schnell erschöpft. Sie versucht, Furchen zu ziehen, um Paprika, Tomaten und Karotten anzupflanzen, was auch immer, Hauptsache, es wächst schnell und gut. Sie hat alles Mögliche darüber gelesen und sich sogar mehrere Videos angesehen, in denen Schritt für Schritt erklärt wird, wie man vorgehen muss. Als sie das Ganze aber praktisch umsetzen soll, scheitert sie vollständig. Sie wird ihre Scham überwinden und jemanden um Hilfe bitten müssen. Vielleicht Píter.
Nachmittags setzt sie sich für eine oder zwei Stunden an ihre Übersetzung. Sie schafft es jedoch nie, die nötige Konzentration aufzubringen. Vielleicht braucht sie eine gewisse Eingewöhnungszeit, sagt sie sich, vorläufig sollte sie sich deshalb jedenfalls nicht verrückt machen. Um den Kopf frei zu kriegen, geht sie in der Umgebung spazieren. Sieso weigert sich allerdings, mitzukommen, sie kann noch so oft nach ihm rufen. Also macht sie sich allein auf den Weg und hört dabei Musik über ihren Kopfhörer. Wenn sie sieht, dass jemand in ihre Nähe kommt, zwingt sie sich, ihren Schritt zu beschleunigen, ja sogar ein wenig zu joggen. Sie möchte lieber unauffällig bleiben, nicht gezwungen sein, sich vorzustellen oder sich zu unterhalten, selbst wenn sie dafür so tun muss, als würde sie Sport treiben.
In der von der langen Trockenheit ausgedörrten Landschaft stehen vereinzelte Olivenbäume, Kork- und Steineichen. Wenn hier und da etwas blüht, sind es einzig und allein die ärmlichen, klebrigen Zistrosen. Das Einzige, was sich von den eintönigen Feldern abhebt, sind die Umrisse des Glauco – ein niedriger, mit Büschen und Gestrüpp bewachsener Berg, der wie mit Kohle auf den Hintergrund des wolkenlosen Himmels gezeichnet scheint. Auf dem Glauco soll es noch Wildschweine und Füchse geben, an den Gürteln der Jäger, die sich dorthin aufmachen, hängen bei ihrer Rückkehr jedoch immer nur Rebhühner und Kaninchen. Irgendwas ist unheimlich an diesem Berg, sagt sich Nat, versucht den Gedanken aber gleich wieder zu verscheuchen. Warum unheimlich? Der Name ist auf jeden Fall hässlich, zweifellos – Glauco, der Graugrüne. Sie nimmt an, dass die Bezeichnung seinem blässlich-fahlen Farbton geschuldet ist. Andererseits muss sie bei dem Wort Glauco an ein krankes Auge denken, eines mit entzündeter Bindehaut, oder an die gläsernen und geröteten, wie verschleierten Augen alter Menschen. Ihr ist klar, dass sie sich vom Begriff des Glaukoms verleiten lässt. Zufälligerweise ist das Wort gerade erst in dem Text aufgetaucht, den sie zu übersetzen versucht, im Zusammenhang mit der Hauptfigur, einem furchteinflößenden Vater, der in einem bestimmten Moment einen seiner Söhne mit einem für diesen äußerst schmerzhaften Fluch belegt. Nat hat zunächst zu verstehen geglaubt, der Vater leide an einer Augenkrankheit, bis sie begriffen hat, dass der Blick, mit dem der Vater seinen Sohn bedenkt, laut dem Text leer und ausdruckslos sein soll, als wäre die Pupille wie abgestorben, fast undurchlässig. Was soll sie an dieser Stelle also schreiben? Gräulich-grün, bläulich-grün, kränklich, verschwommen, unstet? Je nachdem, wofür sie sich entscheidet, muss sie den Rest des Absatzes danach ausrichten. Einfach wörtlich zu übersetzen, ohne die wahre Bedeutung der Stelle zu erfassen, wäre Schummelei.
Trotz der Wanderungen und der körperlichen Arbeit schläft sie nachts schlecht. Die Fenster zu öffnen traut sie sich nicht. Nicht nur wegen der Mücken, die sie zerstechen, trotz all der Mittel, die sie besorgt hat. In den ersten Nächten sind außerdem Spinnen, Geckos und einmal sogar ein Hundertfüßer ins Haus gekommen – Letzteren hat sie zu ihrem Entsetzen in einem Schuh entdeckt. Und eines Morgens war die Küche voller Ameisen, weil sie vergessen hatte, das Essen in den Kühlschrank zu stellen. Tagsüber umschwirren sie die Fliegen, draußen wie drinnen. Lässt sich das irgendwie ändern?, fragt sie sich. Oder ist das eben so auf dem Land, wie ihr Vermieter sagen würde? Ständig ist alles dreckig, da kann sie noch so viel putzen. Sie fegt und fegt, aber der Staub dringt durch jede Ritze und sammelt sich in den Ecken an. Wenn sie für die Nächte wenigstens einen Ventilator hätte, sagt sie sich, könnte sie die Fenster zumachen, und alles wäre angenehmer. Dann wäre sie morgens ausgeruht und hätte mehr Kraft zum Putzen und Übersetzen und für die Arbeit an dem, was irgendwann ein Garten werden soll. Den Vermieter würde sie jedoch um nichts auf der Welt nach einem Ventilator fragen.
Sie beschließt, nach Petacas zu fahren und dort einen zu kaufen. Bei der Gelegenheit, sagt sie sich, könnte sie sich auch das eine oder andere Werkzeug zulegen. Eine Hacke, Eimer, einen Spaten, eine Heckenschere, ein Sieb und noch ein paar Sachen, vorausgesetzt, sie findet heraus, wie das, was sie sucht, genau heißt.
Auch von Werkzeug hat sie keine Ahnung.
Sie ist erstaunt über das Gedränge in Petacas. Erst nach langer Suche findet sie einen Parkplatz. Die Straßenführung ist ein einziges Wirrwarr und die Beschilderung so widersprüchlich, dass es ohne Weiteres passieren kann, dass man kurz nach der Einfahrt in den Ort durch eine plötzliche Umleitung wieder draußen ist. Die Häuser sind bescheiden, die meist schmucklosen Fassaden in sehr schlechtem Zustand. Dazwischen erheben sich, keinem nachvollziehbaren Plan folgend, bald hier, bald da bis zu sechsstöckige Wohnblocks aus Ziegelstein. Der Großteil der Geschäfte befindet sich in der Umgebung des Marktplatzes. Um das Rathaus – ein protziges Gebäude mit weit hervorragenden Vordächern und riesigen Glasfenstern – drängen sich Bars und von Chinesen betriebene Billigläden. In einem davon kauft Nat einen kleinen Ventilator. Anschließend macht sie sich auf die Suche nach einer Eisenwarenhandlung. Sie kann sich nicht dazu aufraffen, jemanden zu fragen. Sie findet es auffällig, wie nachlässig die Frauen herumlaufen, schlecht frisiert und in ausgetretenen Schlappen. Viele Männer, selbst alte, tragen ärmellose Shirts. Kinder gibt es nur wenige, die, die zu sehen sind, lutschen an Wassereisstangen, rennen herum oder wälzen sich unbeaufsichtigt auf dem Boden. Alle – Männer, Frauen und Kinder – sehen sich seltsam ähnlich und sind gleichermaßen laut und zügellos. Eine Folge der Inzucht, sagt sich Nat und denkt, ihr Vermieter passt perfekt in diese Umgebung.
Sie hat Angst, sie könne ihm über den Weg laufen, aber wen sie stattdessen in der Eisenwarenhandlung trifft, ist Píter. Sie freut sich, ihn zu sehen: endlich jemand, den sie kennt, endlich ein freundlicher Mensch, der lächelnd auf sie zukommt und fragt, was sie hier macht. Nat zeigt ihm die Schachtel mit dem Ventilator, und Píter runzelt die Stirn. Er fragt, warum sie sich nicht von ihrem Vermieter einen hat geben lassen. Er ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die vermieteten Räume in bewohnbarem Zustand sind. Eine Klimaanlage wäre sicher ein bisschen viel verlangt, aber einen Ventilator müsste er sehr wohl zur Verfügung stellen.
»Du hättest auch mich fragen können, unter Nachbarn hilft man sich schließlich.«
Nat versucht, sich herauszureden. Sie sagt, einen Ventilator kann sie so oder so gebrauchen. Wenn sie wieder aus La Escapa wegzieht, nimmt sie ihn mit. Píter sieht sie aus dem Augenwinkel an und gibt ihr zu verstehen, dass er ihr das nicht glaubt.
»Und was machst du hier? Willst du alles, was in dem Haus kaputt ist, selbst reparieren?«
Nat schüttelt den Kopf.
»Nein, ich brauche Sachen für den Garten.«
»Du willst einen richtigen Garten anlegen, Gemüse anbauen?«
»Na ja, nur was Einfaches … Paprika und Auberginen sind angeblich unkompliziert. Ich will’s wenigstens versuchen.«
Píter nimmt sie am Arm und kommt näher an sie heran.
»Kauf hier mal lieber nichts«, flüstert er.
Dann sagt er, er könne ihr Werkzeug leihen, alles, was sie braucht. Und er sagt, den Plan mit dem Gemüsegarten solle sie vielleicht doch besser aufgeben. Auf ihrem Grundstück sei schon seit Jahren nichts mehr angebaut worden, die Erde sei völlig unfruchtbar. Wenn sie die in einen halbwegs brauchbaren Zustand versetzen wolle, bedeute das tagelange harte Arbeit, abgesehen davon, dass sie eine gehörige Stange Geld für Düngemittel werde aufwenden müssen. Sollte sie trotzdem darauf beharren – der Ausdruck fällt Nat auf: beharren –, könne er ihr helfen, aber zuraten könne er ihr definitiv nicht. Píter redet mit sanfter Stimme auf sie ein, trotzdem strahlen seine Worte eine Sicherheit aus, der sich nichts entgegenhalten lässt, die Sicherheit des Kenners und Fachmanns. Nat nickt und wartet, bis er seinen Einkauf beendet hat. Kabel, Adapter, Schrauben, eine Zange – alles hochprofessionell, alles sehr spezifisch, aufs Geratewohl zugreifen wie sie kommt ihm nicht in den Sinn.
Draußen auf der Straße geht Píter mit sportlichem Gang neben ihr her, sehr aufrecht und dennoch beweglich. Im Vergleich zu den anderen, die hier unterwegs sind, sind seine Bewegungen von unerhörter Eleganz. Nat erfüllt es mit Stolz, seine Begleiterin zu sein – als wäre ihre Anwesenheit an diesem Ort auf einmal vollkommen gerechtfertigt. Der Zauber verfliegt, als Píter auf die großen Glasfenster des Rathauses deutet.
»Sind die nicht schön? Die habe ich gemacht.«
Nat findet, dass sie überhaupt nicht zu der Ziegelfassade des Gebäudes passen, sagt aber genau das Gegenteil: Es sei toll, wie sie sich ins Ganze einfügen würden. Píter sieht sie wohlwollend an. Genau, sagt er, eben darauf komme es ihm bei seiner Arbeit an – dass die Dinge eine harmonische Verbindung mit dem eingehen, was schon da ist.
»Es gibt bestimmt hübschere Orte auf der Welt als Petacas, das sollte einen aber nicht daran hindern, so viel wie möglich dafür zu tun, dass die eigene Umgebung schöner wird, findest du nicht?«
»Das heißt, du bist …?« Nat weiß nicht genau, wie man jemanden nennt, der Glasfenster anfertigt.
»Glaser? Ja. Na gut, nicht einfach nur Glaser. Man könnte sagen, ich arbeite künstlerisch mit Glas und Farbe. Also jedenfalls begnüge ich mich nicht damit, Glas in Fensterrahmen zu montieren …«
»Klar.« Nat lächelt.
In einer Kneipe am Marktplatz trinken sie ein Bier. Es ist eiskalt, Nat schmeckt es gut. Píter sieht sie aufmerksam an – ein bisschen zu aufmerksam, sagt sich Nat –, aber sein sanfter Blick mildert den unguten Eindruck. Sie kommen wieder auf den Vermieter zu sprechen – den dreisten Kerl, wie Píter sagt –, dann auf das Werkzeug und das unbrauchbare Gelände. Píter sagt noch einmal, er könne ihr alles Nötige leihen. Sie brauche das Grundstück bloß gründlich zu säubern und Platz für einen kleinen Tisch und zwei Liegestühle schaffen. Anschließend könne sie ein paar Oleanderbüsche und Yuccapalmen anpflanzen, oder Kakteen und andere an das strenge Klima angepasste Sukkulenten. Gleich bei Petacas gebe es ein riesiges, sehr billiges Gartencenter, sie könnten irgendwann mal zusammen dorthin fahren, wenn sie möchte. Von Gemüseanbau ist längst keine Rede mehr. Nat kommt ihrerseits auch nicht darauf zurück.
Die nächsten Tage widmet sie dem Außenbereich des Hauses. Um der Hitze zu entgehen, steht sie früh auf. Trotzdem läuft der Schweiß nur so an ihr hinab, und das Gefühl, schmutzig und ungewaschen zu sein, verlässt sie den ganzen Tag über nicht. Sie schrubbt die Veranda, kratzt und schmirgelt den Holzboden und die Balken der Pergola ab, ölt alles ein, stutzt die halbverdorrten überschüssigen Zweige, jätet Unkraut und füllt Müllsack um Müllsack – mit Papierresten, Laub, Eisen- und Plastikteilen, leeren Dosen, noch mehr abgestorbenen Zweigen. Am Ende hat sie eine gar nicht so kleine Freifläche mit rissigem Boden vor sich. Würde das Haus ihr gehören, sagt sie sich, würde sie jetzt Rasen säen, und vielleicht auch die von Píter empfohlenen Oleanderbüsche pflanzen, als natürlichen Sichtschutz, um unerwünschte Zuschauer auf Abstand zu halten. Aber das ist natürlich Quatsch, das Haus gehört ihr nun mal nicht, also wird sie auch nicht umsonst so viel Arbeit dafür aufwenden.
Eines Morgens streckt die Romafrau vom Ortsrand den Kopf herein und fragt, ob sie an Blumentöpfen interessiert ist.
»Ich hab’n ganzen Haufen davon«, sagt sie.