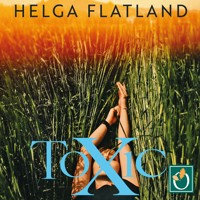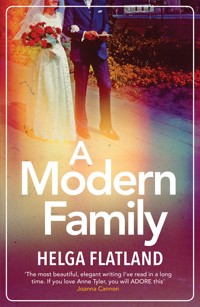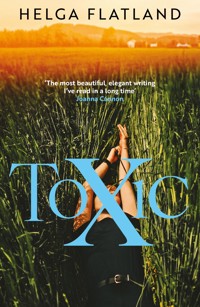17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Eine ganz normale norwegische Familie: Mama, Papa, die erwachsenen Kinder Liv, Ellen und Håkon und die Enkel Agnar und Hedda. Alle gehen ihren interessanten Berufen nach, verstehen sich gut. Feiern gemeinsam die Feste des Jahres. Treffen sich sonntags mit ihren zum Teil wechselnden Partnern zum Essen bei den Eltern. Im Sommer verbringt man Zeit in der Familien-Hütte in den Bergen. Und dann das: Am siebzigsten Geburtstag von Papa verkünden die Eltern, daß sie sich scheiden lassen wollen. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Wie in einem Mikado-Spiel, bei dem ein herausgezogenes Stäbchen die Balance zum Einsturz bringen kann, bricht die Familienidylle zusammen, es gibt scheinbar keinen sicheren Boden mehr. Auch das Leben der Kinder gerät in profunde Unordnung. Erzählt wird diese spannende Geschichte über die Untiefen des Familienlebens abwechselnd von Liv, Ellen und Håkon. Durch diesen Kunstgriff gewinnt der Roman einen einzigartigen Perspektivenreichtum und zeichnet konturscharf das Bild moderner Menschen und ihrer Kämpfe, Verletzungen und Träume.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2019
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe En moderne familie erschien 2017.
© 2017, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS
Published in agreement with Oslo Literary Agency.
Die Übersetzung wurde mit finanzieller Unterstützung von NORLA publiziert.
Lektorat: Stefan Weidle
Korrektur: Kim Lüftner, Ludger Tolksdorf
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: August 2019
ISBN 978-3-95988-144-9
Über das Buch
Eine ganz normale norwegische Familie: Mama, Papa, die erwachsenen Kinder Liv, Ellen und Håkon und die Enkel Agnar und Hedda. Alle gehen ihren interessanten Berufen nach, verstehen sich gut. Feiern gemeinsam die Feste des Jahres. Treffen sich sonntags mit ihren zum Teil wechselnden Partnern zum Essen bei den Eltern. Im Sommer verbringt man Zeit in der Familien-Hütte in den Bergen.
Und dann das: Am siebzigsten Geburtstag von Papa verkünden die Eltern, daß sie sich scheiden lassen wollen. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Wie in einem Mikado-Spiel, bei dem ein herausgezogenes Stäbchen die Balance zum Einsturz bringen kann, bricht die Familienidylle zusammen, es gibt scheinbar keinen sicheren Boden mehr. Auch das Leben der Kinder gerät in profunde Unordnung. Erzählt wird diese spannende Geschichte über die Untiefen des Familienlebens abwechselnd von Liv, Ellen und Håkon. Durch diesen Kunstgriff gewinnt der Roman einen einzigartigen Perspektivenreichtum und zeichnet konturscharf das Bild moderner Menschen und ihrer Kämpfe, Verletzungen und Träume.
Über die Autorin
Helga Flatland (Jg. 1984) hat für ihren fünften Roman, Eine moderne Familie (2017), den »Preis der norwegischen Buchhändler« erhalten. Das Buch wird derzeit in mehrere Sprachen übersetzt – in Norwegen wurden bereits über 100.000 Exemplare verkauft. Helga Flatland hat norwegische Sprache und Literatur an der Universität Oslo studiert und danach ein Aufbaustudium an der Westerdals School of Communication absolviert. Sie lebt in Oslo.
Über die Übersetzerin
Helga Flatland
Eine moderne Familie
Roman
Liv
Die Alpenzinnen sind wie Haizähne, sie spitzen aus einem im Zuschnappen erstarrten Maul durch die über Mitteleuropa hängende dichte Wolkendecke. Sie verwirbeln den Wind, er reißt von allen Seiten am Flugzeug, und wir sind darin so klein, die Hinterköpfe vor mir ruckeln im Takt. In dem Landstrich unter uns findet über die Hälfte der Bevölkerung es in Ordnung, Kinder zu schlagen, denke ich, und für einen Moment suche ich mit dem Blick nach meinen eigenen, die vier Reihen weiter vorne hinter den Rückenlehnen der Sitze völlig verschwinden. Daneben Olaf, dessen Kopf halb an der Kabinenwand, halb am Sitz lehnt. Vor ihm Ellens blonder Scheitel, und durch die Sitze hindurch sehe ich, daß Mamas Kopf an Ellens Schulter ruht, sie schläft. Papa kommt den Mittelgang entlang, um den Hals die neuen Bose-Kopfhörer, hatte er die etwa auf dem Klo dabei? Ein plötzliches Gefühl tiefer Zuneigung, ich lächle ihn an, aber er bemerkt mich nicht. Er setzt sich neben Håkon, dessen Gesicht ich nur teilweise sehen kann, die hohen Wangenknochen und die Nasenspitze vom Licht des Computers vor ihm leicht bläulich gefärbt.
Sie könnten irgendwer sein. Wir könnten irgendwer sein.
In Rom regnet es. Darauf sind wir vorbereitet, seit drei Wochen checken wir täglich die Wettervorhersage, besprechen sie am Telefon, in Textnachrichten und in der Facebook-Gruppe und sagen, es spiele keine Rolle, es sei April und das Wetter unvorhersehbar, und wärmer als in Norwegen wäre es allemal, das Wetter ist ja nicht der Grund für unsere Reise – trotzdem war die Stimmung bei zwanzig Grad und Frühlingssonne am Flughafen in Gardermoen eindeutig besser als jetzt in Fiumicino bei dreizehn Grad und Regen. Ist vielleicht auch einer Art verfrühter Antiklimax geschuldet, unsere Nervosität und gegenseitige Zugewandtheit aus Gardermoen sind im Laufe des Flugs abgeflaut, erste Etappe geschafft, alle atmen vorsichtig auf.
Daß die anderen jetzt mit mir hier sind, fühlt sich wie ein Eindringen in meine Privatsphäre an, sogar am Flughafen. Ich versuche Olafs Blick aufzufangen, möchte eine Bestätigung dafür, daß er das auch so empfindet: Rom und alles Drumherum, alles, was damit zusammenhängt, gehört uns. Durch die Ankunftshalle zu gehen ist heute anders, ich atme nicht so befreit auf, wie wenn Olaf und ich allein hier sind, ich spüre nicht dasselbe Kribbeln. Aber Olaf ist gerade damit beschäftigt, Zugtickets für alle zu besorgen, und ich ärgere mich über meine Undankbarkeit, meine Egozentrik. Als Wiedergutmachung nehme ich Hedda auf den Arm, küsse sie auf die Nase und frage, ob ihr das Ruckeln im Flugzeug Angst gemacht habe. Sie windet sich in meinen Armen, bestimmt zuckergeschockt von den Keksen und der Schokolade, die Olaf nur im äußersten Notfall zum Einsatz bringen sollte.
Wir werden zwei Tage in Rom bleiben, dann fahren wir weiter zu dem Ferienhaus von Olafs Bruder in einem kleinen Dorf an der Küste. Zwei Tage sind zu kurz und zu lang, schießt es mir durch den Kopf, während ich die kleine Familie, die ich mit Olaf geschaffen habe, und auch die, aus der ich komme, mit neuen Augen betrachte.
In vier Tagen wird Papa siebzig. Bei seiner Geburtstagsfeier letztes Jahr hat er mit der Gabel an sein Glas geklopft und verkündet, nächstes Jahr werde er sich und seiner ganzen Familie zum Geburtstag eine Reise schenken. »Wohin auch immer«, hat er laut gesagt, sich zur damals vierjährigen Hedda umgedreht und ergänzt: »Vielleicht fahren wir ja nach Afrika!«
Die Idee an sich, die Art, wie er sie bekanntgab, und seine beinahe exaltierte Stimmung in den Monaten vor seinem Neunundsechzigsten sahen ihm gar nicht ähnlich, weswegen Ellen mir in der Zeit danach täglich eine Liste von Symptomen bei Gehirntumor schickte. »Bestimmt nur seine Reaktion darauf, bald siebzig zu werden«, meinte Olaf, wogegen Ellen und ich heftig widersprachen: Er sei nicht der Typ, der auf sein Alter reagiere, über Leute mit sogenannten Krisen anläßlich von Geburtstagen sowie deren Kompensation mit auffälligen Verhaltensweisen habe er sich immer lustig gemacht, das sei nur eine Maskierung anderer Bedürfnisse. Und da Papa nicht krank wirkte und auch nicht anderweitig in einer Krise und unsere Besorgnis sowieso nicht unsere Lust auf einen gesponserten Urlaub übertrumpfen konnte, gingen Ellen und ich dem nicht weiter nach.
Wir sind schon seit ungefähr zwanzig Jahren nicht mehr zusammen im Urlaub gewesen, nicht mehr, seit »Familie« nur Ellen, Håkon, ich, Mama und Papa waren. Gelegentlich haben wir Überschneidungen unserer Aufenthalte in der Sommerhütte geplant, dann blieben Mama, Papa, Håkon und vielleicht auch Ellen ein paar Tage länger, bevor Olaf, ich und die Kinder übernahmen, aber so eine Reise, eine geplante Wir-fahren-jetzt-gemeinsam-in-Urlaub-Reise, haben wir nicht unternommen, seit ich Anfang Zwanzig war und in der Provence gemeinsam mit Ellen und Håkon auf der Rückbank eines Mietwagens saß.
Ich kann mich nicht daran erinnern, daß wir uns damals so fremd gewesen wären wie jetzt. Fernab von Oslo und unserem Elternhaus in Tåsen, ohne die gewohnten Rahmen, die Muster unserer Gespräche, unserer Treffen, ohne unsere festen Plätze am Tisch, hat sich die Dynamik irgendwie verändert. Jetzt weiß keiner mehr, wie soll man sich aufführen, wie sich anpassen, welche Rolle übernimmt man. Vielleicht liegt es auch daran, daß wir drei erwachsene Kinder im Urlaub mit ihren Eltern sind.
Die Afrika-Idee wurde schnell verworfen – von allen außer von Hedda –, und genaugenommen schlug Olaf Italien als Reiseziel vor, wir könnten ins Haus seines Bruders fahren. Olaf achtet darauf, nie irgend jemandem etwas schuldig zu sein, und der Gedanke, Papa könnte ihm und seinen Kindern die Reise bezahlen, war ihm schnell unerträglich geworden. »Aber du kannst ihm kein Geld anbieten«, sagte ich, »das ist zu überheblich.« Als Kompromiß bezahlt Papa die Flugtickets und das Hotel in Rom, und den restlichen Urlaub wohnen wir umsonst im Haus von Olafs Bruder.
Wir sind für Italien viel zu groß. Hochgewachsen, hellhäutig und blond, im Restaurant passen wir kaum um den Tisch. Das Mobiliar und seine Anordnung ist für putzige kleine Italiener gemacht, nicht für Papa und Håkon mit ihren einsfünfundneunzig, nicht für so lange Arme und Beine, nicht für uns. Wir zwängen uns auf die Stühle, überall Ellbogen, Knie, viel zu viele aneinanderstoßende Glieder. Ellen und Håkon rangeln um Platz, sind plötzlich wieder Teenager ; mir fallen die markanten Nähte zwischen den Sitzpolstern auf dem Rücksitz unseres Autos ein, die wir als Grenzlinien nutzten – nicht mal ein Jackenzipfelchen durfte die eigene Linie überqueren. Sogar der Luftraum rundherum wurde von diesen Nähten definiert. Håkon war erst drei, sein Aufwachsen war begleitet von Linien im Auto und von Schwestern, die Regeln aufstellten, im Zelt, am Eßtisch und im Leben generell.
Am Tisch neben uns sitzt eine italienische Familie, sie sind mehr als wir, ihr Tisch ist kleiner, und sie verspeisen ein Gericht nach dem anderen, wie das Olaf und ich bei unserem ersten Mal in Rom ausprobiert hatten. Wir sagten zum Kellner, wir hätten gerne genau das gleiche wie die Familie am Nebentisch. Ich hatte das schon öfter beobachtet, wie sich diese großen italienischen Familien jeden Abend stundenlang zum Essen niederließen, mit ihren Kindern und den Großeltern, lautstark redend und wild gestikulierend wie im Film, und ich vermißte meine eigene Familie – auch wenn ich bereits damals wußte, es wäre nicht dasselbe, wenn die anderen tatsächlich da wären. Hier. Jetzt sind sie hier, wir sind jetzt hier, an diesem Tisch: Mama, Papa, Ellen, ihr Freund Simen, Agnar und Hedda, Olaf und ich – und Håkon.
Mein Blick geht zu Papa, er sitzt am Tischende, und mir wird schlagartig bewußt, daß wir uns genauso hingesetzt haben wie bei Mama und Papa zu Hause. Papa sitzt am Kopf, Mama links von ihm, ich neben ihr – und Håkon ihr gegenüber, daneben Ellen. Wer später dazugestoßen ist, Lebenspartner, Olaf, Agnar und Hedda, hat sich unserer Sitzordnung anpassen müssen, ich glaube nicht, daß wir darüber nachgedacht haben. Der einzige, der einen stillen Aufstand geprobt hat, ist Simen – die paar Mal, die er bei Familientreffen anwesend war, plumpste er auf den Stuhl neben Ellen, eigentlich Håkons Platz, legte den Arm auf ihre Stuhllehne und klammerte sich demonstrativ fest, bis sich alle anderen gesetzt hatten.
Papas volles Haar ist grau: An die dunklen Haare, die er auf meinen Kindheitsfotos hat, erinnere ich mich nur vage – in meiner Erinnerung ist er schon immer so grau wie jetzt. Unsere Blicke begegnen sich, und er lächelt, ich frage mich, was er denkt, ob er zufrieden ist, ob er sich das so vorgestellt hat. Vielleicht hat er sich überhaupt nichts vorgestellt, normalerweise stellt er sich nichts vor, läßt aber immer Kommentare über mich und meine Vorstellungen ab: »Du mußt versuchen, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, Liv«, hat er gesagt, als ich jünger war und völlig verzweifelt geheult habe, weil die Ferien, ein Handballspiel oder ein Schulaufsatz anders geworden waren, als ich mir das vorgestellt hatte, und obendrein wegen der Unmöglichkeit, Papa klarzumachen, wie entscheidend es war, daß alles exakt so wurde, wie ich mir das ausgemalt hatte, daß alle großen wie auch kleinen Ereignisse und Leistungen einem vorhersehbaren Verlauf folgen mußten, um kein unfaßbares Chaos entstehen zu lassen. »Man kann das Leben aber nicht bis ins Detail planen«, hat Papa gesagt, »du mußt akzeptieren, daß du nicht die ganze Zeit alles unter Kontrolle hast!«
Jetzt beugt er sich zu Mama, mittlerweile hört er auf dem linken Ohr, das am Eßtisch ihr zugewandt ist, schlechter, sie hebt die Hand und schirmt ihre Worte gegen den Restaurantlärm ab – oder andersrum. Papa sieht sie nicht an, er lächelt und nickt.
»Na, habt ihr euch entschieden?« fragt er laut in die Runde und wedelt mit der Speisekarte, noch ehe Mama die Hand wieder gesenkt hat.
Seit wir die Karten bekommen haben, sind gerade zwei Minuten vergangen, und er hat seine noch nicht einmal aufgeschlagen.
»Erst mal sollten wir vielleicht Wein bestellen«, sagt Mama.
Auch darauf geht Papa nicht ein. Aufmerksam studiert er jetzt die Speisekarte. Sie beugt sich zu seinem schwerhörigen Ohr und wiederholt ihre Worte laut, und er nickt noch einmal, wortlos, sieht nur nach unten. Mama lächelt, aber nicht zu ihm, zu keinem von uns. Klappt die Weinkarte auf.
»Wir müssen ja nicht die ganze Zeit zusammen verbringen«, hat Mama gesagt, als wir dabei waren, die zwei Tage in Rom zu planen, und niemandem außer ihr der Besuch im MAXXI ein Bedürfnis war, wie Håkon es ausdrückte. »Ein Bedürfnis«, hat sie wiederholt, »das ist für mich kein Bedürfnis. Ihr redet darüber, als wäre es so was Grundlegendes wie essen, ich hab einfach Lust, meiner Auffassung nach gehört es dazu.« Und obwohl auch Håkon und Ellen da waren, hatte ich wie immer das Gefühl, das ging an mich, unter ihren kritisierenden Worten lag eine Botschaft, in diesem Fall, daß Olaf und ich schon mehrmals in Rom Urlaub gemacht hatten, ohne ein einziges Kunstmuseum besucht zu haben. Genaugenommen war es überhaupt ein Angriff auf unsere Art, Urlaub zu machen, die Kinder zu erziehen, zu leben – jedes Mal trifft es denselben Punkt, so tief drinnen, daß ich es nicht einmal in konkrete Gedanken fassen kann, es ist nur ein winziges Pieksen von einem Gefühl, im Gedächtnis als etwas abgespeichert, wogegen ich mich verteidigen muß. Rom sei ja insgesamt ein Museum, habe ich schnell geantwortet, es gebe da an sich schon soviel zu sehen, daß ich es eher überflüssig fände. Sie lächelte nachsichtig, wie immer, wenn sie meine Verteidigung durchschaute oder ich etwas sagte, was sie selbst heute noch als naseweis klassifiziert. »Sei nicht so naseweis«, sagt sie, und jedes Mal vergesse ich, daß ich vierzig bin.
»Na ja, wir müssen ja nicht die ganze Zeit zusammen verbringen«, hat sie gesagt und forschend beobachtet, wie die Worte bei uns ankamen, und jetzt, vor dem Kolosseum, gefangen im Getümmel einer japanischen Touristengruppe, bin ich mir sicher, auch Ellen und Håkon haben das Gefühl, wir hätten lieber mit Mama Kunst anschauen sollen.
Papa ist auf eigene Faust in den Vatikan gefahren. Er hat nicht einmal gefragt, ob sonst jemand mit möchte, hat einfach während des Frühstücks seinen Plan für heute verkündet. »Und irgend etwas an diesem Benehmen ist seltsam«, habe ich nach dem Frühstück zu Olaf gesagt, »irgend etwas an den beiden ist seltsam. Du merkst das doch auch, oder?« bohrte ich weiter, wußte aber nicht, was ich selbst eigentlich merkte – einerseits waren sie netter zueinander als seit langem, neckten einander, lachten herzlich über die Erzählungen des anderen und beteiligten sich aufrichtig an den Diskussionen, die der andere bei Tisch aufbrachte, als wären ihnen Standpunkt und Ansichten neu – oder als hörten sie diese auf eine neue Art. Andererseits hing über und zwischen ihnen etwas Distanziertes, vielleicht so etwas wie ein Mangel an Vertrautheit.
Olaf meinte, ich solle mich nicht so auf sie konzentrieren. »Wir sind ebenfalls im Urlaub«, sagte er, »und außerdem habe ich meine Zweifel, daß irgend etwas davon besser werden könnte, wenn du versuchst, sie zu ergründen, und jede Bewegung und jeden Blick interpretierst.« – »Mach ich doch gar nicht«, widersprach ich, woraufhin Olaf lachte.
Agnar besteht darauf, sich in die Warteschlange vorm Kolosseum einzureihen. Wir sehen weder, wo sie anfängt, noch, wo sie aufhört, das wird Stunden dauern. Ellen und Håkon schütteln lachend den Kopf und meinen, sie gingen lieber in dieses Café, an dem wir etwas weiter oben vorbeigekommen seien. Ich schaue zu Olaf, er zuckt mit den Schultern.
»Ich kann alleine rein«, sagt Agnar.
»Bist du verrückt?« antworte ich fast automatisch.
Agnar schaut zu Olaf.
»Eigentlich spricht nichts dagegen«, sagt Olaf.
»Eigentlich spricht alles dagegen, Olaf«, antworte ich.
Agnar ist gerade vierzehn geworden und meiner Meinung nach für sein Alter etwas unreif. Olaf meint, er sei genau richtig. Dabei beurteilt Agnar die meisten Situationen noch immer auf Basis der kindlichen Erwartung, alles werde sich irgendwie regeln, jedenfalls ohne jeglichen Gedanken an Konsequenzen, getrieben allein vom Lustprinzip. Hinterher folgt dann die große Reue, er verzweifelt richtiggehend, wenn ihm klar wird, daß Olaf und ich uns Sorgen gemacht haben, weil er beispielsweise über eine Stunde zu spät nach Hause gekommen ist und per Handy nicht erreichbar war – aber schon ein paar Tage später exakt dasselbe Lied. Wir haben ihm erklärt, er sei egoistisch, er müsse sich zusammenreißen, wir müßten ihm vertrauen können, aber zugleich weiß ich, um Vertrauen geht es gar nicht – es geschieht nicht mit Absicht, wie er selbst erklärt: »Wenn ich wo voll drin bin, vergeß ich mich einfach.« Er vergißt absolut alles andere, ich weiß, und ich verstehe es, aber Olaf und ich haben keinen blassen Schimmer, wie wir die Situation handhaben sollen. Außerdem erkennt sich Olaf beinahe schon zu sehr in ihm wieder und meint, momentan sei es am besten, wir ließen ihm eher mehr Freiheiten als weniger. Als wir vier Tage vor Abreise zu Hause in Oslo am Frühstückstisch saßen, mit dem artigen Agnar, wie Olaf ihn mittlerweile an Tagen nach solchen Auseinandersetzungen nennt, wenn Agnar sich darin überschlägt, uns was Gutes zu tun – Kaffee kocht und Frühstück macht und anbietet, auf Hedda aufzupassen und so weiter und so fort, bis in alle brave Ewigkeit –, war ich für den Versuch einer derartigen Lockerung offen.
Aber nicht hier, nicht in Rom. Ach komm, Olaf, bitte, sage ich mit dem Blick.
»Ich hab doch mein Handy«, sagt Agnar.
»Das du nur benutzt, wenn es dir paßt«, entgegne ich. »Ich komm mal lieber mit.«
Wenn er sich derart dafür interessiert, kann ich ihm doch einen Besuch im Kolosseum nicht abschlagen, überraschenderweise beschäftigt er sich seit ein paar Jahren intensiv mit Geschichte und Architektur, und als ich ihm erzählt habe, die Reise gehe nach Rom, bekam er leuchtende Augen.
»Nein, mußt du nicht, ich möchte alleine gehen«, sagt Agnar, trippelt ungeduldig auf der Stelle und fummelt nervös am linken Ohr herum, wie Håkon in Streßsituationen.
»Es geht nicht darum, was du tun möchtest, es geht darum, was du tun kannst und was nicht«, sage ich. Hedda zerrt an meiner Hand, sie will sich auf den dreckigen Asphalt setzen, ich ziehe sie wieder hoch, sie quengelt los, hängt mir wie ein Äffchen am Arm, meine Schulter tut weh.
»Er kann. Hör zu, wir machen es so«, sagt Olaf, legt Agnar die Hände auf die Schultern und sieht ihm direkt und eindringlich in die Augen. »Du hast jetzt zwei Stunden für dich. Bis drei Uhr also. Das bedeutet, wenn du innerhalb der Zeit nicht reingekommen bist, verläßt du die Schlange. Und um drei treffen wir uns in dem Café dort.« Olaf zeigt auf das Café, zu dem Håkon und Ellen unterwegs sind.
Agnar nickt, fast wie gelähmt, wagt kaum einen Blick zu mir, weil er Angst hat, ein Einwand von mir könnte ihm alles kaputtmachen. Aber Olaf und ich haben die beinahe unverbrüchliche Übereinkunft, vor den Kindern die Meinung des anderen zu teilen, wir sind in bezug auf Erziehung, Regeln, Grenzen konsequent und koordiniert, also kann ich nur nicken. Zumal ich ja auch stolz darauf bin, daß er sich so brennend für Dinge interessiert, die anderen Vierzehnjährigen komplett egal sind – und ich wünschte, Mama wäre hier und könnte ihn hören.
Olaf überprüft, ob Agnars Handy genug geladen ist, gibt ihm Geld und sagt, das solle er erst an der Kasse aus der Tasche holen, außerdem müsse er alle zehn Minuten auf die Uhr schauen, das sei ein Test, und wenn er die Freiheit haben wolle, um die er bittet, müsse er den bestehen. Ob Agnar verstanden habe?
»Alle zehn Minuten. Um drei. Geld. Im Café. Verstanden!« sagt Agnar, und auf seinem weichen, vertrauensseligen Gesicht erscheint dieses niedliche Lächeln, ein Traum für jeden Kindesentführer oder Pädophilen, mir wird vor Nervosität übel, dann verschwindet Agnar in der Menge.
Olaf geht mit Hedda zu einem Spielplatz in der Nähe, ich in Richtung Café, alle zehn Schritte drehe ich mich um und schaue, ob ich Agnar in der Schlange erspähen kann, weiß nicht mehr, wie ich selbst mit vierzehn war, bin aber ziemlich sicher, daß ich nie vorgeschlagen hätte, in einer fremden Stadt allein loszuziehen.
Håkon und Ellen sitzen am Rand einer Terrasse mit Ausblick übers Kolosseum. Simen hat sich entschieden auszuschlafen und stößt lieber erst zum Mittagessen zu uns. Eine für unsere Familie im Urlaub völlig undenkbare Einstellung: nicht aufzustehen, nicht rauszugehen, nichts zu tun. »Urlaub heißt für mich ausschlafen können«, hat Simen beim gestrigen Abendessen verkündet. Papa hat gezwungen gelächelt. Wahrscheinlich ist Simen auch der Typ, der ohne Probleme an einem freien Tag bei schönem Wetter im Haus bleiben und fernsehen kann, was für Håkon, Ellen und mich allein praktisch schon unmöglich ist. Selbst als Erwachsene bekomme ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das schöne Wetter nicht ausnutze, wie es Papa uns an jedem einzelnen sonnigen Samstag und Sonntag seit unserer Geburt als Lebensregel eingebleut hat.
Håkon hat eine Flasche Rotwein bestellt, ich bitte den Kellner um ein Glas. Ellen legt die Hand über ihres, als Håkon ihr einschenken will.
»Ich bin wieder mitten in einer Penicillinbehandlung«, sagt sie, »quäle mich seit einem Jahr mit einem rezidivierenden Harnwegsinfekt rum.«
»So oft, wie du Antibiotika schluckst, trägst du bestimmt maßgeblich zur weltweiten Antibiotikaresistenz bei. Vielleicht solltest du es lieber mal mit etwas mehr Moosbeerensaft versuchen«, meint Håkon.
»Interessant, du bist jetzt also auch Experte in Sachen Harnwegsinfekt, Håkon, gibt es eigentlich irgend etwas auf dieser Welt, das du nicht weißt? Wozu du keine Meinung hast?« erwidert Ellen, rollt mit den Augen, lächelt aber zugleich.
Ihre Frotzeleien beruhigen mich, doch mein Herz schlägt weiterhin schnell, und mein Blick richtet sich auf die Touristenmassen, in denen Agnar bestimmt herumirrt und keine Ahnung hat, wohin er soll. Ich schließe die Augen und trinke einen großen Schluck von meinem Wein. Beneide einen Moment lang Ellen und Håkon, die unbekümmert und frei von Verantwortung einfach nur in die eben durch die dünne Wolkendecke brechende Sonne schauen können.
Nur zu dritt sind wir selten. Erst seit Håkon älter ist, treffen wir uns ab und zu auf ein Bier oder zum Essen, immer auf Initiative von mir oder Ellen. Ellen ist zwei Jahre jünger als ich, Håkon wiederum acht Jahre jünger als sie, sein Dreißigster war vor ein paar Wochen. In den letzten Jahren, seit sich der Abstand zwischen uns nicht mehr so groß anfühlt wie früher, als er zehn war und ich zwanzig, sucht auch er den Kontakt, und wir lernen uns als Erwachsene noch mal neu kennen – auch wenn die Hierarchie weiterhin existiert. Ich glaube, Ellen und er haben ein ganz anderes Verhältnis zueinander, sie treffen sich häufiger und haben mehr Kontakt, bestimmt fühlen sie sich einander ähnlich, und sie sind sich auch ähnlicher: Beide ähneln Mama, haben dieselben blonden Haare und großen Augen. Ellen hat außerdem Mamas Kurven und Körperbau – weich und auf graziöse, ansprechende Weise füllig, ganz anders als ich, ich bin schon immer dünn, beinahe kantig.
Ich würde gerne tauschen, hätte gerne Ellens Körper, ich kann mich gut daran erinnern, wie schrecklich es mit sechzehn war, daß sie, die zwei Jahre jüngere, mehr Rundungen und größere Brüste hatte als ich. Daß die Jungs aus meiner Klasse bei uns anriefen, um Ellen zu sprechen. Ich war damals so wütend auf sie, meine Tagebuchaufzeichnungen verraten, daß ich sie richtiggehend haßte und daß ich hunderttausend Gründe erfand, warum das so ist, was wäre sie doch nervig, was für eine aufdringliche Ziege. Als sie dann auch noch vor mir ihren ersten Freund hatte und der mit uns am Abendbrottisch saß und ständig an ihren Haaren herumspielte, erklärte ich Mama, ich wolle ausziehen. Begründet habe ich es mit allem außer Ellen, aber im nachhinein ist mir klar, Mama muß mich durchschaut haben. In meinem Tagebuch steht, daß Mama etwas mit mir unternahm, daß wir Ausflüge machten, zu Oma und Opa fuhren, essen gingen oder ins Kino, daß sie viel Zeit mit mir und ohne Ellen verbrachte. Erwähnt habe ich das aber nur in Nebensätzen, als Kommentar oder Bewertung des Kinofilms, den wir gesehen hatten. Ich kann Mamas total offensichtlichen Einsatz nicht reflektiert oder erkannt haben, oder vielleicht war es mir einfach zu peinlich, sogar vor meinem Tagebuch, daß ich dafür bemitleidet wurde, eine kleine Schwester zu haben, die in jeglicher Hinsicht soviel gelungener war als ich.
Selbst heute überkommt mich noch manchmal kurz dieses erbärmliche und erdrückende Neidgefühl, manchmal flammt es auf, wenn ich wahrnehme, was für Blicke ihr zugeworfen werden, auf der Straße oder in einem Café, manchmal, wenn ich Fotos von früher anschaue, oder am schlimmsten, wenn ich sie bisweilen mit Olaf reden sehe – nein, andersherum, wenn ich sehe, wie er mit ihr redet. Ich habe ihn nie danach gefragt, auch wenn sich diese zutiefst primitive Frage mit naiver Kraft aufdrängt: Findest du sie schöner als mich, hättest du dich für sie entschieden, wenn du gekonnt hättest? Noch nicht mal während unserer heftigsten Streitereien, wenn ich kaum noch weiß, was ich tue oder sage. Wie oft hatte ich nicht Lust, es herauszuschreien, insbesondere am Anfang, habe mich aber immer rechtzeitig gebremst und lieber eine Freundin oder Kollegin von ihm ins Visier genommen: »Glaubst du, ich sehe nicht, wie du sie anglotzt«, schrie ich, »wie du dich ihr zuwendest und dich öffnest, aber glaubst du wirklich, du hättest eine Chance, glaubst du wirklich, sie ist an dir interessiert?« Ja, das ist ziemlich kleinlich und ziemlich erbärmlich, aber immer noch besser als die Alternative.
Mit Anfang Zwanzig wurden Ellen und ich enge Freundinnen. Als ich Olaf kennenlernte, nahm Ellen eine neue Rolle in meinem Leben ein. Auf einmal war sie jemand, dem ich mich anvertrauen konnte, ein Mensch, eine Schwester, jemand, der mir nahestand, und nicht mehr nur die Manifestation von allem, was ich sein wollte und nicht war. Ich studierte damals Journalismus und teilte mit einer Freundin eine Wohnung in Majorstua, während Ellen noch immer zu Hause lebte. Im Jahr nach meinem Auszug trafen wir uns, glaube ich, höchstens zu familiären Anlässen, ich kann mich lediglich daran erinnern, wie wunderbar es war, allein zu leben und mich nicht jeden Morgen in Ellen zu spiegeln, Freunde zu treffen, die nicht wußten, wer sie war. Dann lernte ich Olaf kennen, und auf einmal erschienen meine ambivalenten Gefühle für Ellen übertrieben und kindisch, sie und ich kamen uns schrittweise näher, und nachdem ich Agnar und Hedda bekommen hatte, waren die alten Gefühle nur noch eine schwache Brise, die mich daran erinnerte, wie es einmal gewesen war.
Nach zweieinhalb Gläsern Wein und soviel Sonne, daß meine Nasenspitze sonnenverbrannt prickelt, bin ich ruhiger. Und froh, daß Olaf das Heft in die Hand genommen hat, froh darüber, daß Agnar sowohl das Kolosseum sehen kann, als auch, daß er Eltern hat, die ihm Freiheit bei eigener Verantwortung geben. Froh, mit meinen beiden Geschwistern in einem touristifizierten Café in Rom zu sitzen, während sich unsere Mutter moderne italienische Kunst ansieht und unser Vater durch den Vatikan spaziert.
Ich wage nicht, weiter über meine Sorgen um Agnar zu sprechen, nicht, nachdem Ellen und Håkon mich verständnislos angesehen hatten, als ich ihnen noch vor dem Hinsetzen erzählt hatte, wie sehr ich unter Strom stand. Wir haben darüber schon öfter lang und breit diskutiert, ich weiß, Håkon findet, ich sei überbehütend, hätte zu viele Regeln für die Kinder und deswegen auch zu viele Sorgen. Ellen ist von unserer Art der Kinderhaltung fasziniert, wie sie früher mehrfach ironisch angemerkt hat, seit einem Jahr mag sie nicht einmal mehr einen Kommentar abgeben – zieht sich bloß zurück, wenn wir anfangen, über Kindererziehung zu sprechen. Und auch wenn ich verstehe, was sie damit meint, daß wir Teil eines Trends seien, weiß ich dennoch nicht, wie ich es anders machen soll. Wenn ich mich gegen die intensive Fürsorge auflehne, die auf allen Ebenen und überall propagiert wird, werden die Leidtragenden nur Agnar und Hedda sein, sie geraten ins Abseits.
»Es ist jetzt vierzehn Uhr dreißig«, sagt Ellen und bricht damit in Håkons Reflexionen über unsere Klischeevorstellungen von der italienischen Großfamilie, obwohl Italiener heutzutage durchschnittlich nur etwas mehr als ein Kind pro Familie bekommen.
»Was ja, mal abgesehen davon, daß es von Rezession und schlechter Familienpolitik zeugt, an sich keine Katastrophe ist. Viele Kinder zu bekommen sollte nicht das Ziel sein. Im Gegenteil«, meint er, »die Welt ist sowieso überbevölkert.«
Ellen übertönt die letzten Worte seines Satzes, indem sie lautstark Mama parodiert, die immer, ob man sie nun danach gefragt hat oder nicht, nach einem Blick auf die Uhr verkündet, wie spät es ist.
Damit ziehen wir Mama seit Ewigkeiten auf, mittlerweile ist es ein Insiderwitz zwischen Håkon, Ellen und mir, sogar zwischen Olaf, Agnar und mir. Aber es hat zugleich etwas Verläßliches, Neutrales und Erhellendes. Und Håkon, Ellen und ich haben selbst begonnen – wenn auch in Mamas Tonfall witzartig –, einander und anderen die Uhrzeit mitzuteilen, entweder um eine Stille zu vertreiben, oder um bei diversen gesellschaftlichen Anlässen zum Aufbruch zu blasen, oder als reine Auskunft.
Ich lache, niemand, den ich kenne, kann besser parodieren als Ellen, sie hat eine besondere Beobachtungsgabe, kann noch so kleine Bewegungen imitieren, die Mimik, ein leichtes Schütteln des Kopfes oder einen bestimmten Augenaufschlag, und plötzlich hat sie sich in Mama, Oma, eine Freundin oder irgendeine bekannte Persönlichkeit aus der Politik oder dem Fernsehen verwandelt.
»Danke«, sage ich.
»Mein Gott, entspann dich, er ist vierzehn«, sagt Håkon.
Wir sind augenblicklich darin einig gewesen, daß Ellens vierzehn Uhr dreißig ein Versuch war, mich zu beruhigen – gleiche Assoziationen, gleiche Bezugspunkte. Ich frage mich, wieviel davon genetisch ist, ob wir dieselbe Programmierung haben, ob das der Grund für unser ständiges intuitives Verständnis voneinander und füreinander ist oder ob wir uns in der Art zu denken, reden, assoziieren und schlußfolgern einander angenähert haben. Jedenfalls gibt es zwischen Ellen, Håkon und mir solche Verbindungen, stillschweigend, beständig, losgelöst von Ort und Zeit.
Als ich direkt nach der Journalistenschule als Freie für ein Frauenmagazin arbeitete, schrieb ich über ein Zwillingspaar, das bei der Geburt getrennt worden war. Aber im Gegensatz zu den üblichen Zwillinge-die-direkt-nach-der-Geburt-getrennt-wurden-Geschichten ging es um eineiige Zwillinge, die absolut gleich aussahen, auf dieselbe Art sprachen, dieselben Voraussetzungen hatten, aber völlig verschiedene Leben lebten, verschiedene Entscheidungen getroffen und komplett unterschiedliche Werte hatten – der eine wählte extrem links, der andere weit rechts, sie hatten keine gemeinsamen Interessen und mochten weder dasselbe Essen noch dieselbe Musik oder dieselben Filme ; strenggenommen hatten sie außer dem identischen Aussehen keinerlei Ähnlichkeiten. Sie fühlten sich nicht halbiert, hatten nicht, wie ich es in ähnlichen Artikeln gelesen hatte, in ihrer Kindheit und Jugend einen Bruder vermißt, von dessen Existenz sie nichts wußten, und sie konnten in keiner Weise spüren, was der andere dachte, oder gar die Sätze des anderen beenden.
Meine Redakteurin nahm den Artikel nicht an, meinte, an der Sache sei nichts Aufsehenerregendes oder Faszinierendes, sie wollte das Gegenteil, denn interessanter und spannender wäre, wenn sie tatsächlich dieselben Entscheidungen getroffen hätten, dasselbe Essen mögen würden und die Gedanken und Sätze des anderen beenden könnten. Ich glaube, sie war ein Einzelkind.
Agnar kommt um zehn nach drei angeschlendert, und ich muß mich ziemlich zusammenreißen, um ihm nicht ins Gesicht zu brüllen, was während der letzten zehn Minuten alles in meinem Kopf vorgegangen ist, denn Olaf legt ihm den Arm um die Schultern und lobt ihn, wie toll er das gemacht habe, nicht wahr, Liv? Die Erfahrung hat Agnar ungefähr zwanzig Zentimeter wachsen lassen, vor lauter Stolz und dem Gefühl, erwachsen zu sein, sind seine Schultern und sein Rücken kerzengerade, und so umarme ich ihn, statt zu schimpfen, gebe ihm einen Kuß auf die Stirn und lege meine Hände an sein Gesicht, das noch immer kindlich, rund, pausbäckig ist. Nur ein paar Pickel um die Nase erzählen davon, daß der Übergang vom Kind zum Erwachsenen begonnen hat.
»Absolut«, sage ich und lächle, »das hast du richtig toll gemacht. War es spannend?«
Diese Frage bereue ich sofort, denn Agnar legt los, bis ins kleinste Detail vom Kolosseum zu erzählen, andererseits bestreitet er den gesamten Weg zurück zum Hotel das Gespräch, und ich kann im Taxi meinen Kopf an die Scheibe lehnen und spüren, wie Olaf meine Hand drückt, als wir an dem Hotel vorbeikommen, in dem wir schon ein paar Mal gewohnt haben. Ich erwidere den Händedruck, streichle mit dem Daumen über seinen Handrücken, freue mich plötzlich auf die Weiterreise, raus aus Rom, darauf, in einem Liegestuhl zu liegen, mit Olaf an meiner Seite und einem Buch in der Hand zuzusehen, wie Hedda und Agnar im Pool baden – und daß der Rest der Familie um mich herumschwirrt, wie ich es mir in meinem Büro in Oslo sehnsuchtsvoll vorgestellt hatte. Ausnahmsweise war mir der Gedanke gelungen, wenn auch nur die Hälfte dessen, was ich mir vorstellte, einträfe, wäre ich zufrieden.
Wir haben uns auf drei Autos verteilt und verlassen Rom in Kolonne: Olaf, die Kinder und ich im ersten Wagen, Simen und Ellen im zweiten und Mama, Papa und Håkon im dritten. Obwohl Olaf fast schon verantwortungslos langsam durch den italienischen Verkehr steuert, verliert uns Mama in einem Kreisverkehr, sie nimmt die falsche Ausfahrt, und ihr Wagen verschwindet hinter uns im Verkehrsgewusel.
Ich sage zu Olaf, wir müßten umdrehen oder anhalten, aber wir sind auf einer dreispurigen Straße eingekeilt zwischen unzähligen Autos und können nur geradeaus weiterfahren. Ich rufe Papa an.
»Hallo, hier Sverre«, geht Papa typischerweise ans Telefon, obwohl er mittlerweile ein Handy hat und sehen kann, wer anruft.
Ich habe ihn mehrmals darauf hingewiesen, wie merkwürdig diese Art sei, sich am Telefon zu melden, wo er doch jetzt sehen könne, daß ich oder sonstwer, der ihm nahesteht, anruft – und wir unsererseits könnten ebenfalls sicher sein, wer rangehen werde –, aber er meint, es sei gewöhnliche Telefonetikette, seinen Namen zu sagen.
»Hallo, ihr habt euch verfahren«, sage ich.
»Das vor uns seid nicht ihr?« fragt Papa.
»Nein, ihr seid im Kreisverkehr falsch abgefahren«, sage ich.
»Aha, und wo seid ihr dann jetzt?« fragt Papa ruhig.
»Wo wir sind? Keine Ahnung, Papa, wir sind auf dem Weg raus aus Rom. Du mußt Mama sagen, daß sie umdrehen, zum Kreisverkehr zurückfahren und die dritte Ausfahrt nehmen muß. Und dann müßt ihr dem GPS folgen.«
»Das funktioniert nicht«, erklärt Papa. »Liv meint, wir müssen umdrehen«, sagt er zu Mama, ich kann nicht hören, was sie antwortet.
»Natürlich funktioniert es, Olaf hat es doch vor dem Losfahren eingerichtet«, sage ich. »Kannst du es bitte Håkon geben, damit er es wieder einstellt?«
»Håkon schläft«, sagt Papa, rund um ihr Auto wird jetzt so heftig gehupt, daß ich das Telefon vom Ohr weghalten muß, Mama ruft irgendwas.
»Mein Gott noch mal, dann weck ihn auf!« fordere ich. »Ihr müßt nach dem GPS fahren, und wir warten auf euch, sobald wir irgendwo anhalten können. Ruft an, wenn ihr den großen Kreisverkehr verlassen habt.«
»Wie gesagt, das GPS geht nicht, aber ich werde das schon meistern«, beruhigt mich Papa. Er wird Håkon nicht aufwecken, teils aus Stolz – er will partout niemanden um Hilfe bitten, nicht im allgemeinen wie auch bei technischen Dingen im speziellen –, teils aus Rücksicht: Wenn Håkon müde ist, muß er schlafen.
Beide, Papa und Mama, haben ein extra großes Herz für Håkon, wie Mama gerne sagt, weil Håkon mit einem Herzfehler zur Welt kam und sie die ersten Wochen nach seiner Geburt geglaubt hatten, er werde sterben. Ich kann mich gut daran erinnern, an den winzigen Körper im Brutkasten, die ganzen Schläuche, ich glaubte, er wäre was Außerirdisches.
Als ich nach Agnars Geburt auf der Entbindungsstation lag, mußte ich viel an Mama denken, wie es wohl für sie gewesen war, da zu liegen wie ich gerade, nur ohne ein Kind neben sich ; wie es gewesen war zu wissen, daß Håkon irgendwo in dem riesigen, unübersichtlichen Krankenhaus lag, mit einem winzigen Herzchen, das ein Loch hatte.
Während Håkons Geburt waren Ellen und ich bei Oma, und am nächsten Tag kam Papa zu uns, er saß am Küchentisch und weinte, bemerkte Ellen und mich kaum, wie wir ihn stumm anstarrten. »Ich wußte nicht, wohin mit mir«, sagte er zu unserer Großmutter, die seine Hand streichelte, als wäre er ein kleines Kind, »du kannst dir das nicht vorstellen, ich bin die ganze Nacht zwischen Entbindungsstation und Intensivstation hin und her gerannt.«
In den folgenden Monaten wohnten Mama und er abwechselnd im Krankenhaus. Håkon wurde operiert, die Farbe seiner Haut änderte sich, und er fing an zu schreien, und Mama und Papa waren für dieses Schreien so dankbar, daß Ellen und ich darüber buchstäblich verzweifelten. »Kannst du ihn nicht zum Schweigen bringen?« fragte ich in einer der ersten Nächte, nachdem er nach Hause gedurft hatte – Håkon schrie pausenlos, und Papa trug ihn mit seligem Gesichtsausdruck durch unser Wohnzimmer, das direkt unter meinem Zimmer lag –, und ich erinnere mich, wie Papa antwortete, er könne sich im Augenblick kein schöneres Geräusch vorstellen.
Aus der Angst, Håkon könnte sterben, wurde die Gewißheit, daß er ein wenig anders war, etwas zerbrechlicher, vielleicht ein bißchen wichtiger als wir anderen. Mama und Papa sorgten sich auf völlig andere Art um ihn als um Ellen und mich. Die Ärzte hatten sie darüber unterrichtet, daß er vielleicht in seiner Entwicklung hinterherhinken, Lernschwierigkeiten bekommen oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen könne – und obwohl Håkon schon in der Grundschule einen Kopf größer und eine Schulter breiter als alle Klassenkameraden war, obwohl er schon vor der Einschulung lesen, schreiben und rechnen konnte und obwohl er eine fast übertrieben empathische Persönlichkeit hatte, machte sich Mama die ganze Zeit Sorgen um ihn, sie schien sich schier dem Gedanken zu verweigern, daß er ganz normal war.
Erst viel später sollte sich herausstellen, daß vielmehr Ellen Legasthenie hatte, viel zu spät entdeckt, was sie Mama und Papa noch heute vorwirft, »denn sie hatten ja nur Augen für Håkon«, sagt sie jedem, der es hören will, »und alle dachten, ich wäre dumm.« Das ist nicht wahr, niemand glaubte, Ellen sei dumm, das ist eine Aussage, die sie irgendwo über Legastheniker und Adoptivkinder gelesen hat ; was jedoch stimmt, ist, daß es lange gedauert hatte, bis es entdeckt wurde, eher aber weil Ellen so intelligent war, daß sie ein eigenes System entwickelt hatte, Worte zu erfassen, und sich damit auf eigene Weise ziemlich gut durch die gesamte Grundschulzeit gelesen hatte.
Doch Håkon war der lang ersehnte Nachzügler. Seit Ellen zwei Jahre alt war, hatten Mama und Papa versucht, noch ein Kind zu bekommen, und auch wenn beide Ellen und mir die ganze Schwangerschaft hindurch versichert hatten, sie würden sich freuen, egal, was es werden würde, bin ich überzeugt, sie wünschten sich einen Jungen. Das ist überhaupt nicht seltsam, seltsam war nur, daß die beiden – sicher auch vor einander – darauf beharrten, sie wünschten sich ebensosehr noch ein Mädchen.
Als ich mit Hedda schwanger gewesen bin, habe ich gehofft, es werde ein Mädchen, und das habe ich auch jedem, der fragte, ganz offen erzählt. »Das kannst du nicht sagen, Liv«, sagte Mama. »Warum nicht«, antwortete ich, »nur undifferenzierte Menschen kapieren nicht, daß ich das Kind in jedem Fall liebhaben werde. Aber ich möchte jetzt nunmal lieber ein Mädchen, ich verstehe das Problem nicht.«
»Mir ist jedenfalls ganz lieb, daß du nicht einen Jungen bekommen wirst, dem später zu Ohren kommt, du hättest die ganze Zeit herumerzählt, du möchtest lieber was anderes«, sagte Mama, als klar war, es würde ein Mädchen werden. Ich antwortete, daß ich hoffte, meine Kinder würden nie so unsicher und unreflektiert werden, egal welchen Geschlechts.
Niemand weiß, warum Mama und Papa sich so schwergetan hatten, Håkon zu bekommen, warum es viele Jahre mit Fehlgeburten gedauert hatte, und in einer Privatklinik, in der Mama endlich Hilfe gesucht hatte, hatte man gemeint, es könne von einem Geburtsschaden kommen, der bei Ellens Geburt entstanden sei. »Eine grauenvolle Geburt«, sagt Mama zu Ellens großem Ärger immer. »Aha, du meinst also, daß ich dankbar sein muß?« bemerkt Ellen darauf, und dann fangen jedes Mal die exakt gleichen Reibereien an, die beiden sind sich so ähnlich, gleich stur, manchmal wirkt es, als konkurrierten sie um etwas, das sonst niemand versteht.
Håkon war jedenfalls ein sehnlich erwünschtes Kind und ist es bis heute. In familiären Zusammenhängen benimmt er sich bis heute wie ein kleines Kind, nimmt die Rolle des unbeholfenen Jüngsten ein, legt sich aufs Sofa, wenn wir Essen machen, geht vom Tisch, ohne seinen Teller abzuräumen, sitzt mit Kopfhörern und dem Mac auf dem Schoß mitten im Wohnzimmer, und seine schmutzige Wäsche bringt er erst seit kurzem nicht mehr nach Hause – wahrscheinlich weil seine letzte Freundin das einmal kommentiert hat. Sind Ellen, Håkon und ich unter uns, ist er ganz anders, dann ist er ein erwachsener Mann, der sich an erwachsenen Gesprächen beteiligt und erwachsene Probleme hat.
Aber wenn er sich bei einer Autofahrt durch Italien hinter Mama und Papa auf die Rückbank gelegt hat, muß er jedenfalls schlafen, denkt Papa, und ich beende ohne ein weiteres Wort über das GPS das Gespräch.
Das Haus von Olafs Bruder liegt auf einer kleinen Anhöhe über einem mittelgroßen Badeort an der Riviera. Wir fahren teils am sonnig glitzernden türkisen Mittelmeer entlang, teils weiter oben in den trockenen olivbraunen Bergen durch kleine Dörfer, in denen die Zeit stehengeblieben zu sein scheint, obwohl Olaf meint, diese Art von Kommentar sei ziemlich vorurteilsbeladen.
»Was weißt du schon?« fragt er. »Du weißt beispielsweise nichts über sie oder ihr Leben«, fährt er fort und zeigt auf eine alte Frau in schwarzer Kleidung, die vor ihrem Haus auf einem Hocker sitzt, offensichtlich ohne irgend etwas zu tun zu haben.
Ich antworte nicht. Drehe mich zu Hedda und Agnar um, die auf der Rückbank aus den Fenstern schauen.
»Stellt euch vor, hier leben Menschen!« sage ich zu ihnen.
Das sagte Mama früher immer, wenn wir mit dem Auto unterwegs waren, ob nun in Norwegen oder in anderen Ländern, und an einem Ort vorbeikamen, der auf uns einen verlassenen oder unwirtlichen Eindruck machte. Insbesondere kann ich mich an einen Ort in Portugal erinnern, wir hatten ein Auto gemietet und fuhren ins bergige Hinterland der Algarve. Ich war vielleicht vierzehn. Wir waren schon eine Ewigkeit auf schmalen, kurvigen Straßen unterwegs, die Luft flimmerte von der Hitze über dem Asphalt, und Ellen und ich kriegten den Mund nicht mehr zu, als Papa in vollem Ernst behauptete, auf dem Asphalt könne man bestimmt Eier braten. Wir fuhren durch ein kleines Dorf, es bestand vielleicht aus zehn bis zwölf Häusern, einem kleinen Markt und einer Tankstelle, an der Papa anhielt, um zu tanken. Die Tankstelle ähnelte eher einem kleinen Schuppen, die Schilder und Zapfsäulen waren rotbraun vom Rost. Davor, im Schatten eines kleinen Sonnenschirms, saß ein Mann. Als wir kamen, stand er auf. Er lächelte – Ellen sagte hinterher, er habe nur einen einzigen Zahn gehabt –, betankte für Papa das Auto, auch wenn Papa das lieber selbst tun wollte, und als wir wieder wegfuhren, schaute er uns nach. Ellen und ich drehten uns um und sahen durch die Rückscheibe, wie er kleiner und kleiner wurde. »Stellt euch vor, hier leben Menschen!« sagte Mama wie üblich, und plötzlich verstand ich, was sie meinte. Spürte eine unbändige Sympathie für diesen Mann, der hier zurückbleiben mußte, irgendwo in der portugiesischen Einöde, an einer Tankstelle, das war tatsächlich sein Leben. Er ging mir den ganzen Urlaub nicht mehr aus dem Kopf, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ein paar Tage später im Hotel fragte ich, ob sie glaube, daß er Familie habe. Sie konnte sich nicht einmal mehr an ihn erinnern, und ich erklärte ihr unter Tränen: »Dieser einsame Mann ohne Zähne an der Tankstelle, der dort bestimmt jeden Tag sitzen muß, ohne Familie oder Freunde oder Geld, ohne irgendein Leben.« – »Ach der, aber Schatz, Liv«, sagte Mama und lächelte mich an, »er würde sicher denken, daß unser Leben in Oslo unerträglich anstrengend und hektisch ist. Nicht jeder, der nicht haargenau so lebt wie wir, ist arm dran.«
Weder Agnar noch Hedda scheinen sonderlich auf besagte Phrase zu reagieren. Agnar ist mehr damit beschäftigt, uns die Algen zu erklären, die dem Mittelmeer seine Farbe geben, und Heddas Augen sind am Zufallen, gleich schläft sie ein, ich überlege, ob ich mich mehr darum bemühen sollte, sie bis zur Schlafenszeit wachzuhalten, damit sie nicht den ruhigen Abend, den ich mir ausgemalt habe, komplett verhindert oder verzögert, oder ob ich sie schlafen lassen soll. Bevor ich mich entscheiden kann, ist sie schon eingeschlafen, ich sage Olaf nichts, dem die Schlafhygiene der Kinder ein größeres Anliegen ist als mir.
Nach vier Stunden Autofahrt biegt Olaf auf einen plattenbelegten Parkplatz an einem Berghang ein, die Sonne steht tief über dem Meer. Die dichte Bepflanzung rund um den Parkplatz läßt mich das Haus überhaupt nicht sehen, nur eine kleine Treppe, die in das ganze Grün führt. Hedda und Agnar rennen sich die lange Autofahrt vom Leib, verschwinden die Treppe hinauf. Olaf lächelt mir erwartungsfroh und selbstsicher zu. Ich folge den Kindern und gelange geradewegs auf eine nach Süden ausgerichtete Terrasse mit Aussicht über die kleine Stadt und den weiten Meereshorizont dahinter. Agnar und Hedda jauchzen vor Freude über den in einen kleinen Vorsprung eingelassenen Pool, und auch mich überkommt eine leicht kindliche Begeisterung über das hellblaue Chlorwasser, auch wenn direkt unter uns ruhig und einladend das Mittelmeer liegt.
Die anderen kommen auf die Terrasse. Olaf macht die doppelten Glastüren zum Haus auf, wir betreten eine große Küche mit roten Terrakottafliesen und offenen Schränken, wir schwärmen aus, erforschen das große Haus, das in Olafs Erzählungen immer das kleine Ferienhaus gewesen war, das er seinem Bruder als Erbe gelassen hatte, als die Eltern vor einigen Jahre starben – ich höre Ellens Freudekreischen und Papas Beifallsmurmeln. Mama folgt mir in das größte Schlafzimmer, das nach Südwesten geht und dessen Decke Freskomalereien zieren, es riecht nach Weichspüler und Meer. Sie stellt sich ans Fenster, im Licht der roten Sonne glühen ihre Haare förmlich, sie sagt nichts, und für einen Augenblick bekomme ich Angst, sie könnte es hier zu überkandidelt, zu extravagant und zu abgeschmackt finden, aber sie lächelt mich an.
»Also, wenn das mal kein Schmuckstück ist«, sagt sie, ich glaube, es ist positiv gemeint ; sie streicht mit der Hand über das breite Fensterbrett entlang.
»Ich hatte keine Ahnung, wie groß es ist«, sage ich, »fast ist der Gedanke ein bißchen bitter, daß Olaf es hergegeben hat.«
»Soweit ich verstanden habe, hat es so wohl nicht ausgesehen, als sein Bruder es übernommen hat, der Ausbau und die Renovierung haben Jahre gedauert«, entgegnet Mama.
Wann Olaf und sie wohl darüber gesprochen haben? Er und ich haben nie besonders viel über diesen Ort geredet.
»Ja, trotzdem«, sage ich.
»Ich glaube, du solltest froh sein, daß es dir nicht gehört, denk an die ganze Instandhaltung«, meint Mama, die immer und überall die Instandhaltungskosten sieht, in jedem Haus und jeder Hütte, die Ellen und ich uns gewünscht haben: »Nein, uff, denkt bloß an die Instandhaltung!« Gequält von Gewissensbissen wegen allem, was sie in der Ferienhütte in Lillesand tun müßte, die sie geerbt hat.
»Vor allem bin ich eigentlich darüber glücklich, daß Olaf seinem Bruder das Haus überlassen wollte und es keine häßlichen Erbstreitigkeiten gab«, sage ich und meine es genauso.