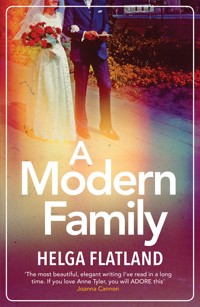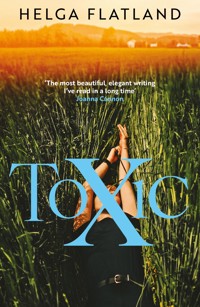17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Sigrid ist Ärztin. Als sie erfährt, dass ihre Mutter Krebs hat, verändert sich alles: Sie erlebt die Vergangenheit neu, ebenso wie ihre Mutter. Helga Flatland zeichnet dieses Familienporträt aus wechselnden Perspektiven, wie man es bereits aus ihrem Roman Eine moderne Familie kennt. Sie lässt sich auf ihre Figuren empathisch ein, respektiert aber auch ihre Freiheiten. Und vor allem: Sie urteilt nicht. Denn es kommt ja nicht darauf an, wer woran wann schuld war, sondern einzig darauf: Wie machen wir weiter? "Ich helfe ihr beim Ausziehen, eine Wollschicht nach der anderen. Als wir das dritte und letzte Wollhemd erreicht haben, lache ich. »Zuunterst immer Wolle«, sage ich. »Dann habe ich dir wenigstens eines der wichtigsten Dinge auf dieser Welt beigebracht«, murmelt Mama im Halbschlaf."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2022
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe Et liv forbi erschien 2020.
© Helga Flatland. First published by
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, 2020.
Published in agreement with Oslo Literary Agency.
Die Übersetzung wurde mit finanzieller Unterstützung von NORLA publiziert.
Lektorat: Stefan Weidle
Korrektur: Kim Lüftner
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: März 2022
ISBN 978-3-95988-218-7
Über das Buch
Sigrid ist Ärztin. Als sie erfährt, daß ihre Mutter Krebs hat, verändert sich alles: Sie erlebt die Vergangenheit neu, ebenso wie ihre Mutter.
Helga Flatland zeichnet dieses Familienporträt aus wechselnden Perspektiven, wie man es bereits aus ihrem Roman Eine moderne Familie kennt. Sie läßt sich auf ihre Figuren empathisch ein, respektiert aber auch ihre Freiheiten. Und vor allem: Sie urteilt nicht. Denn es kommt ja nicht darauf an, wer woran wann schuld war, sondern einzig darauf: Wie machen wir weiter?
Ich helfe ihr beim Ausziehen, eine Wollschicht nach der anderen. Als wir das dritte und letzte Wollhemd erreicht haben, lache ich. »Zuunterst immer Wolle«, sage ich. »Dann habe ich dir wenigstens eines der wichtigsten Dinge auf dieser Welt beigebracht«, murmelt Mama im Halbschlaf.
Über die Autorin
Helga Flatland hat norwegische Sprache und Literatur an der Universität Oslo studiert und danach ein Aufbaustudium an der Westerdals School of Communication absolviert. Sie lebt in Oslo. Zuunterst immer Wolle (Originaltitel: Et liv forbi) ist ihr sechster Roman. Bereits bei CulturBooks als Digitaledition erschienen: Eine moderne Familie.
Über die Übersetzerin
Helga Flatland
Zuunterst immer Wolle
Roman
Mitten im Leben geschieht’s, daß der Tod kommt und am Menschen Maß nimmt. Diesen Besuch vergißt man, und das Leben geht weiter. Doch im stillen wird der Anzug genäht.
1
Mit einem Beilhieb durchtrenne ich ihr Genick. Werfe den Kopf in einen Eimer, den Körper in einen anderen, die Krallen scharren am Plastik entlang, dann ist es still. Ich gehe zum Stall, hole die nächste, presse sie auf dem Weg eng an meine Brust, fühle durch die Federn hindurch das Zittern und den Pulsschlag, flüstere ihr leise zu, bevor ich sie an den Beinen nehme und kopfüber drehe, bis sie ruhig wird. Rasch lege ich sie auf den Hackklotz, strecke ihren Nacken gerade, schlage ihr mit dem stumpfen Ende des Beils fest auf den Kopf, wende es in ein und derselben Bewegung in der Luft und haue ihr im nächsten Hieb mit der Schneide den Kopf ab.
Ich habe vergessen, die Stalltür zu schließen, eine der Hennen ist ausgebüxt, steht nun direkt vorm Stall und sieht mich an. Sie wirkt verzweifelt, vielleicht auch verwirrt, als könnte sie nicht glauben, was sie gerade mit ansehen mußte, ihr Anblick tut mir weh, ich überlege, ob ich sie wieder zu den anderen sperren und bis zum Schluß verschonen soll oder ob sie dann nur unnötig lang voll Angst herumläuft. Gustav würde mich auslachen und sagen, ich schriebe den Tieren Gefühle zu, die sie nicht hätten, meine eigenen.
»Komm schon, altes Mädchen«, flüstere ich und gehe in die Hocke, es schmerzt in den Knien, im ganzen Körper, ich muß Sigrid anrufen, ich hole etwas Mastfutter aus der Tasche, locke damit, die Henne legt den Kopf schief, erst nach links, dann nach rechts.
Ich mag Hühner nicht einmal, und diese haben schon vor Ewigkeiten aufgehört, Eier zu legen, ich habe sie nur noch aus nostalgischen Gründen – zur Aufrechterhaltung der Illusion eines Hofbetriebs, auf einem Bauernhof müsse es ja wohl Tiere geben, hat Viljar das letzte Mal, als er hier war, gesagt. Da gebe ich ihm gerne recht, aber Enkelkinder, die viermal im Jahr zu Besuch kommen, sind kein ausreichender Grund mehr, um fünf uralte, unproduktive Hühner zu behalten.
Am Ende kann die Henne der Verlockung nicht widerstehen, kommt zu mir und pickt mir aus der Hand. Ich streichle ihr über die Federn und lasse sie das Mastfutter auffressen, dann schlachte ich sie.
2
»Sigrid? Deine Mutter hat angerufen«, sagt Aslak, als ich durch die Haustür komme, er liegt mit dem Rücken zu mir auf dem Sofa und streckt, ohne den Blick in meine Richtung zu wenden, mein Smartphone in die Luft, als würde er mir das Gespräch zeigen. »Ich glaube, es ging um irgendwas mit irgendwelchen Hühnern.«
»Wie – du glaubst?« frage ich nach und schlüpfe aus Schuhen und Jacke.
»Doch, es war auf jeden Fall irgendwas mit den Hühnern, aber ich habe nicht wirklich umrissen, was genau«, erklärt er.
»Fast gute Arbeit also.« Ich sinke in den Sessel neben ihm, mehr zu sagen, schaffe ich nicht.
Er lacht halbherzig, dreht sich zu mir und wirft mir einen Blick zu.
»Das kommt davon, wenn du dein Telefon vergißt. Du siehst müde aus«, stellt er fest und ich verbuche das als Lob.
Ich bin müde. Ich bin so müde, daß jedes Gespräch, jede Bewegung, jeder Gedanke anstrengend ist.
»Aber jetzt ist Freitag«, beendet Aslak meine Gedanken und tätschelt lächelnd meinen Oberschenkel. »Viljar möchte Tacos, aber gib ja nicht mir die Schuld dafür, diese Tacofreitag-Sache muß er im Kindergarten aufgeschnappt haben. Weißt du, ob Mia kommt?«
Mia ist bei ihrem Vater, natürlich kommt sie nicht. So hoffnungsvoll, wie Aslak wirkt, bringe ich es nicht über mich, ihm zu erzählen, daß sie seit mehreren Tagen keinen Mucks hat hören lassen.
»Willst du dich nicht umziehen«, sage ich lieber und nicke in Richtung seiner Arbeitshose. »Wo doch jetzt Freitag ist?«
Ich verschiebe den Anruf bei Mama und gehe zu Viljar hinauf, der mit dem iPad auf dem Schoß in dem kleinen Zelt in seinem Zimmer sitzt.
»Hallo, Viljarspätzchen.« Ich strecke den Kopf ins Zelt und gebe ihm einen Kuß auf die Wange, feuchte, salzige Krümel bleiben an meinen Lippen kleben, er ist rund um Mund und an den Händen ganz orange. »Wow, hast du vorm Abendessen Käseflips bekommen«, sage ich mit erhobener Stimme.
Viljar nickt, ohne den Blick von Peppa Wutz auf dem Bildschirm zu nehmen. Aslak hat ihm lieber gleich die ganze Tüte Käseflips gegeben, vermutlich um etwas zu kompensieren oder vielleicht auch zu demonstrieren, aber ich habe aufgehört, verstehen zu wollen, was er damit erreichen will. Mein Verdacht ist, daß er das selbst nicht mehr weiß. Ich löse die Tüte aus Viljars Griff, glücklicherweise protestiert er nicht.
»Noch eine Folge«, bestimme ich, als Peppa und ihre Familie in dieses jede Folge abschließende absurde Gelächter ausbrechen, jedes Mal eine Feier ihres Familienzusammenhalts, und Viljar scrollt mit routinierten Bewegungen die Episodenliste nach unten.
Ich gehe unter die Dusche, wasche die Haare zweimal, seife mich mit der antibakteriellen Seife ein, die ich aus der Praxis mitgenommen habe, schrubbe den ganzen Körper, unter den Nägeln, werde nicht sauber, in Haut und Haaren hängen noch die Bakterien all der Patienten mit rasselndem Husten, eiternden Wunden, juckenden Geschlechtsteilen und geschundenen Seelen. An manchen Tagen nehmen sie mich mit ihren Problemen regelrecht in Beschlag, und ich kriege es nicht hin, mich richtig aufzustellen, sie nehmen sich schlicht, was sie haben wollen, und verschwinden. An solchen Tagen bin ich unfähig gegenzuhalten, mein Selbstvertrauen sinkt, zugleich steigt meine Angst, und ich stelle Krankmeldungen und Rezepte aus oder schreibe Überweisungen für ein MRT, ein CT oder zum Herzspezialisten.
Als ich wieder ins Wohnzimmer komme, ist Aslak auf dem Sofa eingeschlafen, ich unterdrücke den Drang, ihn zu wecken, ihn anzuschreien, wenn hier jemand auf dem Sofa einschlafen dürfe, dann ja wohl ich, ich lasse ihn schlafen, kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren zu jammern, ertrage es nicht, einen Streit loszutreten, wenn ich das, was ich wirklich sagen möchte oder meine, sowieso nicht aussprechen darf. Einen Streit, der mich vor allem zu der Einsicht bringen könnte, daß ich gar nicht weiß, was ich wirklich möchte oder meine. Aslak hat die Arme hinterm Kopf verschränkt, er trägt wieder das Goldkettchen von seiner Konfirmation, das er abgenommen hat, als wir nach Oslo gezogen sind.
In der Küche stehen unausgepackt die Einkaufstaschen auf der Arbeitsplatte – Milch, Schmand, Hackfleisch, die Verpackungen sind feucht vom Kondenswasser. Wie früh Aslak wohl von der Arbeit gekommen ist, wie lange er wohl schon auf dem Sofa liegt und Viljar in seinem Zimmer Medienzeit haben läßt, ein Begriff, den Aslak weder über die Lippen noch zur Anwendung bringt. Als ich gerade das Hackfleisch anbrate, kommt er in die Küche, legt von hinten die Arme um mich und küßt mich in den Nacken. Eine seltene Annäherung, ich drehe mich um und lehne mich für einen Augenblick an ihn, schnuppere an seiner linken Achselhöhle. Ich vermisse, wie er früher beim Nachhausekommen gerochen hat, nachdem er einen ganzen Tag schwere Stämme gewuchtet und verzähnt hatte, diesen von Stärke und primitiver Sicherheit zeugenden Geruch. Nach unserem Umzug nach Oslo hat er eine Möbeltischlerei eröffnet, und jetzt umgibt ihn nur mehr ganz schwach der Duft von Holzöl und Waschpulver.
Ich war es, die wegwollte, hierher wollte, dieses Leben wollte.
Er hält mich eine Weile im Arm, zieht mich kurz enger an sich, läßt mich dann mit einem Seufzer los und deckt den Tisch. Ich versuche es erneut bei Mia, bete inständig, daß sie ans Telefon geht, denn danach kann ich keinen weiteren Anruf in Abwesenheit auf ihrem Telefon hinterlassen, ohne daß sie etwas hineininterpretiert, zwei verpaßte Anrufe können noch bedeuten, ich hatte einfach Lust, mit ihr zu sprechen. Früher rief ich so lange bei Leuten an, bis ich sie erreichte, ich habe ewig nicht begriffen, daß man das als aufdringlich oder alarmierend auffassen konnte, eigentlich erst, als Mia richtig wütend wurde. »Wenn ich nicht rangehe, muß dir doch klar sein, daß ich beschäftigt bin, kein Mensch ruft fünfmal an, wenn es kein Notfall ist«, schimpfte sie, »mußt du immer so scheißdrüber sein?«
Natürlich geht sie nicht ran, ich stelle sie mir in Jens’ und Zadies Küche vor, wie sie entspannt lächelnd dasitzt, wie die drei gemeinsam kochen und ungezwungen auf englisch plaudern, was Mia unglaublich lehrreich und nützlich findet, da sie nächstes Jahr zum Studium nach London geht. Ich unterdrücke den Drang, ihr auf die Mailbox zu brüllen, was es für eine bodenlose Ungerechtigkeit sei, daß Jens, der mit fünfundvierzig plötzlich erwachsen geworden ist, eine rundum perfekt funktionierende, umgängliche Tochter serviert bekommt, und das nach der ganzen Arbeit und Liebe, die Aslak und ich in sie investiert haben – insbesondere nach der Hölle der letzten Jahre mit ihren endlosen Runden von Auflehnung und Anfeindungen, den Streitgesprächen, die mich komplett entgeistert zurückgelassen hatten, ich war völlig fassungslos, was dieses nicht mehr wieder zu erkennende Wesen vor mir alles zu denken und schreien imstande war. Wo sie das wohl her hat, dachte ich, das hat mit meinen dunklen Seiten, meiner Wut, mit mir nichts zu tun. Mia war in diesen Konfrontationen so kontrolliert, so treffsicher, zeitweise so gerissen und kalt, daß ich mir anschließend Kinderfotos von ihr ansehen mußte, um mich daran zu erinnern, daß ich sie liebte. »Das hat sie von Jens«, versuchte ich Aslak und mir mehr als einmal einzureden, es seien sein Einfluß, seine Gene oder seine Abwesenheit.
Aber es hatte auch mit Jens nichts zu tun. Der ist notorisch ausweichend und gänzlich unfähig, irgendeine Entscheidung zu treffen oder sich für irgend etwas anderes als seine Impulse einzusetzen. Ich hatte ihn mit neunzehn kennengelernt, als er im Zuge seiner Ausbildung als Turnusarzt in unser Dorf kam – voll Anziehungskraft für mich allein schon deswegen, weil er von außerhalb war, anders, neu, eine Alternative zu all dem Kleinen, Abgedroschenen, der Enge. Und anziehend, weil er tonangebend und ungehemmt war und einen durchschaute. »Ich glaube, du hast auf mich gewartet, Sigrid«, sagte er am Abend unseres Kennenlernens beim vierten Bier. Daß er da sicher auch schon von diversen Opiaten high gewesen war, ging mir erst viel später auf, aber es hätte auch keine Rolle gespielt, ich war schlicht widerstandslos, wurde von ihm angesogen, an ihm festgesaugt. Ich dachte, er würde nach seinem Turnusjahr meinetwegen bleiben, daß wir, ohne ein Wort darüber zu verlieren, etwas aufbauten, ein Leben, eine Zukunft. Ich kapierte nicht, wie planlos und unbeständig er war – kapierte nicht, was ich mir im Nachhinein hunderttausendmal gesagt habe: daß er fragil, süchtig und kaputt war, ein Mensch, der, um nicht unterzugehen, ständig Auftrieb in Form von Anerkennung, Bewunderung oder Rausch brauchte. Er konnte Lobeshymnen von ihn vergötternden Patienten ohne jeden Anflug von Verlegenheit zitieren oder derart unverhohlen mit sich selbst, seinen Eigenschaften und Talenten prahlen, daß ich das als Ausdruck eines gesunden Selbstbewußtseins und als die Wahrheit mißinterpretierte. Mir war die Erfahrung, daß mich ein Mensch so sehr faszinierte, ich von ihm nie genug bekommen, ihm nie nahe genug sein konnte, völlig neu. Jederzeit konnte das Gefühl, ihn zu vermissen, aufflammen, und ich sehnte mich selbst in Augenblicken nach ihm, nach mehr von ihm, wenn es gar nicht mehr ging, einander noch näher zu sein, wenn zwischen unsere Körper kein Millimeter Luft paßte.
Als ich mit Mia im fünften Monat schwanger war, wurde gegen Jens eine Aufsichtsbeschwerde eingelegt. Ein Kollege hatte entdeckt, daß er eine Menge Rezepte für Suchtstoffe ausgestellt hatte, und innerhalb weniger Tage beschloß Jens, er habe eine Luftveränderung dringend nötig. Ich habe nie jemandem erzählt, daß ich selbst – verliebt, wütend und schwanger – ihn zum Flughafen Flesland gefahren habe, als er mit einer Hilfsorganisation nach Bangladesch ging.
Mia meldet sich, nachdem wir mit den Tacos fertig sind, ich Viljar seine obligatorischen Gutenachtlieder vorgesungen habe und nun mit Aslak von unseren Sofas aus einen Film gucke. Den Protest gegen das Vergeuden des Wochenendes mit Fernsehen habe ich vor Ewigkeiten eingestellt. Ganz am Anfang, nachdem mit Jens Schluß gewesen war, hatte ich mehr oder minder unbewußt versucht, Aslak in Jens’ und meine Beziehungsrituale zu pressen: In den gemeinsamen Jahren mit ihm fällt mir kein einziger Abend ein, an dem wir ferngesehen hätten, ich erinnere mich nur an einen alles absorbierenden Kreislauf aus Gesprächen, Sex, Sehnsucht, Streit und Versöhnung. Bestimmt hatten wir auch ruhigere Tage, aber wenn ich an uns zurückdenke, sind wir ständig in Bewegung. Aslaks Ruhe und Stille erzwingt eine andere Beziehungsform, andere Rituale, ein anderes Leben. Und wäre Jens nicht vor einem Jahr wieder nach Oslo gezogen und hätte mein Leben in Beschlag genommen, Mia in Beschlag genommen, würde ich nicht einen weiteren Abend ruhelos herumhocken und Aslak und ihn vergleichen.
»Hallo, Mia, Liebling«, gehe ich mit möglichst unbekümmerter Stimme ans Telefon.
»Hallo, du hattest angerufen?« fragt Mia.
»Ja, ist ja eigentlich nicht ganz doof, wenn wir wissen, ob wir beim Abendessen mit dir rechnen sollen oder nicht«, sage ich.
Ich sitze auf dem Sofa und zupfe an einem losen Faden am Saum eines der Kissen, über deren Stoff Aslaks Arbeitshose jeden Feierabend schubbert. Aslak schaltet den Film auf Pause.
»Ja okay, aber wenn du nichts von mir hörst, ist doch wohl klar, daß ich nicht komme.« Ich lausche zwischen ihren Worten nach Jens im Hintergrund, nach Geräuschen, Gesprächen, irgend etwas, das verrät, was sie gerade tun, hoffentlich sehen sie fern.
»Ja, wäre aber trotzdem nett, wenn du Bescheid gibst«, sage ich. »Ich kriege dich ja kaum noch zu Gesicht.«
Das kratzt haarscharf an der Grenze dessen, was ich mir geschworen habe, meinen eigenen Kindern niemals anzutun; ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, ihnen das Gefühl zu geben, sie wären mir etwas schuldig.
»Du hast mich doch vor zwei Tagen gesehen, Mama.« Mia klingt eher genervt als nach schlechtem Gewissen.
»Und bleibst du also das ganze Wochenende da?« frage ich.
»Ich weiß noch nicht, vielleicht gehen Zadie und Papa morgen abend zu so einer Sache, dann schlafe ich vermutlich zu Hause«, antwortet sie, und daß Aslak und ich für sie immer noch ihr Zuhause sind, schlägt den Umstand, daß sie Jens nun Papa nennt und meinen Drang nachzufragen, zu was er und Zadie morgen vielleicht gehen.
»Okay, schön. Dann, bis morgen.« Ich registriere aus dem Augenwinkel, wie sich Aslak aufsetzt.
»Ja, vielleicht. Oma hat übrigens gerade angerufen, aber ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, und jetzt geht sie nicht ran.«
»Bei uns hat sie auch angerufen, aber es ist nichts Dringendes, Papa hat gesagt, es geht um irgendwas mit ihren Hühnern«, sage ich.
Aslak bewegt sich. Eine kleine Pause entsteht.
»Okay, gut. Na dann, bis morgen oder Sonntag«, verabschiedet sich Mia. »Tschüß.«
»Ja, dann tschüß«, antworte ich.
Ich lege auf, und Aslak sieht mich an.
»Sie kommt bestimmt morgen.« Ich versuche ihn anzulächeln, und für einen Augenblick schießt mir das Bild durch den Kopf, wie Mia auf Aslaks Brustkorb liegt und er behutsam auf ihr Köpfchen pustet, um sie zu beruhigen.
Daran, daß Mama Mia angerufen hat, ist nichts anormal, die beiden sprechen oft miteinander, bestimmt öfter, als ich mit einer der beiden telefoniere. Doch am Zeitpunkt ist irgend etwas komisch, oder vielleicht auch mit mir. Vielleicht bin ich jedes Mal, wenn Mama anruft, auf der Hut, aber im nachhinein löscht die Erleichterung, daß es nichts Ernstes war, die vorausgegangene Beunruhigung. Aber abgesehen davon, ist es eher unwahrscheinlich, daß mich Mama anruft, um über die Hühner zu sprechen. Ich versuche es bei ihr nach dem Zubettgehen, aber sie nimmt nicht ab. Wie immer vorm Einschlafen, checke ich auf Facebook, wie lange es her ist, daß sie, Mia und Magnus online waren. Mama war vor neunzehn Minuten aktiv, ich kann mich also entspannen. Ich bemerke, daß auch Jens vor vier Minuten online war.
Ich liege wach und lausche Aslaks Atem und dem von fern hereindringenden Lärm der Stadt, an den ich mich einfach nicht gewöhne, er stört mich noch immer, auch wenn ich Aslaks Beschwerden, man könne im Sommer unmöglich mit offenen Fenstern schlafen, vehement widerspreche. »So ein Quatsch, wir sind hier in einer der ruhigsten Wohngegenden von Oslo«, sagte ich in einem der ersten Sommer und öffnete das Fenster zum Garten, »stiller wird es nicht, wenn man in der Stadt leben will.« – »Nicht ich will hier leben«, antwortete er und machte das Fenster zu.
Ich war es, die nach Oslo ziehen wollte, nachdem mein Turnusjahr vorbei war, ich war fertig mit meiner Ausbildung und mit einem Mal komplett fertig mit allem, was vorher war, fertig mit dem Dorf, fertig mit den Gefühlen für Jens, fertig mit Papa, fertig mit Mamas einnehmender Einsamkeit. Aslak und Mia mußten sich mir und meinen Bedürfnissen fügen, wie Aslak ein paar Jahre später bemerkte – nicht wütend oder anklagend, eher als Erkenntnis. »Ich kann dir dafür nicht ewig zu Dankbarkeit verpflichtet sein«, schrie ich ihn damals an, ohne daß er je nach Dankbarkeit verlangt hätte. Aber im vergangenen Jahr hat es sich jeden Tag so angefühlt, als würde er etwas einfordern, eine Entschädigung in Form von Verpflichtung – ich kann ihn niemals verlassen. In meinen schlimmsten Momenten bin ich rasend eifersüchtig auf Mia, auf ihre Rebellion, ihre Freiheit, ihr Sich-Lossagen von Aslak – und im selben Moment winde ich mich vor schlechtem Gewissen.
Mia arbeitet während ihrer Vorkurse fürs Studium bei einer Produktionsfirma, verdient zum ersten Mal eigenes Geld – und diese sensationelle Entdeckung ökonomischer Freiheit hat ihr Bedürfnis nach Selbständigkeit massiv befeuert. Sie kommt erst am Sonntagmorgen, offenbar noch mit der Schminke von gestern unter den Augen, in irgendeiner geliehenen Jogginghose, die zu groß und unvorteilhaft ist, um einer Freundin zu gehören. Sie setzt sich an den Küchentisch und mampft den Bacon, den ich für Viljar und Aslak gebraten habe. Ich muß mich zusammennehmen, um nicht zu sagen, ich hätte sie beim Frühstück nicht eingerechnet.
»Ist es nicht schön, so jung zu sein und schon eine so erwachsene Tochter zu haben, ihr könnt ja fast Freundinnen sein«, sagen meine Freundinnen manchmal. Ja, klar sei das schön, ja, irgendwie wäre es ein bißchen wie Freundinnen, na klar, stimme ich ihnen dann zu. Aber ich möchte überhaupt nicht Mias Freundin sein. Solange sie unbekümmert und glücklich wirkt, habe ich beispielsweise keinerlei Bedürfnis zu wissen, wo sie diese Nacht verbracht hat. Mia hingegen testet bis heute unser beider Grenzen aus und teilt mitunter unangenehm intime Einzelheiten aus ihrem neuentdeckten und stetig größer werdenden Erwachsenenleben, um dann in der darauffolgenden Woche wieder stumm und unnahbar zu sein. Als sie noch ein Kind war, dachte ich, es würde für mich okay sein, wenn sie mir alles erzählte, das sei die Art Mutter, die ich bin, jetzt und für immer, aber in der Praxis hat sich gezeigt, daß für mich Grenzen existieren, sogar in bezug auf Mia.
Sie sieht glücklich aus, ähnelt Jens, ähnelt nur Jens, als sie Gott sei Dank über einen von Aslaks unzähligen Witzen lacht. Er bemüht sich zu sehr, hoffentlich kriegt er die Balance hin. In den letzten Monaten mußte ich mehrfach Zeugin von Situationen werden, in denen sich Aslak über einen Kontakt zu Mia, über ein Fünkchen geschenkte Aufmerksamkeit von ihr derart gefreut hat, daß er eine Grenze überschritten hat, die außer Mia niemand kennt und nach der sie urplötzlich mit einem herablassenden Kommentar zusticht, schlimmstenfalls mit einem quasi zufälligen Verweis auf Jens.
Während ihrer Kindheit und Jugend hat sich meist Aslak der Gespräche und Fragen über Jens angenommen. »Du kannst ihr doch nicht auf diese Weise antworten«, hatte er gemeint, als Mia sechs war und auf ein Bild mit uns dreien auch Jens malen wollte. Sie hatte nach seiner Haarfarbe gefragt, und ich hatte schulterzuckend geantwortet, das könne sie sich selbst aussuchen, woraufhin sie natürlich verwirrt war und Aslak angesehen hatte. »Er hat dieselbe Haarfarbe wie du«, hatte er gesagt und ohne einen Blick zu mir schnell hinzugefügt: »Und dieselbe Augenfarbe.« – »Sie muß wohl nicht alle Details über ihn wissen«, hatte ich anschließend gemeckert. »Früher oder später wird sie sowieso alles über ihn herausfinden, was sie interessiert, und dann möchte nicht ich derjenige sein, der sie zuvor daran gehindert hat«, hatte Aslak geantwortet. Seine Strategie hat gut funktioniert, bis Jens nach Oslo gezogen ist, mit seiner Anwesenheit Aslak und mich in ein anderes Licht gerückt und ihr eine Vergleichsmöglichkeit geboten hat.
Die Veränderung ist vage, ganz und gar ungreifbar, ich weiß nicht, wie ich darüber sprechen soll, und wage schon gar nicht das Risiko, sie noch weiter in Richtung Jens zu drängen, also verhalten Aslak und ich uns ihr gegenüber, als tanzten wir auf rohen Eiern. Es macht mich komplett wahnsinnig, und in mir brodeln Tausende Bemerkungen und Ermahnungen: sie könne doch sicher die Musik leiser drehen, wie besprochen das Bad putzen, Bescheid geben, ob sie zum Abendessen komme, die farbigen Socken nicht in die weiße Wäsche werfen, ihm nicht vergeben, ihn nicht vergöttern, nicht in ihm aufgehen.
Abgesehen davon war das vergangene Jahr ein unangenehmer Vorgeschmack darauf, wie das Leben nach ihrem Auszug sein wird, und bei diesem Gedanken überfällt mich jedes Mal sofort Atemnot – erstens, daß sie so weit weg von mir sein wird, und zweitens, daß ich dann herausfinde, was Aslak und ich ohne sie sind.
»Und, hast du Oma erreicht?« fragt Mia und hockt mit angezogenen Beinen auf der Bank, während Aslak und ich den Tisch abräumen.
»Nein, ich probiere es gleich nochmal, aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen«, sage ich.
»Ja, weiß ich«, antwortet Mia, »aber ich bin nun mal jemand, der nicht anders kann, als sich Sorgen zu machen.«
»Aha, so jemand bist du?« Ich lache.
»Hör auf«, antwortet Mia, »du hast mich schon verstanden.«
Dieses Gespräch haben wir unzählige Male geführt. Ich kann mir einen Kommentar über das Bedürfnis ihrer Generation, die persönlichen Eigenschaften und Charakterzüge zu proklamieren, einfach nicht verkneifen. »Ich bin nun mal jemand, der sehr empathisch ist«, sagte ein Mädchen, das mit gebrochenem Arm in meine Praxis gekommen war, ich nickte, während ich ihren Arm untersuchte, und verstand den Zusammenhang nicht. »Mhm, und ist das hart für dich?« fragte ich etwas unsicher. »Ach nein«, antwortete sie unbekümmert, »mir geht nur einfach alles sehr nah, verstehen Sie?« – »Ich verstehe«, antwortete ich und überwies sie zum Röntgen.
Ich habe versucht, Mia zu erklären, daß es irgendwie unangenehm sei, wenn man erzählt bekäme, wie man sie sehen solle. Das beeindruckte sie nicht. Es sei ja noch unangenehmer, wenn man falsch gesehen werde, hatte sie mit einem Schulterzucken geantwortet, und vielleicht hat sie recht.
Der Montag kommt mit einer solch normalisierenden Kraft, daß ich in der U-Bahn nach Ellingsrud beinahe losheule. Die herbstliche Dunkelheit erzeugt eine Gemeinschaft im Waggon, die mir von hellen Sommermorgen fremd ist, eine freundliche Stille, vielleicht aus Sympathie oder Anerkennung für die anderen, die auch um sechs Uhr aufgestanden sind, um rechtzeitig bei der Arbeit zu sein, und ebenfalls der düsteren Dunkelheit und schneelosen Kälte des Novembers getrotzt haben. Ich bin Teil dieser Gemeinschaft, ziehe die Schultern hoch, puste auf meine Hände, aber es gibt keinen Monat, den ich lieber mag. Ereignislos, feiertagslos, keinerlei Ausnahmezustand, nur die stille Dunkelheit, die unbeirrt mehr und mehr vom Tag verschlingt.
Die vierzig Minuten U-Bahn-Fahrt zur Arbeit und zurück sind zum Höhepunkt meines Tags geworden, ein angenehmes Dazwischen, in dem ich weder mit anstrengenden Patienten noch mit anstrengenden Familienmitgliedern umgehen muß. Beim Aussteigen versuche ich es zum dritten Mal erfolglos bei Mama, und zum ersten Mal seit Freitag erlaube ich mir, die übliche Sorge um sie zu spüren, ein Gefühl solch konstanter, fester Größe, daß sie ebensogut ein schmerzendes Körperteil sein könnte, manchmal ignorierbar, aber immer da.
Ich nehme mir für die ersten Patienten unverhältnismäßig viel Zeit, spreche wie üblich ewig mit Ingrid. Sie ist neunzig, hat stets Bonbons in der Tasche, die sie im Wartezimmer und an die Sprechstundenhilfen verteilt – und sie streichelt mir beim Gehen über die Wange wie eine Bilderbuchoma. Ihre Präsenz ist so angenehm sanft, daß ich sie schlicht dabehalten und jeden Gedanken an den restlichen Tag verdrängen möchte. Anschließend verspüre ich den nächsten Patienten gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil ich Lieblinge habe, und nehme mir viel zuviel Zeit für eine gynäkologische Untersuchung und ein Attest zur Verlängerung eines Führerscheins.
Als ich Frida aufrufen will, die meines Wissens schon seit eineinhalb Stunden im Wartezimmer sitzt – wie immer –, ruft Mama endlich zurück. Bevor ich rangehen kann, öffnet Frida die Tür zu meinem Sprechzimmer. Ich weise den Anruf ab.
»Frida, du mußt warten, bis ich dich hole. Das haben wir doch besprochen?« versuche ich möglichst pädagogisch zu sagen, ohne dabei herablassend zu klingen, eine schier unmögliche Balance, insbesondere wenn sich Frida wie ein ungeduldiges Kind aufführt: »Aber mein Termin war um zehn nach, und deine letzte Patientin ist doch schon ewig raus«, antwortet sie.
»Gehst du bitte wieder ins Wartezimmer, bis ich dich aufrufe?« frage ich, aber Frida bleibt verunsichert in der Tür stehen.
»Ich meine es ernst«, schiebe ich nach, wende mich dem Bildschirm zu, schlucke.
»Ich glaube, ich kriege das Kind jetzt«, sagt sie.
»Nein, tust du nicht«, antworte ich mit Blick Richtung Bildschirm, presse die Zähne aufeinander, schließlich macht sie die Tür zu.
Für ein paar Minuten starre ich auf ihre Krankenakte, ohne darin zu lesen, dann gehe ich ins Wartezimmer und hole sie rein. Noch bevor wir durch die Tür sind, heult sie los, aber daran bin ich gewöhnt, ihre Tränen bringen mich nicht mehr aus der Fassung, denn wenn ich nur ein Fünkchen Hoffnung auf Fürsorge jenseits der berufsmäßigen erwecke, verschlingt sie mich mit Haut und Haaren.
Bei einer der ersten Begegnungen habe ich sie in den Arm genommen, hatte keine Ahnung, wie ich mit ihrer Verzweiflung und Angst umgehen sollte – und mit diesem Blick, der selbst nach mehreren Jahren als Spielball in einem System, das nicht wußte, wohin mit einer wie ihr, das Vertrauen ausstrahlte, sie sei nun an jemanden geraten, der ihr helfen könne. »Ich werde dir helfen«, dachte ich damals im festen Glauben, das sei mir möglich. Bis heute glaube ich an manchen Tagen, die Tatsache, daß ich hier war, stabil und nach und nach mit deutlichen Grenzen, sei tatsächlich eine Hilfe.
Bei ihrem ersten Besuch in der Praxis war es schwer, sie zu mögen. Sie war eine trotzig jammerige Klette mit einer Krankenakte, die sie selbst auswendig konnte und in der eine endlose Reihe von Einweisungen, beendeter oder abgebrochener Therapien bei Psychologen des sozialpsychiatrischen Diensts, Medikamenten, Sozialamtsmaßnahmen und unverhältnismäßig vielen Hausarztwechseln aufgelistet war. Nun war sie mittlerweile seit sieben Jahren meine Patientin.
»So. Wie geht’s?« frage ich, sobald sie sitzt und ich ihr wie üblich ein Päckchen Taschentücher hingelegt habe.
»Ich glaube, ich kriege das Kind jetzt«, wiederholt sie. »Bitte.«
Sie schluchzt, lehnt sich mit dem Oberkörper nach vorne, der Bauch stößt gegen die Schenkel, sie verschränkt die Hände hinterm Kopf und wippt vor und zurück.
»Du kriegst das Kind noch nicht jetzt, du bist erst in der vierundzwanzigsten Woche, weißt du«, sage ich. »Aber die Hälfte haben wir schon geschafft, Frida, du packst das.«
Ich verfluche mich selbst für dieses wir, mache im Eifer zu helfen noch immer grundlegende Fehler, vermittle ihr das Gefühl von Gemeinschaft, wo sie doch am dringendsten verstehen muß, daß sie in erster Linie allein ist, daß niemand kommen wird, um sie zu retten. Zumindest niemand außer mir, und mitunter versetzt mich der Gedanke, daß sie nur mich hat, in Panik.
»Nein, das packe ich nicht, ich will es weghaben«, brüllt sie in Richtung Boden. »Es frißt mich auf.«
Erschreckend viele ihre Gedanken erinnern mich an mich selbst während meiner Schwangerschaft mit Mia, wie sich damals Angst und Einsamkeit in den absurden Gefühlen und Vorstellungen manifestiert hatten, ich würde verspeist werden. Ich schreibe in die Krankenakte, Fridas Gedanken seien krank, verstört, an der Grenze zu psychotisch.
»Nichts frißt dich auf, in dir wächst ein gesundes, schönes Kind.« Mir wird klar, wie falsch diese Wortwahl war, daß sie gerade mit diesem wachsenden Etwas in sich nicht umgehen kann, ich denke an mich selbst damals, habe aber heute weder Zeit noch Energie, den richtigen Zugang zu ihr zu suchen, bin nach nur drei Patienten bereits über eine halbe Stunde in Verzug. »Wollen wir erstmal den Blutdruck messen und danach schauen wir uns deinen Bauch an?«
Frida kapituliert, richtet sich auf, schiebt den Ärmel hoch. Ihr dünner Unterarm ist voll mit kreuz und quer verlaufenden weißen Narben. Als sie das erste Mal bei mir war, habe ich nichts dazu gesagt, ich erinnere mich noch an ihre gespannte Erwartung beim Hochschieben des Ärmels und die anschließende Enttäuschung über meine ausbleibende Reaktion. Diese Erinnerung versetzt mir einen Stich, seitdem ich sie mögen gelernt habe, denke ich, ich hätte ihr diese Genugtuung einfach geben können.
Ich ertappe mich häufig dabei, wie ich mich in ihr spiegle, mich wiedererkenne, sie lebt so viele meiner Neigungen aus, alles, was ich kontrollieren, was ich in Schach halten muß. Ich kriege nicht genug davon, wie sie die Maßstäbe sprengt, grenzenlos in ihrer Annährung an die Welt.
Ich esse mittags im Pausenzimmer im Stehen einen Joghurt, habe das Gefühl, es geht schneller, wenn ich mich nicht hinsetze, außerdem hat mich die Smartwatch, die ich von Aslak zu Weihnachten bekommen habe, bereits Dutzende Male erinnert, daß ich weit hinter meinem Aktivitätsziel »Stehen« liege. Die beiden Ärzte, mit denen ich mir die Praxis teile, essen mit ihren Smartphones in den Händen am Tisch, obwohl wir vor langem beschlossen haben, die Mittagspause solle handyfreie Zeit sein, eine Ruheoase im Tagesverlauf, eine halbe Stunde, in der wir miteinander sprächen, einander auf Stand brächten, Erfahrungen und eventuelle Frustrationen loswerden könnten.
Ich gehe mit dem Rest meines Joghurts zurück ins Sprechzimmer, rufe Mama an. Sie ist sofort dran.
»Endlich«, sagt sie.
»Dir auch Hallo«, entgegne ich.
»Ich habe doch das ganze Wochenende versucht, bei dir anzurufen«, sagt sie.
»Nein, hast du nicht, du hast genau einmal angerufen. Eigentlich ist es eher umgekehrt, ich habe es mehrmals bei dir versucht«, antworte ich.
Sie wird für ein paar Sekunden still, im Hintergrund höre ich den Teekessel, stelle mir die Küche daheim vor, Mama in ihrer gelben Strickjacke, die grüne Teekanne.
»Jedenfalls ist keiner von euch rangegangen, als ich angerufen habe«, sagt sie. »Ich habe mich allmählich gefragt, ob da eine Verschwörung in Gang ist.«
Sie lacht halbherzig.
»Keine Sorge, ich habe von Magnus seit mehreren Wochen nichts gehört«, antworte ich. »Aber ist denn irgendwas Besonderes?«
»Nein, eigentlich ging es nur um die Sache mit den Hühnern. Ich habe ja Aslak gesagt, daß ich gerne mit euch sprechen wollte, bevor ich sie schlachte, Viljar ist ja so vernarrt in sie, und …« Seit Papa körperlich behindert ist und wir die Kühe und Schafe schlachten mußten, hat Mama Hühner gehabt, sie hatte darauf beharrt, ein Hof müsse Tiere haben, und sich zwölf Hühner zugelegt. Ich erinnere mich an den Anblick von über den Hof torkelnden, kopflosen Hühnern, als Mama den ersten Schwung geschlachtet hat. Sie hatte dazu ihre Biologie-Klasse eingeladen, denn die Kinder sollten den Kreislauf des Lebens kennenlernen, also daß die Hühnerfilets, die sie aßen, nicht aus der Tiefkühltruhe stammten. »Sie stammen auch nicht von alten, zähen Hühnern«, hatte Magnus angemerkt, aber Mama fuhr damit fort, Kinder zum Schlachten einzuladen, bis ein paar Eltern beim Schulleiter Beschwerden wegen Traumatisierung einreichten.
Viljar war meines Wissens nie besonders vernarrt in Mamas Hühner gewesen, im Gegenteil zeigt er eher ziemlich deutliche, beunruhigende Zeichen einer generellen Vogelphobie, deren Ursache zu finden mir bisher die Energie gefehlt hat. Zu behaupten, sie denke an Viljar, ist nur eine weitere Art, mir ein schlechtes Gewissen zu machen.
»Ja, das ist lieb von dir, daß du an Viljar gedacht hast«, sage ich nur. »Aber du mußt natürlich tun, was deiner Meinung nach für die Hühner am besten ist, Mama.«
»Ist sowieso zu spät«, antwortet sie. »Ich habe sie am Donnerstag geschlachtet.«
3
»Aber wenn du sie schon am Donnerstag geschlachtet hast, dann verstehe ich nicht, warum du uns am Freitag so dringend erreichen mußtest«, sagt Sigrid.
Ich gieße das kochende Wasser in den Bottich, der auf der Arbeitsplatte steht, weiß nicht, wie ich das Gespräch fortsetzen soll, hätte nicht den Umweg über die Hühner machen dürfen, sondern direkt zu Sache kommen müssen, wie ich es am Freitag vorgehabt hatte, aber ich hatte das ganze Wochenende nur Sigrid vor Augen und wie unmöglich es war, ihr noch mehr von mir und meinem Krempel aufzuladen.
»Ach, ich meinte Freitag, ich habe sie am Freitag geschlachtet«, sage ich. »Aber genug davon. Wie geht es euch?«
»Gut, nur bin ich gerade bei der Arbeit, also wenn es nichts Dringendes ist, dann laß uns vielleicht lieber am Nachmittag nochmal sprechen?« bittet sie, irgendwie zögerlich, sicherlich will sie sich nicht zu einem weiteren Gespräch verpflichten.
Bei jedem Telefonat mit ihr glaube ich, etwas werde sich ändern, spüre das erst nach dem Auflegen und bleibe immer mit dem Gefühl zurück, etwas sei unerfüllt geblieben. Oft bin ich nach unseren Gesprächen wegen der in Tonfall und Pausen steckenden Anschuldigungen tagelang niedergeschlagen – diese Minisekunde Schweigen vor jeder ihrer Antworten, als gäbe sie mir damit Zeit, noch etwas zu sagen.
»Ja, natürlich«, stimme ich zu, »natürlich können wir am Nachmittag sprechen.«
Ich trage den Bottich nach draußen, habe am Freitag nur geschafft, die Hühner grob zu rupfen und notdürftig auszunehmen, bevor ich aufgeben mußte und das unfertige Schlachtvieh in die Gefriertruhe legte. Ich konnte mich gerade noch aufs Sofa schleppen, wo ich mehrere Stunden wie erschlagen liegen blieb. Die Hühner sind in der Gefriertruhe im Stall, die voller Wildfleisch ist, das ich weder essen konnte noch mich dazu überwinden, es wegzuwerfen, nachdem ich kapituliert und Gustav in ein Pflegeheim gesteckt hatte.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendeines der Hühner zu essen, aber zumindest vermittelt es ein Gefühl von Sinnhaftigkeit, ein Tier ohne Umwege und ohne unnötigen CO2-Abdruck zu Nahrung zu verarbeiten. Ich hole einen der kopflosen Körper aus der Truhe, meide den Blick auf die Beschriftungen der restlichen Fleischpakete, Gustavs schiefe Handschrift, Elchfilet 2009 – sein letztes Jagdjahr, als ihn seine Jagdkameraden beinahe auf den Hochsitz hatten tragen müssen. Sie beehrten ihn anschließend mit dem Filetstück des einzig erlegten Elchs, wofür er sich mehr schämte als für seine Forderung, zur Jagd mitzukommen. Im folgenden Jahr saß er schon im Rollstuhl.
Ich säubere die gefrorenen Hühner, meine Finger in den gelben Gummihandschuhen werden vor Kälte ganz weiß und steif, aber ich werde bestimmt nicht aufhören, muß das erledigt haben, bevor Sigrid wieder anruft; mich überfällt das Gefühl, alles andere müsse geordnet sein, bevor ich es ihr erzähle, bestimmt sollte ich auch zuerst bei Gustav vorbeischauen, alle Pflichten erledigt haben.
Wie üblich sitzt Gustav am Fenster, das nach Norden geht, zum Hof und zu mir. Seine Haare sind grau, fast schon weiß, aber immer noch voll, ein Gegensatz zu dem dürren Körper. Manchmal überrascht mich, wie er tatsächlich aussieht, daß er dem Mann in meinen Gedanken und Erinnerungen nicht mehr ähnelt.
»Hey, du.« Ich beuge mich hinunter und umarme ihn. »Haben sie dich heute wieder nicht rasiert?« Ich streiche ihm mit dem Zeigefinger über die stopplige Wange.
Er hebt den Blick und sieht mich an, lacht los, hat noch immer verblüffend gesunde Zähne, weiß und kräftig. Seine Zähne waren ihm immer heilig, er meinte, man könne über einen Menschen viel dadurch erfahren, wie er auf seine Zähne achte, und vollzog morgens und abends strikte Abläufe aus Putzen und Zahnseide. Selbst als er nicht mehr wußte, wie man die Dusche anstellt, putzte er sich weiterhin ohne Hilfe die Zähne.
Ich löse die Rollstuhlbremsen und schiebe Gustav in sein Zimmer, ertrage es nicht, vom Pflegepersonal oder anderen Patienten beobachtet zu werden. »Mama, du solltest sie besser Bewohner:innen nennen«, sagte Magnus bei seinem letzten Besuch hier. Sigrid, er und ich saßen um den Tisch in der Ecke und redeten über Gustav hinweg miteinander, was immer passiert, wenn sie mitkommen, wir finden keine gemeinsame Art der Kommunikation, die ihn miteinbezieht. Ich kann nicht mit Gustav sprechen, wie ich es tue, wenn wir allein sind, und Sigrid und Magnus können oder wollen vermutlich ihre persönliche Art der Kommunikation – oder des Schweigens – mit ihrem dementen Vater, nicht praktizieren. »Warum soll ich sie Bewohner nennen«, fragte ich. »Sie leben nur deshalb hier, weil sie krank sind, und kranke Menschen in Behandlung sind wohl strenggenommen die Definition von Patienten.« Sigrid nickte, aber ich habe schon mehrmals gehört, wie sie eigene Patienten als Empfänger oder Klientinnen oder irgend etwas anderes, das sie auf Augenhöhe heben sollte, bezeichnet hat. Ich habe sie damit konfrontiert und bei unserer letzten Diskussion darüber angemerkt, warum sich auch nur ein einziger Patient auf der Welt wünschen solle, mit seinem Arzt auf Augenhöhe zu sein, mir würde das jedenfalls ziemlich Sorgen machen, schließlich gehe es ja darum, daß man komme, um Hilfe zu kriegen. Und das erfordere Hierarchie. Sigrid hat nicht geantwortet, sondern nur Magnus ihren typisch vielsagenden Blick zugeworfen, selbstmitleidig, fast um seine Bestätigung bettelnd, als würde ich sie in diesem Gespräch, ja in jedem Gespräch angreifen oder kritisieren oder beleidigen.
Jetzt bin ich mir meiner Argumentation nicht mehr sicher. Mich selbst als Patientin zu bezeichnen ist ein passives und beruhigendes Abgeben der Verantwortung, aber zugleich kann ich mich mit dieser Rolle nicht vollständig identifizieren, gut möglich, daß ich mich in Zukunft lieber als Klientin fühlen möchte, als eine Art Teilnehmerin mit mehr Kontrolle.
Der Großteil der anderen Bewohner ist älter als Gustav, und ich habe schon häufiger gedacht, es beschleunige sicher seinen Gehirnschwund, nur krumme, gebrechliche Menschen als Gegenüber zu haben. Jedesmal wenn ich über den Parkplatz auf die Eingangstür von Gustavs nunmehr letztem festen Wohnsitz zugehe, lasse ich mich von sämtlichen Gedanken, wie schrecklich er es hier haben muß, übermannen.
Heute fühlt es sich anders an, ich schaffe sogar, mit Gustav auf dem Weg in sein Zimmer zu plaudern, lächele dem Pfleger zu, was ich normalerweise vermeide, weil ich die Verurteilung, die aus seinem Blick spricht, nicht ertrage. Kaum sind Gustav und ich allein, entspanne ich mich. Ziehe meine Strickjacke aus, stelle Gustav im Rollstuhl dicht ans Kopfende des Betts und lege mich dann hin, mit dem Kopf auf sein Kissen, seinen Geruch. Atme tief ein, langsam wieder aus, strecke die Hand aus und streichle ihm erneut über die Wange, nehme seine in meine und drücke sie, kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Zum ersten Mal seit Donnerstag weine ich. Plötzlich tut mir Gustav furchtbar leid, was er erdulden muß, ist unerträglich.
»Ach, das kommt nur daher, daß ich den ganzen Tag mit den Hühnern am Werkeln war«, erkläre ich und sehe ihn an, lächle halbherzig und wische mir zugleich die Tränen mit dem Ärmel seines Pullovers ab. »Das hast du nie verstanden, ich weiß, aber sie wachsen einem nun mal ans Herz.«