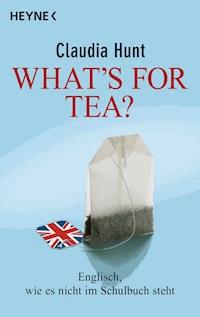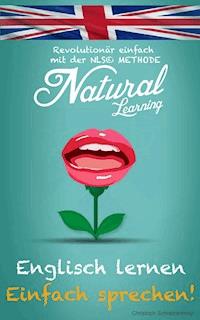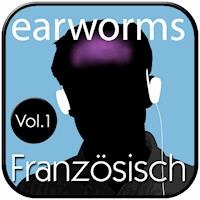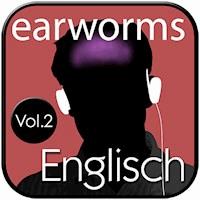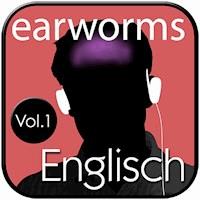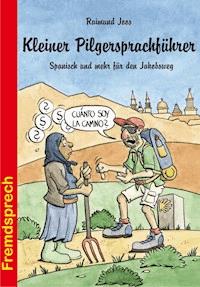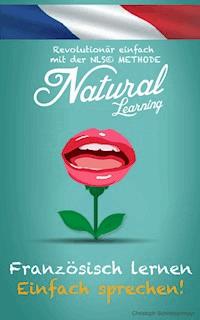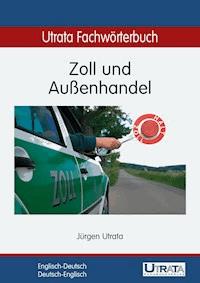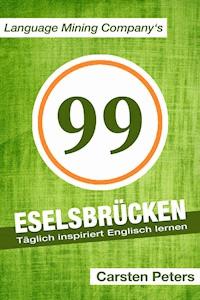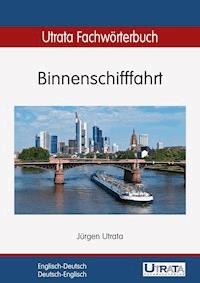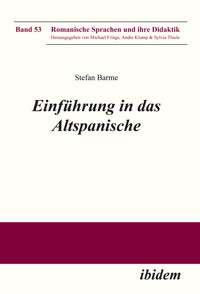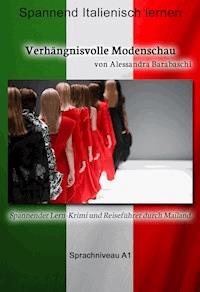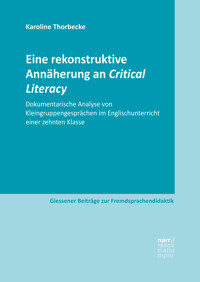
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik
- Sprache: Deutsch
Sprache ist Macht - und der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe. Genau hier setzt Critical Literacy an: Schüler:innen sollen lernen, sprachliche Machtstrukturen kritisch zu hinterfragen und so gesellschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und zu verändern. Dieses Buch untersucht erstmals, wie dieses Bildungsversprechen im Unterricht eingelöst werden kann. Die Autorin analysiert dokumentarisch, wie Schüler:innen mit Aufgaben zur Konsumkritik umgehen und inwiefern dabei Irritationen entstehen als mögliche Auslöser von Bildung. Dabei zeigt sich: Gleichberechtigte Interaktion und kreative Zugänge fördern Critical Literacy, während andere in der Theorie wichtige Elemente weniger relevant sind. Aus diesen praxisnahen Einblicken zieht die Autorin wertvolle Implikationen für Forschung und Lehrer:innenbildung. Das Buch richtet sich an alle, die an der Gestaltung eines emanzipativen Fremdsprachenunterrichts interessiert sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GIESSENER BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENDIDAKTIK
Herausgegeben von Jürgen Kurtz, Michael Legutke, Hélène Martinez, Ivo Steininger und Nicola Würffel.
Begründet von Lothar Bredella, Herbert Christ und Hans-Eberhard Piepho.
Karoline Thorbecke
Eine rekonstruktive Annäherung an Critical Literacy
Dokumentarische Analyse von Kleingruppengesprächen im Englischunterricht einer zehnten Klasse
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381141128
© 2025 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
ISSN 0175-7776
ISBN 978-3-381-14111-1 (Print)
ISBN 978-3-381-14113-5 (ePub)
Inhalt
Danksagung
I Einleitung
II Theoretische Überlegungen
1Gegenstandstheorie Critical Literacy
1.1Was ist Kritik?
1.1.1Antike Rhetorik, Aufklärung und kritische Theorie
1.1.2Diskurstheorie und Critical Discourse Analysis
1.1.3Paulo Freire und die kritische Pädagogik
1.2Was ist Critical Literacy?
1.2.1Analytische Komponente
1.2.2Performative Komponente
1.2.3Critical Literacy als transformatorischer Anspruch
1.2.4Verortung des Konstrukts
1.2.5Forschungsstand und Beschreibung des Desiderats
1.3Zusammenfassung und Formulierung der Forschungsfragen
2Bildungstheorie
2.1Bildung empirisch erforschen
2.1.1Bildung als krisenhafter Prozess
2.1.2Irritation als kleine Krise
2.1.3Antwortweisen auf Irritationen
2.1.4Nachdenklichkeit als produktiver Umgang mit Irritation
2.1.5Bildung als zieloffener Prozess
2.1.6Irritationsfreundliche Settings im Fachunterricht
2.2Bildungstheoretische Präzisierung der Forschungsfragen
3Methodologie
3.1Praxeologische Wissenssoziologie
3.1.1Zielsetzung und Grundannahmen
3.1.2Rekonstruktion von Norm-Habitus-Spannungen als zentrales Interesse dokumentarischer Analyse
3.1.3Wissenssoziologisches Verständnis von Macht
3.2Methodologisch präzisierte Fragestellungen
III Methodische Überlegungen
4Vorgehen bei der Datenanalyse
4.1Passagenauswahl und Transkription
4.2Formulierende und reflektierende Interpretation
4.3Fallvergleich und Typenbildung
5Untersuchungsdesign
5.1Feldzugang und Datenerhebung
5.2Rechtliche und ethische Überlegungen zu Datenschutz und Urheber*innenrechten
5.3Didaktische Begründung der Konzeption der Unterrichtseinheit
5.4Beschreibung der Unterrichtseinheit
5.5Begründung des Fokus auf die Phase der Critical Transformation bei der Datenauswertung
IV Ergebnisdarstellung
6Analyse der Rahmung der Aufgabenbearbeitung
6.1Dokumentarische Analyse der Aufgabenstellung
6.2Dokumentarische Analyse der Einführungssituation der Aufgabe
7Exemplarische Falldarstellung
8Mehrdimensionale Typenbildung
8.1Dimension 1: Umgang mit dem Themenfeld Konsumerismus
8.1.1Typ 1: Involvierte Rezeption
8.1.2Typ 2: Kreatives Redesign
8.1.3Typ 3: Engagierte Diskussion
8.1.4Typ 4: Engagierte Diskussion und kreatives Redesign
8.2Dimension 2: Umgang mit Dissens
8.2.1Typ 1: Ko-Konstruktion
8.2.2Typ 2: Hierarchie
8.2.3Typ 3: Heteronomie
8.3Dimension 3: Umgang mit der Norm der Konsumerismus-Kritik
8.3.1Typ 1: Distanzierung
8.3.2Typ 2: Prüfung
8.3.3Typ 3: Subjektivierung
8.3.4Typ 4: subjektivierende Prüfung
9Relationierung der Analyseergebnisse
9.1Relationaler Typ 1: affirmativ
9.2Relationaler Typ 2: subversiv
9.3Relationaler Typ 3: reflektierend
9.4Relationaler Typ 4: reflektierend-subversiv
9.5Von der Empirie zur Theoriegenerierung: Gedankenexperimentelle Vereinfachung der relationalen Typologie
V Diskussion der Ergebnisse
10Critical Literacy als Interaktionsgestaltung
10.1Gleichberechtigte Dialogizität
10.2Gegenüberstellend-direktiver Lehrstil
10.3Distanzierte Reproduktion
11Critical Literacy als kreativer Prozess
11.1Kreative Critical Literacy als Ausdrucksmedium
11.2Kreative Critical Literacy als Reflexionspotential
12Critical Literacy als kritischer Gebrauch der Fremdsprache
13Critical Literacy als kognitivierende Analyse
14Critical Literacy als soziales Engagement
VI Fazit und Ausblick: Implikationen für Forschung und Lehrer*innenbildung
Literaturverzeichnis
Anhang
Transkriptionsrichtlinien
Tabellarische Übersicht über in der Darstellung verwendete Passagen
Einverständniserklärung
Abstracts
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
„An allem ist zu zweifeln.“
Karl Marx
„Love für den Zweifel“
Finna Luxus
Danksagung
Bildung entsteht in einer Konstellation der Krise. Und: Aus einem Bildungsprozess geht man verändert hervor. Verändert hat mich die Arbeit an meiner Promotionsschrift in jedem Fall, aber vor allem auch die vielen bereichernden menschlichen Begegnungen, die ich in den letzten Jahren machen durfte. Euch, und den Menschen, die schon vorher in mein Leben getreten sind und die mich auf meinem auch krisenhaften Weg zur Abgabe begleitet haben, möchte ich an dieser Stelle danken:
An erster Stelle danke ich meinem Erstbetreuer Andreas Bonnet für seine messerscharfe und immer konstruktive Kritik, die mir geholfen hat, so einige Knoten in meinem Kopf zu entwirren, und dafür, dass er immer in meine Fähigkeiten und in die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit vertraut hat.
Auch danke ich meinem Zweibetreuer David Gerlach für seine hilfreiche Kritik im Rahmen von Kolloquien, auf Tagungen und in Betreuungsgesprächen, welche entschieden dazu beitrug, die Qualität meiner Arbeit zu steigern.
Ich danke meiner Drittgutachterin Sílvia Melo-Pfeifer, dass sie sich spontan – trotz Forschungsaufenthalt – bereit erklärte, das Drittgutachten zu übernehmen.
Ich danke meiner Kooperationslehrerin sowie allen Schüler*innen, die an meiner Studie teilgenommen haben, dafür, dass sie sich mutig auf das Abenteuer Unterrichtsforschung eingelassen haben. Solche Offenheit macht Innovation möglich.
Ich danke Margitta Kuty. Ohne sie gäbe es diese Arbeit nicht. Ich danke meinen Greifswalder Kolleg*innen Luisa Grabiger, Susan Reichelt, Maybritt Woodcock und Daniel Rühlow für ihre fachliche, berufliche wie menschliche Unterstützung. Franziska Malsch und Arne Last danke ich dafür, dass sie mir während der letzten Phase meiner Greifswald-Zeit Obdach gewährt haben. Ich habe mich bei euch immer sehr wohl und zuhause gefühlt!
Ich danke Birgit Schädlich für ihr Augen öffnendes Feedback auf der DGFF-Sommerschule und dafür, dass sie mir anschließend empfohlen hat, Andreas Bonnet zu kontaktieren.
Ich danke Britta Lübke, Inga Püster und Eva Schneider für ihre kompetente Beratung.
Angelika Paseka danke ich dafür, dass sie mich in die Kniffe der dokumentarischen Interpretation eingeführt hat. Den Teilnehmenden der Hamburger fremdsprachendidaktischen Promotionskolloquien sowie des Bildungsgangkolloquiums danke ich für den wertvollen Austausch.
Ich danke meinen Interpretationspartnerinnen Teresa Berding, Johanna Brüggemann, Ioana Barth-Chiotoroiu, Carina Leonhardt, Mareen Lüke und Melissa Major, mit denen es mir immer große Freude gemacht hat, zu interpretieren.
Ich danke Constanze Struck für die bereichernde Zusammenarbeit im Promovierenden-Rat.
Ich danke Jocelyn Glazier für den informativen Kurs zur Critical Discourse Analysis, welcher mir hilfreichen Input für das Verfassen meines Theorieteils lieferte.
Ich danke meinen Co-Working-Partnerinnen Talke Cassing und Theresa Müller, deren Gesellschaft mir das letzte Drittel meiner Promotionszeit versüßt hat.
Ich danke Jules Bündgens-Kosten und Britta Viebrock, durch deren hilfreiches Feedback während meiner Tätigkeit in Frankfurt ich noch so einiges dazulernen durfte.
Außerdem danke ich meinen Frankfurter Kolleg*innen Rieke Dieckhoff, Jan-Erik Leonhardt und Karoline Wirbatz für die vergnüglichen gemeinsamen Mensa- und Kaffeepausen.
Ich danke Luzie und Pierre Trippel sehr dafür, dass ich in meiner Frankfurter Zeit bei ihnen wohnen durfte. Es war ein schöner Zufall, dass mir die Frankfurter Stelle ermöglicht hat, mit euch und meinem lieben Patensohn so viel Zeit zu verbringen.
Ich danke Donata Burckhardt für die vielen Telefonate, die mir auch im tiefsten Promotions-Loch immer ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert haben. Darüber hinaus danke ich auch allen meinen anderen weltbesten Freund*innen für ihre emotionale Unterstützung.
Ich danke meiner Mutter Anke Maria Thorbecke sehr für das akribische Lektorat aller meiner Seminararbeiten während meines Studiums, meiner Examensarbeit sowie des Großteils meiner Dissertationsschrift. In diesem Zuge danke ich auch den anderen Korrekturleser*innen meiner Dissertation nochmals ganz herzlich für ihre Unterstützung!
Ich danke auch meinem Vater Rupprecht Thorbecke herzlich für die interessierten Nachfragen zu meiner Arbeit und dafür, dass er mir nie Stress gemacht hat, fertig zu werden. Ich danke meiner Großmutter Gertrud Hollm für ihr ehrliches Interesse an meiner Dissertation, die ich ihr gerne noch vorgelesen hätte. Ebenso danke ich Silke Leinkauf, Mario Schuenemann, Leander Leinkauf und Sophie Schwanitz für ihre Unterstützung.
Ganz besonders danke ich Sarah Leinkauf. Dafür, dass sie den ganzen großen Topf Promotionssuppe zusammen mit mir ausgelöffelt hat und die dafür eigentlich auch einen Titel verdient hätte, wenn nicht sogar mehrere. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft.
Hamburg, im August 2024
Karoline Thorbecke
I Einleitung
Englischunterricht ist kein Sprachkurs – Englischunterricht ist ein Fach mit Bildungsauftrag, welches Schüler*innen1 zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen soll (KMK, 2023, S. 6). Aber was meint dieser Bildungsauftrag? Diese Frage bewegte mich nach Ende meines Vorbereitungsdienstes als Englischlehrerin an einer Hamburger Stadtteilschule. Entlastet vom Prüfungsdruck des Referendariats begann ich mich zu fragen, welchen gesellschaftlichen Beitrag ich mit meinem Englischunterricht leisten könnte, jenseits der Vermittlung funktional-fremdsprachlicher Kompetenzen. Inwiefern kann Englischunterricht junge Menschen dabei unterstützen, sich in der Vielstimmigkeit, Multimodalität und Informationsflut unserer digitalisierten Weltgesellschaft zurecht zu finden, sie vor Täuschung und Manipulation bewahren? Wie kann Englischunterricht Schüler*innen dabei helfen, ein Interesse an und eine begründete Haltung zu den komplexen Problemlagen unserer Gegenwart zu entwickeln und dabei selbstbewusst auf die eigene Handlungsfähigkeit zu vertrauen? Was brauchen Jugendliche, um zu emanzipierten Bürger*innen in der globalisierten Welt heranwachsen zu können?
Dieser an mich als Lehrperson gerichtete Bildungsauftrag erschien mir überfordernd und reizvoll, „unverfügbar“ (Rosa, 2018) und lockend zugleich – ich war „disorientiert“ (Mezirow, 1991), wenn nicht gar „irritiert“ (Bähr et al., 2019a) in den Begrifflichkeiten der transformatorischen Bildungsforschung sprechend: Ich befand mich also am Beginn eines Bildungsprozesses, in welchem sich meine Sicht auf Englischunterricht transformieren würde – auch wenn ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte.
Mich der Herausforderung der Erforschung des an mich gerichteten Bildungsauftrages zu stellen, erschien mir damals um so dringlicher geboten, als dass die Jugendbewegung Fridays for Future gegründet wurde, in der sich die Verzweiflung über die zahlreichen globalen Umweltprobleme der jungen Generation entlud. Jedoch wurde mir schnell bewusst, dass offizielle Dokumente wie der Orientierungsrahmen für nachhaltige Entwicklung (KMK & BMZ, 2016) zwar allgemeine pädagogische Leitlinien für die Integration von umweltbezogenen Themen in den verschiedenen Fächern boten, es jedoch an konkreten Konzepten fehlte, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Fremdsprachenunterricht umgesetzt werden könnte (Bartosch (2018); Rosenau (2018)). Auch wenn die Art und Weise, wie ökologische Themen erzählt werden, beeinflussen kann, inwiefern wir wissenschaftlichen Fakten und politischen Maßnahmen Vertrauen schenken, werden in Materialien und Rahmenplänen literarisches, sprachliches und kulturelles Lernen oft als etwas betrachtet „that occurs additionally, after the basic scientific facts have been established”, wie Bartosch und Ludwig (2022, S. 6) kritisieren. Dabei fungiert Sprache zumeist lediglich als Instrument zur Informationsbeschaffung und -weitergabe, ohne dass die Schüler*innen zur Reflexion über die englische Sprache angeregt würden, z. B. im praktischen Unterrichtsvorschlag für den modernen Fremdsprachenunterricht des Orientierungsrahmens für nachhaltige Entwicklung (KMK & BMZ, 2016, S. 165–175).
Auf meiner Suche nach einem sprachbewussten didaktischen Ansatz mit sozial-emanzipativen Anspruch erweckte Critical Literacy mein Interesse, denn Critical Literacy will Lernende befähigen, diskursive Machtstrukturen zu reflektieren, zu kritisieren und zu verändern (Gee, 2012). Obwohl Critical Literacy erst in den letzten 15 Jahren Eingang in die verschiedenen Fremdsprachendidaktiken gefunden hat (Abednia & Crookes, 2018, S. 11) und jüngst eine neue Blüte in der deutschsprachigen Fremdsprachendidaktik erlebt (Leonhardt und Viebrock (2020b); Gerlach (2020a)), blickt das Konzept bereits auf eine lange Geschichte im muttersprachlichen Englischunterricht zurück, die eine Vielzahl an verschiedenen Definitionen hervorgebracht hat. Laut Ávila und Zacher Pandya (2013b, S. 2) herrscht jedoch weitgehend Konsens über die zwei Hauptziele des Ansatzes:
the main, underlying goal of critical literacies praxis is twofold: to investigate manifestations of power relations in texts, and to design, and in some cases redesign, texts in ways that serve other, less powerful interests. (Ávila & Pandya, 2013b, S. 2)
Kritische Diskursanalyse – oder im schulische Kontext „Critical Language Awareness“ (Fehling, 2008) – soll Rezipient*innen befähigen, implizite Perspektivierungen, Machtstrukturen, Normalitätsvorstellungen und Ideologien in Texten auf einer Meta-Ebene zu explizieren (Jones, 2019, S. 11). Diese Kritik und Dekonstruktion von sprachlichen Machtstrukturen solle „real-world impact” (Vasquez, 2017, S. 9) haben und so „socially transformative” wirken (Vasquez et al., 2019, S. 303). Auf Grund dieses Anspruchs, nicht nur die Rezeptionsweisen von Schüler*innen zu verändern, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene Einfluss zu nehmen, versteht sich Critical Literacy als „pedagogy of individual and social transformation” (Morrell, 2008, S. 53).
Forschungsziel
Auch wenn ich mit Leonhardt und Viebrock (2020a, S. 43) in der grundsätzlichen Befürwortung dieser „Hoffnungsbezogenheit“ von Critical Literacy übereinstimme, stellte ich bei Sichtung des Forschungsstandes fest, dass das Versprechen persönlicher wie gesellschaftlicher Transformation zwar eine große Zahl an unterrichtspraktischen Vorschlägen inspiriert hat, jedoch ein Mangel besteht an empirischen Studien, welche eine methodisch valide Überprüfung dieses Bildungsanspruchs anstreben: So kritisiert Wolfe (2010), dass der Diskurs um Critical Literacy sich nicht für die Effekte der vorgeschlagenen Unterrichtssettings auf die Schüler*innen interessiere und auch Behrman (2006, S. 492) schließt sein Review über auf Critical Literacy abzielende Lehrpraktiken mit der Feststellung: „most classroom practices have not been formally evaluated by the contributing authors, nor is there any attempt here to evaluate the effectiveness of each practice”.
Dies entspricht auch Lükes (2024) Einschätzung des deutschsprachigen Diskurses, in welchem es ihr zufolge vor allem an Arbeiten zur theoretischen Ausschärfung sowie der empirischen Untersuchung von Critical Literacy mangele (siehe Granger & Gerlach, 2024 für eines der wenigen Beispiele empirischer Forschung im deutschen Schulsystem). Dazu sei ergänzt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt meines Wissens keine Studien gibt, die sich der Entwicklung von Critical Literacy im Unterrichtsgeschehen mittels rekonstruktiver Methoden nähern. Für die Erforschung von Bildungsprozessen sind rekonstruktive Verfahren jedoch in besonderer Weise geeignet, wie auch Koller (2018, S. 16), Plikat (2020) und Gerlach (2022) argumentieren, da diese der prozesshaften sowie implizite Tiefenstrukturen betreffenden Natur von Bildungsprozessen gerecht zu werden vermögen.
Eine kritische empirische Prüfung des Bildungsversprechens der Critical Literacy mittels des Einsatzes rekonstruktiver Verfahren ist somit dringend erforderlich, um den erwartungsgeladenen Diskurs empirisch zu bereichern und Möglichkeitsräume für kritische Bildung im Fremdsprachenunterricht auszuleuchten. Ziel meiner Arbeit ist daher, Chancen für die Entwicklung von Critical Literacy zu identifizieren und zu beschreiben, die sich in situ im fremdsprachlichen Unterrichtsgeschehen ereignen, um aus diesen Beobachtungen Rückschlüsse über förderliche wie hinderliche Gegebenheiten für die Anbahnung von Critical Literacy zu ziehen.
Bildungstheoretischer Rahmen
Um sich dem Bildungsanspruch von Critical Literacy empirisch zu nähern, stellt sich zunächst die Frage, wie sich Bildung empirisch untersuchen lässt. Kollers (2018) transformatorische Bildungstheorie liefert eine theoretische Fundierung für dieses Vorhaben, in welcher das Krisenmoment eine zentrale Rolle spielt, wobei er Krise als ein „Infragestellen der Normalität einer Routine, einer Erwartung, einer eingespielten Wahrnehmungs-, Denkoder Handlungsweise (2018, S. 215) definiert. Diese sei „Voraussetzung und Bedingung von Bildungsprozessen“ (Bähr et al., 2019b, S. 3). Da solche die ganze Person betreffenden Krisen allerdings im unterrichtlichen Kontext nur äußerst selten vorkommen, stellt die Untersuchung von fachlich gerahmten Irritationsmomenten, als kleinere „didaktisch-methodisch domestizierte Krise[n]“ (Bonnet & Hericks, 2013, S. 46) einen niedrigschwelligen Zugang zu etwaigen Bildungschancen im Unterrichtsgeschehen dar.
Methodologische Prämissen
Wie bereits erwähnt, ist die Eignung rekonstruktiv-interpretativer Verfahren für die Erforschung von Bildungsprozessen wiederholt betont worden (Gerlach, 2022; Koller, 2018, S. 16; Plikat, 2020). In Einklang mit diesen Überlegungen nutze ich für die Auswertung meiner Studie die dokumentarische Methode, da sie die Rekonstruktion von Hinweisen auf sich anbahnende Bildungsprozesse ermöglicht. In der praxeologischen Wissenssoziologie, der Grundlagentheorie der dokumentarischen Methode, wird davon ausgegangen, dass unsere Praxis von konjunktiv geteilten impliziten atheoretischen Wissensbeständen strukturiert wird, den sogenannten Orientierungsrahmen (Bohnsack, 2017). Diese verinnerlichten, performativen Wissensbestände können in Diskrepanz zu äußerlichen Handlungserwartungen – den Normen – geraten, welchen ein „Forderungscharakter“ zukommt (Bohnsack, 2014, S. 43). Das notorische Diskrepanzverhältnis zwischen Normen und Habitus, von welchem in der Wissenssoziologie ausgegangen wird, wird habitusspezifisch bearbeitet. Relevant im Kontext der empirischen Bildungsforschung ist dabei insbesondere die Annahme, dass die Bearbeitung dieser Diskrepanz – wenn diese nicht-routinisiert erfolgt – zu impliziten oder expliziten Reflexionsprozessen und so zu einer Veränderung des Habitus führen kann (Rauschenberg & Hericks, 2018, S. 114). So kann die Rekonstruktion von nicht-routinisierten Umgangsweisen mit Norm-Habitus-Spannungen Hinweise auf sich anbahnende Bildungsprozesse im Unterrichtsgeschehen liefern.
Empirisches Vorgehen
Um Bildungschancen in situ im Unterrichtsgeschehen beobachten zu können, habe ich für die Untersuchung gemeinsam mit der unterrichtenden Englischlehrerin eine auf Critical Literacy abzielende Einheit geplant, die von dieser Lehrerin in ihrer 10. Klasse einer allgemeinbildenden deutschen Sekundarschule durchgeführt und von mir und einer Hilfskraft videographiert worden ist. Die Einheit hatte Influencer*innen-Marketing zum Gegenstand. Oft wird nämlich kritische Werbeanalyse für die Förderung von Critical Literacy empfohlen. Außerdem betonen z. B. Kalantzis und Cope (2012), dass Texte aus der Lebenswelt der Lernenden, die multimodal sind, besonders geeignet für Critical Literacy seien.
Zentrale produktive Aufgabe der Unterrichtseinheit war die Erstellung einer konsumkritischen Parodie eines Influencer*innen-Videos, welche die versteckten Beeinflussungsstrategien der Videos offenlegen sollte. In meinem Dissertationsprojekt interessiere ich mich dafür, empirisch zu rekonstruieren, was passiert, wenn Schüler*innen diese auf Critical Literacy abzielende Aufgabe bearbeiten sollen. Dabei ist für mein Forschungsinteresse insbesondere von Relevanz, wie Schüler*innen dabei mit sprachlicher Perspektivierung sowie den schulischen Machtstrukturen umgehen und inwiefern und in welchen Kontexten dabei nicht-routinisierte Umgangsweisen mit Norm-Habitus-Spannungen rekonstruierbar werden, da diese – wie oben dargelegt – als Bildungschancen gefasst werden.
Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Im theoretischen Teil I dieser Arbeit wird zuerst die Gegenstandstheorie um das Zielkonstrukt Critical Literacy aufgearbeitet (Kapitel 1). Dazu nähere ich mich zunächst der Geschichte des Kritikbegriffs, welchen ich aus philosophischer, linguistischer sowie pädagogischer Perspektive beleuchte. Diese historische Vorarbeit ist notwendig, um das didaktische Zielkonstrukt in seiner Genese und in seiner Abgrenzung von verwandten Konstrukten klar zu umreißen. Da es sich bei Critical Literacy um eine komplexe Kompetenz handelt, werden sodann die verschiedenen angestrebten Teilziele beschrieben, die mit Critical Literacy in Verbindung stehen, um eine differenzierte Übersicht über die mit dem Konstrukt in Verbindung stehenden Normen zu liefern.
Nach Zusammenfassung des Forschungsstandes um Critical Literacy werden aus diesem die Forschungsdesiderate abgeleitet und dann das Irritationsmoment als zentrales bildungstheoretisches Konstrukt zur empirischen Erforschung des Bildungsversprechens von Critical Literacy vorgestellt (Kapitel 2). Dabei wird in Annahmen der empirischen Bildungstheorie über die Struktur und Beschaffenheit von Bildungsprozessen eingeführt sowie über förderliche Gegebenheiten für deren Initiierung im schulischen Unterricht.
Nachdem die Forschungsfragen unter Zuhilfenahme des bildungstheoretischen Begriffsvokabulars präzisiert worden sind, wird sich der praxeologischen Wissenssoziologie, dem dritten Theoriestrang dieser Arbeit, gewidmet (Kapitel 3). Über die Erläuterung der zentralen Konzepte der Wissenssoziologie wird die empirische Erforschung von Bildungschancen vorbereitet – gefasst als nicht routinisierte Bearbeitungsweisen von Norm-Habitus-Spannungen.
Im methodischen Teil II dieser Arbeit wird dann das forschungspraktische Vorgehen der dokumentarischen Methode eingeführt (Kapitel 4). Außerdem lege ich meine forschungsethischen, forschungspraktischen und didaktischen Überlegungen zur Konzeption des Untersuchungsdesigns dar (Kapitel 5).
Im empirischen Teil III dieser Arbeit wird zunächst die Aufgabenstellung sowie die Situation ihrer unterrichtlichen Einführung einer dokumentarischen Analyse unterzogen, um den Rahmenbedingungen der Aufgabenbearbeitung Berücksichtigung zu schenken (Kapitel 6). Die anschließende exemplarische Analyse eines Falles dient dazu, mein Vorgehen bei der dokumentarischen Analyse und die Auswahl der Vergleichsdimensionen transparent zu machen (Kapitel 7).
In der mehrdimensionalen Typenbildung werden sodann die sieben analysierten Fälle vergleichend nebeneinandergestellt, um zentrale Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die drei Vergleichsdimension herauszuarbeiten und zu abstrahieren (Kapitel 8). Die im Rahmen der Typenbildung herausgearbeiteten Charakteristika der Typen werden dann im Kapitel der relationalen Typenbildung in Relation gesetzt, um so Zusammenhänge zwischen den Orientierungen in den einzelnen Vergleichsdimensionen aufzuzeigen (Kapitel 9).
Im Teil IV dieser Arbeit, der Diskussion, werden die Ergebnisse der empirischen Analyse schließlich auf die Theorielinien zurückbezogen, um so eine theoretisch wie empirisch informierte Beantwortung der Forschungsfragen zu ermöglichen (Kapitel 10 bis 14). Im Fazit und Ausblick (Kapitel 15) werden die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und abschließend aus diesen Ergebnissen Implikationen für die künftige fremdsprachendidaktische Forschung zu Critical Literacy sowie für die Fremdsprachenlehrer*innenbildung gezogen.
1Um meinen Sprachgebrauch möglichst inklusiv zu gestalten und in Bezug auf die Kategorie Geschlecht zu neutralisieren, Geschlechtervielfalt jenseits des binären Geschlechtersystems abzubilden sowie Rezeptionsgewohnheiten zu irritieren, habe ich mich dafür entschieden, in meiner Dissertationsschrift mit Hilfe des Gender-Sterns zu gendern, wie auch von der Diskriminierungsstelle des Bundes empfohlen. Die Verwendung des Gender-Sterns stellt den Ausführungen der Diskriminierungsstelle zufolge auch für Menschen mit Seheinschränkungen keine Barriere mehr dar, da aktuelle Screenreader bestimmte Satzzeichen ausblenden können. Des Weiteren wurde die Verständlichkeit des Gender-Sterns für Menschen mit Lernschwierigkeiten in Angeboten in leichter Sprache geprüft und auch in Bezug auf diese Gruppe das Gendern mit Stern für verständlich und somit barrierearm befunden (2023).
II Theoretische Überlegungen
1 Gegenstandstheorie Critical Literacy
Anliegen dieser Arbeit ist die empirische Rekonstruktion von Critical Literacy. Um eine theoretische Anbindung und Bewertung des empirisch Beobachteten zu ermöglichen, wird sich im gegenstandstheoretischen Teil dieser Arbeit zunächst aus einer allgemeineren Perspektive dem Begriff der Kritik genähert, und gefragt, was eigentlich damit gemeint ist, wenn gefordert wird, dass Menschen kritisch sein sollen.
Auch wenn diese begriffsgeschichtliche Einbindung für die empirische Studie nicht unbedingt von Nöten ist, wurde dieser zunächst nicht (fremd-)sprachendidaktische Zugang gewählt, um vor diesem Hintergrund die Spezifik des Konstrukts Critical Literacy in angemessener Komplexität darstellen und verbindende Elemente der verschiedenen für diese Arbeit genutzten Theorien – der kritischen Theorie, der transformatorischen Bildungstheorie sowie der Wissenssoziologie – aufzeigen zu können, um so deren epistemische und forschungsparadigmatische Passung für das Forschungsvorhaben nachvollziehbar zu machen. Zudem wird mit diesem kurzen Exkurs in die Begriffshistorie dem Vorwurf begegnet, dass im erziehungswissenschaftlichen Diskurs das Adjektiv „kritisch“ häufig verwendet werde ohne ein Verständnis dafür, wie dieses überhaupt in der Philosophie entstanden sei und sich entwickelt habe (Morrell, 2008, S. 29). Anschließend wird auf Critical Literacy als spezifische Spielart von Kritik geblickt. Dabei wird Spezifisches wie Verbindendes mit nahestehenden didaktischen Zielkonstrukten herausgearbeitet und abschließend ein Überblick über den aktuellen fachdidaktischen Diskurs um Critical Literacy geliefert.
1.1 Was ist Kritik?
1.1.1 Antike Rhetorik, Aufklärung und kritische Theorie
Im alltagssprachlichen Gebrauch wird das Wort „Kritik“ erstens verwendet, „um sich gegenüber einer Sache im Modus des Zweifels zu nähern und um auszudrücken, dass man selbst damit noch nicht zufrieden ist“ und zweitens für die „grundlegende kategoriale Analyse einer Sache“ (Bonnet & Hericks, 2020a, S. 165). Es leitet sich vom griechischen Substantiv „kriticos“ ab, der Fähigkeit, zu argumentieren und zu beurteilen (Luke, 2012a).
Wie die griechische Etymologie des Begriffes bereits vermuten lässt, hat dieser seine begriffsgeschichtlichen Wurzeln in der griechischen Rhetorik. Schon im Kontext seiner ersten überlieferten Verwendung ist der Begriff der Kritik somit auf den Gegenstandsbereich der Sprache bezogen und auf die mit Sprachgebrauch verbundenen Möglichkeiten zur Manipulation. In seinen platonischen Dialogen lässt Platon seinen Lehrer Sokrates mit verschiedenen Gesprächspartnern über die Zielsetzungen der Rhetorik in den Austausch treten. In der Georgias übt der platonische Sokrates harsche Kritik an den Zielsetzungen der traditionellen Rhetorik, indem er die manipulativen Möglichkeiten aufzeigt, welche der Missbrauch dieser „Fähigkeit mit Worten zu überzeugen“ mit sich bringt (Platon, 2014, 452e).
Jedoch ist die Kritik an der Rhetorik, welche Platon durch die Stimme Sokrates‘ äußert, nicht von grundsätzlicher Natur. Im Dialog Phaidros differenziert er diese Kritik aus, indem er der traditionellen Rhetorik die Möglichkeit einer Rhetorik im Dienste der Wahrheit gegenüberstellt, welche erst dann genutzt werden sollte, wenn die „Wahrheit“ erworben worden ist, um andere Menschen von dem, „was wirklich ist“, „kunstgerecht zu überzeugen“ (Platon, 2019, 260d3). Es geht Platon hier somit um einen angemessenen Gebrauch der Rhetorik, welche nicht für gegenstandsunabhängige Überzeugung (die persuasio in der traditionellen Rhetorik) zur Durchsetzung von Eigeninteressen gebraucht werden sollte, sondern dafür, „um die Ordnung in der Seele des Einzelnen und der Gemeinschaft“ herzustellen, wie Erler (2019) betont.
Erler stellt die zentrale Rolle der Irritation für den Erkenntnisprozess in der platonisch-sokratischen Rhetorik heraus. Für den Erfolg der rhetorischen Bemühungen sei nämlich notwendig, dass der Adressat einen „Perspektivwechsel von gewohnten Vorstellungen“ (Erler, 2019, S. 324) vollziehe, „der als unangenehm empfunden werden und beim Adressaten zu Irritation führen kann".
In diesem Kontext macht Erler darauf aufmerksam, dass Platon – statt ein philosophisches Traktat zu verfassen – für seine Ausführungen zur Rhetorik nämlich die offene Form des Dialogs wählt. Da es Momente in diesen Dialogen gibt, in denen Sokrates mit seinen Gesprächspartnern keine Einigung findet, ermögliche gerade dieses in den Dialogen vorgeführte „Scheitern“ des Erkenntnisprozesses einen aktiven Leseprozess für die Rezipierenden, „indem sie weniger die Ergebnisse einer Reflexion als den Prozess illustrieren“ (Erler, 2019, S. 334).
Hierin dokumentiert sich Erler zufolge Platons Verständnis von Irritation „im Sinne einer verunsicherten Verwunderung und Desorientierung als Initialzündung für ein Nachfragen und als Merkmal von Philosophie und des Philosophen“ (Erler, 2019, S. 326). Neben diesen immer noch bemerkenswert aktuellen Ausführungen zur Rolle der Irritation im Reflexionsprozess sei zur Annäherung an den Kritikbegriff zudem in Bezug auf Erler (2019, S. 327) darauf verwiesen, dass ein weiteres Charakteristikum der platonisch-sokratischen Rhetorik das konsequente Einstehen für Positionen in Bezug auf Sachargumente ist, „ohne Rücksichtnahme auf Personen oder lieb gewonnene Überzeugungen“.
In den antiken Ausführungen zu Gestaltungs- und Einsatzweisen der Rhetorik klingt also an, dass mit Kritik die Analyse der rhetorischen Herstellungs- und Wirkweisen von Manipulation im Gegensatz zur Positivnorm einer Rhetorik der Irritation sowie der sachbezogenen Argumentation gemeint ist. Während in den Ausführungen der antiken Philosophen damit trotz aller kritischen Distanznahme zum Inhalt von Sachurteilen die Existenz einer objektiven Wahrheit vorausgesetzt wird, unterziehen die Philosophen der Aufklärung den Wahrheitsbegriff selbst einer kritischen Prüfung:
Kant stellt in seiner Konzeptualisierung von Wirklichkeit den Verstand a priori der Erfahrung voran (Kant, 1919, S. 41–42). Da der Geist bestimme, wie uns die Dinge erscheinen, sei es notwendig, diesen zu zähmen durch eine strenge Methode der Urteilsfindung, welche logischen Kriterien folge (Irrlitz, 2015). Kants drei Kritiken lassen sich somit als skeptische Haltung gegenüber dem menschlichen Verstand lesen sowie als ein Aufruf zu selbstkritischer Reflexion, zu einer „kritischen Vernunft, die den gemeinen Verstand in Schranken hält, damit er sich nicht in Speculationen versteige“ (Kant, 2022, S. 259).
Hegel liefert nun eine Rechtfertigung für die Kategorien, welche das Denken strukturieren. Das dialektische Prinzip geht davon aus, dass sich neue Gedanken aus der Gegensätzlichkeit von Sein und Nichts entwickeln. Auch wenn häufig von einer „dialektischen Methode“ mit dem Dreischritt der These, Antithese und Synthese gesprochen wird, macht Wolff (2014, S. 86) darauf aufmerksam, dass dieses verbreitete Verständnis irreführend sei, da Hegel mit der Dialektik keine Methode bezeichnet, also ein bewusstes und regelhaftes Vorgehen zur Erlangung von Erkenntnissen, sondern lediglich ein „Bewegungsprinzip“ der „Denkbestimmungen“. Dennoch stellt Gegensätzlichkeit und Widerspruch ein wichtiges Element dieser Denkbewegung dar, wie Hegel erklärt, da durch das Verwirren von Bestimmtheiten im Dialektischen das „Speculative“ entstehen könne, welches „die Erkenntnis des Entgegengesetzten in seiner Einheit [sei]“ (Hegel, 2006, S. 831).
Durch die genauere Beschreibung sowie die Aufforderung zur Kontrolle der Denkbewegungen, welche zur Herstellung von Erkenntnissen notwendig sind, sowie der Wechselwirkungen zwischen Verstand und Erfahrung bereichern Kant und Hegel die Ausführungen der antiken Philosophen zur dialogischen Kritik an der Rhetorik durch eine erkenntnis- und erfahrungstheoretische Basis. Die Überlegungen der Philosophen der Aufklärung stellen dabei eine Art Propädeutik der (manipulations-)kritischen Textanalyse dar, da bei ihnen Kritik als kritische Selbstreflexion verstanden wird beziehungsweise als Meta-Reflexion über die Methode der Urteilsfindung: Durch eine logische Methode der Urteilsfindung soll der Verstand kontrolliert werden, welcher die Erfahrung der Wirklichkeit strukturiert.
Kritisch gerahmt und neuthematisiert werden die zentralen Thesen Kants und Hegels in Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung. Die „kritische Theorie“ der Frankfurter Schule, die u. a. in der Dialektik der Aufklärung entfaltet wird, stellt Philosophie nicht als deskriptive und rein theoretische, sondern als normative und empirisch informierte Disziplin dar, als „Denken, das sich als Moment der Anstrengung weiß, eine menschliche Welt zu schaffen" (Hindrichs, 2017, S. 2).
Auch wenn die kritische Theorie als marxistische Theorie mit dem Horizont der Aufhebung der Klassenherrschaft entstanden ist, ruft diese nicht zur Revolution auf, sondern verbleibt auf der Ebene der kritischen Bewertung der Zeitgeschichte. Dieser „Schwellenstatus“ zwischen Theorie und „revolutionärer Praxis“ werde durch das Adjektiv „kritisch“ verdeutlicht:
Es bedeutet „prüfend“ und „richtend“ und markiert dadurch die Distanz der Theorie sowohl zum Bestehenden als auch zu dessen bloßer Erkenntnis. Indem die Theorie kritisch wird, verwandelt sie sich aus der Erfassung des Bestehenden in eine Judikative, die ihm das Urteil spricht. Zur Exekutive wird sie hingegen nicht. (Hindrichs, 2017, S. 2)
Allerdings könne die kritische Theorie insofern zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Umstände beitragen, als dass die Bewusstmachung von Ungerechtigkeiten zur Entwicklung eines revolutionären Klassenbewusstseins beitragen könne, welches im Marxismus als Voraussetzung der Überwindung der kapitalistischen Ideologie gesehen wird.2
In ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der Aufklärung werfen Horkheimer und Adorno dabei deren Philosophen eine „Entzauberung der Welt“ vor – wobei sie dieses Schlagwort von Max Weber leihen (Horkheimer & Adorno, 1971, S. 10): Kant habe den Verstand über die Natur erhoben mit seiner These, das wahrnehmende Subjekt konstruiere die Wirklichkeit. So werde Naturwahrnehmung reduziert auf „the business of applying the "correct" pre-existing category to objects" (O'Connor, 2017, S. 117). Das wahrnehmende Subjekt sei ihrer Ansicht nach aber ein dynamisches, welches auf das Wahrgenommene reagiert und die Kategorien, die der Verstand an die Wirklichkeit anlegt, seien immer historisch determiniert (O'Connor, 2017, S. 120). Sie sprechen sich deshalb für einen grundsätzlichen Zweifel an eigenen Überzeugungen und kritische Selbstreflexion aus.
Horkheimer und Adorno übernehmen dabei Hegels Auffassung, dass alle Dinge in sich selbst widersprechend seien, und wenden sie gegen die Aufklärung selbst. Die Aufklärung habe für sich einen Anspruch auf absolute Wahrheit erhoben und sei damit selbst totalitär geworden, was einer dialektischen Auffassung des Gegenstandes widerspreche, denn man könne die Gegenstände der Wirklichkeit wegen ihrer Komplexität und „aufgrund der Begrenztheit unserer Theorien und Weltbilder immer nur im Prozess der Korrektur unserer Widersprüche in ihrer Reichhaltigkeit sukzessive entfalten“ (Kreis, 2017, S. 138). Auch wenn Horkheimer und Adorno in Bezug auf das Verständnis des Gegenstandes als dialektisch mit Hegel übereinstimmen, stellen sie Hegels Anspruch, die Dialektik zu einem positiven Abschluss in einer Synthese – einer Zusammenschließung von Kategorien – führen zu können, grundsätzlich in Frage (Kreis, 2017, S. 146). Aufklärung sei nämlich ein „permanenter Zwischenzustand“ (Kreis, 2017, S. 148), und könne ihre interne Dialektik nur überwinden, indem sie sich stets von neuem und immer auf andere Weise verstricken werde in diese Dialektik.
Durch die Ausführungen der Frankfurter Schule wird Wirklichkeit also als diskursiv konzeptualisiert. Dem Subjekt wird dabei zwar eine zentrale Rolle bei der Herstellung des Gegenstandes zugeschrieben, welches in seiner Bildung von Verstandeskategorien zum Zwecke der Theoretisierung der empirischen Wirklichkeit allerdings selbst historisch und sozial determiniert sei – Gegenstand und Verstand stehen somit in einem Wechselverhältnis. Eine zweifelnde, hinterfragende, logischen Prinzipien folgende, kontroverse Auseinandersetzung sei deshalb nicht nur in Bezug auf Gegenstände, sondern auch in Bezug auf den eigenen Verstand, die eigenen Sichtweisen, Glaubenssätze und Weltbilder von Nöten.
Dabei wird auf die prinzipielle Unabschließbarkeit des dialektischen Erkenntnisprozesses hingewiesen, da alle Gegenstände inhärent widersprüchlich seien und so nur im kontroversen Diskurs angemessen beschreibbar. Der Kritikbegriff wird zudem gesellschaftspolitisch, indem er in den Dienst einer Bewusstmachung von Ungerechtigkeiten gestellt wird, welche zum Abbau der Klassenherrschaft beitragen soll. Somit erhält der Kritikbegriff ein dem Marxismus entlehntes normatives Bezugssystem und verbleibt nicht auf analytisch-deskriptiver Ebene.
1.1.2 Diskurstheorie und Critical Discourse Analysis
Für eine linguistische und schließlich fachdidaktische Annäherung an den Kritikbegriff sind nicht nur die dargelegten Aspekte der Philosophiegeschichte des Begriffs von Relevanz, sondern ebenso die linguistische Diskurstheorie mit ihren Reflexionen über Machtverhältnisse in Diskursen. In allen Definitionen von Diskurs steht Sprache nicht als autopoietisches System für sich, sondern sie spielt eine bedeutende Rolle für das Verständnis menschlicher Gesellschaften, wie sich auch in Jaworski & Couplands (2014, S. 3) Definition von Diskurs widerspiegelt: “Discourse is language use relative to social, political and cultural formations – it is language reflecting social order but also language shaping social order, and shaping individuals’ interaction with society.” Sprache wird hier also eine nicht nur abbildende, sondern auch bedeutungsgenerierende Funktion zugeschrieben.
Bakhtin konzeptualisiert Worte in seinen Ausführungen zur Semantik als inhärent dialogisch – ähnlich dem weiter oben besprochenen Konzept des Dialektischen: Ein Wort erhalte seine Bedeutung immer nur in der Beziehung zu anderen Worten, die ihm widersprechen oder an es angrenzen, sodass ein Wort ohne Kontext keine Bedeutung habe:
The world, directed toward its object, enters a dialogically agitated and tension-filled environment of alien words, value judgments and accents, weaves in and out of complex interrelationships, merges with some, recoils from others, intersects with yet a third group: and all this may crucially shape discourse, may leave a trace in all its semantic layers, may complicate its expression and influence its entire stylistic profile. (Bakhtin, 1981, S. 276)
Foucault (1981) hingegen beschäftigte sich in seiner Ordnung des Diskurses mit den Prinzipien, die den Diskurs strukturieren, regulieren und so Machtverhältnisse verschieben (Foucault, 1981, S. 52). Einige Beispiele solcher Kontrollmechanismen des Diskurses, welche Foucault anführt, sind z. B. das Verbieten, die Opposition zwischen Vernunft und Wahnsinn sowie zwischen Wahrheit und Unwahrheit.3 Bourdieu (1991) lenkte mit seinen sozialphilosophischen Ausführungen zu Sprache als Symbolic Power die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten der impliziten Machtausübung und Beeinflussung durch Sprache.
Die theoretischen Konzepte dieser Untersuchungen leiten zur kritischen Diskursanalyse hin. Critical Discourse Analysis – im Folgenden abgekürzt als CDA – ist eine ideologiekritische Ausrichtung der Diskursanalyse mit sozial-emanzipativem Anspruch, welche sich mit den diskursiven Herstellungsmechanismen von Macht, Einflussnahme, Perspektivierung und Ideologie beschäftigt. Die kritische Diskursanalyse wurde maßgeblich von Faircloughs Konstrukt der Critical Language Awareness beeinflusst, welches ein linguistisches Modell zur Untersuchung von Machtstrukturen sowie Repräsentations- und Herstellungsweisen von Wissen in gesellschaftlichen Diskursen liefert.
Diskurse, die Gee als eine Kombination von „saying (writing)-doing-being-valuing-believing-combinations” (1989, S. 6) definiert, seien ideologisch, da sie sogenannte „cultural models“ befördern. Damit meint Gee sich verfestigende Theorien oder Verallgemeinerungen über die Welt, wie sie sein sollte, und wie die Menschen in ihr sich verhalten sollten. Diese Vorstellungen sind Teile größerer Wissenssysteme, der Discourses (geschrieben mit einem großen D).4 Solche Wertvorstellungen über die Welt, welche Allgemeingültigkeit für sich reklamieren, indem sie als selbstverständlich gerahmt sind, sollten stets kritisch hinterfragt werden:
all beliefs are theoretical, grounded in a theory of some sort that tells us what words ought to mean and how things ought to be described and explained. In this sense, all claims and beliefs are “ideological”. But we still must always ask ourselves whether our theories are based on a genuine attempt to understand the world and make it better or just on a desire for power, control, and status. (Gee, 2012, S. 20)
Dabei verbleibt die kritische Diskursanalyse aber nicht auf einer deskriptiven Ebene, sondern geht normativ wertend vor und versteht sich zudem selbst als soziales Engagement, um soziale Gegebenheiten zu verbessern (Jaworski & Coupland, 2014, S. 35). Da sich die CDA als Widerstand gegen unterdrückerische Ideologien sieht, ist die Analyse von Machtstrukturen im schulischen Diskurs ein wichtiger Anwendungsbereich der Disziplin, um herauszuarbeiten, wie sich gesellschaftliche Makro-Strukturen in den Interaktionen im Klassenraum widerspiegeln.5
Jedoch wird die demokratieförderliche Rolle der kritischen Diskursanalyse nicht nur darin gesehen, im Schulsystem wirkende Machtstrukturen aufzudecken, sondern zudem in ihrer Rolle als „democratic resource to be made available through the education system“ (Jaworski & Coupland, 2014, S. 35). Kritische Diskurslinguist*innen sollten Lehrer*innen und Schüler*innen dabei unterstützen, sich selbst die kritische Diskursanalyse anzueignen und anzuwenden, um so Agency zu entwickeln (Luke, 1995, S. 13).
In dieser pädagogischen Anwendung der kritischen Diskursanalyse wird der Bogen zur Critical Literacy geschlagen. Bevor die Zielsetzungen dieses Konstrukts näher beschrieben werden, wird neben der kritischen Diskursanalyse in der Linguistik im folgenden Abschnitt zudem auf die kritische Pädagogik als nahestehende Disziplin eingegangen.
1.1.3 Paulo Freire und die kritische Pädagogik
Paolo Freires kritische Pädagogik ist die Übertragung von Grundgedanken der kritischen Theorie auf den pädagogischen Kontext. In seinem 1970 erstmals veröffentlichten Werk Pedagogy of the Oppressed (Paolo Freire, 2006) liefert er eine Analyse des brasilianischen Bildungssystems, welches er mit seinem viel zitierten Schlagwort des Banking Model of Education kritisiert. Dabei gehe es lediglich um die unhinterfragbare Weitergabe von Informationen, die Köpfe der Schüler*innen würden dabei vom Lehrenden mit Wissen befüllt wie eine Bank – wobei in dieser Metaphorik auch eine Kritik an der kapitalistischen Zielrichtung des Bildungssystems mitschwingt. Als Alternative zu diesem passiven Modell der Wissensweitergabe stellt Freire (1976) den Dreischritt von Naming, Reflection und Action vor,6 welcher über die Benennung und Analyse gesellschaftlicher Probleme sowie über die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zu individueller wie gesellschaftlicher Transformation führen solle (Morrell, 2008, S. 53).
In diesem Prozess spielt die Auseinandersetzung mit (Schrift-)sprache eine zentrale Rolle, da Freire – ähnlich wie die Vertreter*innen der kritischen Diskursanalyse – davon ausgeht, dass Sprache und Gesellschaft eng miteinander verwoben sind: „Reading the world always precedes reading the word, and reading the word implies continually reading the world“ (Paolo Freire & Macedo, 1987, S. 35).
Ein weiterer Grundpfeiler der kritischen Pädagogik neben ihrer kritischen Analyse der Wechselwirkung zwischen Sprache und Welt ist ihr dialogischer Ansatz, in welchem die Hegelsche Dialektik wiederhallt: Freire (2006) geht davon aus, dass das Lesen von Wort und Welt als dialektischer Prozess ablaufen müsse, um schließlich ein differenzierteres Verständnis zu erzielen. Dafür sei ein gleichberechtigter Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden essentiell (Morrell, 2008, S. 54–55).
Die kritische Pädagogik versteht sich als Beitrag auf dem Weg zu sozialer Gerechtigkeit, sein pädagogisches Programm hat also einen revolutionären Grundgedanken und verbleibt nicht auf der Ebene der kritischen Sozialanalyse wie die kritische Theorie. Diese gesellschaftlichen Veränderungen und vor allem auch eine Revolution der schulischen Bildung als Instrument der Unterdrückung sollten durch die Förderung eines „kritischen Bewusstseins“ erreicht werden. Das kritische Bewusstsein soll – in marxistischer Tradition – „eine wachsende Kritikfähigkeit sozialer Beziehungen, Interaktionen und Machtgefüge fördern“ (Gerlach, 2020a, S. 13).
1.2 Was ist Critical Literacy?
Bei Critical Literacy als pädagogischem Konzept handelt es sich nun um ideologiekritische Diskursanalyse im schulischen Kontext und im Rahmen der schulischen Interaktionsstrukturen mit gesellschaftlich-emanzipatorischem Anspruch. Die Bezeichnung Critical Literacy bezieht sich dabei sowohl auf das normative didaktische Zielkonstrukt als auch auf die pädagogischen Praktiken, durch welche dieses Zielkonstrukt erzielt werden soll. Dabei ist zu beachten, dass Critical Literacy nicht immer trennscharf von Critical Pedagogy abzugrenzen ist und beide Benennungen teils synonym verwendet werden. Jedoch wird Critical Literacy eher im Zusammenhang mit literalen Praktiken wie der ideologiekritischen De- und Rekonstruktion von Texten genutzt, während Critical Pedagogy das allgemeinpädagogische Ansinnen verfolgt der Ausbildung sozialemanzipativen Handlungswillens innerhalb der Gesellschaft. Critical Literacy geht laut Abednia & Crookes (2018) auf die pädagogische Arbeit von Freires Kollegen Ira Shor in den 1980er Jahren zurück. Während sich Shors Arbeit laut Abednia & Crookes (2018) zunächst auf den muttersprachlichen Englischunterricht von Arbeiter*innenkindern konzentrierte, fanden die Prinzipien der Critical Literacy ab den 1990er Jahren zunächst zunehmend Verbreitung im Kontext der Zweitsprachendidaktik (Abednia & Crookes, 2018, S. 6–7). Erst in den letzten 15 Jahren fand Critical Literacy Eingang in die verschiedenen Fremdsprachendidaktiken (Abednia & Crookes, 2018, S. 11) und erlebt jüngst eine neue Blüte in der deutschsprachigen Fremdsprachendidaktik – siehe Kapitel 1.2.5 für eine Zusammenfassung des aktuellen fremdsprachendidaktischen Forschungsdiskurses.
In ihrer langen Geschichte innerhalb des muttersprachlichen Englischunterrichts, auf welche Critical Literacy zurückblickt, wurde eine Vielzahl an verschiedenen Definitionen dieses Zielkonstrukts hervorgebracht sowie praktische methodische Vorschläge zu seiner Erzielung unterbreitet.7 Trotz der mannigfaltigen Füllungen des Ansatzes, herrscht Ávila & Pandya (2013b) zufolge jedoch weitgehend Konsens über die Hauptziele von Critical Literacy:
the main, underlying goal of critical literacies praxis is twofold: to investigate manifestations of power relations in texts, and to design, and in some cases redesign, texts in ways that serve other, less powerful interests. (Ávila & Pandya, 2013b)
Somit kommt Critical Literacy eine reflexive wie eine produktive Komponente zu. Im Folgenden wird auf die konkrete Füllung dieser zwei Komponenten sowie auf das damit verbundene Ziel der individuellen wie gesellschaftlichen Transformation eingegangen.
1.2.1 Analytische Komponente
Die reflexive Komponente von Critical Literacy hebt darauf ab, dass sprachlich konstruierte Machtstrukturen und implizite Normalitätsvorstellungen – sogenannte Präsuppositionen – durch kritische Diskursanalyse explizit und so für die Kritik zugänglich gemacht werden. Diese kritische Diskursanalyse im schulischen Kontext wird als Critical Language Awareness (Fehling, 2008) bezeichnet. Während Norman Fairclough, auf den das Konstrukt zurückgeht, Language Awareness als „conscious attention to properties of language and language use as an element of language education“ (Fairclough, 1992) definiert, werden bei Critical Language Awareness spezifisch Herstellungsmechanismen von Macht und Ideologie in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Critical Language Awareness strebt also „ein tieferes Verständnis sozialer, politischer und ideologiekritischer Aspekte des Sprachgebrauchs“ (J.-E. Leonhardt & Viebrock, 2020a, S. 38) an.8 Ziel dieser kritischen Diskursanalyse sei Luke (1995, S. 20) zufolge, den Common Sense zu hinterfragen.
Dies könne dadurch geschehen, dass Texte und Diskurse daraufhin befragt werden „whose material interests particular texts and discourses might serve, how that articulation works on readers and listeners, and strategies for reinflecting and rearticulating these discourses in everyday life” (Luke, 1995, S. 20). Wichtig zu beachten ist dabei, dass Critical Literacy von einem sehr weiten Textverständnis ausgeht, wobei fast alles als ein Text gelesen werden könne: „For instance, a classroom can be read as a text; even everyday objects like water bottles can be read as texts.” (Vasquez et al., 2019, S. 300). Die Problematisierung solcher Texte durch kritische Diskursanalyse und Verwendung einer analytischen Meta-Sprache sei somit die linguistische Konkretisierung von Freires Aufruf dazu, die Welt zu lesen (Luke, 2012b, S. 27). Bei dieser Analysepraxis solle stets zwischen der textuellen Mikro- und der gesellschaftlichen Makroperspektive hin- und hergependelt werden, um diese Praktiken auf die in ihnen aktiven Machtstrukturen hin zu untersuchen (Comber, 2013, S. 589).
Das kann auf Lexemebene beispielsweise eine Analyse der verwendeten Pronomina und der damit produzierten Praktiken des Ein- oder Ausschließens von Geschlechtsidentitäten meinen oder auf grammatikalischer Ebene z. B. die Verschleierungen von Machtausübenden durch die Verwendung von Passivkonstruktionen. Auf der Ebene der sprachlichen Großstrukturen ist dabei auch die Analyse der sozialen Verwendungsweisen und Merkmale von (machtvollen) Genres (Lau, 2013, S. 4) – wie z. B. politische Reden – ein wichtiger Analyseaspekt der Critical Language Awareness.
Morrell stellt heraus, dass es sich bei Critical Literacy nicht nur um die Entwicklung von Analysefertigkeiten handele, sondern auch um einen fragenden Prozess in Auseinandersetzung mit Ideologien, die uns in Texten als gegeben präsentiert werden und im Rahmen dessen diese Analysefertigkeiten zur Anwendung kommen:
Becoming critically literate entails coming to understand ourselves separately from the discourses that surround us; becoming critically literate also entails having the skills and sensibilities to ask demanding questions of the ideas, concepts, and ideologies that are presented to us as fact. It is also important to understand that the process of becoming critically literate is about both the development of skills and the development of a process. (Morrell, 2008, S. 38)
Dieser kritische Prozess soll durch die Methode der Analyse dazu führen, eine kritische Distanz, eine Meta-Ebene zum analysierten Text entwickeln zu können, indem ein Schritt von ihm zurückgetreten wird. Auf diesen Aspekt heben auch Breidbach et al. (2014, S. 91) ab, wenn sie betonen, dass eine als „critically literate“ charakterisierbare Person, fähig sein solle „to take a step back from the obvious, from what is perceived as normal, from established practices with regard to the use of language.”
Dabei geht es aber nicht notwendigerweise darum, eine „negative Haltung“ gegenüber einer Sache einzunehmen, sondern darum, verschiedene Perspektiven auf einen Sachverhalt nachzuvollziehen und ihn so zu durchdringen, wie Vasquez et al. (2019, S. 300) herausstellen – was an den unabschließbaren Prozess der Annäherung an einen Gegenstand erinnert, den permanenten Zwischenzustand, auf den in der Dialektik der Aufklärung abgehoben wird.
1.2.2 Performative Komponente
Critical Literacy strebt über die beschriebene analytische Awareness-Dimension hinaus auch explizit eine handlungspraktische bzw. performative Dimension an, für welche die kritische Sprachbewusstheit die Voraussetzung darstellt. Das kritische Schreiben habe allerdings laut Janks (2010, S. 155) innerhalb von Critical Literacy weniger Aufmerksamkeit erhalten als das kritische Lesen, auch wenn Critical Literacy eine „synthesis of critical language awareness and critical textual production” (Morrell, 2008, S. 33) darstellt.
Schüler*innen, die critically literate sind, sollen über die Fähigkeit und den Willen verfügen, einen Diskurs mit Hilfe eines anderen Diskurses zu kritisieren, sofern dieser Diskurs Ungerechtigkeit reproduziert. Critical Literacy als komplexe Kompetenz beinhaltet also auch die spezifische Nutzung eines Diskurses, nämlich mit dem Ziel, einen anderen zu kritisieren:
We can also talk about a literacy being liberating (“powerful”) if it can be used as a “meta-language” or a “meta-Discourse” (a set of meta-words, meta-values, meta-beliefs) for the critique of other literacies and the way they constitute us as persons and situate us in society. Note what I have called a liberating literacy is a particular use of a Discourse (to critique the other ones), not a particular Discourse. ” (Morrell, 2008, S. 33)
Diese produktive Komponente meint allerdings nicht nur die Fähigkeit, auf einer Meta-Ebene Kritik zu äußern, sondern zudem auch konstruktive Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge zu machen (Vasquez et al., 2019, S. 300).
Eine konstruktive Umgangsweise mit kritisierten Texten kann dabei auch beinhalten, produktiv mit diesen umzugehen, indem sie verändert werden (Elsner & Viebrock, 2013; Gerlach, 2020a; Gerlach & Lüke, 2020). Diese Transformation eines Textes wird häufig als „Redesign” bezeichnet. Janks (2010, S. 156) erklärt, dass die Rekonstruktion von Texten – aufbauend auf deren Dekonstruktion – dazu verhelfen könne, Konstruktionsweisen von Macht und Beeinflussung, z. B. durch sprachlich vorgenommene Positionierungen oder die Affordanzen der gebrauchten Modi nachzuvollziehen.9 Somit kann das Redesign von Texten, z. B. durch Verfassen von Gegentexten oder Antworttexten, auch zur Erzielung reflexiver und rezeptiver Aspekte von Critical Literacy beitragen, wie auch Janks (2010, S. 156) anmerkt. Die Meta-Kritik an Texten sowie ihre Rekonstruktion soll Schüler*innen befähigen, selbst Teil machtvoller Diskurse zu werden, sodass in diesen auch bisher ungehörte Stimmen Gehör finden.
Die Praktik des Redesign lässt sich mit Hilfe von Butlers Konzept der „Resignifikation“ weiter ausdifferenzieren. Mit diesem Konzept beschreibt Butler einen Prozess der „Fehlaneignung“ als „Wiederholung der ursprünglichen Unterordnung zu andern Zwecken, deren Zukunft zum Teil offen ist“ (Butler, 1998, S. 61). Durch diese verändernde Wiederholung, welche Bedeutungen verschiebt, sollen gesellschaftliche Machtgefüge denormalisiert und so verändert werden.
Engel (2007) zufolge kann der Prozess der Fehlaneignung sich zum einen auf diffamierende, pejorative Konzepte wie „schwul“, oder „pervers“ beziehen. Dabei fungiert die kontextverändernde Aneignung dieser Konzepte als Möglichkeit des Subjekts sich gegen verletzende Äußerungen zu wehren und diese zu Kategorien positiver Identifikation umzudeuten, um so zur Selbstermächtigung des Subjekts beizutragen und gesellschaftlich dominante Konzepte wie Heteronormativität in Frage zu stellen.
Zum anderen können auch gesellschaftlich machtvolle Konzepte resignifiziert werden, wie z. B. die patriarchalen Institutionen der Ehe oder der Familie. Dabei mache es Engel (2007) zufolge einen entscheidenden Unterschied, ob marginalisierte Gruppen sich diese Konzepte lediglich aneignen, um Zugang zu (zumindest einem Teil der10) mit diesen assoziierten Privilegien zu erhalten oder ob diese Konzepte stattdessen in ihren machtvollen Strukturen angefochten und so fehlangeeignet werden, was systemdestabilisierend wirken kann.
Am Beispiel der Institution der Familie würde dies bedeuten, dass queere Personen in einem Aneignungsprozess die durch die heterosexuelle Kleinfamilie reproduzierten traditionellen Hierarchien legitimieren und sich an heteronormative Standards assimilieren (wie z. B. traditionelle Arbeits- und Einkommensverteilung in Paarbeziehungen, intergenerationelle Eigentumsweitergabe, oder Schließen einer Ehe, welche als Institution patriarchale Strukturen und gesellschaftliche Ungleichheiten weiter verfestigt, z.B. durch die Subventionierung privater Kinderbetreuung oder die steuerliche Bevorteilung von verheirateten Eltern gegenüber Alleinerziehenden). Eine Fehlaneignung der machtvollen Institution der Familie hingegen würde deren Funktionsweisen irritieren durch die Entwicklung von „denormalisierenden und enthierarchisierenden Alternativen“ der Reproduktionsarbeit, der gesellschaftlichen Eigentumsvergabe etc., und traditionelle patriarchale Familienstrukturen aufbrechen, z. B. im Rahmen von solidarischen, familienübergreifenden Wohnformen.
Um marginalisierten Stimmen in machtvollen Diskursen Gehör zu verschaffen, spielt neben dem Redesign außerdem die Instruktion in machtvollen Genres für verschiedene Zielgruppen wie zur Umsetzung verschiedener Kommunikationsabsichten ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Förderung von performativer Critical Literacy (siehe z. B. Martin & Rose, 2008 für eine Übersicht über die Genre-Analyse in Tradition der Sydney-Schule). Diese Veränderung der Texte ist mit dem Ziel der gesellschaftlichen Transformation verbunden: „It enables us to think about how to transform texts that we have deconstructed to remake the world” (Janks, 2010, S. 156). Diese durch Janks geäußerte Hoffnung leitet über zur transformatorischen Komponente der Critical Literacy, welche über die Lernziele der Textanalyse, -dekonstruktion und -rekonstruktion hinausführt.
1.2.3 Critical Literacy als transformatorischer Anspruch
Janks & Vasquez (2011, S. 1) zufolge hätten die mannigfaltigen pädagogischen Ansätze, die sich unter dem Label Critical Literacy vereinen, in all ihrer Verschiedenheit dennoch das Ziel gemeinsam, sozialen Wandel anzustoßen: „In the Freirean tradition (1970), becoming literate is linked to naming and renaming the world, in other words to social transformation.” Der Begriff der Transformation wird allerdings in dreifacher Bedeutung verwendet: Neben der Transformation von Texten und der gesellschaftlichen Transformation ist damit auch die Transformation der Sichtweisen und Haltungen der individuellen Schüler*innen gemeint, denn Critical Literacy versteht sich als „pedagogy of individual and social transformation” (Morrell, 2008). Gerlach (2020a, S. 26) bringt das Konstrukt der Critical Literacy, also die De- und Rekonstruktion von Texten, über die Reflexion in Verbindung mit einer „Transformation grundlegender Figuren des Selbst- und Weltverständnisses“, wodurch ein transformatorischer Bildungsanspruch anklingt11 – wie auch in Plikats (2020) Ausführungen zum Resonanzkonzept im Rahmen einer kritischen Fremdsprachendidaktik.
Interessant sind in diesem Kontext Phipps & Guilhermes (2004, S. 3) Ausführungen, auch wenn sich diese nicht dezidiert auf das Konzept Critical Literacy, sondern auf die kritische Pädagogik beziehen. Für eine kritische Pädagogik, die „reflection, dissent, difference, dialogue, empowerment, action and hope“ umfassen solle, betonen sie nämlich, wie auch Gerlach (2020a), die Relevanz der Reflexion. Dabei grenzen sie die Reflexion von dem Ansatz der Analyse und Interpretation ab, da sich Reflexion durch einen „expliziten Rückbezug auf individuelle persönliche Erfahrungen“ auszeichne. Kritische Reflexion sei laut Phipps & Guilherme über den Dialog mit der Dimension des Handelns verbunden. Somit stellt die individuelle Transformation – durch Bildung als Zuwachs an Reflexivität – die Voraussetzung dar für das übergeordnete und übergreifende Ziel der gesellschaftlichen Transformation. So könne Critical Literacy „real-world impact” (Vasquez, 2017) haben und „socially transformative” wirken (Vasquez et al., 2019). Diese anvisierte gesellschaftliche Transformation zielt dabei auf verschiedene Bereiche des Gesellschaftlichen ab:
Each approach to the critical is normative, predicated on assumptions that the refashioning of language and literacy in this way will have an impact not just on individual capacities and life pathways, but also on the reshaping of institutions, of local cultures, of social lives, and of civic and political spheres. (Luke, 2012b, S. 28)
So könnten z. B. soziale Benachteiligung oder Bildungsungleichheit gemindert werden (Ávila & Pandya, 2013b, S. 2). Diese Zielsetzung steht im Einklang mit Freires Konzept des „concienziao“: Auf das Lesen des Wortes folge das Lesen der Welt (Paolo Freire & Macedo, 1987). Concienziao als Critical Awareness ist somit – im Gegensatz zum geläufigen Verständnis der Critical Language Awareness – nicht rein analytisch-rezeptiv angelegt, sondern enthält auch eine handlungspraktisch-emanzipative Komponente. Die übergeordnete Zielsetzung von Critical Literacy beschränkt sich somit nicht auf Lese- und Schreibkompetenzen, sondern ist die Bildung engagierter Bürger*innen:
the development of active, engaged citizens who will, as circumstances permit, critically inquire into why the lives of so many human beings, including their own, are so materially (and spiritually) inadequate, prepared to seek out solutions to the problems they define and encounter and take action accordingly. (Crookes, 2013, S. 77)
Es lässt sich also feststellen, dass das Spezifische an Critical Literacy im Vergleich zum philosophischen und linguistischen Verständnis von Kritik vor allem darin liegt, dass nicht nur ein reflexiver, sondern auch ein produktiver, verändernder Umgang mit Texten angestrebt wird, und dass durch diesen Umgang mit Texten persönliche wie gesellschaftliche Veränderung herbeigeführt werden soll – die Rolle der Kritik erschöpft sich also nicht in der „Judikative“, sondern wird zudem selbst zur „Exekutive“. In dieser performativen Komponente findet sich die Schnittstelle zwischen Critical Literacy und Critical Pedagogy, wobei Critical Literacy – eine aufmerksame Haltung für die diskursive Herstellung von Ungleichheiten – die Voraussetzung für Critical Pedagogy darstellt – den Willen, diese Ungleichheiten aktiv durch eigenes Handeln zu vermindern.
1.2.4 Verortung des Konstrukts
Literacy definiert Gee als „mastery of a Secondary Discourse“ (Gee, 2012, S. 174). Dabei betrifft Literacy nicht nur die literale Sprache, sondern auch andere symbolische Systeme eines Diskurses. Diese Multimodalität und Multimedialität von Diskursen wird manchmal auch besonders durch Begrifflichkeiten wie „visual“ oder „digital literacy“ hervorgehoben oder dadurch, dass Literacies im Plural verwendet werden: “Critical approaches generally acknowledge that literacies are in the plural” (Kalantzis & Cope, 2012, S. 213).
Aufgrund der Multiliteralität von Diskursen wird Critical Literacy häufig (z. B. bei (Breidbach et al., 2014) als Bestandteil des Konstrukts der Multiliteracies (New London Group, 2000) verstanden, wobei Critical Literacy ein allen Literacies inhärenter Bestandteil sei (Breidbach et al., 2014, S. 96). J.-E. Leonhardt & Viebrock (2020c, S. 6) hingegen konzeptualisieren Critical Literacy nicht als Literacy, die sich querschnittsartig durch alle anderen Literacies zieht, sondern betrachten die verschiedenen multimodalen Literacies, wie z. B. Visual Literacy oder Functional Literacy, als Voraussetzung für die Herausbildung von Critical Literacy.
Critical Literacy, verstanden als komplexe Kompetenz des Umgangs mit Repräsentativität in Texten lasse sich laut J.-E. Leonhardt & Viebrock als Teilbereich der „Text- und Medienkompetenz“ in den KMK-Standards (KMK, 2012) fassen. Durch diese Verortung wird also auf die analytische wie produktive Komponente von Critical Literacy abgehoben, nicht aber auf die transformatorisch-emanzipatorische. So eng gefasst lässt sich Critical Literacy zudem an den Kompetenzbereich „Analysieren und Reflektieren“ des Strategiepapiers „Bildung in der digitalen Welt“ (KMK, 2017) anschließen. Sehr deutlich klingt Critical Literacy zudem im Orientierungsrahmen für nachhaltige Entwicklung (KMK & BMZ, 2016) für den Bereich moderne Fremdsprachen an. Vor allem im Kompetenzbereich Bewerten („Was Sprachen mit Menschen tun“) wird die Anbahnung von kritischer Sprachbewusstheit angestrebt:
Teil einer Bildung für nachhaltige Entwicklung ist die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, sprachliche und kulturelle Einflussnahmen rational zu bewerten. Dazu gehören Fragestellungen zur globalen Entwicklung, die im Rahmen konkreter Anlässe im Unterricht beleuchtet werden, z. B.:
Wie geschieht Manipulation durch Sprache, beispielsweise durch Werbetexte, expositorische Texte, fiktionale Texte wie Utopien?
Wie geschieht Herrschaft durch Sprache?
Welche Formen der Diskriminierung durch Sprache gibt es und wie wirken sie auf die Betroffenen? (KMK & BMZ, 2016, S. 158)
Auf der kritischen Sprachbewusstheit baut der dritte Kompetenzbereich „Handeln“ des Dreischritts „Erkennen-Bewerten-Handeln“ auf, in welchem es wesentlich darum gehe, „bei der Auseinandersetzung mit Herausforderungen des globalen Wandels Motivationen aufzubauen“ (KMK & BMZ, 2016, S. 158). Auch wenn die Begrifflichkeiten Critical Literacy oder Critical Language Awareness hier nicht explizit verwendet werden, zeigen sich durch die anvisierte Verbindung von kritischer Sprachreflexion und das darauf aufbauende gesellschaftliche Engagement die Zielstellungen des Orientierungsrahmens für globale Entwicklung und die von Critical Literacy als fast deckungsgleich. Somit klingt das Zielkonstrukt Critical Literacy – teils mit, teils ohne emanzipative Zielsetzung – in mehreren offiziellen Dokumenten an, was die wahrgenommene Relevanz des Konstrukts verdeutlicht.
Im aktuellen fachdidaktischen Diskurs finden sich zudem weitere prominente Konstrukte, die der Critical Literacy in ihren Zielstellungen nahe stehen: Matz (2020) hebt die Bedeutsamkeit der fremdsprachlichen Diskursfähigkeit (Hallet, 2012) als übergeordnetes Zielkonstrukt im Kontext eines kritischen Fremdsprachenunterrichts hervor, da es kulturelle Teilhabe und Partizipation an gesellschaftlichen Diskursen als übergeordnete Leitziele des Englischunterrichts definiert. Die fremdsprachliche Diskurskompetenz, die Bonnet et al. (2013) für den Kontext des bilingualen Unterrichts entwickelten, lässt sich aufteilen in eine konzeptuale, sprachliche, eine praktisch-methodische und eine reflexive Dimension. Insbesondere die Teilkompetenzen „Bewertende Sprachproduktion“ sowie „Aushandeln und Ausdrücken von Differenz“ (Bonnet et al., 2013, S. 179) stehen dabei Teilaspekten der Critical Literacy nahe. Diese Teilkompetenzen umfassen „die Befähigung zu eigenständigen Bewertungen der gesellschaftlichen Bedeutung von Kenntnissen, Wissensbeständen und Fähigkeiten, die im Sachfach erworben werden“ sowie die Erfahrung, „wie in einem bestimmten Fach Wissen erzeugt und Probleme gelöst werden“ und zielen somit auf Herstellungsweisen und Perspektivierung von Wissen ab.
Auch Byrams (1997) Konzept der Critical Citizenship Education (Porto et al., 2017) betont die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit als Zielsetzung. Dieses Zielkonstrukt habe laut König (2020, S. 134) allerdings einen stärkeren Fokus auf die affektive Dimension mit den Teilkompetenzen der Empathie und Perspektivübernahme als die analytisch-kognitiv ausgerichteten Ansätze von Critical Literacy, in welchen die affektive Dimension eher in den Hintergrund trete, da Perspektivübernahme Machtverhältnisse reproduzieren könne und deshalb immer durch Analyse und Reflexion ergänzt werden müsse.
Zudem wird in fremdsprachendidaktischen Ansätzen mit kritischem Anspruch auch auf Claire Kramsch‘ (2006) Konstrukt der Symbolic Competence Bezug genommen, z. B. bei König (2020), welches eine theoretische Grundlage für die Analyse sozialer Positionierungen mit Hilfe kultureller Kategorien wie Gender oder Class liefert. Ein weiteres nahe stehendes und in der Fachdidaktik breit rezipiertes Zielkonstrukt ist das der fremdsprachlichen Diskursbewusstheit, welches von Plikat (2017) in den Diskurs eingeführt wurde. Auch Plikat bezieht sich auf Faircloughs Konzept der Critical Language Awareness, welches er, neben der affektiven und sprachstrukturellen Domäne, mit dem Diskursbegriff, dem transformatorischen Bildungsbegriff und der normativen Leitlinie der Menschenrechte verbindet, um so ein alternatives Zielkonstrukt zur interkulturellen Kompetenz für den Fremdsprachenunterricht vorzuschlagen. Der entscheidende Unterschied zwischen Critical Literacy und kritischer Diskursbewusstheit ist allerdings, dass Plikat explizit jegliche Anbahnung von politischem Handeln im unterrichtlichen Kontext ablehnt. Er bezieht sich dabei auf das Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsens (Wehling, 1977) und fordert, dass die Beschäftigung mit gesellschaftlichen Problemen ausschließlich auf der reflexiven Ebene verbleiben müsse.
Marxl & Römhild (2023) stellen die Konstrukte Symbolic Competence (Kramsch, 2006), kritische Diskursfähigkeit (Hallet, 2008) und Diskursbewusstheit (Plikat, 2017) – nicht jedoch das der Critical Literacy – nebeneinander und bekräftigen dabei dasjenige der fremdsprachlichen Diskursbewusstheit, da es im Gegensatz zu den anderen Konstrukten eine normative Bezugsgröße für das Fällen von Werturteilen über Sprache liefere, nämlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Zudem arbeiten Marxl & Römhild (2023) heraus, dass in allen drei von ihnen diskutierten Konstrukten Habermas‘ (1995a) Theorie kommunikativen Handelns aufgegriffen wird – welches auch schon Piepho (1974) in den fremdsprachendidaktischen Diskurs integrierte. Habermas‘ Diskursethik folgend müssten Schüler*innen durch Fremdsprachenunterricht somit nicht nur befähigt werden, Regeln des Diskurses anzuwenden, sondern auch in die Lage versetzt werden, diese Regeln und ihren Gültigkeitsbereich auszuhandeln. Ein kritisches fremdsprachendidaktisches Zielkonstrukt müsse deshalb auch immer eine reflexive, meta-sprachliche Ebene enthalten.
Schildauer (2023) bringt mit der „Critical Second Language (L2) Classroom Discourse Competence (CDC) for (English) language teachers” ein weiteres Konstrukt in den Diskurs mit ein, welches eine andere Zielgruppe als die anderen Konstrukte aufweist: Aufbauend auf Thomsons (2022) „Classroom Discourse Competence“ zielt die Critical CDC nämlich auf diskursive Kompetenzen für L2-Lehrpersonen ab, um zusätzlich zu Spracherwerbsprozessen auch „inclusive and empowering discourse practices“ (Schildauer, 2023, S. 58) in ihrem Unterricht zu ermöglichen.
Trotz der unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und theoretischer Fundierungen der einzelnen Konstrukte lässt sich als gemeinsamer Konsens des Diskurses die geteilte Erwartung an den Fremdsprachenunterricht konstatieren, dass dieser jenseits der Vermittlung überprüfbarer funktionaler Kompetenzen auch fremdsprachliche Bildungsprozesse ermöglichen soll. So stellen Leonhardt & Viebrock fest: „In gewisser Weise fallen Critical Language Awareness, Critical Cultural Awareness und fremdsprachige Diskursbewusstheit damit zusammen bzw. bezeichnen eine ähnliche konzeptionelle Vorstellung aus etwas unterschiedlichen Perspektiven“ (2020a, S. 41).
Die Vielzahl der Konstrukte, in denen diese Hoffnung anklingt, verdeutlichen die empfundene Dringlichkeit des Anliegens im Diskurs. Es ist nicht Ziel meiner Arbeit, eines dieser Konstrukte auszuwählen. Vielmehr scheinen mir die Vielfalt und die unterschiedlichen Bedeutungsnuancen der Konstrukte als wünschenswert im Rahmen einer auf Pluralität, Unabschließbarkeit und Kontroversität angelegten – und somit kritischen – Konzeptualisierung von Wissen, da die einzelnen normativen Konstrukte ihre Bedeutung nur in der Dialogizität mit und in Abgrenzung von benachbarten Konstrukten erhalten12 – und somit ihre Berechtigung haben, um Facettenreichtum und Differenziertheit des theoretischen Diskurses zu stärken. Zudem ist eine Schließung auf eines der Konstrukte auch nicht Ziel meiner im praxeologischen Paradigma verorteten Arbeit, da die Begriffsdifferenzierungen ohnehin nicht abbilden können, was in der Praxis an Relevanz gewinnt. Stattdessen wird durch die Abbildung der Bedeutungsnuancen zwischen den Konstrukten ein theoretisch sensibilisierter Zugang zu den Daten angestrebt, um die theoretische Aushandlung didaktischer Zielsetzungen durch eine empirische Perspektive zu bereichern. Auf diese Weise wird sich empirisch der Frage angenähert, welche Normen und normativen Bezugsgrößen in der Praxis relevant werden und in welcher Beziehung diese Normen zu den Praktiken im Klassenzimmer stehen.
Trotzdem war es aus forschungspragmatischen Gründen von Nöten, eine der vielfältigen Begrifflichkeiten auszuwählen, und ich habe mich für jene der Critical Literacy entschieden. Dies ist zum einen damit zu begründen, dass dieser Begriff anschlussfähig an den englischsprachigen Literacy-Diskurs und seine Verwendung im Sinne einer Internationalisierung des fachdidaktischen Diskurs deshalb wünschenswert ist. Zum anderen lässt sich die Wahl dadurch begründen, dass der Literacy-Diskurs bereits eine beachtliche anschlussfähige begriffliche Differenziertheit aufweist (Trültzsch-Wijnen, 2020). Zudem wurde die Begrifflichkeit Critical Literacy in der Konzeptionsphase dieser empirischen Studie gehäuft in Praxispublikationen der Fremdsprachendidaktik verwendet (Gerlach & Lüke, 2020; J.-E. Leonhardt & Viebrock, 2020b), und auch in Gesprächen mit Lehrpersonen wurde deutlich, dass dieses Konstrukt bereits eine gewisse Nähe zur Praxis etabliert hat und als für die Praxis relevant wahrgenommen wird, weshalb es mir für eine praxeologisch-rekonstruktive Erforschung geeignet erschien.
1.2.5 Forschungsstand und Beschreibung des Desiderats
Wie weiter oben bereits erwähnt, werden die Begriffe Critical Literacy und Critical Pedagogy teils nicht trennscharf voneinander abgegrenzt: Es begegnen nämlich Publikationen, welche die Autor*innen selbst als Realisierungsformen von Critical Literacy bezeichnen, dabei allerdings einen zwar machtkritischen sowie sozial-emanzipativen Ansatz fokussieren, jedoch ohne sprachreflexiven Anspruch.