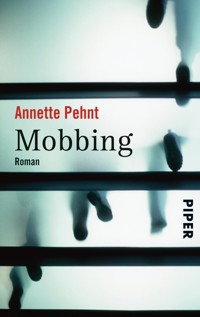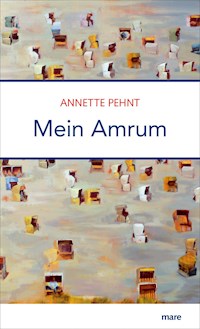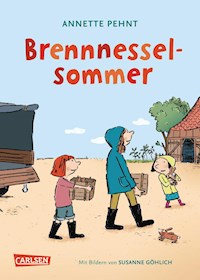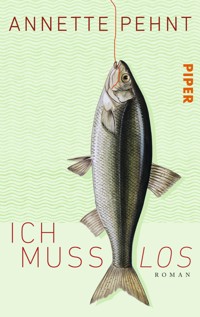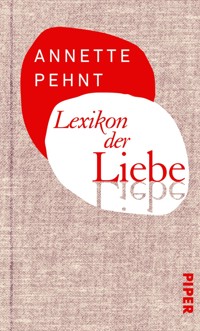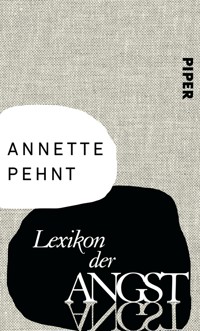19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Poetisch und intensiv: die Wucht der Klarheit Was uns Menschen ausmacht: Geschichten von der Meisterin der Reduktion Dauernd passiert etwas anderes. Wir verlieben uns, es gibt Missverständnisse, der Vater stirbt, eine Freundin geht. Unser Leben steckt voller Widersprüche und geheimer Zeichen. Aber wie viele Worte braucht es, um dieses Leben zu beschreiben? Annette Pehnt erzählt einfache Geschichten, manche berühren, andere überraschen. Es sind Geschichten nahe am Schweigen: Alles ist plötzlich zwangsläufig, die Liebe, die Einsamkeit, die Dinge, natürlich der Tod. Und dann entsteht in der Knappheit das, was uns Menschen ausmacht. Dem Sog dieser existenziellen Geschichten kann sich niemand entziehen. »Annette Pehnt schreibt hochreflektiert und glasklar.« NDR
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Covergestaltung: buxdesign, München
Coverabbildung:
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Jemanden aussuchen
Mit Pinguinen
Gewohnheiten
Rehe spielen
Weiße Landschaft
Applaus
Schlechte Strahlen
Pfirsiche
Eine Wahl gewinnen
Bäume lernen
Glückskinder
Schon bereit
Katzenbaum
Heißer Lappen
Einen Vulkan besteigen
In der Erde graben
Training
Versprochen
Von innen brennen
Tote Tiere
Alle ihr Ding
Gegen die Verabredung
Druck der Milch
Übersetzen
Einen Ring verlieren
Wieder atmen
Vogelschlag
Ruhiger Atem
Pfeffer und Ewigkeit
Warm in meiner Hand
Weit raus
Leute wie wir
Zurechtkommen
Zeit der Freude
Zitronen an den Bäumen
Zitat
Nachbemerkung
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Jemanden aussuchen
1.
Ich wünsche mir eine Schwester.
Schon sehr lange.
Als ich klein war, stand sie auf meinem Wunschzettel.
Liebes Christkind, schrieb ich.
Bring mir eine Schwester.
Egal wie sie aussieht.
Hauptsache Schwester.
Als ich klein war, wollte ich mit der Schwester Kleider tauschen.
Ich wollte ihr alles beibringen, was ich konnte.
Stelzen laufen.
Pfeifen, Kaugummiblasen machen.
Schleifen binden.
Ich wollte großzügig sein.
Und ich brauchte sie.
Sie sollte mir beim Tausenderpuzzle helfen.
Mücken töten.
Und meine Zöpfe flechten.
Beim Fangen wäre ich schneller.
Aber ich würde sie gewinnen lassen.
Ich wäre meiner Schwester eine gute Schwester.
Aber ich bekam keine.
Zu Weihnachten nicht und sonst auch nicht.
Ein Kind reicht uns, sagten die Eltern.
Sie sagen es bis heute.
Wir konnten alles für dich tun, sagen sie.
Wahrscheinlich wollen sie meinen Dank.
Aber ich wollte gar nicht alles.
Ich wollte nur die Hälfte.
Oder etwas mehr.
Den Rest für meine Schwester.
Meine Freunde hatten Schwestern.
Sie stritten sich dauernd.
Die Schwestern waren ihre Feinde.
Sie schnappten das größte Tortenstück.
Sie aßen nachts das Eiskonfekt aus der Truhe.
Sie beklauten sich.
Sie verpetzten einander.
Die Eltern hatten die Schwestern lieber.
Die Schwestern hatten mehr Glück in der Liebe.
Sei froh, dass du keine Schwester hast, sagten meine Freunde.
Aber meine Schwester wäre nicht so.
Sie würde mich besser kennen als sonst jemand auf der Welt.
Sie könnte meine Hosen enger nähen.
Und kickboxen.
Sie würde mir die besten Geschenke machen.
Weil sie weiß, was ich mag.
Sogar an den Migränetagen würde ich sie ertragen.
Sie dürfte mir den Eimer halten.
Und ich ihr.
Nachts würden wir uns schreiben.
Mit geheimen Abkürzungen.
Ob alles gut wäre.
Wenn nicht, käme sie sofort.
Egal wo sie gerade wäre.
Ich hätte eine Schwester.
Und ich wäre selbst eine Schwester.
Weil ich keine habe, kann ich keine Schwester sein.
Meinen Eltern reicht es, dass ich Tochter bin.
Sie wissen nicht, wovon ich rede.
Ich rede auch gar nicht mehr darüber.
Es gibt eine Lösung.
Ich suche mir jemanden aus.
Eine neue Schwester.
Sie muss nichts davon erfahren.
Hauptsache, ich weiß es.
Und ich weiß auch schon, wen.
2.
Seit einigen Wochen habe ich endlich eine Schwester.
Sie heißt Sabrina.
Den Namen habe ich nicht ausgesucht.
Die Schwester schon.
Wir kennen uns seit der Schule.
Sabrina ist genau die Richtige.
Sie kann vieles besser als ich.
Sie singt so schön.
Sie kann auch zeichnen.
Und Gedichte schreiben.
Sie ist künstlerisch begabt.
Aber sie ist auch praktisch veranlagt.
Sie kann Abflussrohre reinigen.
Und Treppenhäuser streichen.
Auf einer hohen Leiter mit Gumminoppen.
Ich weiß das alles schon lange.
Früher hat es mich gestört.
Sabrina hatte immer gute Noten.
Vor allem in Deutsch und Kunst.
Ihre Haare waren länger als erlaubt.
Sie wurde immer eingeladen.
Manchmal wollte ich ihr die Haare abschneiden.
Aber das ändert sich jetzt.
Denn nun ist sie meine Schwester.
Und ich bin stolz auf sie.
Zeig mir deine Bilder, sage ich.
Sie holt die neuen Zeichnungen.
Ich finde sie verrückt.
Und das sage ich auch.
Sabrina freut sich.
Sie versteht, wie ich es meine.
Weil Schwestern sich eben verstehen.
Ich rufe sie jetzt öfter an.
Damit wir guten Kontakt haben.
Sie ist jedes Mal überrascht.
Sie muss sich erst an mich gewöhnen.
Sie weiß ja nicht, dass sie meine Schwester ist.
Aber sie wird es merken.
Sie wird auch lernen, auf mich stolz zu sein.
Ich erzähle ihr von meinem Tag.
Von der Arbeit, von der Pause im Park.
Dass ich nicht mehr rauche.
Und von dem gelben Kater heute Morgen.
Sie hört eine Weile zu.
Dann unterbricht sie mich.
So wie Schwestern es eben tun.
Sie erzählt von ihrer Lieblingskatze.
Und dass wir keine Tiere halten sollten.
Weil Tiere frei sein wollen.
Nein, Sabrina, sage ich.
Manche Tiere können gar nicht frei sein.
Hunde zum Beispiel.
Sie brauchen die Menschen.
Aber Katzen wollen frei sein, sagt Sabrina.
Sie will das letzte Wort behalten.
Ich reiße mich zusammen.
Soll sie doch.
Ich bin großzügiger, als ich dachte.
Aber sie muss auch lernen, für mich da zu sein.
Ab und zu.
Ich bitte sie um Hilfe.
Mit der Waschmaschine.
Dahinter ist Schimmel.
Nur ein bisschen.
Ich habe ihn neulich entdeckt.
Ich habe gleich Gift gekauft.
Und einen Schaber.
Und spezielle Farbe.
Aber allein kann ich nichts machen.
Ich muss die Waschmaschine verrücken.
Sabrina wird mir helfen.
Dafür sind Schwestern da.
Aber sie hat keine Zeit.
Sie singt im Chor.
Am nächsten Abend trifft sie Freunde.
Und dann fährt sie auch bald in Urlaub.
Ich freue mich für sie.
Ich wünsche ihr einen schönen Urlaub.
Wenn sie zurückkommt, frage ich einfach noch mal.
Es eilt ja nicht.
3.
Sabrina meldet sich nicht mehr.
Sie müsste längst zurück sein.
Ich habe Sabrina schon geschrieben.
Sie antwortet nicht.
Sie hat ihr Profilbild geändert.
Sabrina an einem Bootssteg.
Ihre Beine baumeln über dem Wasser.
Um die Schultern hat sie einen weißen Pulli.
Alles sieht frisch und windig aus.
Ich bin froh, dass sich Sabrina gut erholt hat.
Nun möchte ich sie bald sehen.
Der Schimmel hinter der Waschmaschine verschwindet nicht von allein.
Es gibt also einiges zu tun.
Wir könnten die Waschmaschine zusammen wegrücken.
Ich weiß ja, dass Sabrina praktisch veranlagt ist.
Das war sie immer schon.
Schwestern kennen sich länger als sonst jemand.
Ich weiß alles über sie.
Den Schimmel würde ich übernehmen.
Das würde ich ihr nicht zumuten.
Danach würde ich sie auf ein Glas Wein einladen.
Dann kann sie mir vom Urlaub erzählen.
Ich schaue mir alle Bilder an.
Ich kann sehr geduldig sein.
Ich drängele nicht.
Ich weiß, dass sich Sabrina melden wird.
Bis es so weit ist, erledige ich viele andere Dinge.
Ich besuche meine Eltern.
Wir sprechen nicht über Geschwister.
Auch meine Eltern waren im Urlaub.
Bei meinen Eltern bin ich nicht so geduldig.
Sie zeigen mir Bilder, bis ich gähne.
Ich halte mir die Hand vor den Mund.
Sie merken es gar nicht.
Ich fange auch an mit dem Schimmel.
Der Fleck wird größer.
Ich ziehe mir einen Mundschutz an und spachtele ihn ab.
So weit es geht.
Und ich melde mich bei einem Chor an.
Ich muss sogar vorsingen.
Ein Lied meiner Wahl.
Ich singe Kein schöner Land.
Meine Stimme zittert etwas.
Aber sie nehmen mich.
So habe ich etwas mit Sabrina gemeinsam.
Jeden Dienstag gehe ich zum Chor.
Ich stehe neben fremden Frauen.
Sie nicken mir zu und sagen ihre Namen.
Ich kann sie mir nicht merken.
Beim nächsten Mal frage ich wieder.
Danach traue ich mich nicht mehr.
Ich tue so, als wüsste ich alles.
Ich tue auch so, als könnte ich Noten lesen.
Das muss ich Sabrina erzählen.
Dann können wir darüber lachen.
4.
Nun haben wir uns seit Monaten nicht gesehen.
Mein Vater hat mir mit der Waschmaschine geholfen.
Den Schimmel dahinter hat er auch weggemacht.
Im Chor kenne ich inzwischen einige aus dem Sopran.
Hinterher trinken wir ein Bier.
Mit den Noten tue ich mich schwer.
Die Namen weiß ich noch immer nicht.
Aber es merkt niemand.
Alles ist so, wie es sein soll.
Nur Sabrina fehlt mir.
Vielleicht braucht sie etwas Abstand.
Trotzdem rufe ich irgendwann an.
Meine Hände sind feucht.
Wie bei einer Bewerbung.
Wie war dein Urlaub, Sabrina, frage ich.
Sie lacht.
Ach das. Ist ja schon ewig her!
Warum hast du dich nicht gemeldet, frage ich.
Gleich halte ich mir die Hand vor den Mund.
Wie klingt das denn.
Ich bin nicht Sabrinas Mutter.
Das sagt sie auch gleich.
Aber sie lacht dabei.
Sie hat gute Laune.
Sie lädt mich ein zum Tanz in den Mai.
Ich bin so froh.
Ich ziehe ein blaues Kleid an.
Dann ein zitronengelbes.
Oder besser doch eine Hose.
Ich schicke Sabrina ein Bild.
Wie Schwestern es eben machen.
Egal, schreibt sie zurück.
Komm einfach.
Sie nimmt mich, wie ich bin.
Ich radele zum Tanzfest.
Viele Menschen stehen vor dem Saal.
Die Halle ist hell erleuchtet.
Drinnen tanzen sie schon.
Ich sehe jemanden aus dem Chor.
Nur Sabrina ist nirgendwo.
Ich stehe eine Weile herum.
Ich hole mir ein Glas Bowle.
Dann noch eins.
Ich schaue den tanzenden Paaren zu.
Da sehe ich Sabrina.
Sie tanzt auf der Bühne mit einem kleinen Mann.
Er ist dünn und wendig.
Ein guter Tänzer.
Sie lachen und drehen sich.
Sabrinas Haare sind länger als erlaubt.
Ich weiß nicht, wer ihr Tänzer ist.
Ich weiß auch nicht, warum Sabrina so gut tanzt.
Sie kann doch sonst schon so viel.
Sie will in allem die Beste sein.
Ich lehne mich an die Wand und starre sie an.
Ihr wippendes Haar und den frischen weißen Rock.
Sie sieht aus wie eine Reklame.
Mich hat sie völlig vergessen.
Meine Hände sind schon wieder feucht.
So wird niemand mit mir tanzen.
Ich stecke sie in die Hosentaschen.
Und schließe die Augen.
Ich wünsche mir, dass Sabrina hinfällt.
Oder dass der Tänzer ihr die Haare abschneidet.
Oder dass der Schimmel sie frisst.
Da schlägt mir jemand auf die Schulter.
Da bist du ja endlich, ruft Sabrina.
Hier ist was los.
Komm, ich stelle dich ein paar Leuten vor!
Sie nimmt mich an der Hand.
So, wie ich es mir immer gewünscht habe.
Ich hasse sie mit aller Kraft.
So ist das eben bei Schwestern.
Mit Pinguinen
Mein Bauch ist riesig.
Die Haut reicht fast nicht.
Sie ist so straff wie Leder.
Darunter ein Baby.
Der Nabel hat sich umgestülpt.
Manchmal fotografiere ich ihn.
Ich setze mich aufs Bett und lege eine Hand auf den Bauch.
Das machen viele Schwangere so.
Ich schaue mir die Bilder auf dem Handy an.
Die Schwangeren sitzen da und schauen nachdenklich in die Ferne.
Eine Hand auf dem Bauch.
Mit der anderen machen sie das Foto.
So wie ich manchmal.
Manche malen sich auch einen Lachmund auf den Bauch.
Vielleicht weil sie sich freuen.
Ich freue mich nicht.
Ich könnte einen weinenden Mund auf die Haut malen.
Mit Lippenstift.
Aber das mache ich nicht.
Ich schaue lieber nachdenklich in die Ferne und knipse mich.
Also meinen Bauch.
Die Leute freuen sich, wenn sie ihn sehen.
Im Bus fragen sie mich, ob sie ihn anfassen dürfen.
Dabei schauen sie mich nicht an.
Sondern den Bauch.
Eigentlich wollen sie das Baby anfassen.
Aber dazwischen ist die Haut.
Meine Haut.
Ja klar, sage ich.
Sie streicheln und klopfen meinen Bauch.
Ich weiß nicht, warum ich das zulasse.
Jeder will gerne gestreichelt werden.
Wenn das Baby da ist, werde ich es nicht mehr erlauben.
Wenn es da ist.
Ich glaube nicht, dass es kommt.
Ich weiß, dass es kommen wird.
Aber ich kann es einfach nicht glauben.
Ich spreche auch nicht mit ihm.
Man soll mit dem Baby sprechen.
Man soll ihm vorsingen.
Und klassische Musik spielen.
Ich mag keine klassische Musik.
Ich kann sie nicht ertragen.
Sie erinnert mich an die Schule.
Warum soll ich Musik hören, die ich nicht mag?
Ich gehe zu einem Kurs.
Das soll man so machen.
Damit man weiß, was auf einen zukommt.
Der Kurs ist in einem Raum mit lila Wänden.
Wie ein Schlund.
Ich ducke mich etwas.
Alle scheinen sich zu kennen.
Dabei fängt doch der Kurs gerade erst an.
Sie sitzen auf Lammfellen und unterhalten sich.
Die Gesichter glänzen lila.
Wegen den Wänden.
Die Papas sind auch dabei.
Sie sitzen hinter den Mamas und halten sie fest.
Die Hebamme begrüßt uns mit warmer Stimme.
Alle müssen etwas sagen.
Wie sie heißen, wie schwanger sie sind und was sie erwarten.
Es geht reihum.
Mir wird heiß.
Ich habe länger mit niemandem gesprochen.
Und ich weiß nicht, was ich erwarte.
Als ich dran bin, versagt meine Stimme.
Ich krächze meinen Namen.
Und dass ich nicht glaube, dass ich schwanger bin.
Und dass ich nichts erwarte.
Alle starren mich an.
Sie starren auf meinen Bauch.
Er ist genauso groß wie alle Bäuche hier.
Die Hebamme dankt mir.
Danke, dass du so offen bist.
Das ist ein guter Einstieg.
Und sie redet eine Weile über Offenheit.
Das ist gut.
Die anderen schauen sie an und vergessen mich.
Dann müssen wir noch auf alle viere.
Und den Rücken krumm machen.
Nicht so einfach mit den riesigen Bäuchen.
Katze Kuh nennt die Hebamme das.
Die Papas machen es auch.
Für sie ist es viel einfacher.
Endlich ist es vorbei.
Ich gehe schnell raus.
Zu Hause sitze ich am Esstisch.
Das Sofa ist zu weich.
Ich kann nicht mehr gut aufstehen.
Lieber sitze ich sehr gerade am Esstisch.
Heute habe ich nichts gelernt.
Im Bauch bewegt sich etwas.
Das wird wohl das Baby sein.
Ich lege eine Hand auf die Delle.
Ich versuche, zu ihm zu sprechen.
Hallo, kleiner Teufel, sage ich.
Dann schäme ich mich.
Das Baby kann nichts dafür.
Ich sollte höflicher sein.
Entschuldige, sage ich laut.
Hallo, mein Kleines.
Das hört sich falsch an.
Ich kann nicht mit ihm sprechen.
Das mache ich dann, wenn es da ist.
Dann fällt mir sicher etwas ein.
In der Nacht schlafe ich nicht.
Ich kann kaum atmen.
Der Bauch drückt auf meine Lunge.
Ich drehe mich zur Seite.
Jetzt liegt der Bauch neben mir wie ein weiches Tier.
Ich schiebe ein Kissen unter ihn.
Damit die Haut nicht so zieht.
Das hat mir niemand erklärt.
Vielleicht geht es nur mir so.
Die anderen Schwangeren sehen gesund aus.
Ausgeschlafen und satt.
So haben sie Kraft für die Zeit mit dem Kind.
Das steht auch in meinem Buch.
Sammeln Sie Kraft für die Zeit mit dem Kind.
Ich würde gern zur Arbeit.
Im Büro könnte ich auf einem Bürostuhl sitzen.
Der wäre genau richtig.
Und könnte Bürokaffee trinken.
Der würde mich wach machen.
Ich könnte mit den anderen reden.
Aber nicht zu viel, weil wir ja arbeiten.
Das passt mir gut.
Und niemand würde meinen Bauch anfassen.
Das macht man nicht im Büro.
Ich habe gefragt, ob ich bis zur Geburt arbeiten kann.
Aber ich durfte nicht.
Sie brauchen ja auch die Zeit, hat mein Chef gesagt.
Um sich vorzubereiten.
Er hat keine Ahnung.
Er ist jünger als ich und hat zwei Geliebte.
Das sagen jedenfalls alle.
Auf jeden Fall hat er keine Babys.
Ich bin schon vorbereitet, habe ich gesagt.
Tut mir leid, sagte der Chef.
So ist das Gesetz.
Und man kann sich immer noch verbessern.
Alles Gute für Sie.
Seitdem bin ich zu Hause.
Keiner besucht mich.
Vorher nicht.
Und jetzt auch nicht.
Ich räume alles auf.
Das geht schnell, denn bei mir ist es immer ordentlich.
Ich gehe spazieren.
Auch das geht schnell.
Ich kenne jede Straße und jede Gasse.
Ich trage meinen Bauch herum und atme tief durch.
Es riecht nach Rasenschnitt und Lasagne.
Zu Hause wärme ich mir etwas auf.
Dann sitze ich noch eine Weile am Esstisch.
Ich will mich nicht hinlegen.
Im Sitzen kriege ich viel mehr Luft.
Ich schaue aus dem Fenster und denke an früher.
Mir fällt das Mobile ein.
In meinem Kinderzimmer.
Kleine Walfische, die sich drehten.
Über mir.
Wenn ich nicht einschlafen konnte.
Ich beschließe, morgen ein Mobile zu basteln.
Für das Baby.
Dann habe ich etwas zu tun.
Andere Schwangere machen das auch.
Ich sehe es auf all den Fotos.
Sie basteln die ganze Zeit.
Mobiles, Stofftiere, kleine Becher und Socken.
Damit zeigen sie dem Baby ihre Freude.
Auch wenn es im Bauch nichts sehen kann.
Endlich ist es wieder Morgen.
Die Läden öffnen.
Ich kaufe ein Bastelset Mobile mit Pinguinen.
Dazu Kleber, Farben und Fäden.
Für Ihr Kind, fragt die Verkäuferin.
Nein, für mich, sage ich und bezahle.
Zu Hause lese ich mir durch, was man machen muss.
Es hört sich einfach an.
Man muss alles ausschneiden, zusammenkleben und aufhängen.
Mit meiner Nagelschere schneide ich die kleinen Pinguine sorgfältig aus.
Ich passe gut auf mit den Schnäbeln.
Und den Flossen.
Oder Füßen.
Mit Pinguinen kenne ich mich nicht aus.
Zwischendurch bekomme ich Appetit.
Basteln macht hungrig.
Das ist gut.
Ich sollte öfter basteln.
Ich sollte auch öfter essen.
Und einkaufen.
Ich klebe die Pinguine zusammen.
Ich hänge sie an die Drahtbügel.
Sie sind nicht im Gleichgewicht.
Ich blättere in der Gebrauchsanweisung.
Ich schiebe sie hin und her.
Sie verheddern sich.
Langsam werde ich wütend.
Ich mache doch alles richtig.
Irgendetwas läuft hier schief.
Die Bügel hängen nach unten.
Egal was ich tue.
Ich werfe das Mobile auf den Tisch.
Morgen bringe ich es zurück.
Es gibt sowieso keinen Platz zum Aufhängen.
Ich mag die Pinguine gar nicht.
Ihre Augen sind starr.
Ich bekomme das Geld zurück.
So einfach ist das.
Dann gönne ich mir ein Stück Torte und einen Kaffee.
Ich setze mich ans Fenster und schaue auf die Straße.
Draußen regnet es etwas.
Ich bin froh, dass die Pinguine weg sind.
Sie sind in meine Wohnung eingedrungen.
Eine ganz Horde.
Nun habe ich sie verjagt.
Ich trinke meinen Kaffee.
Ich vergesse den Bauch.
Es ist schön, aus einem anderen Fenster zu schauen als sonst.
Da bringt die Kellnerin die Torte.
So, sagt sie, einmal Schwarzwälder Kirsch.
Bei Ihnen essen ja zwei.
Bald ist es so weit.
Sie fragt mich nicht.
Sie weiß es.
Ich starre sie an.
Danke, sage ich.
Soll ich mal ein Foto von Ihnen beiden machen, sagt sie.
Sie zeigt auf mein Handy.
Fürs Familienalbum.
Danke, sage ich noch einmal.
Danke nein.
Ich esse die Torte rasch.
Sie ist viel zu süß.
Und der Alkohol ist nicht gut für das Kind.
Ich werde es Pinguin nennen.
Ein Kosename.
Mehr nicht.
Gewohnheiten
Ich weiß genau, was ich tun muss.
Es kommt darauf an.
Wenn Lili aufwacht, muss es hell sein.
Wenn sie in der Nacht aufwacht, muss ich die Lichter anschalten.
Wenn sie morgens aufwacht, ist es sowieso hell.
Wenn die Rollladen geschlossen sind, schreit sie.
Also lasse ich sie oben.
Wenn Lili sich anzieht, müssen die Kleider bereitliegen.
Auf dem blauen Sessel neben ihrem Bett.
Es müssen die gleichen Kleider wie gestern sein.
Wenn sie dreckig sind, muss ich sie nachts waschen.
Und trocknen.
Wir haben alle Hosen fünfmal.
Die Pullover auch.
Wenn sich Lilis Zehen in den Socken verfangen, weint sie.
Wenn sich ihr Kopf im Pullover verfängt, zittert sie.
Ich stehe neben ihr und reiche ihr die Kleider.
Überall sind Fallen.
Dann Frühstück.
Die Marmeladengläser stehen rechts und links von ihrem Teller.
So, wie es sein soll.
Die Milch habe ich aufgewärmt.
Morgens muss es still sein.
Das Radio verwirrt sie.
Ans Handy darf sie erst später.
Auch ich schweige.
Ich muss mich konzentrieren.
Wenn etwas runterfällt, hebe ich es auf.
Dann hat alles wieder seine Ordnung.
Die Fahrt zur Schule ist unser bester Moment.
Lili sitzt hinten, angeschnallt.
Ich lege eine Kassette ein.
Hoffentlich geht das Auto nicht kaputt.
Wir brauchen den Kassettenrekorder.
Und die Fensterheber.
Lili lässt das Fenster fünf Zentimeter herunter.
Auch im Winter.
Ich stelle das Hörspiel an.
Warum ist die Banane krumm?
Wir hören beide nicht zu.
Eine Weile lang ist alles ruhig.
Dann parken wir vor der Schule.
Wie die anderen Eltern auch.
Ab jetzt kann alles passieren.
An guten Tagen steigt Lili aus.
Ihre Freundin steht an der richtigen Stelle.
Neben der Treppe.
Lili nimmt ihre Tasche und rennt zu ihr.
Ich fahre weg, solange nichts passiert.
An schlechten Tagen ist die Freundin nicht da.
Oder sie steht bei den Fahrrädern.
Das geht nicht.
Lili steigt nicht aus.
Sie umklammert ihre Tasche.
Ich bleibe hier, sagt sie.
Aber du musst in die Schule, sage ich.
Gar nichts muss ich, sagt sie.
An sehr schlechten Tagen drehen wir um und fahren nach Hause.
Oder ich warte, bis sie den Türgriff loslässt.
Ich reiße die Tür auf und zerre an ihr.
Sie schreit.
Die anderen Eltern kennen das schon.
Aber es interessiert sie trotzdem.
Alle schauen zu.
Falls die Freundin jetzt nach Lili ruft, bin ich gerettet.
Falls nicht, bleibt es ein sehr schlechter Tag.
Nach der Schule braucht Lili Essen.
Sofort.
Ich darf sie nicht fragen, was sie will.
Sonst wird sie wütend, wenn es fertig ist.
Weil es anders ist, als sie dachte.
Ich muss Nudeln kochen und die richtige Soße.
Die Soße muss so sein wie immer.
Dunkelrot und ohne Stücke.
Die Gemüsestücke püriere ich.
Das geht nur, wenn Lili es nicht merkt.
Den Pürierstab spüle ich rasch und lege ihn weg.
Bevor wir essen, muss ich den Spruch sagen.
Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir.
Wenn ich es vergesse, haut Lili in die Nudeln.
Mit der flachen Hand.
Auch wenn ich es zu spät sage oder jemand anruft.
Lili ist zu alt für den Spruch.
Sie ist auch zu alt für das Hörspiel im Auto.
Du behandelst mich wie ein Kind, sagt sie.
Du bist mein Kind, sage ich.
Sollen wir den Spruch nicht mehr sagen?
Sie schaut mich an.
Dann stößt sie heftig gegen den Tisch.
So heftig, dass ein Glas zu Boden fällt.
Ich hole den Feger.
Aber ich bin zu langsam.
Als ich zurückkomme, zeigt sie auf die Scherben.
Sie weint.
Die schneiden mich, schluchzt sie.
Ich räume die Scherben weg.
Weil ich mich beeile, schneide ich mir den Finger.
Das Blut tropft auf das Kehrblech.
Ich drehe mich schnell um und verstecke den Finger.
Ich halte ihn unter kaltes Wasser.
Ich weiß nicht, was passiert, wenn Lili Blut sieht.
Wir haben keine Übung damit.
Nur das, was wir üben, geht gut.
Nach dem Mittagessen schläft Lili.
Sie ist zu alt für einen Mittagsschlaf.
Aber sie legt sich aufs Bett wie immer.
Ich lege mich auf das Sofa.
Ich starre an die Decke.
Ich weiß nicht, wie der Tag vergehen soll.