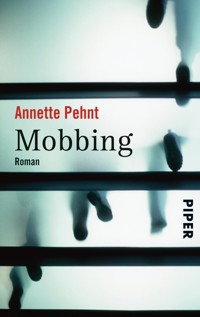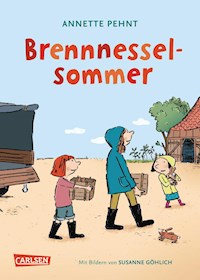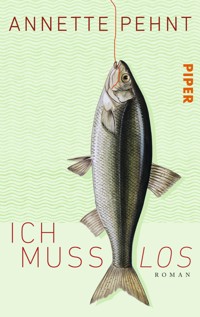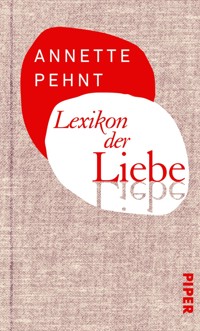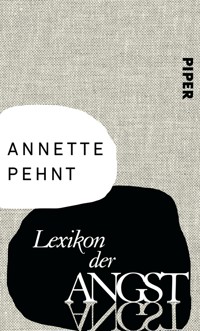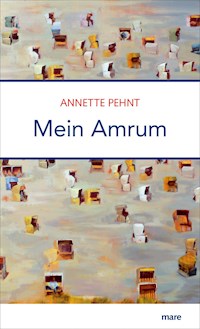
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit vielen Jahren zieht es Annette Pehnt immer wieder nach Amrum. In ihrer poetischen Amrumgeschichte erkundet sie nun, wie ihre Liebe zu dieser kleinen, speziellen und gleichsam entrückten Nordseeinsel entstanden ist; sie spaziert mit ihrer Hündin über den Kniepsand und durch die Dünen, erinnert sich dabei an vergangene Reisen, besucht das Heimatmuseum in Nebel und lässt uns an ihrem genauen Blick auf die Landschaften und Menschen Amrums teilhaben. Doch vor allem möchte Annette Pehnt einfach über die Insel schreiben, denn "wer nach Amrum kam, wollte Geschichten erzählen … Geschichten von lila Blaubeerlippen und Sahnewolken im schwarzen Tee". Nachdenklich und sehr persönlich entfaltet Annette Pehnt die eigenwillige Poetik ihrer Insel – indem sie über den Zauber von Anfängen und Aufbrüchen schreibt, über Veränderungen, übers Ankommen, Sich-Verirren und Zu-sich-selbst-Finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Annette Pehnt
Mein Amrum
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2019 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann, mareverlag
Abbildung © akg-images / Bianca Classen
Lektorat Ilka Heinemann, Köln
Typografie (Hardcover) mareverlag
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-354-5
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-293-7
www.mare.de
Für Barbara
Inhalt
Aufbruch
Das erste Mal
Ankommen
Verirren, verlieren
Erzählen
Wörter
Nebensachen
Übergänge
Veränderungen
Aufbruch
Aufbruch
Auf Amrum konnte ich noch nie gut arbeiten. Ein Irrtum zu glauben, ein geliebter Ort sei gut fürs Schreiben. Es gibt so viel anderes zu tun: über die Heide gehen, auf der höchsten Düne über die weichen, struppigen Hügelketten schauen, vom zähen, wetterfesten Strandgras gesäumt; in den Mulden, die niemand betreten darf, brüten Vögel zwischen Holunderbüschen, Kaninchen rasen durch die Senken, Fasane scharren im Gestrüpp. All dies muss ich anschauen, und das Fahrrad schlingert in den sandigen Rillen zwischen Norddorf und Nebel. Pferde mit nassen Mähnen hinter Steenodde. Ständig überrascht mich der Leuchtturm. All die Orte, die ich lange nicht gesehen habe.
Wie soll ich hier arbeiten, ich müsste in einem Zimmer sitzen, an einem Tisch, in Reichweite einer Steckdose, während Windstöße die Zweige vor dem Fenster niederdrücken, Kinder sich auf dem Weg zum Strand einen Ball zuschieben, die Kapuzen fest um die Gesichter gezurrt. Während ich nach Wörtern suchte, sähe ich die Sonne, die schon wieder durchgreift, Regen und Sonnenschein zugleich; ich müsste den Blick senken und nach einem Wort für dieses Wetter suchen, das es nicht gibt, wo ich doch die Insel selbst haben kann, unter mir, über mir, um mich herum. Es kümmert sie nicht, ob ich sie beschreibe; sie bringt mich zu gar nichts außer sich selbst. Und deswegen will ich dorthin. Mit der Hündin.
Die Inseln meiner Kindheit waren immer andere, nie kehrten wir zum gleichen Ort zurück. Auf jeder Insel wünschte ich mir, bleiben zu können, in einem der alten Häuser am Hafen, oder am Rand der Pinienwälder. Einfach bleiben, Schafe halten, endlich einen Hund haben, ein Ruderboot am Steg, einen Platz in der Dorfschule. Vielleicht eine Freundin in einem der Höfe, Bienenkörbe am Wegrand. In einem der Gärten die Hausaufgaben machen, während mein Vater im Haus Bücher schrieb und meine Mutter Feigenmarmelade kochte.
Meine Eltern lachten, wenn ich ihnen diese Geschichten erzählte, denn nichts lag meiner Mutter ferner, als Marmelade einzukochen, und mein Vater brauchte Bahnhöfe, Städte und ihre Architekturen. Aber sie freuten sich über meine Begeisterung, die auf jeder Insel gleichermaßen ausbrach, und bis heute bin ich leicht zu begeistern. Zugleich lachten sie über meine Ahnungslosigkeit: dass ich nicht wusste, wo man leben kann, dass man Geld verdienen muss, was möglich und was unmöglich ist und wie schwer es ist, mit einem fremden Ort vertraut zu werden.
Doch mir waren die Inseln nicht fremd, es waren meine Sommerorte, und über die Jahre wurden sie eins, eine einzige leuchtende, freundliche Gegend, mit den Düften des Südens und der Tatkraft des Nordens, mit der Schroffheit des äußeren Westens, nur im Osten waren wir nie.
Später reisten wir auch an andere Orte. Wir übten Ferien in Städten, in Gegenden fernab der See. Es müssten nicht immer Inseln sein, hatten meine Eltern beschlossen, wir sollten auch andere Landschaften kennenlernen, und die Städte, die sie uns zeigen wollten, lagen mitten in Europa. Diese Reisen waren lehrreich, aber unübersichtlicher. Nie hatte ich hinterher das Gefühl, wirklich ortskundig geworden zu sein.
Auf Amrum ortskundig zu werden scheint ein bescheidenes Ziel; aber um es zu erreichen, braucht es nicht weniger Zeit und Sorgfalt als in einem weitläufigen Gelände.
Die Insel schreiben.
Über die Insel gehen und ans Schreiben denken.
Über die Insel schreiben und ans Gehen denken.
An die Insel denken und über das Gehen schreiben.
Seit Längerem fliege ich nicht mehr, wofür es viele Gründe gibt, und einer davon ist die Hündin.
Die Insel kennenlernen mit der Hündin.
Die Hündin auf der Insel kennenlernen.
Der Sand, die Salzwiesen hinter Norddorf und das Knistern des Fahrradreifens auf dem Pfad am Watt entlang. Oder eher ein Knirschen, ein Knacken, wenn kleine Steinchen unter dem Reifen wegspringen, und das Schlingern des Lenkers, wenn das Rad in lockeren Sand hineinsteuert. Die Hündin liefe nebenher, knapp an der Leine, ihr gleichmäßiger, weit ausgreifender Trab neben dem Vorderreifen. Auf den Bohlenwegen müsste ich sie gut festhalten, sie würde den Kaninchen folgen wollen, und am Strand gäbe es mehr Platz, als sie jemals gesehen hat.
Den Wind wird sie lieben. Wind macht sie aufgeregt, sie reißt den Kopf hoch, spürt die Windstöße im Fell, tänzelnd hält sie die Schnauze in die Luft, bis sich die Leine spannt und ich sie zurückrufe.
Als ich noch lange Strecken flog, überquerte das Flugzeug irgendwann zwischen der Nacht und dem frühen Morgen, wenn alle eingenickt waren (die knisternden Fleecedecken eng um die Leiber gezurrt, die Nackenkissen umgelegt wie aufgeblasene Halsbänder), die unbewohnten Ebenen. Nie wusste ich genau, wo wir waren. Die Augen brannten, der träge Körper hing im Sitz, während wir minutenlang, stundenlang über leere Landschaften flogen, gleichmäßig gewellte Hügelketten ohne Vegetation, irgendwo zwischen Sibirien und Grönland, oder über die Salzwüsten von Chile, die Ausläufer des Himalaja. Eine Unruhe drang in meine Schläfrigkeit, und ich schaute auf die kleine Anzeigetafel direkt vor mir, um unsere Route zu begreifen – in einer Gegend, in der ein Absturz keine Spur hinterlassen würde, wo es nichts gäbe, wo wir bleiben könnten, keine Siedlungen, keine Vegetation, nichts. Dann richtete ich mich hellwach in meinem Sitz auf, der Wunsch nach Begrenzung, nach Überschaubarkeit war dort oben noch stärker.
Dass einen jemand findet.
Hunde können nicht fliegen. Wenn es nicht anders geht, kann man sie in Boxen sperren, sedieren und mitnehmen; vorher müssen sie geimpft werden, hinterher sind sie gezeichnet von der Reise und wollen nie wieder in die Box. Im Grunde geht es mir genauso. Auf Schiffen dagegen ist die Reise turbulent, aber begreiflich. Man überblickt die Entfernungen, und wenn es zu einem Unglück käme, wäre man in Lebensgefahr, aber nicht sofort zerschmettert; es gibt Schwimmwesten, Rettungsboote und den tapferen Seenotrettungsdienst, der auf den Friesischen Inseln um Spenden bittet, und ich stecke jedes Mal etwas Kleingeld in die Sparbüchsen.
Ich war immer wieder auf Inseln. Aber noch nie mit der Hündin. Wir kennen uns noch nicht lange, sie kommt von einer südlichen Insel, die sie durchstreift hat, bis jemand sie anfuhr und am Straßenrand liegen ließ. Dort sammelte man sie auf, versorgte sie und suchte ein Zuhause für sie. So fanden wir uns. Lange habe ich mir einen Hund gewünscht. Als Kind schon schrieb ich es hartnäckig auf jeden Wunschzettel, ich fragte ständig nach, manchmal täglich, führte alle Hunde der Nachbarschaft aus und stellte mir vor, sie gehörten mir. Ich ließ nicht locker; ich war sicher, ein Hund wäre das Glück meines Lebens. Von meinem Taschengeld kaufte ich mir eine rote Leine aus Leder, weil ich sicher war, wenn die Leine an der Garderobe hing, würde sich auch der Hund einstellen. So war es nicht; ich wartete, sparte und verhandelte. Irgendwann brannte der Wunsch nicht mehr, es gab andere Träume, ich wollte reisen, lebte in anderen Ländern. Aber immer habe ich jedem Hund hinterhergeschaut.
Dann kamen Hunde in die Familie, und noch heute wundere ich mich, warum es so lange dauerte, bis ich mir diesen Wunsch erfüllt habe. Ich übte mich darin, ein Tier zur Gesellschaft zu haben.
Seit einem Jahr gewöhnt die Hündin sich an mich, an das Leben in einem Haus am Rande einer Stadt, an Futter aus dem Napf und die Leine am Hals. Und ich gewöhne mich an den mageren Körper an meiner Seite, an ihr Seufzen im Dunkeln, an Spaziergänge frühmorgens und spät in der Nacht. Wenn ich arbeite, liegt sie unter dem Tisch, seitlich auf dem Boden hingestreckt oder kompakt zusammengerollt. Sie erinnert mich daran, wann es Zeit wird, aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen. Und sie zwingt mich dazu, jeden Tag eine Stunde lang über die Wiesen zu laufen. Ich gehe langsam bergauf, stecke auf der Obstwiese ein paar Äpfel ein, manchmal werfe ich ihr einen Stock und schaue ihr zu, wie sie ihre riesige Runde rennt, der Körper schmal und gestreckt, der Kopf nach vorn gereckt, die langen Beine weit ausgreifend. Irgendwann kommen Zäune, Gärten und Wege, die ihre Runden begrenzen, sie nimmt die Kurve scharf und rast zu mir zurück, so schnell, dass sie nicht rechtzeitig zum Stehen kommt.
Gereist sind wir noch nicht zusammen.
Warum ausgerechnet nach Amrum – die weite Fahrt, teuer und beschwerlich –, warum immer wieder dorthin? Wovon kann ich auf Amrum erzählen? Die Amrumgeschichten sind für Weitgereiste sonderbar still und kleinteilig. Von Nichtigkeiten und Nebensachen, von Windrichtungen und Lachmöwen, von Tee im alten Schulhaus. Die Fahrten nach Amrum: bescheidene Reisen, nicht dazu gedacht, klüger zu werden. Nur ortskundiger. Immer, wenn ich hierherfahre, ist es eine Rückkehr, und die vertraute Landschaft heißt mich willkommen, weil ich es so will. Einfache Sommerfrische.
Die Hündin wäre auch zufrieden mit einem langen Gang in den Wäldern, das Meer hat sie ja nicht gesehen damals auf ihrer Insel, sie trieb sich im Landesinneren herum, an den Rändern der kleinen Touristenstädte, wo sie Müll fraß und Schatten suchte. Das Meer ist ihr egal. Sie hat keine Sehnsüchte – außer mich, vielleicht.
Es ist nicht leicht, mit ihr nach Amrum zu reisen. Und es wird ihr nicht gefallen. Wir werden durch ganz Deutschland fahren müssen, die Hündin in einer Box im Kofferraum liegend, geduckt, mit eingezogenen Pfoten. Oder in einem Zugabteil, schlotternd und hechelnd. Auf ihrer Insel hat sie das Fürchten gelernt. Die Furcht sitzt ihr in den Knochen. Anfangs hatte sie Angst vor allem und jedem. Vor anfahrenden Autos und Männern, vor wehenden Plastiktüten und dem Klirren der Gläser in der Spülmaschine. Sie drückte sich an die Wand und duckte sich.
Auf Amrum gibt es nichts zu fürchten. Deswegen fahren die Leute dorthin. Das war nicht immer so, und nicht für alle. Immer gibt es auf einer Insel das Wetter zu fürchten, auch auf Amrum gab es Sturmfluten, auch dort werden Leute krank, zerbrechen Familien, ich weiß.
Als der GAU in Fukushima passierte, war ich auf Amrum. In jenem kalten Frühling, an der Ostsee war der Bodden noch gefroren, war ich von Hamburg heraufgekommen, um in der weißen Sonne auf dem Kniepsand herumzuspazieren und etwas fertig zu schreiben. Die Zentralheizung in meiner Wittdüner Ferienwohnung war so stark, dass ich die Fenster im kleinen Wohnzimmer immer wieder aufreißen musste. Ein winziger Fernseher stand auf dem Tresen der Einbauküche, und ich zog mir einen Stuhl davor, weil ich vom Sofa aus nichts erkennen konnte, und starrte auf die sich ständig wiederholenden Bilder der schmelzenden Reaktoren, der ernsten Gesichter (wenig Tränen), auf die verwüsteten Gegenden. Morgens lief ich nach unten zur Mole und kaufte im Souvenirladen die Zeitung, weil ich dem Fernsehen nicht traute, und studierte die Erklärungen, Modelle von Kernschmelze, die verschiedenen Reaktorblöcke, die Ausbreitung des verseuchten Kühlwassers über Quadratkilometer. Abends erklärten Experten das Gleiche noch einmal in den Gesprächsrunden. Tagsüber ging ich wie immer über die Insel. Und es verwirrte mich, dass die Angst, die ich morgens und abends spürte, sich verflüchtigte, sobald ich vor das Haus trat. Ich wusste ja, was geschehen war, ich vergaß es nicht. Ich wusste auch, dass es Folgen haben würde und dass keine Insel der Welt sicher wäre, aber ich spürte keine Angst und auch nicht die Aufregung, die mich durchströmte, wenn ich über den Zeitungsartikeln saß und versuchte, den Vorfall genau zu verstehen. Langsam ging ich über die Inselstraße hinunter zum Strand, der unter dem bleistiftfarbenen Himmel in einem schlickfarbenen Dunkelgrau dalag, dunkler als sonst, eine einzige glatte Fläche, noch Sand und schon Wasser zugleich. Ich suchte den Übergang, wie immer fand ich ihn nicht, und wie immer ging ich einfach weiter, nach Westen, nach Norden, es war egal, ich würde das Meer nicht verpassen, ich würde mich nicht verlaufen, und Angst hatte ich keine. Erst abends wieder, vor dem kleinen Fernseher in der Ferienwohnung, als ich den Menschen in ihrer verseuchten Landschaft dabei zusah, wie sie in zerstörten Häusern nach ihren Leuten suchten. Das nächste Atomkraftwerk ist nicht sehr weit von Amrum entfernt, dachte ich, die Gleichzeitigkeit von Unglück und Sommerfrische bleibt unbegreiflich.
Wenn ich über Amrum schreibe, worüber schreibe ich dann nicht?
Auf dem Kniepsand gehen, die Hand über die Augen legen, um in die Helligkeit hinter den Wolken zu schauen; nichts begreifen.
Da war die Hündin noch lange nicht geboren.
Wir werden die Reise machen, lass mich ein wenig planen, wie es gehen könnte.
Sie ist zu groß für einen Kofferraum und zu unverständig, um lange stillzuhalten, ich kann ihr nicht erklären, dass es sich lohnen wird, so wie es sich für mich lohnt, zwölf Stunden im Zug zu sitzen, Hamburg, Dagebüll, die Fähre, Föhr, Amrum. Sie kann das eine nicht gegen das andere aufwägen. Ich entscheide: Wir fahren zusammen. Es gibt sie, mich und irgendwo dort oben im Norden Amrum, und wenn wir drei zusammenkommen können, wäre das eine glückliche Fügung.
Sie hat vieles erlebt, wovon ich nichts weiß, Fußtritte, Bisse, Hunger. Dass Steine sie trafen, weil man sie aus dem Hinterhof jagte, dass ihr Körper auf Metall traf und dann auf dem Asphalt aufschlug, ich weiß nicht, was ihr in den Knochen steckt. Sie muss um ihr Futter gekämpft, in Papierkörben gewühlt, andere Hunde weggebissen haben. Vielleicht hat ihr manchmal jemand etwas hingeworfen, ein Stück altes Brot, ein Stück altes Fleisch. Einmal wagte sie sich in den Garten einer Villa, wo eine Familie grillte, der Duft nach Fleisch eine große Versuchung. Sie trieb sich hinter den Büschen herum, bis die Kinder sie sahen und nach den Eltern schrien, die scheuchten sie weg. Ihr Fell war verlaust, die Ohren verklebt. Abends lag sie hinter Containern, oder an den Parkplätzen, bei den anderen Streunern, großen stillen Tieren, Rücken an Rücken. Den Menschen wichen sie aus, nur wenn der Hunger zu groß wurde, lungerten sie vor Restaurants herum oder an den Raststätten, wo Touristen sie fotografierten. Die Kinder wollten sie vielleicht streicheln, aber das kannten sie nicht, und an guten Tagen waren sie ein Rudel und preschten bellend durch die Straßen.
Sie hat gelernt, Menschen nicht in die Augen zu schauen. Auch mich schaut sie nicht an. Sie weiß nichts von Fukushima und von Amrum. Von mir weiß sie manches nach einem Jahr, und die Angst kennt sie. Auf Amrum wird ihre Angst nicht verschwinden, für einen Streuner gibt es überall Grund genug, sich zu fürchten. Der Wind wird sie erschrecken, wenn er um die Strandkörbe fährt und an Schildern rüttelt, wenn er an der Fischbude eine Plastiktüte vor sich hertreibt; das Knacken der Äste in den Wäldern, das plötzliche Auffliegen der Vögel. Die Taxis am Hafen und der Lärm der anlegenden Fähre. Angst steckt im Körper, so wie meine Mutter bis zuletzt erschrak, wenn die Sirenen am Samstagmorgen um zehn Uhr zur Probe heulten, weil das Geheul ihr für immer in den Knochen steckte, wie man sagt, und auch mir in den Knochen steckt, weil sich meine Knochen erinnern an etwas, das ich nicht erlebt habe.
Wenn die Hündin schläft, atmet sie rasch, und ihre Pfoten bewegen sich manchmal, als wolle sie davonlaufen. Alle Hunde träumen, aber ihre Unruhe ist anders. Ihr linkes Ohr ist eingerissen, und an der Rute hat sie eine kahle Stelle. Wir werden zusammen unterwegs sein, und wenn die Angst sie überkommt, werde ich die Leine kurz nehmen und sie dicht neben mir führen. Vielleicht ist es zu früh für eine Reise? Wir müssen gut planen, wir brauchen Fahrkarten, Wasser und Futter, ich werde ihr eine Decke einpacken, damit sie sich hinlegen kann, wenn der Boden vibriert, und einen Maulkorb, weil das in den Vorschriften steht, und für mich den Laptop und die Regenhose, alles in einen Rucksack, damit ich die Hände frei habe für die Hündin, wenn wir über den Bahnsteig gehen und unser Abteil suchen, Nachtzug nach Hamburg, vielleicht werde ich schlafen können.