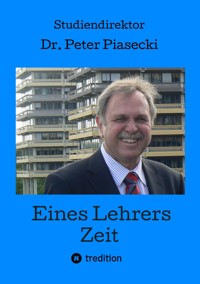
4,99 €
Mehr erfahren.
Eines Lehrers Zeit. Drei Wörter für ein Berufsleben. Dargestellt wird eine Aufzeichnung pädagogischen Tuns und Erlebens in der Schule, eine Sammlung von Erfahrungen mit dem deutschen Berufsschulsystem, eine Erinnerung an Erlebnisse und Unterrichtssituationen und die Teilhabe an wissenschaftlichen Diskussionen über gemeinsame, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekte mit der TU Dortmund. Es ist der subjektive Blick eines Lehrers und Studiendirektors über ein aktives Berufsleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Piasecki
EinesLehrers Zeit
© 2024 Dr. Peter Piasecki
ISBN Softcover: 978-3-347-99275-7
ISBN Hardcover: 978-3-347-99276-4
ISBN E-Book: 978-3-347-99277-1
Druck und Distribution im Auftrag:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist Dr. Peter Piasecki als Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Einleitung: Bildung und Erziehung, historische Aspekte
Kleine Geschichten aus dem Schuldienst
Lehrer erklärt Schülern in Wirtschaftskunde wie viel er verdient
Klassenfahrt in der Referendarzeit: Lehrerin kauft Eis für alle
Die Mütze von Sch. im Berufsvorbereitungsjahr
Eine Klassensprecherwahl, wie sie nicht sein sollte
Prüfung bei Feueralarm (!)
Dezernent zu Versetzungen
Dezernent als Dienstvorgesetzter
Religionsnote: „Gib allen eine 2“
Lehrplan Informatik Klasse 12, überladen
Publisher AG
„Pädagotchi“ prüft Arbeitszeit der Pauker
Wer viel Kopiert wird schnell befördert
Schüler aus letzter Metallklasse, stand immer 5, netter Junge, wollte Lehrer werden
Schülerin bei hohem Schnee verspätet, entschuldigt sich, Schule noch leer (Winter 2009/10)
Vortrag Humboldt-Universität. Lesetraining: Brief mit Dank
Berufliche Hierarchien bei den Schülerinnen Hauswirtschaft
Nachwuchs nach Preisgewinn „Schulen ans Netz“
Bogenschießen
Nach der Fahrt zur Rehacare in der Bahn: Schüler haben alle Sitzplätze eingenommen
Schule und Gesellschaft
DIE ZEIT begleitet die Bildungsdebatte
Lehrerfortbildung (CNC, CAD usw.)
Mitglied einer Arbeitsgruppe im Landesinstitut für Schule und Weiterbildung
Moderator für Lehrerfortbildung
Tätigkeiten in Prüfungsausschüssen der Kammern
Berufskollegs in NRW
Das Autismuskompetenzzentrum im CJD Dortmund
Verbandsarbeit im vlbs und vds
Schulabsentismus: Arbeitskreis bei der Bezirksregierung Arnsberg
Gastvorlesungen an der Uni Innsbruck und der TU Dortmund
Universität Innsbruck
Technische Universität Dortmund
„Autismus und Berufsbildung“
Kongresse und Publikationen
Unterrichtsentwürfe im Wandel
Impulse durch internationale Arbeit
Verbundprojekte mit der TU Dortmund
Beirat beim Bundesinstitut für Berufsbildung BiBB: Nachteilsausgleich
Die Inklusionsdebatte
Inklusionsschwimmen im SC Wiking Herne 1921 e.V.
Berufung zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für Zweite Staatsprüfungen
Hattie: Der Lehrer macht den Unterschied
Auszug ausgewählter Aufsatzpublikationen
PIASECKI, Peter (2011): Das BMBF-Projekt DoKoTrain (Dortmunder Kommunikationstraining) 2008 - 2011
Publikations- und Vortragsverzeichnis von Peter Piasecki
Pädagogik und Erziehungswissenschaft
Rezensionen Rehabilitationswissenschaften
Fachtagungen der Verbundpartner Dortmunder Kommunikationstraining
Kongressvorträge/Tagungsbeiträge
Auszeichnungen
Projektmessen
Gastvorlesungen
Publikationen Peter Piasecki: Wirtschafts- und Technikgeschichte, Salinengeschichte
Bücher
Herausgeber
Artikel
Rezensionen Wirtschafts- und Technikgeschichte
Kongressvorträge Wirtschafts- und Montangeschichte
Publikationen Peter Piasecki in der Pensionszeit: Sportgeschichte
Eines Lehrers Zeit
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kleine Geschichten aus dem Schuldienst
Publikations- und Vortragsverzeichnis von Peter Piasecki
Eines Lehrers Zeit
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
Vorwort
ERASMUS von Rotterdam (1469 - 1536), der über 100 Bildungsbücher schrieb und bereits früh erkannte: „Der Mensch wird nicht geboren, sondern gebildet“ (http://www.sigurdhebenstreit.de/texte/2/2/, Zugriff: 21.05.23)
Eines Lehrers Zeit. Drei Wörter für ein Berufsleben. Nachfolgend soll nicht eine Geschichte der Pädagogik der letzten rund vier Jahrzehnte geschrieben werden, es soll auch nicht die Biographie eines Lehrers entstehen. Nein - angedacht ist die Aufzeichnung pädagogischen Tuns und Erlebens in der Schule, die Sammlung der Erfahrungen mit dem Schulsystem, vor allem mit dem Berufsschulsystem, die Erinnerung an Erlebnisse in Unterrichtsituationen und die wahrgenommene wissenschaftliche und berufsverbandsbezogene Diskussion in Fachwissenschaft und Pädagogik. Es ist darüber hinaus auch ein Beitrag zur eigenen Teilhabe an der wissenschaftlichen Diskussion durch Publikationen und Vorträge auf nationalen und internationalen Tagungen und Kongressen auf drei Kontinenten in den Forschungsfeldern Wirtschafts- und Technikgeschichte sowie Erziehungswissenschaft im Kontext der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderungen. Es ist der subjektive Blickwinkel EINES Lehrers und Studiendirektors und es ist die Zeitspanne, die etwa die Jahre von 1970 bis 2018 in den Focus nimmt.
Die Anregung, einen Blick auf die Jahrzehnte des Arbeitslebens eines Lehrers und verantwortlichen in der Schulleitung zu werfen, hat ihren Ursprung darin genommen, dass der Autor häufig gegenüber anderen Lehrern zum Ausdruck gebracht hat, dass von den erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern sich Aussagen über die pädagogische Arbeit nur an ganz wenigen Stellen in der veröffentlichten Literatur finden. Hier geht ganz viel Erfahrung verloren. Pädagogische, wissenschaftliche Veröffentlichungen fußen zumeist – natürlich – auf den Arbeiten der im Hochschulsystem Beschäftigten und weniger auf den in Studienseminaren, in der Verwaltung der Bezirksregierungen, im Schulministerium oder im praktischen Schuldienst beschäftigten Beamten. Publikationen entstammen mithin einem Umfeld, in dem praktische Unterrichtserfahrungen eher die Ausnahme bilden. Hochschullehrer aus einer Erziehungswissenschaftlichen Fakultät sollten verstärkt auch immer wieder eigene Unterrichtserfahrungen in normalen Unterrichtssituationen in Schulklassen sammeln. Mein Vorschlag: Forschungssemester eines Hochschullehrers könnten zumindest partiell auch an Schulen absolviert werden.
Fand sich in den Diskussionen der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts die Frage nach möglicher Ausrichtung der Forschung (BREZINKA, 1975) oft im Zentrum der Hochschuldiskussionen wieder, so können wir heute einen Trend in die Richtungen qualitative und quantitative Forschungen ausmachen, wobei quantitative Untersuchungen nach der subjektiven Einschätzung des Autors ein höheres Gewicht haben, als man es gerne zugeben würde. Gleichwohl scheinen qualitative Untersuchungen zu dominieren. Organisierte man vor 40 Jahren den Unterricht nach Lern- und Feinlernzielen, so stehen heute kompetenzbasierte Konzeptionen für unterrichtliches Handeln im Fokus. Und immer war die neue Unterrichtskonzeption so viel besser als die alte.
Häufig wird im Folgenden nur die männliche Form Lehrer, Schüler usw. verwendet. Dies erfolgt immer dann, wenn im jeweiligen Kontext nicht beide Geschlechter angetroffen wurden. Z.B. gab es in meinen Metallklassen im jeweiligen Zeitkontext nur männliche Auszubildende, oder als Gegenbeispiel, in meiner Floristenklasse während der Referendarausbildung saßen ausschließlich weibliche Auszubildende.
Das Buch widme ich meinen Schülerinnen und Schülern, die mir die Sinnhaftigkeit meines Lehrerberufs vielfältig und oft unbewusst verdeutlicht haben. Gerne blicke ich heute auf ein erfülltes Lehrerleben zurück. Gleichwohl war nicht alles leicht.
Danken möchte ich auch nicht wenigen Weggefährten, die mir sozial verbunden waren und sind.
Mein ganz besonderer Dank aber gilt meiner Familie, mit deren Unterstützung ich mich umfänglich immer beruflich einbringen konnte.
Literatur
BREZINKA, Wolfgang (1975): Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft. Eine Einführung in die Metatheorie der Erziehungswissenschaft. 3. Auflage, Weinheim und Basel.
Einleitung: Bildung und Erziehung, historische Aspekte
PESTALOZZI (1746 – 1827) „Die Anschauung ist das Fundament der Erkenntnis“. zit. nach: http://www.heinrich-pestalozzi.de, Zugriff: 21.05.23)
Die Arbeit des Lehrers zielt auf die Bildung und Erziehung junger Menschen. Dies ist nicht so einfach, wie es klingt. Schon bei der Frage, was denn Bildung und was Erziehung ist, findet man vielfältige Antworten in der Literatur. Im Schulrecht besteht dagegen Klarheit: „Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung (SchG NRW, § 1). Auf die individuelle Förderung wird unten weiter einzugehen sein.
Die Begriffe Bildung und Erziehung gehören irgendwie immer zusammen. Gibt man sie im Internet ein, so erhält man ca. 2.050.000 Einträge. Der Lehrerverband VBE Bildung und Erziehung erscheint an erster Stelle, direkt gefolgt vom Internetlexikon WIKIPEDIA, der Zeitschrift „Bildung und Erziehung“ und dem Deutschen Bildungsserver. Was meint nun Bildung, was Erziehung?
Schauen wir heute auf die Homepage einer Erziehungswissenschaftlichen Fakultät, wie z.B. der Freien Universität Berlin, so findet sich folgende Information: „Die allgemeine Erziehungswissenschaft untersucht die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Erziehung und Bildung, d.h. sie beschäftigt sich mit allen Institutionen und Situationen, in denen Erziehung direkt oder indirekt vorkommt. Da Erziehung jedoch nicht nur in Schulen und der Familie stattfindet, beschäftigen sich eine Vielzahl von Institutionen mit Erziehung und Bildung, deren gestelltes Ziel ist es, handelnde Individuen zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Tun zu erziehen.“ (Erziehungswissenschaft: Bildung, Erziehung, Qualitätssicherung, FU Berlin).
Als Gegenposition ist dagegen Wolfgang BREZINKA, der in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts versucht hat, die Pädagogik auf die Füße einer Erziehungswissenschaft zu stellen, zu zitieren: „Bildung gehört heute zu jenen abgenutzten Worten, die von jedermann gebraucht werden und doch nur unklare und einander widersprechende Vorstellungen auslösen über das, was gemeint ist.“ (BREZINKA, 1988, S. 30)
Damit würden wir wieder auf Start gehen. Eine brauchbare Definition von Bildung findet sich in der ENZYKLOPÄDIE der Sonderpädagogik unter dem Stichwort Bildung: „Als einer der Grundbegriffe der Pädagogik und in enger Verbindung mit dem Begriff Erziehung bedeutet Bildung in Bezug auf den Lehrer: Übermittlung von Kenntnissen und Informationen, Unterricht (s. Didaktik); die Gesamtheit des übermittelten Wissensgutes; in Bezug auf den Schüler: Aufnahme des übermittelten Bildungsgutes insbesondere durch Lerntätigkeit sowie praktische Anwendung der Kenntnisse…“ (Enzyklopädie 1992, 95-96). Schaut man in dem gleichen Werk unter Erziehung nach, so findet man folgende Definition: „Die Gesamtheit bewußt gelenkter Handlungen der Gesellschaft mit dem Ziele, der jungen Generation Arbeits- und Lebenserfahrungen, Kenntnisse, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Werte als Ergebnisse der gesamten historischen Entwicklung zu übermitteln“ (ENZYKLOPÄDIE 1992, 187). Beide Begriffe sind mit diesen Definitionen damit in der Tat eng verknüpft. Das Wort Kenntnisse erscheint dabei wie ein Schlüsselbegriff in beiden Definitionen. Schauen wir hier ein wenig weiter zurück.
COMENIUS (lat. Johann Amos Comenius, 1592-1670) dessen Ziele in der Pädagogik umfassend waren, beabsichtigte, allen Menschen alles auf umfassende Weise zu lehren: "omnes omnia omnino" (LOHRMANN, 2019). Die Theologischphilosophische Grundlage seiner Pädagogik bildet dabei die These, dass das ganze Leben eine Schule sei. Ähnlich umfassend findet sich der viel zitierte Bildungsbegriff bei Wilhelm von HUMBOLDT: „Der wahre Zweck des Menschen … ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen“ (HUMBOLDT, W. v., Schriften, 1960, S. 64).
Auch für PESTALOZZI gilt ein umfassendes Ziel, welches darauf ausgerichtet ist, den Menschen als „sittlichen Menschen“ zu erziehen. „Dieser strebt nach dem Guten, trachtet nach der Liebe, ist verwurzelt in religiösem Glauben und stellt seinen Egoismus wo immer möglich zurück. Er fühlt sich innerlich frei, das Gute zu wollen, und ist darum ‚Werk seiner selbst‘“ (http://www.heinrich-pestalozzi.de, Zugriff: 21.05.23).
Aktuell werden die Begriffe Bildung und Erziehung als Schlüsselfaktoren gesehen, wie z.B. am „Institut Arbeit und Qualifikation“ (IAQ) der Universität Duisburg Essen, wo unter dem Titel „Bildung und Erziehung im Strukturwandel“ ausgeführt wird:
„Der Name der Abteilung ist Programm. Das Bildungs- und Erziehungssystem befindet sich in einem doppelten Strukturwandel. Extern ist es mit den Anforderungen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen konfrontiert - Beispiele dafür sind die steigenden Qualifikationsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt im Zuge der Globalisierung, der technischen Entwicklung und der steigenden Ansprüche an qualifizierte Dienstleistungen; die demographischen Herausforderungen mit dem wachsenden Anteil älterer Arbeitnehmer/innen einerseits und zurückgehenden Kinderzahlen andererseits sowie wachsende soziale und regionale Disparitäten im Hinblick auf das Qualifikationsniveau und die soziale Integration der Bevölkerung. Bildung und Erziehung werden immer stärker als Schlüsselfaktoren für die Bewältigung dieser Herausforderungen erkannt und sollen einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit, zum sozialen Zusammenhalt und zur Chancengleichheit sowie zur Bewältigung der demographisch bedingten Herausforderungen leisten“ (http://www.iaq.unidue.de/abteilung/best.php, Zugriff: 22.12.17).
Alle Begriffe zu Bildung und Erziehung spannen keinen Schirm für alle mit Bildung und Erziehung beauftragten oder befassten Menschen auf. Die Begriffe entziehen sich empirischer Wissenschaft, bilden gleichwohl Orientierung im Pädagogischen Tun.
Das persönliche Reflektieren ist in diesem Kontext unverzichtbar. Schlichter definiert, sieht der Autor selber Bildung als Vermittlung (Selbstvermittlung) von Wissen und Kompetenzen und Erziehung als Weg zur demokratisch geprägten Teilhabe und Verantwortung in der Gesellschaft an.
Abschließend finden sich zahlreiche, interessante und mit Lebensbezug geäußerte Meinungen zum Bildungsbegriff, wie sie in verschiedenen Ausgaben im Fragebogen der Zeitschrift „FORSCHUNG UND LEHRE“ (https://forschung-und-lehre.de) abgedruckt wurden:
„Äußerungen von Wissenschaftlern und Prominenten: Bildung ist…
Die aus Erfahrung und Wissenschaft erwachsende Anstrengung, aus der Individualität herauszutreten. (Paul Kirchhoff, Heidelberg, Jurist)
Informationen zu Wissen zu verdichten und dies dann in Zusammenhänge einordnen zu können. (Wolfgang Bergsdorf, Erfurt, Rektor)
Lebendiges Abenteuer - nicht das Abspulen toter Fakten. (Ranga Yogeshwar, WDR, Dipl.-Physiker)
Mit den Schätzen der Vergangenheit im Rucksack vorwärts schreiten. (Albrecht Beutelspacher, Gießen, Mathematiker)
Elexier der Freiheit - nämlich alles, was einem auf ideelle Weise hilft, sich aus materiellen Zwängen zu befreien und die so erworbene Freiheit zu genießen. (Kurt Reumann, FAZ, Redakteur)
Das Fundament für unser kulturelles Zusammenleben. (Erwin Staudt, IBM)
Fähigkeit zur Toleranz durch Einsicht. (Joachim Bublath, ZDF, Autor)
Das, was bleibt, wenn man alles vergessen hat. (Julian Nida-Rümelin, Philosoph)
Das höchste Gut, das die Gesellschaft hat (Kerstin Thurow, Rostock, Laborautomation)
Die Basis für Nachdenklichkeit. (Jens Peter Meincke, Köln, Rektor)
Der Weg zu intellektueller Bescheidenheit und humaner Existenz. (Bernd Rüthers, Konstanz, Jurist)
Lebenstüchtig werden durch erkennen und handeln lernen. (Norbert Walter, Deutsche Bank, Volkswirt)
Andere Antworten zu kennen als die, die gerade en vogue sind. (Arnd Morkel, Trier, Politik-wissenschaftler)
Bildung ist, was den Menschen zu Individualität und Kreativität, zu Freiheit und Verantwortung befähigt. (Thomas Oppermann, Hannover, Jurist, z.Z. MWK Niedersachsen)
Wissen, Charakter, Geschmack. (Gerhard Vollmer, Braunschweig, Philosoph)
Unablässiges Streben nach geistigen Horizonten. (Wolfgang A. Herrmann, München, Chemiker)
Der Versuch, Barbaren zu zivilisieren. Meistens schafft sie nur gebildete Barbaren. (Michael Wolffsohn, München, Historiker)
Der Luxus, zitatenreich darüber nachzudenken, was Bildung ist. (Detlef Müller-Böing, Gütersloh, Centrum für Hochschulentwicklung)
Meistens Selbsttäuschung. (Peter Eschberg, Frankfurt, Intendant des Schauspiels)
Gebildet ist ein Mensch, der sich für mehr interessiert als das, was in BILD, EXPRESS und vergleichbaren Boulevardblättern steht. (Heinz Dürr, Dr. Ing., Vorstandsvorsitzender Stiftung Lesen)
Die Kraft, das Fernsehen abzuschalten. (Winfried Schulze, München, Historiker, Vorsitzender des Wissenschaftsrates)
Das Menschsein am Menschen. (Joachim Sartorius, Generalsekretär des Goethe-Instituts)
Das, was ich erreichen möchte. (Christine Hohmann-Dennhardt, Juristin und Wissenschaftsministerin in Hessen)
Das Gegenteil von Einseitigkeit, also Offenheit gegenüber allen sinnvollen Leistungen, auch auf solchen Gebieten, die einem fernstehen. (Alfred Fettweis, Bochum, Nachrichtentechniker)
Literatur
BREZINKA, Wolfgang (1975): Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft. Eine Einführung in die Metatheorie der Erziehungswissenschaft. 3. Auflage, Weinheim und Basel.
BREZINKA, Wolfgang (1988): Erziehung, Kunst des Möglichen. Beiträge zur Praktischen Pädagogik. 3. Aufl. München.
ENZYKLOPÄDIE der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik und ihrer Nachbargebiete (1992). Hrsg. von Gregor DUPIUS und Winfried KERKHOFF, Berlin.
Erziehungswissenschaft: Bildung, Erziehung, Qualitätssicherung, FU Berlin, (www.fu-Berlin.de/studium/studienangebot/grundstaendige/erziehungswissenschaft. Zugriff: 15.09.2011).
Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg Essen. (http://www.iaq.unidue.de/abteilung/best.php, Zugriff: 23.09.2011).
http://www.heinrich-pestalozzi.de/de/dokumentation/grundgedanken/erziehung_bildung/index.htm (Zugriff: 05.10.2011).
https://forschung-und-lehre.de (verschiedene Zugriffsdaten)
HUMBOLDT, Wilhelm von (1960): Schriften zur Anthropologie und Geschichte. Hrsg. von Andreas FLITNER und Klaus GIEL mit einem Anhang: Bildung und Biographie (https://www.tu-braunschweig.de/hispaed/personal/emeriti/hretter/skripte, Zugriff: 05.10.2011).
LOHRMANN, Julia: Deutschunterricht: Johan Amos Comenius (https://www.planetwissen.de/gesellschaft/lernen/deutschunterricht/pwiejohanamoscomenius100.html, Zugriff: 12.11.2019).
SCHULGESETZ für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April 2011.
Pädagogik in der nachachtundsechziger Zeit: Robinsohn, Roth und Brezinka
Karl JASPERS: „Es ist das Schicksal eines Volkes, welche Lehrer es hervorbringt und wie es seine Lehrer achtet.“ (1883 – 1969) (https://1000-zitate.de/autor/Karl+Jaspers/, Zugriff: 21.05.23)
Der Umfang der Erziehungswissenschaften im Rahmen eines Studiums für das Lehramt an berufsbildenden Schulen (Laufbahn der Studienräte) betrug Anfang der 70er Jahre 20 Semesterwochenstunden. Das war nicht üppig. Aber es galt die Dominanz der zwei zu studierenden Unterrichtsfächer, die mit 80 bzw. 60 Semesterwochenstunden für das zweite Fach angemessen ausgestattet waren. Was blieb aus den Fragmenten des Pädagogikstudiums haften? Drei Namen zunächst, die die Debatte jener Zeit maßgeblich mitbestimmt oder ausgelöst hatten. So fragte H. ROTH 1968: „Stimmen die deutschen Lehrpläne noch?“ So brachte ROBINSOHN, der den Autor am meisten berührte, dass damals eher verspottete Wort vom „Curriculum“ anstelle von „Lehrplan“ in die Debatte ein (1967), und BREZINKA mühte sich, die Pädagogik zur Erziehungswissenschaft im Kontext des „Kritischen Rationalismus“ von POPPER zu entwickeln (1975). Schließlich ist an Jakob MUTH, den genialen und praktisch begabten Hochschullehrer und Karlwilhelm STRATMANN, den legendären Berufspädagogen, zu denken, die beide an der Ruhr-Universität Bochum lehrten, als der Autor dort studierte. Hier konnte man etwas für sein Berufsleben lernen.
Die im politisierten Raum geführten erregten Debatten der späten 60er Jahre fanden ihr Forum nicht nur in Demonstrationen und soziologischen Zirkeln wieder, sondern fanden ihren Niederschlag ebenso handfest in den Publikationen der Hochschulpädagogen jener Wendezeit. Ausgangspunkte dieser Debatte bilden ROTH und ROBINSOHN. ROBINSOHN, der 1933 Deutschland verließ und an der Hebräischen Universität Jerusalem studierte, war dann ab 1963 Direktor des UNESCO-Instituts für Pädagogik in Hamburg. Sein grundlegendes Werk erschien 1967 im Luchterhand Verlag unter dem Titel „Bildungsreform als Revision des Curriculums“. Sein umfassender Anspruch fußte dabei auf dem Satz von Seneca: „Non scolae vitae discimus“ (nicht für die Schule, fürs Leben lernen wir) (GEUTING, S. 1) und zielte auf die zentrale Aufgabe von Schule, Schülerinnen und Schüler zur Bewältigung von Lebenssituationen zu befähigen. Hierauf fußt sein bestechend klarer Bildungsbegriff: “Bildung als Vorgang, in subjektiver Bedeutung, ist Ausstattung zum Verhalten in der Welt“ (ROBINSOHN 1967, S. 13).
Der Ausgangspunkt seiner Argumentation ist sicher darin zu sehen, dass er die Entscheidung über die Inhalte als konstituierend im Erziehungsprozess ansah, aber gleichwohl feststellen musste, genau an diesem Punkt, nämlich an der begründeten und verantwortbaren Wahl der Curriculuminhalte gab es große Defizite (ebenda, S. 44). In diesem Prozess der Curriculumbildung forderte er jetzt eine intersubjektive Überprüfbarkeit und formulierte die Aufgaben der Curriculumforschung:
„Wir gehen also von den Annahmen aus, daß in der Erziehung Ausstattung zur Bewältigung von Lebenssituationen geleistet wird; daß diese Ausstattung geschieht, indem gewisse Qualifikationen und eine gewisse ‚Disponibilität‘ durch die Aneignung von Kenntnissen, Einsichten, Haltungen und Fertigkeiten erworben werden; und daß eben die Curricula und – im engeren Sinne – ausgewählte Bildungsinhalte zur Vermittlung derartiger Qualifikationen bestimmt sind. Damit ergibt sich für die Curriculumforschung die Aufgabe,
Methoden zu finden und anzuwenden, durch welche diese Situationen und die in ihnen geforderten Funktionen, die zu deren Bewältigung notwendigen Qualifikationen und die Bildungsinhalte und Gegenstände, durch welche diese Qualifizierung bewirkt werden soll, in optimaler Objektivierung identifiziert werden können“ (ROBINSOHN 1967, S. 45).
Ein grandioser Ansatz, der alle Elemente enthielt, die auch heute noch in der Bildungsplanung eine Rolle spielen – ohne dass man sich dabei auf Robinsohn bezieht. In zeitlichem Kontext zu ROBINSOHN ist hier auch Heinrich ROTH zu sehen, der 1969 fragte: „Stimmen die deutschen Lehrpläne noch?“ und damit ebenso wie MEYER (1977) und ROBINSOHN die Bildungsdebatte zur Curriculumentwicklung beflügelte. Wie aber sahen um 1970 die Lehrpläne aus? Dieses später. Zunächst: Wer kann die Relevanz und Adäquanz von Bildungsgegenständen festlegen? ROBINSOHN stellt hierzu fest: Fachwissenschaftler, Repräsentanten der Verwendungsbereiche und Vertreter der anthropologischen Wissenschaften, zu denen er auch die Erziehungswissenschaft zählt (1967, S. 49). Was wird hier vergessen? Der Einfluss der Politik. Einer meiner Hochschullehrer an der Ruhr-Universität Bochum formulierte immer: Die Pädagogik ist eine politische Wissenschaft. Meint: Politiker entscheiden (länderspezifisch) was in der Schule passiert.
Rahmenlehrpläne und Ausbildungsordnungen
Nach dem innovativen Blick auf die von ROBINSOHN intendierte neue Curriculumentwicklung setzen wir hier noch einen Blick auf die Lehrplanentwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1964, also auf die vorachtundsechziger Zeit. Die hier genutzten und ausgewählten Lehrpläne für gewerblich-technische Berufsschulen (metallgewerbliche Berufe), wurden 1965 publiziert und fassten die Diskussion der Nachkriegsjahre zusammen. Sie hatten Gültigkeit während der Zeit meiner Referendarausbildung.
Für den Beruf Stahlbauschlosser wurden beispielhaft unten zwei Seiten ausgewählt. Sie zeigen für die Mittelstufe der dreijährigen Ausbildung die nach Unterrichtseinheiten gegliederten Themen für die Fächer Fachkunde, Fachrechnen, Fachzeichnen und Naturkundliche Grundlagen. Im Anhang finden sich dann in der Anlage I/70 weitergehende Hinweise auf den Unterrichtsstoff.
In der Unterrichtseinheit 16 der Mittelstufe für Stahlbauschlosser wurde für das Fach Fachkunde das Thema „Arbeitsverfahren der Spanlosen Formung: Gießen“ kurz benannt. In der zugehörigen Anlage wird dann - wie in der Abbildung aus Heft 16 deutlich wird – der zugehörige Unterrichtsstoff beschrieben. Zur Unterrichtseinheit 16 in Fachkunde wurde festgelegt: „Gießwerkstoffe, Einformen von Hand und mit der Maschine, Gießvorgang, Gießfehler“ (LEHRPLÄNE, Heft 16, S. 58f und 181).
Der Status der Lehrplankonstrukte aus den 1960er Jahren spiegelt deutlich das Bild einer eher summarischen Inhaltsaufzählung. Gleichzeitig galt, dass „Maßgebend für die Auswahl der Stoffgebiete die Anforderungen in den Abschlußprüfungen sind“ (LEHRPLÄNE, Heft 16, S. 110).
Tab.: Ausschnitt aus dem LEHRPLAN Heft 16 (Schule in Nordrhein-Westfalen) LEHRPLÄNE für gewerblich-technische Berufsschule, aus dem Jahre 1965, S. 58-59
Tab.: Ausschnitt aus dem LEHRPLAN Heft 16 (Schule in Nordrhein-Westfalen) LEHRPLÄNE für gewerblich-technische Berufsschule, aus dem Jahre 1965 mit differenziertem Stoffverteilungsplan zur Unterrichtseinheit 16 (S. 181).
Studienbedingungen in den 1970er Jahren
Ich blicke gerne auf meine Studienzeit in den 70er Jahren an der Ruhr-Universität Bochum zurück. Eingeschrieben für die Fächer Geschichtswissenschaften, Schwerpunkt Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte, Politikwissenschaften und Erziehungswissenschaften. Der Umfang der Wochenstunden war für das ganze Studium vorgegeben und konnte frei über die erforderlich scheinenden Semester verteilt werden. Das Fach Maschinenbau wurde mir im Rahmen der angestrebten „Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen“ durch meinen Studienabschluss an der Fachhochschule Bochum anerkannt. Das Zweite Fach und Erziehungswissenschaften, einschließlich der kompletten Ersten Staatsprüfung, mussten absolviert werden. Es war ein freies Studium, das ich sehr geliebt habe. Aus einer großen Angebotsfülle von Vorlesungen, Seminaren und Hauptseminaren konnte damals ausgewählt werden. Einige Beispiele sollen hier aufgeführt werden, weil sie auch die aktuelle geisteswissenschaftliche Situation in der unmittelbaren 68er Nachfolgeära widerspiegeln. Zu beachten ist auch, dass auf diesen Studiengang aufbauend mit der Zweiten Staatsprüfung eine Fakulta zu „Geschichte – Politik – Recht“ verliehen wurde.
Einige von mir belegte Veranstaltungen zur Geschichtswissenschaft:
„Die Entwicklung der Technologie (Weber)“
„Die Großmächte und Vorderasien im 19. und 20. Jahrhundert (Haussig)“
„Geschichte der Weimarer Republik (Bahne)“
„Weltrevolution und Koexistenz 1818 – 1920 (Fröhlich)“
„Probleme der Außenwanderung (von Nell)“
„Die industrielle Entwicklung des Ruhrgebiets (Weber)“
„Aufklärungs- und Verfassungsfragen im östlichen Europa (Roos)“
Politologie/Soziologie/Erziehungswissenschaften:
„Einführung in die Politische Wissenschaft (Weber)“
„Einführung in die Jugendsoziologie (Werner)“
„Leistungsdifferenzierung in der BRD – England – Schweden (Willke)“
„Berufsausbildung und sozialer Wandel (Stratmann)“
„Methoden und Theorien der Erwachsenenbildung (Knoll)“
„Erziehung und Geschlechterrolle (Stoffer)“
„Didaktische Probleme an Berufsbildenden Schulen (Jung)“
„Technik und Gesellschaft (Papalekas)“
„Soziologie des Konfliktes (Papalekas)“
An der Ruhr-Universität Bochum habe ich viele großartige Hochschullehrer in Seminaren, Prüfungen und Gesprächen kennen gelernt. Erinnern möchte ich gerne an die Professoren Weber (mein späterer Doktorvater, mit dem ich heute noch in Kontakt stehe), Roos, bei dem ich meine Zwischenprüfung abgelegt habe, Timm, Betreuer der Hausarbeit bei der Ersten Staatsprüfung und leider früh verstorben, Stratmann, der legendäre Berufspädagoge, der ein besonderes Ohr für Studierende mit abgeschlossener Berufsausbildung hatte, oder die Pädagogen Muth und Willke.
Erste Erfahrungen im Unterricht während der Studienzeit an der Fachoberschule in Abendform
"Es ist die wichtigste Kunst des Lehrers, die Freude am Schaffen und am Erkennen zu erwecken." Carl SEELIG (Hrsg.), Albert Einstein - Mein Weltbild, Ullstein Verlag, Berlin, 2005, S. 29
Meine ersten Erfahrungen im Unterricht konnte ich in der Fachoberschule Technik, Klasse 12, sammeln. Diese Schulform wurde in Herne auch in Abendform geführt und hier konnten Schülerinnen und Schüler mit dem mittleren Bildungsabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung in vier Semestern in zwei Jahren die Fachoberschulreife erwerben, die zum Besuch der damals aus den alten Ingenieurschulen heraus entwickelten Fachhochschulen berechtigte. Bedingt durch meinen Abschluss an der Fachhochschule Bochum konnte ich nebenberuflich als Lehrender in der Fachoberschule unterrichten. Meine hier erteilten Fächer waren Mathematik und Technologie.
Weil der Unterricht zu ungünstigen Zeiten für hauptamtliche Lehrer erteilt werden musste, hatten Nebenberufler durchaus eine Chance, erste Erfahrungen in der echten Unterrichtspraxis zu erwerben. Alle, die dort nebenberuflich unterrichteten, studierten nach einem ersten Studienabschluss an einer FH an Universitäten in einem Lehramtsstudiengang. Gleichwohl wurde diese Gruppe zusätzlich auf die Aufgaben in der Berufsschule in Herne vorbereitet. Dieses übernahm ein Lehrer, den ich bereits in der Zeit meines eigenen Besuchs der Abendschule positiv erlebt habe und der uns als Meister der Magie mit diversen Zaubertricks nach langen Arbeitstagen in der Abendschule aufgemuntert hat. Von ihm habe ich viel gelernt, ebenso wie von dem damaligen Leiter der Abendschule, mit dem ich über Jahrzehnte freundschaftlich verbunden war.
In unserer Gruppe haben wir viel erfahren, was in und um den Unterricht in der Klassenpraxis wichtig war. So etwa habe ich das von ihm vorgestellte System für die Bewertung von Klassenarbeiten bis zu meiner Pension selber beibehalten, weil es vor allem für technische und naturwissenschaftliche Fächer wirklich gut geeignet war. Alles das, was ich hier benenne, habe ich in meiner Referendarzeit nicht gehört, es war kein Thema, kann hier aber nur knapp angesprochen werden und ist für heute akzeptierte Unterrichtsmethoden eher nicht mehr relevant. So diskutierten wir die Frage, was zu tun ist, wenn Unruhe in der Klasse aufkommt. Klare Lösung: keine Sätze wie: „Jetzt seid doch bitte einmal ruhig!“ Oder: „Jetzt muss aber Ruhe sein.“ So etwas hilft nicht in einer Berufsschulklasse. Sein Vorschlag: Genau schauen, wer im Zentrum der Störung in der Klasse steht. Diesen einen Schüler deutlich ansprechen und klare, aber auch wirklich umsetzbare Maßnahmen androhen. Alternative: Alles in der Klasse laufen lassen (soll heute durchaus vorkommen!).
Ein anderes Beispiel: In einer Klasse mit Schülerinnen sollte man als Lehrer immer darauf achten, nicht mit einer Schülerin am Ende der Stunde alleine in einer Klasse zu bleiben. Also: Gegen Ende der Stunde bereits dafür sorgen, dass man seine eigenen Sachen rechtzeitig eingepackt hat und so mit dem Pulk der Schülerinnen aus der Klasse gehen kann. Ein mögliches Gespräch könnte dann auch auf dem Flur geführt werden. Fragen dieser Art haben meine Fachleiter im Referendariat nicht angesprochen.
Referendariat in den späten 70er Jahren
"Der echte Schüler lernt aus dem Bekannten das Unbekannte entwickeln und nähert sich dem Meister." Johann Wolfgang von Goethe, Werke, dtv Verlag, München, 1982, Hamburger Ausgabe, Band 12, Maximen und Reflexionen Nr. 1233, S. 531
Das Referendariat des Autors erstreckte sich über die Zeitspanne von August 1977 bis April 1979. Es fand statt am Studienseminar für Berufsbildende Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen in Gelsenkirchen und es brachte einen intensiv empfundenen Einschnitt in mein Leben. Die Studienzeit habe ich als sehr frei empfunden, ohne die möglichen „Freiheiten“ wirklich auszuschöpfen. Dies änderte sich jetzt. Dabei hatte ich noch Glück: einer meiner beiden Fachleiter (Ausbildungslehrer und Schulleiter der Ausbildungsschulen spielten zu dieser Zeit im Referendariat im Kontext der Einflussnahme von Bewertungen noch keine Rolle) war kompetent und geradlinig (er wurde später Schulleiter und Berufspolitiker), der andere hingegen spielte liebend gerne den kleinen König aus einer absolutistischen Schulära. Noch heute sage ich deshalb: „Ich mochte alle Zeiten meines Studiums und meiner Tätigkeit im Schuldienst, weniger gerne denke ich an mein Referendariat zurück.“
Bedingt durch meine Fächer Metalltechnik und Geschichte – Politik – Recht, wurde ich einerseits der Metallberufsschule Gelsenkirchen und andererseits der auf dem gleichen Gelände angesiedelten Berufsschule für Nahrung und Bekleidung zugewiesen. In der zweiten Ausbildungsschule kam ich gleich in eine Floristenunterstufe (1. Ausbildungsjahr), weil die Fachlehrerin für Floristik längerfristig ausgefallen war. Sechs Stunden pro Woche sollte ich an dieser Schule ableisten, die jetzt alle auf einen Tag in diese eine Klasse gelegt wurden. Natürlich war ich in den sechs Stunden alleine in dieser Klasse. Der Schulleiter ermunterte mich gleich und schlug vor, dass ich neben Politik auch Wirtschaftslehre mit viel berufsbezogenem Schriftverkehr unterrichten möge, um gut über den Tag zu kommen. Für Wirtschaftslehre habe ich keine Faculta angestrebt, fühlte mich durch das Studium der Wirtschaftsgeschichte aber ausreichend vorgebildet. In der Klasse war das Unterrichten durchaus angenehm, weil Floristenklassen damals schon als „pflegeleichte Klassen“ angesehen wurden. Nach zwei Monaten, auf dem ersten Elternsprechtag, wunderten sich die damals noch für eine Berufsschule recht zahlreich erschienenen Eltern doch darüber, dass ein neuer Referendar vom ersten Tag an die Klasse leitete, obwohl er keine Ahnung von Floristik zu haben schien (wie sollten es die Eltern auch anders sehen). Durch diese Anregungen sah sich der Schulleiter jedoch bemüßigt, wenigstens weitere Lehrkräfte in die Klasse einzubinden. Ich selber jedoch habe die motivierte Klasse in Politik bis zum Zweiten Staatsexamen unterrichtet und dort auch meinen Unterricht im Rahmen der Prüfung abgehalten. Insgesamt hat uns dieser Start in der Klasse gut zusammengeschweißt. Die eigentlich für den Berufsstart vorgesehene Hospitation – oder wie sie heute eher genannt wird: strukturierte Hospitation – habe ich im Fach Politik jedenfalls nie kennen gelernt.
Ein anderes Ereignis ist mir ebenfalls noch in guter Erinnerung. Damals galt in Berufsschulen folgender Satz: „Ein Berufsschullehrer kann alle Fächer unterrichten, wenn er nur 24 Stunden vorher Bescheid weiß.“ Diese Zeit ließ sich auch verkürzen. In einer Pause sprach mich der Schulleiter in der Berufsschule für Nahrung und Bekleidung an, ich möge nach der Pause in seine Klasse gehen und dort bei den Raumausstattern Unterricht (nicht Aufsicht!) übernehmen und das Thema Berechnung von Ovalen durchnehmen. Ein Smartphone gab es 1977 noch nicht und in meiner Schultasche war alles für den Floristenunterricht eingepackt. So habe ich dann die Unterrichtsstunde aufgeteilt in das konstruieren eines Ovals als Zeichnung und in eine vereinfachte Berechnung, die ich aus frühen Schulzeiten noch im Hinterkopf hatte. Es ging irgendwie dann doch besser als ich gedacht habe. Das hat mir auch der Schulleiter später bestätigt, der natürlich seine Schüler befragt hat. So wurde die Kontrolle durchgeführt, heute würde man „evaluiert“ sagen.
Insgesamt war die Referendarausbildung in meiner Ausbildungszeit doch sehr arbeitsintensiv – auch heute wird es sicherlich so empfunden. Allein die sogenannte Schriftliche Hausarbeit – für die man großzügig für 2 Wochen vom Unterricht freigestellt wurde – hatte damals einen Umfang von durchschnittlich über 100 Seiten (ohne Anhänge, wo oft die Ergebnisse der Schülerarbeiten dokumentiert wurden) – eigentlich ausreichend Arbeit für mindestens drei Monate. Sehr glücklich war ich damals, als ich die Ergebnisse der Hausarbeit in der Zeitschrift „Die alte Stadt - Vierteljahreszeitschrift für Stadtsoziologie, Stadtgeschichte, Denkmalpflege und Stadtentwicklung“ veröffentlichen konnte. Es war meine erste wissenschaftliche Publikation.
Auch die Unterrichtsentwürfe gehörten nicht zur Kategorie „Kurzfassung“. Heute hat man die schriftliche Hausarbeit im Vorbereitungsdienst für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in NRW abgeschafft. Abgeschlossen wurde meine Referendarausbildung 1979 noch mit der Zweiten Staatsprüfung und der Verleihung des Titels: Assessor d.L.a.b.S. Dieser Titel wird heute bei bestandener „Staatsprüfung“ nicht mehr verliehen. (Vgl.: ORDNUNG des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen –OVP vom 10. April 2011, GV. NRW. S. 218). Ernüchternd war die Übergabe der Assessor-Urkunde: Man ging ins Sekretariat des Studienseminars und holte gegen Unterschrift bei der Sekretärin das Dokument ab. Das war‘s. So ist es zwei Jahre vorher bereits mit der Übergabe des Zeugnisses über die Erste Staatsprüfung an der Ruhr-Universität Bochum gelaufen. Hier enthielt mein Originalzeugnis zwar einen mit der Schreibmaschine übertippten Fehler, der aber den Unterzeichner, den Leitenden Regierungsschuldirektor, nicht gestört hatte und wo meine Einwendungen abgetan wurden, dass man doch alles lesen könne. Nun ja, das Zeugnis hat mir in diesem Zustand nicht geschadet.
Kleiner Exkurs: Film über Störer im Unterricht, alle im Anzug, Friktionen im Unterricht
Schon in den 70er Jahren war das Unterrichten in der Berufsschule in verschiedenen Ausbildungsklassen und Schulformen unterschiedlich fordernd. Im Herzen des Ruhrgebiets, in Gelsenkirchen wiederum, waren die Klassensituationen auch bei gleichen Berufsschulklassen nicht vergleichbar. Zu den schwierigen Klassen gehörten etwa damals Jungarbeiterklassen oder auch Berufsschulklassen, z.B. für die Schlosserberufe, insbesondere wenn sie mit bis zu 33 Auszubildenden gut gefüllt waren. In anderen Klassen, wie etwa bei Technischen Zeichnern, wo ich in der Metallberufsschule einem kompetenten Studiendirektor zugewiesen war, lagen die Anforderungen vor allem im fachlichen Bereich.
Als Studienreferendare – unser Seminar umfasste etwa 180 angehende Studienräte- war unsere Woche so getaktet, dass wir montags und dienstags Seminar- bzw. Fachseminare besuchten und an den übrigen drei Tagen 12 Stunden im Unterricht in Schulen eingesetzt waren. Im Seminar wurde immer wieder der Wunsch geäußert, das Thema „Unterricht in schwierigen Klassen“ zu behandeln. Schließlich gab die Seminarleitung dem nach und kündigte einen Film zum Thema „Friktionen im Unterricht“ an. Wir waren alle sehr gespannt, was kommen würde. Der Film, gezeigt im Hauptseminar vor allen Referendaren, offenbarte dann die Unterrichtssituation in einer Jungarbeiterklasse in den 50er Jahren. Alle im Film gezeigten Berufsschüler, die als sogenannte ungelernte Arbeiter noch berufsschulpflichtig waren, kamen einen Tag in der Woche in die Berufsschule und waren dann vier Tage im Betrieb. Alle trugen hier Anzüge und Krawatten(!). Was passierte dann im Film? Während der Lehrer vorne unterrichtete, begannen hinten im Klassenraum drei der Schüler unter dem Tisch – ganz leise, ohne zu sprechen – Karten zu spielen. Hiervon bemerkte der Lehrer zunächst nichts und unterrichtete weiter frontal seine Klasse, in der es im Übrigen ganz leise und geordnet zuging. Als der Lehrer die Kartenspieler schließlich doch bemerkte, erfolgten Ermahnungen, die zwar wiederholt werden mussten, jedoch fand alles in einer insgesamt eher freundlichen Atmosphäre statt.
Soviel zum Thema Friktionen im Unterricht. Nach meiner Erinnerung wurde das Thema nicht vertiefend behandelt. Der Film sollte schließlich für sich sprechen.
Frederic Fester





























