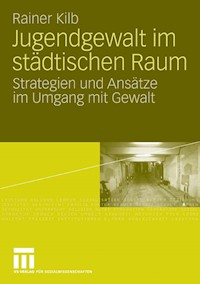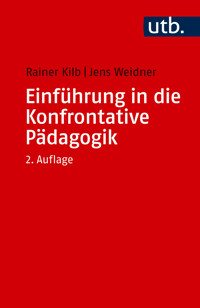
35,99 €
Mehr erfahren.
Wie können gewalttätige Kinder und Jugendliche mit Ihren Taten konfrontiert werden? Und wie lässt sich eine Beschäftigung mit den Opfern einfordern? Die Konfrontative Pädagogik findet Antworten auf diese Fragen. Sie ist als sozialpädagogischer Handlungsansatz mittlerweile fest etabliert und hat sich im Umgang mit gewalttätigen Kindern und Jugendlichen als äußerst wirksam erwiesen. Im Mittelpunkt stehen dabei spezifische Gesprächstechniken und verschiedene Formen von Anti-Aggressivitäts- bzw. Coolness-Trainings sowie das Konfrontative Sozialtraining. Das Lehrbuch stellt die wichtigsten methodischen Ansätze einer Konfrontativen Pädagogik dar und verortet sie im Spektrum aktueller Konflikt- und Gewalttheorien. Mit vielen Fallbeispielen wird anschaulich beschrieben, in welchen Feldern der Sozialen Arbeit die Konfrontative Pädagogik zum Einsatz kommen kann und in welchem Bereich welche Handlungsbausteine und Techniken anwendbar sind. Eine kompakte Einführung von den führenden Vertretern zum Thema, die didaktisch aufbereitet ist und durch Reflexionsfragen zu jedem Kapitel den Lernerfolg sichert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
utb 3868
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen Psychiatrie Verlag · Köln
Psychosozial-Verlag · Gießen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Rainer Kilb / Jens Weidner
Einführung in die Konfrontative Pädagogik
2., überarbeitete Auflage
Mit 5 Abbildungen, 4 Tabellen und 6 Übersichten
Mit einem Beitrag von Horst Schawohl
Ernst Reinhardt Verlag München
Prof. Dr. em. Rainer Kilb, Dipl.-Pädagoge, lehrt Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit an der HAW Mannheim.
Prof. Dr. Jens Weidner, Dipl.-Sozialpädagoge, lehrt Erziehungswissenschaften und Kriminologie an der TH Hamburg und ist Gründer des Deutschen Instituts für Konfrontative Pädagogik.
Hinweis
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
UTB-Band-Nr.: 3868
ISBN 978-3-8252-6434-5 (Print)
ISBN 978-3-8385-6434-0 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-8463-6434-5 (EPUB)
© 2025 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v. § 44b UrhG einschließlich Einspeisung / Nutzung in KI-Systemen ausdrücklich vor.
Dieses Werk kann Hinweise / Links zu externen Websites Dritter enthalten, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich entfernt.
Printed in EU
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung, Stuttgart
Satz: Sabine Ufer, Leipzig
Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Einleitung
1 Aktuelle Ausgangssituation
2 Multidisziplinäre fachliche Grundlagen zur Erklärung und zur Systematisierung des Gewaltphänomens
2.1 Formen und Motive von Gewalt
2.2 Klassische theoretische Befunde zur Entstehung von Gewalt
2.2.1 Psychologische Erklärungsmodelle von Gewalt
2.2.2 Soziologische und kriminologische Erklärungsmodelle
2.2.3 Sozialisationstheoretische Erklärungsmodelle
2.2.4 Entwicklungspsychologische Besonderheiten in der Adoleszenz
2.3 Empirische Ausgangsbasis und diversitätsorientierte Aspekte der Gewalt
2.3.1 Geschlechtsspezifische Aspekte der Gewalt
2.3.2 Ethnisch-kulturspezifische Aspekte
2.4 Interdisziplinarität in Erklärungs- und Handlungstheorien und ihre Folgen für konzeptionelles Arbeiten
3 Entstehungszusammenhänge von Gewalttaten
3.1 Hedonisch-emotive Erfahrungen während der Tatausführung
3.2 Handlungsentscheidung und subjektiver Abwägungs- und Entscheidungsprozess
3.3 Auslöser und Anlässe
3.4 Gelegenheiten
3.5 Begleitumstände und Beschleuniger
3.6 Handlungsmuster und ihre Motive
3.7 Primäre sozialisatorische Vermittler
3.8 Synoptische Betrachtung: Biografische Verlaufsketten und die Erfahrung des Tatrausches
3.8.1 Ohnmacht, Missachtung und Demütigungen
3.8.2 Negatives Selbstkonzept, „epiphanische Erfahrungen“ und der Wunsch nach eigener Handlungsmacht
3.8.3 Vulnerabilität, Übertragungen und berauschende Erfahrungen
3.9 Angenommene Ausgangssituation bei gewalttätigen Jugendlichen
4 Konfrontierende pädagogische Ansätze und ihre Rahmenbedingungen
4.1 Theoretische Implikationen
4.1.1 Lerntheoretisches Paradigma und Konfrontierende Pädagogik
4.1.2 Psychoanalytische Aspekte und Konfrontierende Pädagogik
4.1.3 Konfrontative Ansätze als adäquate sozialpädagogische Reaktion auf die angenommenen Ausgangssituationen gewalttätiger Jugendlicher
4.2 Alters-, entwicklungsbezogene, kultur- und geschlechtsspezifische Besonderheiten der Zielgruppen
4.3 Konfrontierende Herangehensweisen, Programme und Curricula
4.3.1 Konfrontationen als ritualisierte Folge von Handlungsschritten und im Rahmen der Gesprächsführung
4.3.2 Anti-Aggressivitäts-Training (AAT)
4.3.3 Coolness-Training (CT)
4.3.4 Individuelles Anti-Aggressivitäts-Training (Einzel-AAT)
4.3.5 Andere konfrontative Ansätze und Trainingsformen
4.4 Rechtliche Rahmenbedingungen und ethische Aspekte
5 Anwendungsfelder, Verbindungen zu anderen Methoden, professionelle Kompetenzen und Qualitätsstandards
5.1 Anwendungsfelder und -situationen
5.2 Verbindungen zu anderen Methoden
5.3 Professionelle Kompetenzen
5.4 Evaluationsergebnisse
5.5 Rahmenbedingungen und Qualitätsstandards
6 Historische, ideengeschichtliche und gesellschaftspolitische Rahmung
6.1 Historischer Rückblick
6.2 Konfrontative Bezüge in der ideengeschichtlichen Entwicklung der Pädagogik
6.3 Verortung des Ansatzes im aktuellen gesellschaftspolitisch-pädagogischen Diskurs
Literatur
Ausbildungsmöglichkeiten
Sachregister
Einleitung
„Der Erziehungsauftrag an uns wird zwischen Eltern ohne Zeit und überforderten Lehrern hin und her geschoben, wir gewinnen Freiraum in diesem Chaos, und der gefällt uns. Wir verwildern in diesem Vakuum, dessen Ränder aus Watte sind und dessen Grenzen wir selbst setzen. Dass es auch noch andere Grenzen gibt, merken wir erst wieder, wenn vor uns ein brennendes Haus steht, das wir angezündet haben, und hinter uns drei Polizisten, die erstaunlich fest zupacken. Unsere Spielregeln sind unlogisch und schwer zu durchschauen, aber auch ein Schlag ins Gesicht ist ein Rausch, denn er hinterlässt ein Gefühl, das eindeutig ist […]“ (König 1993, 3).
Das 1993 verfasste Essay des damals jugendlichen Autors in Enzensbergers Kursbuch „Jugend“ zum Thema „Wir Vodookinder“ weist auf ein für die 1980er bis 2000er Jahre fast klassisches Missverständnis in zahlreichen pädagogischen Feldern hin. Die Rolle der Pädagogen wird oftmals darauf reduziert, nahezu jedes Verhalten zu akzeptieren und lediglich dann verstärkend auf Entwicklungen zu reagieren, wenn diese als positiv interpretiert werden.
Im Beurteilungsraster zahlreicher autoritär und auf männliches Dominanzstreben hin sozialisierter Jugendlicher wird ein solches Verhalten i. d. R. als zu nachsichtig und als schwach bzw. als schwächlich identifiziert, bei ihren Lehrern und Sozialpädagogen aber gleichzeitig als verständnisvolles Einfühlungsvermögen verbucht. Der adoleszente Aggressionsimpuls hin zur rauschhaften Allmachtserfahrung in der entgrenzten Gewaltsituation mündet im watteweichen Nichts scheinbarer Gleichgültigkeit auf Seiten der Erziehenden und verleitet auf der Seite der „zu Erziehenden“ dazu, weitere moralische Hindernisse zu überwinden, die letzten Tabugrenzen zu überschreiten und sich im Zustand des Ausrastens den „finalen Kick“ zu verschaffen (Sutterlüty 2003; Weidner / Malzahn 1997).
Wichtig erscheint hier, die jeweils geeignete Balance zwischen zwei zentralen Verhaltenseckpolen austarieren zu können, nämlich eine im Verständnis der Harvard-Methode (Methode des sachbezogenen Verhandelns) zu findende Trennung zwischen Person und Verhalten vorzunehmen, die sich etwa folgendermaßen liest: die Person zu verstehen, mit ihrer destruktiven Handlung (Tat) aber nicht einverstanden zu sein. In einer solch ambivalenten Reaktion kann die Verbindung zwischen Fürsorglichkeit und Konfrontation (Crain 2005) hergestellt bzw. aufrechterhalten werden, in der die beiden erzieherischen Handlungskomponenten des verstehenden Zugangs und des erzieherischen Angebotes, sich an einer erwachsenen Objektfigur abzuarbeiten, zu reiben und letztendlich zu orientieren, eine fruchtbare Liaison eingehen können. Adoleszente finden hier den temporären Gegner, den sie benötigen, um ihr „Selbst“ zu entwickeln und dieses erlebbar werden zu lassen.
Im Umgang mit gewaltbereiten und gewalttätigen Kindern und Jugendlichen ist aber gleichermaßen wichtig, deren Gewaltaktivität selbst einerseits als individuelle Botschaft zu entschlüsseln und entsprechend differenziert zu werten; andererseits sollte sich in einer institutionellen Reaktion eine Gleichbehandlung aller Betroffenen widerspiegeln, die Gewalt als zu verurteilendes Verhalten erscheinen lässt und gerade durch die Konfrontation des Gewaltausübenden das Angebot zu deren Integration erneuert.
Den pädagogischen Fachkräften wird bei der Bearbeitung dieses scheinbar widersprüchlichen Sachverhalts sehr viel Fingerspitzengefühl abverlangt: Sie müssen zwischen individueller Bearbeitungshilfe gegenüber den gewalttätigen Akteuren und – dazu manchmal im Widerspruch stehender – einheitlicher Reaktion auf abweichendes Verhalten im Klassen- bzw. Gruppenverband unterscheiden, ohne bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen Gerechtigkeitslücken zu hinterlassen.
Weshalb kann es sinnvoll sein, zu konfrontieren? Fitzgerald Crain (2005) fand in seiner Arbeit mit aggressiven Kindern und Jugendlichen heraus, dass gelingende pädagogische Reaktionen immer in einem Bezug zur Symptombedeutung stehen.
„Dem Unvermögen verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher und ihrer Eltern, Konfrontation auf konstruktive Art auszutragen, entspricht paradoxerweise ein schwieriger Umgang mit den vielfältigen Formen der Aggression“ (Crain 2005, 266).
So erfordere der Umgang mit „narzisstischer Wut auf kleinste Kränkungen“ andere „Behandlungsformen“ als etwa die bei Gewaltausübung von Männern gegenüber Frauen, der Misshandlung des eigenen Kindes oder dem „sadistischen Quälen eines fremden Opfers“; eine gezielt provozierte Schlägerei aus einer Gang heraus wiederum eine andere Behandlungsform als der scheinbar willkürlich zustande gekommene Totschlag beim zufälligen Zusammentreffen mit einer als Bedrohung erlebten unbekannten Person in einem abgelegenen Quartier.
Eigentlich sollte zum pädagogischen Haltungs- und Handlungsinventar eine möglichst große Breite im Spektrum zwischen Verhaltensakzeptanz und positiver Verhaltensverstärkung einerseits sowie Kritik-, Konfrontations- und in extremen Situationen auch Verurteilungs- und sogar Ablehnungsvermögen des Schüler- oder Klientenverhaltens andererseits gehören. Denn gerade in der Ausschöpfung einer solch vielstufigen Palette verschiedener Verhaltenslevel drückt sich Kompetenz zu differenzierendem pädagogischen Gestaltungs- und Reaktionsvermögen aus. Anbiederndes und häufig auf eigenen Ängsten aufbauendes Verständnis für extreme Regelverletzungen insbesondere in der sozialpädagogischen Arbeit mit schwierigen Einzelnen oder Gruppen können dagegen realitätsferne und problematische Entwicklungen fördern.
Der Begriff der Konfrontativen Pädagogik ließe sich deshalb auch mit dem Slogan „Mut zur Erziehung“ umschreiben. Er steht nicht für ein in sich kohärentes Theoriegebilde, sondern gleichermaßen für eine Haltung, einen interaktionsbezogenen Interventionsstil, eine Gesprächsform sowie für curriculare Angebote. Eine konfrontierende Haltung und ein solcher Interventionsstil müssen in der pädagogischen Interaktion nicht einmal unbedingt dominierend sein; sie bilden, je nach Zielsetzung, ein Element unter meist mehreren anderen.
Diesem Lehrbuch zur Konfrontativen Pädagogik soll die Aufgabe zukommen, in knapper und prägnanter Art den bisherigen Stand der praxisbezogenen Entwicklungen darzustellen und deren theoretischer Erdung nachzugehen. Das geschieht zunächst über die Betrachtung der sozialpolitisch geprägten Ausgangssituation sowie einer Abhandlung zum fachlichen Diskurs über Gewalt. Im zweiten Kapitel wird dazu ein Überblick über die klassischen Definitionen und Begriffsverständnisse sowie die entsprechenden Hintergrundtheorien gegeben. Da insbesondere die soziologischen und kulturtheoretischen Ansätze nur strukturelle Korrelate und Hintergrundfaktoren im Sinne erhöhter Risikofaktoren liefern können, soll im dritten Kapitel über die Verbindung mit psychologischen und sozialisationsbezogenen Theorien versucht werden, am Modell einer Tatgenese typische Muster gewaltaffiner Karrieren zu identifizieren, die in einen Bezug zur konfrontativen Interventionspraxis gesetzt werden. Es soll daraus klarer hervorgehen, weshalb das konfrontierende Interaktionselement in spezifischen biografischen Situationen situationsadäquat ist und damit auch wirkungsvoll sein kann.
Es folgen im vierten Kapitel eine Übersicht zu den verschiedenen Anwendungsformen der Konfrontativen Pädagogik und im folgenden Abschnitt eine Darstellung von deren Übertragbarkeit bzw. Einsatz in den verschiedenen schulischen und sozialpädagogischen Handlungsfeldern. Daran anschließend werden Querbezüge zu anderen methodischen Ansätzen aufgezeigt, um im Schlusskapitel eine historische, gesellschaftspolitische und ideengeschichtliche Rahmung der Konfrontativen Pädagogik vorzunehmen und hiermit auch die aktuelle kontroverse Debatte aufzunehmen.
Die Kapitel 4.3.2 zum AAT-Curriculum und 5.4 zur Evaluation wurden von Rainer Kilb und Jens Weidner gemeinsam verfasst, Autor des Kapitels 4.3.4 zum Konfrontativen Einzeltraining ist Horst Schawohl. Autor der anderen Kapitel ist Rainer Kilb.
Zur Vertiefung und zur reflexiven Diskussionsanregung finden sich am Ende einiger Abschnitte Literaturtipps sowie Übungsaufgaben.
An dieser Stelle gebührt den zahlreichen in der Konfrontativen Pädagogik tätigen Fachkräften Dank für ihre kreativen Ideen zur Weiterentwicklung der Trainingsbausteine, unseren Kritikern für deren hartnäckige Infragestellungen, die eine Debatte erst interessant machen, Horst Schawohl für seine Bereitschaft, das Kapitel zum Konfrontativen Einzeltraining zu verfassen, sowie den vielen Studierenden für ihre fundierte Kritik an den Textauszügen.
Frankfurt am Main und Hamburg, April 2025
Rainer Kilb und Jens Weidner
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei Berufsbezeichnungen meist die grammatikalisch maskuline Form gewählt. Gemeint sind stets alle Personen unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität.
Kapitel1 Aktuelle Ausgangssituation
Phänomen und Verständnis von Gewalt – und hierbei insbesondere ihre im Jugendalter ausgeprägten Artikulationsformen – sind mehr als andere erzieherische Themen durch die jeweilige zeithistorische öffentliche Diskussion bestimmt. In teilweise hysterischer Form ausgetragen, müssen häufig Einzeltaten dafür herhalten, den gesamten Gesetzeskanon infrage zu stellen. Dabei leben wir zivilisationshistorisch betrachtet in einer Zeit, in der nahezu sämtliche harten Indikatoren der Gewalt, wie etwa die Anteile der durch Kriege, durch Völkermord oder durch Terrorismus umgekommenen Menschen wie auch die allgemeine Mordrate deutlich rückläufig sind. Pinker (2011) verbindet diese Entwicklung mit den schon weit zurückliegenden Ereignissen des Zusammenkommens intensiver überörtlicher Handelsbeziehungen, der Aufklärung und der humanistischen Revolution sowie damit aufkommender demokratisch-rechtsstaatlicher Verfasstheit in den „zivilisierteren“ Gesellschaften.
Wegen der trotzdem anhaltenden intensiven Erregbarkeit im Umgang besonders mit jugendlicher Gewalt kann man rasch den Eindruck gewinnen, dass es gerade bei diesem Thema zu großen Projektionen von Erwachsenen auf die jeweils nachwachsende Generation kommt, die in der Literatur schon immer als schlimmer im Vergleich zur vorausgegangenen (der Generation der Eltern) gezeichnet wurde. Periodizität und Intensität der jeweiligen Debatten scheinen dabei von Zufällen bestimmt, z. B. wenn Wahlen bevorstehen und die konkurrierenden Parteien das Thema „Innere Sicherheit“ für sich entdecken oder aber wenn ein Ehemaliger Schüler und Lehrer seiner früheren Schule durch einen Amoklauf tötet. In solch einem – durch aktuelle Ereignisse geprägten – Umgang zeigt sich die soziale Dimension von Gewalt und lässt sie uns sehr nahe treten. Dabei kommt es offensichtlich zu dem Paradoxon, dass wir umso mehr Gewaltängste ausprägen, je weniger wir den Umgang mit ihr gewohnt und im Umgang mit ihr geübt sind.
Gewalt in ihrer Intensität, wie auch in ihrer Definition, ist immer auch durch die Form der Kommunikation über sie bestimmt; und in diese Kommunikation fließen subjektiv empfundene Ängste, Zuschreibungen, reale Vergleiche und zeitgemäße Interpretationsmuster ein und machen sie historisch wie auch sozialräumlich nahezu unvergleichbar.
Diese zeitgeschichtliche Relativität und Einbettung dessen, was durch wen als Gewalt definiert ist und was als Gewalt wahrgenommen wird, besitzt Auswirkungen auf die Diskussion, was aktuell als Gewalt gilt und wie ihr zu begegnen ist.
So kommt es nicht zufällig, dass der Ansatz der Konfrontativen Pädagogik in den frühen 1990er Jahren in einer Zeit entwickelt wurde, in der sich einerseits der Schrecken über fremdenfeindliche Gewalttaten im Westen (Mölln, Solingen usw.) wie im Osten (Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen usw.) der Bundesrepublik mit den Ängsten vor Jugendaufständen wie in den französischen Banlieues vermischten und zu einem generellen Nachdenken über den bis dahin üblichen Umgang mit jugendlichen Gewalttätern führte.
Zur Beschreibung der Ausgangssituation dieses Buches ist ein zweiter Aspekt wichtig. Die Entwicklung der Konfrontativen Pädagogik als Handlungsmethode erfolgte einerseits erfahrungsbasiert und in hypothesengestützter Form, angelehnt an wissenschaftliche Befunde aus der Lerntheorie, der Kognitionspsychologie, der Konfrontativen und Provokativen Therapie; andererseits wurden die ersten Curricula in experimenteller Form eines Trial-and-error-Verfahrens in der Praxis erprobt. Eine handlungstheoretische Kohärenz war insofern nur zum Teil gegeben. In diesem Lehrbuch erfolgen hierzu weitere Annäherungen z. B. mit Hilfe psychoanalytischer und tiefenpsychologischer Erkenntnisse.
Die bisherige Gewaltforschung war vor allem sektoral aufgestellt; es wurden dabei verschiedene Theoriegebilde aus der Psychologie, der Evolutionsbiologie, der Soziologie, der Kulturanthropologie, der Kriminologie oder der Neurowissenschaften zwar partiell aufeinander bezogen; das geschah aber meist weder fallorientiert noch auf die Entstehungsweise biografischer Prozesse hin bezogen, sodass die sehr komplexen Verzahnungen zwischen allgemeinen gesellschaftlichen Risiken und individuell sehr unterschiedlichen Ausprägungen damit nicht erfasst werden konnten. Da innerhalb der curricularen Maßnahmen der Konfrontativen Pädagogik, wie etwa dem Anti-Aggressivitäts-Training (AAT), immer fallspezifisch gearbeitet wird, werden die verschiedenen Theorien zur Gewaltentstehung für eine sich diesem Kapitel dann anschließende tatprozessuale Analyse verwendet. Hierdurch soll einerseits der hohen Komplexität bei der Analyse von Gewaltursachen und Tatgenese entsprochen werden; gleichzeitig soll aufgezeigt werden, dass handlungsmethodische Aspekte entsprechend der jeweils benutzten Erklärungstheorien methodisch vielseitig ausgerichtet sein müssen.
Damit zusammenhängend soll auch die in der aktuellen kritischen Debatte immer wieder zu findende Zuschreibung betrachtet werden, nach der die Konfrontative Pädagogik im Sinne einer strafenden oder gar „schwarzen Pädagogik“ in eine andere Zeit gehöre oder „nicht der Rede wert“ sei (Herz 2010; Dörr / Herz 2010). Hinter dieser Kritik verbirgt sich ein aus unserer Sicht zu eingegrenzter Umgang mit heutigen gesellschaftlichen Realitäten. Dass sich Letztere durch plurale Lebensoptionen und individualisierte Lebenspraxen auszeichnen, wird dabei kaum bestritten. Dass aber solche gesellschaftlichen Kontingenzen bei der in multi- bzw. transkulturellen Gesellschaften anzutreffenden Ungleichzeitigkeit von Entwicklungen andere und vor allem vielfältigere Ansätze und Umgangsformen und nicht eine „Entweder-oder-Pädagogik“ erfordern, ist eine aus unserer Sicht zwangsläufige Folge. Die Konfrontative Pädagogik steht hier für eine einzelne dieser vielen Optionen, die im Rahmen einer auf demokratischen Umgang zielenden schulischen sowie sozialen Pädagogik Anwendung finden sollte. Da sie u. a. auch durch autoritative Elemente geprägt ist, stellt sie einen Baustein für erzieherische Prozesse ganz bestimmter Adressaten in ganz spezifischen biografischen Situationen dar. Zur Adressatengruppe gehören in der tertiären Prävention mehrfach gewalttätig Straffällige, in der sekundären Prävention Kinder und Jugendliche mit stark gewaltaffinen Verhaltensweisen.
Gewalt soll im Rahmen dieses Lehrbuchs nicht ausschließlich in negativer Konnotation verstanden werden. In der Arbeit mit Gewalttätern geht es nicht zuletzt darum, „Sinn“ und „Botschaft“ einer Gewalttat in einer Biografie zu identifizieren und hieraus Schlüsse für eine nachhaltige Bearbeitung bzw. das weitere individuelle Vorgehen zu ziehen. Erst durch die offene Betrachtung täterbezogener und überaus ambivalenter Gefühlslagen während einer Tatausübung können pädagogische Fachkräfte Einblick in die komplexen Entwicklungspfade innerhalb einer Biografie erhalten. Die Gewalttat fungiert dabei als Indikator und als Schlüssel zu einem Konglomerat oft zahlreicher miteinander korrespondierender und verwobener Einzelfaktoren, die erst in ihrem Zusammenwirken die Intensität einer Aktion oder Reaktion wirklich erklären können.
Ein solches „Verstehen“ darf im eigentlichen pädagogischen Prozess dann aber nicht ausschließlich den Inhalt dessen ausmachen, was methodisch anvisiert ist.
Die Kunst der Konfrontativen Pädagogik besteht darin, diesem „Verstehen“ das „Nichteinverstandensein“ mit der gewalttätigen Aktion gegenüberzustellen und hieraus die Spannung für einen kognitiven, emotiven und moralisch akzentuierten Lernprozess zu initiieren. Dieser Lernprozess mündet schließlich in eine Übernahme der Tatverantwortung des Täters und in eine Weiterführung der Interaktion zum Gewalt erleidenden Opfer.
Gewalt wird zuletzt im Sinne eines „sozialen Konfliktes“ thematisiert, der sich biografisch vor allem in der adoleszenten Entwicklungsphase artikuliert. Adoleszente Vulnerabilität und kollektive Grenzüberschreitungen, Allmachtsphantasien im Rausch des Gewaltfurors können hierbei zu zentralen Themen der Identitätsarbeit werden. Konfrontierenden Erwachsenen kommen dann symbolische wie auch beziehungspsychologische Funktionen zu, die solche adoleszenztypischen Botschaften gerade nicht ins Leere verpuffen lassen sollen.
Übersicht 1: Weshalb Konfrontative Pädagogik?
Manche Adoleszente erhalten die Konfrontation, die sie ansonsten mit anderen suchen (würden).
Einige Jugendliche respektieren (verstehen) zunächst nur diese „Sprache“.
Manche Jugendliche benötigen temporär normative Eindeutigkeit.
Plurale normative Ausdifferenzierung in unserer Gesellschaft erfordert differenzierte „Pädagogiken“.
Kapitel2 Multidisziplinäre fachliche Grundlagen zur Erklärung und zur Systematisierung des Gewaltphänomens
Die Debatte zu den verschiedenen im Zusammenhang mit Gewalt verwendeten Begrifflichkeiten steht im Verhältnis zur Anzahl ihrer diversen Begründungstheorien, die wiederum – jeweils für sich allein stehend – meist nicht ausreichend sind. So lassen sich beispielsweise durch die Lerntheorien die sozialisatorisch eingeübten Gewaltmuster und deren Wiederholungsgewohnheiten erklären, nicht aber unbedingt deren ursächliche, in der Person liegende Antriebsimpulse oder deren Intensität. Mithilfe der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie gelingt es wiederum nur unzureichend, die jeweiligen Gewaltmuster auf ihr Ausgangsmuster zu beziehen.
Da Gewalttaten als menschliches Verhalten auf ein Zusammenspiel multipler Faktoren in unterschiedlichen Umgebungskontexten zurückgehen, erfordert die Identifikation ihrer Ursachen tiefer gehende und interdisziplinäre Analysen. Zumkley (1993) und Lösel / Bliesener (2003) verweisen dabei auf die Schwierigkeit, dass sich Risikofaktoren je nach Kombination unterschiedlich verhalten, die Wirkung eines Risikofaktors durch die Präsenz eines zweiten verstärkt werden kann oder dass ein Risikofaktor eher indirekt als direkt auf die Entwicklung delinquenten Verhaltens einwirken kann. Vor diesem Hintergrund sollen im Folgenden sämtliche einen Tataufbau und ihren Ablauf kennzeichnende Aspekte und Entwicklungsstufen betrachtet werden. Ausgehend von den biografischen, fallorientierten und (tat)prozessualen Ebenen und Variablen soll schließlich eine für die Konfrontative Pädagogik kennzeichnende Handlungstheorie entwickelt werden.
Im Einzelnen werden dabei zuerst auf der phänomenologischen Ebene die verschiedenen Gewaltformen unterschieden. Auf den folgenden Betrachtungsebenen finden sich auf der Täterseite die motivationalen, intrinsischen und intentionalen Aspekte, auf der Opferseite diejenigen des Objekt- und Übertragungsangebotes wieder, wenn etwa die Person des Opfers vom Täter deshalb ausgewählt wurde, weil sie sich zum „geeigneten“ Zeitpunkt als „geeignetes Objekt“ am – aus Tätersicht – „richtigen Ort“ aufhält. Diese Aspekte sind wiederum nur dann relevant, wenn es passende Gelegenheiten, Anlässe, stimulierende Verstärker und letztendlich auslösende Faktoren gibt, in die zumindest Täter und Opfer, manchmal auch Dritte, einbezogen sind. Der gesamte Entwicklungsprozess einer Gewalttat kann aber auch in ritualisierte Formen eingebunden sein, wie es etwa beim Hooliganismus im Umfeld des Profifußballs geschieht.
Diesen Ereignisebenen untergeordnet, spielen dann erst sozialisatorische Faktoren als primäre „Vermittler“ und sonstige gesellschaftliche Hintergründe eine Rolle (Abb. 1). Entscheidend für eine umfassende Handlungstheorie zur Gewaltgenese ist aber sowohl die Einbindung biografischer Aspekte als auch die Annahme, dass sich im Verlauf einer Tatausführung die emotiven Elemente und die rationalen Zweck-Mittel-Bezüge immer wieder neu formieren können.
Follow for extended description
Abb. 1: Kontextueller Entstehungsprozess einer Gewalttat (Kilb 2012)
Zur Differenzierung von Aggression, Aggressivität, Gewalt und Konflikt: Die Begriffe „Konflikt“, „Gewalt“, „Aggressivität“ und „Aggression“ werden alltagssprachlich häufig synonym verwendet und lassen sich deshalb nicht eindeutig voneinander abgrenzen (Übersicht 2). In der Fachliteratur stehen der Konflikt- und der Gewaltbegriff definitorisch oftmals in einem historischen und sozialen Kontext, was sowohl ihr Verständnis als auch ihre jeweilige Bewertung und Eingrenzung angeht. So ist z. B. die Ausübung von Gewalt als Zuchtmittel in der Erziehung erst seit relativ kurzer Zeit ausdrücklich untersagt (BGB § 1631 Abs. 2); trotzdem ist Gewaltanwendung im familiären Rahmen immer noch recht verbreitet und das Phänomen dort alltagssprachlich nicht unbedingt unter dem gleichnamigen Begriff subsumiert.
Im Unterschied zum Gewaltbegriff und dessen partieller Bedeutungsüberschneidung mit Aggressivität und Aggression steht der Konfliktbegriff für einen noch viel breiteren Korridor eines Agierens in Nichtübereinstimmungen von Interessen, Bedürfnissen, Gefühlen und Meinungen. Jede Gewalttat lässt sich aus einem Konflikt ableiten, legt man Friedrich Glasls Unterscheidung zwischen inter-personalem und intra-personalem Konflikt zugrunde (Glasl 1999, 14 f.).
Gewalt lässt sich einerseits also als eine intensive Form der Konfliktaustragung verstehen und ist hierbei in eine soziale Interaktion mindestens zweier Akteure eingebunden; sie kann aber auch als primäre Handlungsaktion im Sinne dissozialer Gewalt erfolgen und hierüber eine interaktionsbezogene Konfliktdynamik erst auslösen.
Allgemein wird heute zwischen einem engen Gewaltbegriff (im Sinne einer stark schädigenden physischen Aktion), psychischer Gewalt (häufig als Vorstufe körperlicher Gewalt) und struktureller (Galtung 1969, 167 ff.) und / oder institutioneller Gewalt differenziert.
Da kein einheitliches Begriffsverständnis existiert, sollen hier die Definitionen von Zimbardo / Gerrig (2003) zugrunde gelegt werden. Der Gewaltbegriff wird also im Sinne eines extremen, auf eine Verletzung anderer Personen hin bzw. eines auf Sprengung geltender sozialer Regeln zielenden Angriffsverhaltens benutzt, welches jeweils gesellschaftlich-historischen Bewertungsmustern unterliegt (Kilb 2023a, 2020, 2012).
Übersicht 2: Verständnisse des Gewalt- und Aggressivitätsbegriffs
Aggressivität als Verhaltensimpuls und / oder als Gefühl
Aggression als eine Person oder einen Gegenstand schädigende/s Angriffsverhalten / Tat
Gewalt als gesellschaftlich-historisch entweder verbotenes, erlaubtes oder gebotenes Angriffsverhalten
Gewalt als körperliche/r, sachbezogene/r, psychische/r Beschädigung oder Angriff, bzw. als strukturelle oder im Sinne staatlichen Machtmonopols erfolgter Einschränkung
Das rechtsstaatlich fundierte Gewaltmonopol soll hier als zivilisatorische Errungenschaft und damit als notwendige, aber demokratisch zu kontrollierende staatliche Gewaltaktivität zur Sicherung rechtsstaatlicher Prinzipien vorausgesetzt werden. Der sogenannten institutionellen Gewalt kommt in diesem Rahmen die Funktion zu, rechtliche Bestimmungen notfalls auch gegen den individuellen Willen durchzusetzen, was nicht ausschließt, dass es hierbei auch zum Missbrauch kommen kann.
„Gewalt stellt vor allem eine physische, in bestimmten Fällen auch psychische Form von Willensbrechung eines anderen Menschen / einer anderen Gruppe dar, die entweder in illegalen Formen, oder aber auch in gesellschaftlich akzeptierten und vom Rechtssystem tolerierten Formen stattfinden kann. Gewalt kann dabei als extreme Form der Konfliktbearbeitung / -eskalation, als instrumentelle Gewalt oder als Übertragungshandeln in diffuser dissozialer Form auftreten und geht hierbei auf unterschiedliche Motive zurück“ (Kilb 2012, 13).
Da die Anwendung von Gewalt eine von vielen Varianten der Konfliktaustragung ist, stellt sich das Verhältnis zwischen Gewalt und Konflikt so dar, dass Gewaltanwendung entweder eine fortgeschrittene und intensive Prozessstufe in der Eskalationsspirale eines Konfliktes ist oder aber eine eher diffuse, mit Aggressionsabbau verbundene persönliche oder kollektive Aktivität, die auf ein inneres bzw. auf ein in der Biografie, im intimeren Verbundsystem der gewalttätigen Person liegendes Ereignis zurückgeht und entweder willkürlich oder auch gezielt nach Spannungsabfuhr bzw. -ableitung sucht.
2.1 Formen und Motive von Gewalt
Gewaltformen
Gewalttätigkeiten artikulieren sich in unterschiedlichen Formen und können auf völlig verschiedenen Hintergründen und Motiven beruhen, sodass sich – hieraus jeweils ableitbar – ganz verschiedene sozialpädagogische Handlungsstrategien ergeben. Reemtsma (2009) geht in seiner phänomenologischen Kategorisierung zunächst vom rein körperlichen Bezug von Gewalt aus und differenziert nach den drei Dimensionen von
lozierender Gewalt
, die sich nicht auf den Körper richtet, sondern den Körper (anderer) – weil dieser einem anvisierten Ziel im Wege steht – bewegt oder auch beseitigt (
Reemtsma 2009
, 109),
raptiver Gewalt
, deren Ziel der Körper (anderer) ist, der für die eigenen Bedürfnisse und Interessen funktionalisiert wird (
Reemtsma 2009
, 113) und von
autotelischer Gewalt
, die auf eine Zerstörung des Körpers (anderer) zielt (
Reemtsma 2009
, 116).
Eine körperbezogene Kategorisierung ist vor allem relevant für Arbeitsansätze, die sich auch auf die Gewalt erleidenden Opfer beziehen, denn sie führen bei ihnen zu ganz unterschiedlichen Verletzungen und hinterlassen verschiedene Leidensfolgen. Die körperbezogene Handlung stellt zudem zunächst die physische Schnittstelle zwischen den initiierenden Akteuren und Betroffenen einer Gewalttat dar. Von Reemtsmas Typologie ausgehend, lassen sich dann täterseitig Absichten, Ziele, Motive und energetische Impulse, opferseitig die körperlichen wie psychischen Verletzungen und deren psychosoziale und ggf. ökonomische Folgen thematisieren. Im konfrontierenden Arbeitsansatz wie dem Anti-Aggressivitäts-Training oder auch dem Täter-Opfer-Ausgleich werden diese einzelnen Ebenen und Faktoren in der Täter-Opfer-Kommunikation angesprochen und aufeinander bezogen.
Die Differenzierungsvariante Reemtsmas klammert zunächst einmal Hintergründe und Motive des als Täter Agierenden aus und ermöglicht dadurch eine Herangehensweise, die gleichermaßen Gewalt als soziale Interaktion als Tat und als Erleiden erfahrbar und bearbeitbar werden lässt (Reemtsma 2009, 124). Hierdurch wird auch die aus der Sicht des Erleidenden vom Täter häufig erzwungene Beziehung sichtbar, der auch in der Tatbearbeitung eine große Bedeutung zukommt.
Gewaltmotive
Eine zweite Betrachtungsebene in der Analyse von Gewalt ist die der Motive von Tätern. Nunner-Winkler (2004, 49 ff.) spricht in ihrer Differenzierung von sogenannten täterbezogenen Sinn- bzw. Motivkontexten, nach denen Gewalt in folgenden Formen auftritt:
1. als zweckorientierte Gewalt, wie z. B. bei Raubdelikten,
2. als wertrationaler Gewalteinsatz, z. B. aufgrund milieutypischer „Ehrverständnisse“ oder aus religiösen Werten oder diesbezüglichen Abgrenzungen heraus,
3. als affektuelles Reagieren auf nicht alltägliche Reize („neuronale Entgleisung“), wie z. B. eine traumatische Blitzreaktion,
4. als kompensierende Gewalt im Rahmen einer Projektion, einer Übertragung eigener „Traumata“ oder fehlender Anerkennung.
Aus unserer Sicht wäre eine solche Differenzierung noch durch zwei weitere Aspekte zu ergänzen, nämlich
5. als Reaktion auf eine subjektiv als provozierend wahrgenommene Geste, wie etwa dem „falschen Blick“ im Rahmen adoleszenter Identitätsfindung mit leichter narzisstischer Kränkbarkeit,
6. als Gewalt im Sinne eines Eigenwertes, als Lust an körperlicher Selbsterfahrung durch Kampf, oder an der Intensität von Anspannung („Kick“), der Erregung und von Risikolust (Kilb 2012).
Die Motive können miteinander korrespondieren; teilweise werden einzelne Motive auch zur Legitimation für ein anderes primäres Motiv funktionalisiert. So stößt man insbesondere bei aggressiven Jugendlichen nicht selten auf Erklärungsnachlieferungen im Anschluss an eine Tat, oder diese suchen einen gewaltlegitimierenden Anlass bei ihren Opfern, um sich damit eine Begründung erst zu verschaffen (Sutterlüty 2003, 72 ff.).
Motivbetrachtung und Reflexion über den subjektiven Sinn von Gewalttaten helfen über eine personenbezogene biografische Rekonstruktion dabei, die Zusammenhänge im Entstehungsprozess einer Tat zu erschließen und diese mit zum Gegenstand der Bearbeitung zu machen. In Kap. 3 wird auf die diversen Stufen der Entwicklung von Gewalttaten genauer eingegangen, da nur über eine Rekonstruktion der Schlüssel zu einer präzisen Behandlung liegen kann.
2.2 Klassische theoretische Befunde zur Entstehung von Gewalt
Die theoretischen Modelle und Befunde, die es zur Erklärung von Gewalt gibt, sind häufig kaum miteinander vergleichbar, da sie Gewalt unter verschiedenen Prämissen, aus verschiedenen Perspektiven heraus oder aber nur selektiv auf einzelne Gewaltaspekte hin fokussieren. Es soll deshalb hier unterschieden werden zwischen
den klassischen ätiologischen Theorien, die Gewalt weitgehend als individuelle Aggression oder als erlerntes Verhalten thematisieren,
Theorien, die Gewalt als Produkt der durch sozialisatorische Prozesse vermittelten Lebenserfahrungen definieren und
Theorien, die gewalttätiges Handeln als Aspekt gesellschaftlicher Verwerfungen und Ungleichheit betrachten.