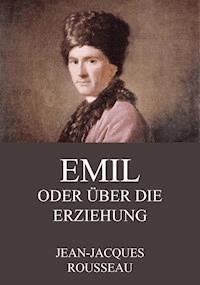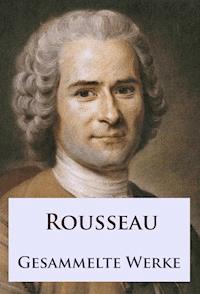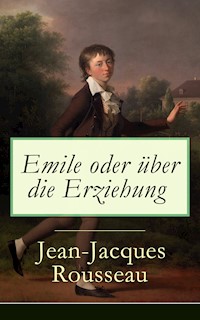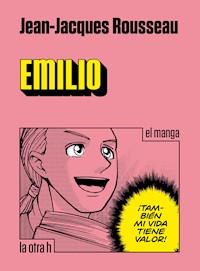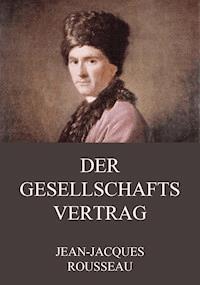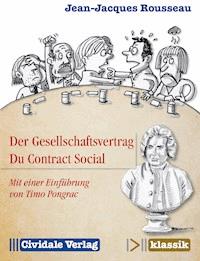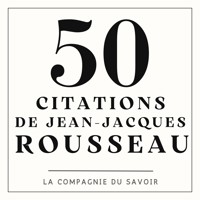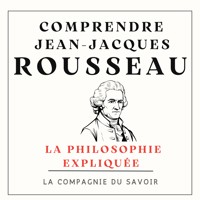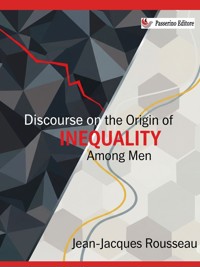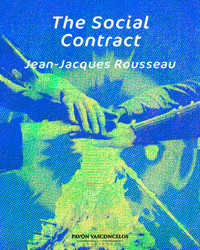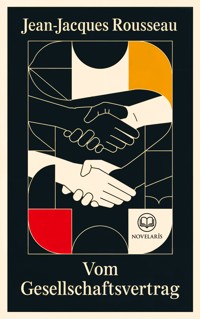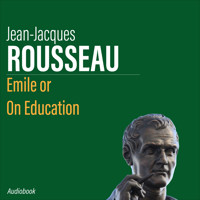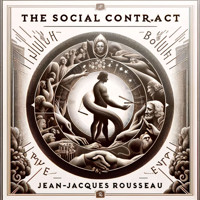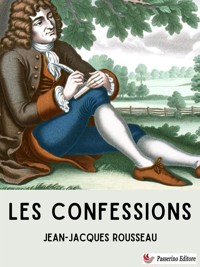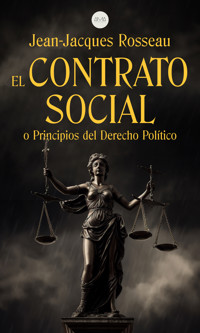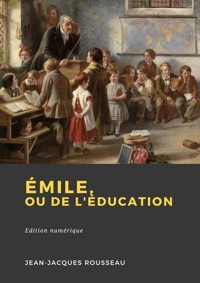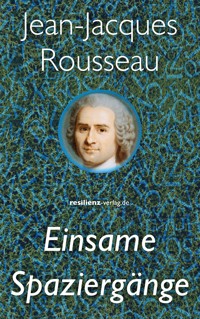
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: resilienz-verlag.de
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1776, wenig Zeit vor seinem Tod, begann Rousseau seine Rêveries du promeneur solitaire (Träumereien des einsamen Spaziergängers) niederzuschreiben. Sie sind autobiografisch gehalten und Rousseau blickt auf sein Leben zurück, bekennt, welche Hoffnungen er hatte, welche Erwartungen an ihn gestellt wurden und was er von seinen Mitmenschen hält. Da sie gemeinsam mit den Confessiones erschienen, erhielt die Nachwelt auf einen Schlag eine Aufsehen erregende Menge an autobiografischen Eröffnungen. Seine "einsamen Spaziergänge" der späteren Lebensjahre, so schreibt Rousseau in einem Brief seien für ihn das Bedeutsamste und "am häufigsten und am liebsten Erinnerte". Wolfram Frietsch sieht hier das Resilienz-Potenzial: Im Grunde sind die zehn Spaziergänge Zwiegespräche mit sich selbst und dann des Autors Jean-Jacques Rousseau mit seinem Leser. Mit einem Schlag war er aus "der Ordnung der Dinge gehoben" worden und wusste nicht wie. Nach und nach lernt er, Kohärenz wiederzugewinnen und lässt genau daran den Leser teilhaben: "Nach vielen unruhigen Jahren bekam ich wieder Mut, ging in mich selbst, und dann erst lernte ich den Wert der Zuflucht kennen, die ich mir aufgespart hatte." Die Resilienz der "Spaziergänge" ist der rote Faden, auf den der Herausgeber in seinem Vorwort aufmerksam macht: Es beginnt sich der wichtigste Resilienzfaktor herauszukristallisieren, der in den Spaziergängen zum Tragen kommt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkung
Wolfram Frietsch: Die Resilienz der
Spaziergänge
Rousseaus Kontrollüberzeugung
Resilienzfaktoren Kurzfassung
J. J. Rousseau's Einsame Spaziergänge
Erster Spaziergang
Zweiter Spaziergang
Dritter Spaziergang
Vierter Spaziergang
Fünfter Spaziergang
Sechster Spaziergang
Siebenter Spaziergang
Achter Spaziergang
Neunter Spaziergang
Zehnter Spaziergang
Vorbemerkung
Im Jahr 1776, wenig Zeit vor seinem Tod, begann Rousseau seine Rêveries du promeneur solitaire (Träumereien des einsamen Spaziergängers) niederzuschreiben. Die zehnte und letzte Rêverie folgte im Frühjahr 1777, er musste sie 1778 drei Monate vor seinem Tod abbrechen. Sie blieb unvollständig. Erstmals erschienen waren die Rêveries postum 1782. Sie sind autobiografisch gehalten und Rousseau blickt auf sein Leben zurück, bekennt, welche Hoffnungen er hatte, welche Erwartungen an ihn gestellt wurden und was er von seinen Mitmenschen hält. Da sie gemeinsam mit den Confessiones erschienen, erhielt die Nachwelt auf einen Schlag eine Aufsehen erregende Menge an autobiografischen Eröffnungen. Seine „einsamen Spaziergänge“ der späteren Lebensjahre, so schreibt Rousseau in einem Brief1 aus dem Jahr 1762, seien für ihn das Bedeutsamste und „am häufigsten und am liebsten Erinnerte“.
Die Spaziergänge stellen eine Rückschau dar, die sein Leben unter verschiedenen Gesichtspunkten aber mit schonungsloser Offenheit beschreibt. Worum es geht und was der tiefere Sinn seiner Selbstbetrachtungen ist, erschließt sich beim Lesen unmittelbar. Es bedarf keiner philosophischen Kenntnisse, um zu verstehen, was Rousseau sagen möchte. Viel eher bedarf es einer gewissen Empathie für das Gelesene.
Es kommt hier also weniger darauf an, zu wissen, was Rousseau gemeint hat oder welche Philosophie sich dahinter verbirgt, all das kann an geeigneter Stelle nachgelesen werden. Hier geht es allein um Sie als Lesende!
Und es geht darum, die eigenen Gedanken mit jenen des Autors abzugleichen. Als Lesende werden Sie zum Autor, denn vieles, was Rousseau über sich schreibt, erschließt sich uns unmittelbar und betrifft unser eigenes Leben, ganz so, als ob wir es selbst erzählt oder aufgeschrieben hätten. Manchmal hat man das Gefühl, Rousseau sitzt gegenüber und erzählt aus seinem Leben, wir hören nicht nur zu, sondern tauchen auch in seine Welt ein, weil wir vielleicht genauso empfunden haben wie er. Wir können uns darin gespiegelt sehen oder angestoßen, doch es wird uns nicht kalt lassen. Seine Spaziergänge berühren. Das Berührende ist das, was uns ausmacht. Lassen wir uns davon ansprechen, alles Weitere wird sich finden.
Lesen wir das Buch also gegen den Strich nicht als Buch des Wissens, sondern als tief empfundene Lebensweisheit. Die Worte, so sie uns berühren, helfen, wieder mit dem Leben ins Gleichgewicht zu kommen, eine gewisse Harmonie herzustellen, und eigene Widerstandskräfte zu mobilisieren. Vielleicht ermutigen Rousseaus Worte gar, das eigene Leben neu anzugehen?
Die Welt ist noch weit davon entfernt, von uns in einem friedlichen Sinne entdeckt oder erobert zu sein. Widerstand gegen das Leben erfordert Kraft. Heute spricht man von Resilienz. Und darum geht es, die eigene Resilienz, also die eigene Widerstandskraft über den Text zu finden und daraus zu lernen.
Lassen wir also die Worte das sagen, was sie sagen: etwas über Rousseau und etwas über uns.
resilienz-verlag.de
Quellen und Literatur
J. J. Rousseau's Einsame Spaziergänge. Sein letztes nachgelassenes Werk. München 1783 bey Johann Baptist Strobl.
J. J. Rousseau's Selbstgespräche auf einsamen Spaziergängen. Ein Anhang zu den Bekenntnissen. Berlin 1782. Bey Johann Friedrich Unger.
Rousseau, Jean-Jacques: Träumereien eines einsamen Spaziergängers. In ders.: Schriften. Bd. 2. Hrsg. Henning Ritter. München, Wien: Carl Hanser Verlag, 1978, S. 637–760.
Rousseau, Jean-Jacques: Träumereien eines einsamen Spaziergängers. In ders.: Schriften. Hrsg. Henning Ritter. Band 2. Ullstein Materialien. Berlin 1981. S. 637–760.
Rousseau, Jean-Jacques: Träumereien eines einsamen Spaziergängers. Neuübersetzung Ulrich Bossier. Nachwort von Jürgen von Stackelberg. Reclams Universal-Bibliothek, 2003.
Rousseau, Jean-Jacques: Träumereien eines einsam Schweifenden. Nach dem Manuskript und den Spielkarten neu übersetzt, kommentiert und mit einem Nachwort versehen. Hrsg. Stefan Zweifel. Matthes & Seitz, Berlin 2012.
Rousseau, Jean-Jacques: Die Bekenntnisse. Mit 15 Kupferstichen. Vollständige Ausgabe. Übersetzt von Alfred Semerau. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1981.
Taureck, Bernhard H. F.: Jean-Jacques Rousseau. rororo Monographien. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei Hamburg 2009.
1 Taureck, Bernhard H.F.: Jean-Jacques Rousseau. Rowohlt Monographie. Hamburg 2009, S. 130.
Die Resilienz der Spaziergänge
Rousseaus Kontrollüberzeugung
Im Grunde sind die zehn Spaziergänge ein Zwiegespräch mit sich selbst und erst dann eines des Autors Jean-Jacques Rousseau mit seinem Leser. Was er erzählt, sind nicht nur Geschichten, Gedanken oder Erlebnisse, die sich zugetragen haben und woraus er Schlüsse zog, er beteiligt den Leser auch an seinen Lebenserfahrungen, und er offenbart eine Strategie, die sich als Überlebenstraining entpuppt. Es ist ein Leben, das sich den Widrigkeiten stellt und ihnen trotzt, basierend auf bewusster Reflexion und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen. Hätte er nicht die Möglichkeit gehabt, sein Tun zu überdenken und adäquat zu handeln, er hätte einen einsamen, aussichtslosen Kampf gegen die Welt und sich selbst führen müssen. Was ihn stark machte, waren seine Gabe des Nachdenkens und seine Beharrlichkeit, das Leben nicht nur zu ertragen oder zu akzeptieren, wie es ist, sondern auch immer wieder zu sich selbst zurückzufinden.
Wer war dieser Denker, Philosoph, politische Autor, Musiker und Pädagoge Jean-Jacques Rousseau?
Rousseau wurde am 28. Juni 1712 in Genf geboren und verstarb am 2. Juli 1778 in Ermenonville nahe Paris. Berühmtheit erlangte das ihm seit Voltaire mit Absicht fälschlich unterstellte Diktum „Zurück zur Natur!“ Weder gibt es Rousseau zufolge eine solche Rückzugsmöglichkeit, noch kann es eine politische Gesellschaftsform geben, die den Sog der auf Entwicklung drängenden Selbstzerstörung aufhalten könnte. Andererseits bezieht sich der Spruch darauf, dass man einem Kind seine „Natur“ oder „Natürlichkeit“ belassen sollte. Rousseau wendet sich gegen äußere und innere Zerrissenheit bzw. Selbstentfremdung. Es ist aber möglich, dass gerade Rousseaus eigene Zerrissenheiten in seine schriftlichen Zeugnisse mündeten und so damals wie heute helfen können, die Zeiten zu überdauern. Die nach wie vor bedeutendsten Werke Jean-Jacques Rousseaus seien wie folgt zusammengefasst:
Du contrat social ou principes du droit politique
(
Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts
), Amsterdam 1762.
Émile ou De l’éducation
(
Emile oder Über die Erziehung
), Amsterdam 1762.
Les Confessions
(
Die Bekenntnisse
, verfasst 1764–1770), Genf 1782 (erster Band, Bücher I–VI) und 1789 (zweiter Band, Bücher VII–XII).
Darüber hinaus zeugt eine Reihe weiterer Werke von Rousseaus Vielseitigkeit, darunter solche über Musik, Opernkompositionen, philosophische Abhandlungen oder Antworten auf akademische Wettbewerbe. Rousseau war eine bekannte Gestalt; einerseits berühmt, geschätzt und auch beliebt, von anderer Seite jedoch angefeindet, verfolgt und des Öfteren auf der Flucht. Schließlich zog er sich zurück, blieb allein bzw. lebte mit seiner ehemaligen Haushaltsgehilfin und späteren Ehefrau Marie-Thérèse Levasseur (insgesamt 34 Jahre) zusammen. Sie hatten fünf Kinder, die alle unmittelbar nach der Geburt in ein Waisenhaus gebracht wurden. Das hatte ökonomische, gesellschaftliche aber auch pädagogische Gründe, wie Rousseau in seinen Bekenntnissen ausführt.
Doch es bleibt bis heute die Diskrepanz zwischen Émile, dem epochalen Erziehungsroman, in dem Rousseau detailliert beschreibt, auf welche Weise ein Kind erzogen werden sollte – nach heutigem Maßstab immer noch zeitgemäß – und Rousseaus eigenen Kindern, die er nicht bei sich behielt bzw. selbst erzog, sondern weggab. Émile wurde dennoch zu einer wirkmächtigen Kraft für viele Generationen. Die Anekdote, dass sogar Immanuel Kant während der Lektüre von Émile seinen gewohnten Nachmittagsspaziergang verpasste, an dem er sonst eisern festhielt, ist eine originelle Illustration des Eindrucks, den das Werk auf seine Zeitgenossen gemacht haben muss.
Sein für die politische Theorie bis heute wichtigstes Werk Vom Gesellschaftsvertrag geht davon aus, dass die Menschen mittels eines Vertrages gesellschaftlich gebunden seien. Der Vertrag basiert auf dem volonté générale, dem Gemeinwillen und auf Einsicht, Vernunft und Freiwilligkeit. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen volonté générale, dem Gemeinwillen, und volonté de tous, der Summe der Einzelinteressen. Letztere beruhen auf individuellen Ansichten und müssen nicht dem Gemeinwillen folgen, sondern können ihm sogar zuwiderlaufen und so die staatliche Ordnung gefährden. Es ist für Rousseau wesentlich, dass es einen allgemeinen Konsens gibt, der sich bildet, und zwar aufgrund der gesellschaftlichen Gesamtsituation, vernünftig und einsichtig und nicht aufgrund von Partikularinteressen, die den Staat als Zweckgemeinschaft ansehen. Berühmt sind die ersten Sätze des Buches:
Der Mensch wird frei geboren, und überall ist er in Banden. Mancher hält sich für den Herrn seiner Mitmenschen und ist trotzdem mehr Sklave als sie. Wie hat sich diese Umwandlung zugetragen? Ich weiß es nicht. Was kann ihr Rechtmäßigkeit verleihen? Diese Frage glaube ich beantworten zu können.
Hier offeriert Rousseau einen Ausweg aus der Ungerechtigkeit, mittels eines ausgeklügelten und durchdachten Systems. Wie gesagt: die Gedanken sind bis heute von Relevanz, werden aber auch nach wie vor kritisiert bis abgelehnt. Der allgemeine Wille (volonté générale) zielt auf das Gemeinwesen ab. Doch einen Garanten, einen legitimen, vernünftigen bzw. allseits anerkannten Konsens dafür scheint es nicht zu geben. Die Schattenseiten wären die „Tyrannei der Massen“ oder eben ein Staatsozialismus. Der Einfluss dieses Werkes auf die Taktgeber der Französischen Revolution steht dennoch außer Frage.
Rousseaus Bekenntnisse, eine Sammlung von zwölf Büchern, beschreiben das, was sich für ihn an Menschlichem darstellen lässt. Dabei verfährt er offen und persönlich. Sein Vorbild sind die Confessiones des Augustinus. Sie sind ihm Maßstab für Selbstkritik und Exhibitionismus des eigenen Lebens. Darin übertrifft er Augustinus sogar. Er verfuhr nach dem Motto Juvenals: „Das Leben der Wahrheit zuliebe aufs Spiel setzen“ (Juvenal: Satiren IV, 91).
Ich werde vor den höchsten Richter treten, dies Buch in der Hand, und laut werde ich sprechen: ... Ich habe für wahr halten dürfen, was meines Wissens nach hätte wahr sein können, niemals aber etwas, von dem ich wußte, daß es falsch sei. Ich habe mich so gezeigt, wie ich gewesen bin: verächtlich und niedrig, wo ich es war, und ebenso edelmütig und groß, wo ich es war: ich habe mein Inneres so enthüllt, wie du selber es geschaut hast, ewiger Geist.2
Die Bekenntnisse sind seine Autobiografie und folgen demnach chronologisch seinen wichtigen Lebensstationen. Er beschreibt seine Reaktion auf Menschen und Geschehnisse und hält sie in literarischer Form fest. Er plädiert für eine beinahe schonungslose Offenheit. Theoretische Überlegungen machen seine Biografie greifbarer. Die Bekenntnisse stellen bis heute einen Maßstab für eine kritische Betrachtung eigenen Lebens dar.
Rousseaus Idee war es, anhand der Schilderung seines Lebens seine Versuche zur Selbstverwirklichung beispielhaft für die Öffentlichkeit darzustellen. Dies gelingt ihm in seinem letzten großen Werk, den Rêveries du promeneur solitaire (Träumereien des einsamen Spaziergängers). Jedes der zehn Kapitel umfasst einen Spaziergang mit je einem eigenen Thema. Das Buch beschreibt am persönlichen Beispiel in großer Offenheit die Bandbreite menschlicher Möglichkeiten.
Worum geht es? Das Leben erfordert Widerstand. Wer könnte das besser und genauer abbilden als Jean-Jacques Rousseau? Immer wieder erfordert es Widerstandskraft, um wieder in Einklang mit sich selbst und der Welt zu gelangen. Damit das gelingen kann, ist es möglich, etwas zu aktivieren, das man Resilienz nennt. Die eigene Resilienz im und durch den Text gespiegelt zu finden und daraus zu lernen, das soll hier kurz dargestellt werden, damit der Lesende einen eigenen Resilienz-Zugang finden kann.3
Gerade die Disharmonie fordert uns heraus, entgegenzuwirken, d.h. etwas in uns zu aktivieren, das als Resilienz bezeichnet werden kann.
Resilienz meint die „psychische Widerstandsfähigkeit“. Durch sie passe ich mich an belastende Situationen in meinem Leben an oder ich lerne, sie zu überwinden. Menschen können lernen, mit Krisensituationen umzugehen und dafür Resilienzstrategien entwickeln. Die Resilienzforschung untersucht Faktoren, die Handlungen begleiten und Lebenssituationen bestimmen.
Die Parallele zu Rousseau ist offensichtlich. Auch ihm liegen solche Gedanken nahe. Seine Spaziergänge beschreiben Krisen und Strategien, ihnen zu begegnen. Betrachtet man die in der Literatur vorgeschlagenen Lösungsansätze als Strategien, so ergibt sich das, was ich eine Resilienzstrategie nenne. Sie fußt auf der Anwendung von Resilienzfaktoren, die im Anhang dieser Einführung tabellarisch zusammengefasst aufgeführt werden. Für die Spaziergänge sind folgende Resilienzfaktoren wichtig:
Kontrollüberzeugung
(6)
4
geht davon aus, dass wir selbst Ereignisse beeinflussen können und Auslöser für Situationen sind, die als Resultat eigenen Handelns gelten.
Kohärenz
(7) bedeutet, den Zusammenhang in der Welt zu entdecken, dass alles mit allem zusammenhängt und Sinn ergibt.
Hardiness
(8) steht dafür, die eigene Widerstandskraft zu aktivieren, um die Herausforderungen zu bewältigen.
Religiosität
(9) als Resilienzfaktor drückt aus, dass es möglich ist, mittels Glauben oder Überzeugung Sinn und Zweck in der Existenz bzw. im Leben zu finden, um dem Leben besser zu begegnen ist.
Coping
(10) steht für die Bewältigung von Schicksalsschlägen, eventuell sogar deren Überwindung und die aktive Suche nach Lösungen.
5
Die Absicht von Resilienz ist es demnach, Widerstände zu erkennen und ihnen so entgegenzuwirken, dass die Harmonisierung des Lebens wieder erreicht wird. Ziel ist es hier, die Spaziergänge das Werk mittels Resilienz neu zu lesen bzw. zu betrachten. Es geht also nicht um eine philosophische oder literarische Interpretation, sondern darum, Bezüge zu sich selbst aufzuspüren. So Lesen heißt, sich für das Werk und für sich selbst zu interessieren, womit die Spaziergänge auch als „eigene“ Wegstrecken betrachtet werden. Lesen heißt, sich für das Werk und für sich selbst zu interessieren. Worum geht es also?
Der Erste Spaziergang, d. h. Kapitel eins, beginnt mit der Beschreibung des Gefühls von Einsamkeit. Rousseau erzählt, er habe keine Brüder im Geiste, keine Freunde oder Gesellschaft außer sich selbst. Er weiß warum, denn er diagnostiziert, dass die Welt um ihn herum ihn hasst und verleumden will. Er fühlt sich nicht nur missverstanden, sondern (neudeutsch): gemobbt. Das käme daher, weil er so ist, wie er ist: unbedingt ehrlich, ein wenig unbeholfen in Gesellschaft, aber geradlinig, wenn es darum geht, seine Gedanken in schriftlicher Form auszudrücken. Als unbeteiligter Leser wäre man versucht, all das „wehleidig“ zu nennen. Doch dem ist nur bedingt so. Tatsächlich wurde Rousseau wegen seiner radikalen Ansichten massiv diskreditiert und bloßgestellt, wenn auch von anderer Seite hoch geschätzt und geradezu verehrt.
Als Opernkomponist rebellierte das Orchester gegen seine Musik. Als politischer Autor wurde er zum Vorläufer des Sozialismus, indem er die Ungleichheit unter Menschen historisch zu erklären und zu begründen suchte. Sein berühmt gewordener Satz: „Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen: dies ist mein und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft“, zeigt die andere Seite des Privateigentums. Doch gerade dahin ging das Streben der Masse, nach Besitz und „eingezäuntem Reich“.
Rousseau arbeitete weiter an diesen Gedanken: „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“, so der erste Satz seines immer noch aktuellen Buches vom Gesellschaftsvertrag6. Das bedeutete einen Umsturz der derzeit bestehenden Gesellschaftsordnung. Dass er sich mit einem solch radikalen, wenn auch ehrlich beherzten Denken wenig Freunde machte, ist nachvollziehbar.
Rousseaus Selbstwertgefühl scheint in den Spaziergängen verletzt oder kaum noch vorhanden. Nur indem er seinen Widersachern das Menschliche abspricht, kann er ihre Handlungen so von sich abspalten, dass es für ihn erträglich wird. Er empfindet, dass all das Unangenehme nur da sei, weil er so ist, wie er ist. Jede Reaktion seinerseits löst eine Aktion aus und vice versa. Dieses Wissen bedroht und schützt ihn zugleich im Sinne einer Kontrollüberzeugung (6), denn es obliegt ihm, die Welt so zu sehen, wie er sie sehen will:
Ich bin aus der Ordnung der Dinge gehoben, und weiß nicht wie; ich sank in ein unverständliches Chaos, wo ich nichts sehe; und je mehr ich über meinen Zustand nachdenke, desto weniger begreif ich, wo ich bin. (35)
Die Ordnung, woraus besteht sie? Jedenfalls fällt Rousseau, wie er sich selbst beschreibt, in ein Chaos, das er nicht begreifen kann. Welche Tat löste es aus? Der Gedanke dahinter ist, die Kontrolle über sein Leben wiederzuerlangen, seine Widerstandskraft zu stärken, sodass Selbstwertgefühl (5) und Kontrollüberzeugung (6) zu Wegweisern werden. Für ihn ist es das Schicksal, das ihn leiden lässt, oftmals ohne zu wissen, warum. Am Anfang steht die Ratlosigkeit darüber, was um ihn und mit ihm vorgeht. Weder hat er das Gefühl, sein Leben bewältigen, noch sich vor Widrigkeiten schützen zu können. Sein Kohärenzgefühl (7) ist nicht nur defizitär, sondern so vermittelt er es dem Leser, völlig abhanden gekommen. Allmählich gewöhnt er sich an diesen Zustand und arrangiert sich damit, was wiederum genau der Sinn wiedergewonnener Kohärenz ist.
Alles in allem sind seine Spaziergänge auch Reflexionen darüber, was er getan hat, was er hätte tun können und welches weitere Vorgehen ihm vorschwebt. Ein Satz wie: „Ich kämpfte lange ebenso fruchtlos als heftig“ (10) scheint gnadenlos und zeigt doch eine Möglichkeit, sein Leben als das zu subsumieren, was es ist, eine Ansammlung aus Reaktionen. Nur, so wird deutlich, sind es nicht die Reaktionen allein, d. h. eine Art Kausalität, die ihn der werden ließen, der er ist. Er ist sich dessen bewusst, dass der Verstand, „daß der menschliche von den Sinnen eingeschränkte Verstand sie [die Wahrheit] nicht ganz fassen kann“ (67). Er braucht „Einsamkeit“ und „Entsagung“: „Das Werk, so ich unternahm, konnte nur in der Einsamkeit vollbracht werden …“ (60). Doch neben der Einsamkeit ist es auch das Annehmen des Schicksals, das ihn zu leben ermöglicht:
Aber ich blieb standhaft: für das erstemal in meinem Leben hatte ich Mut, und diesem Mut hab ich's zu danken, daß ich mein schreckliches Schicksal, das bald über mich kam, ertragen konnte. (61)
Und an anderer Stelle heißt es: „Nach vielen unruhigen Jahren bekam ich wieder Mut, ging in mich selbst, und dann erst lernte ich den Wert der Zuflucht kennen, die ich mir aufgespart hatte“ (64).
Allmählich wird deutlich, dass es Rousseau um die Kontrolle seines Lebens, seiner Umgebung und seiner Weltsicht geht (Kontrollüberzeugung (6), dass er das, was er ausdrücken will, nur erreichen kann, wenn er es so gestaltet, dass es Sinn macht (Kohärenzsinn, 7). Selbst wenn er immer wieder „Rückschläge“ erleidet: „Ich halte mich für weise, und ich bin der Betrogene, bin das Schlachtopfer eines eitlen Irrtums“ (65), so meint dies nicht nur das Gesagte, sondern auch, dass er wieder und wieder die Motivation findet, sich neu zu erheben, um dem Alltag, wie seinen Emotionen und Dämonen Widerstand entgegenzubringen (Hardiness, 8). Er hätte es gerne anders:
In meiner Jugend hatte ich das vierzigste Jahr als die Epoche meines Lebens festgesetzt, wo alle Bemühung, Glück zu machen, und jeder Anspruch aufhören soll. Ich hatte mich fest entschlossen, nach Erreichung dieses Alters meinen Zustand, welcher es auch immer sein möchte, nicht mehr zu ändern, sondern in den Tag zu leben, ohne mich um die Zukunft zu bekümmern. (58)
Er ist um das Ziel bemüht, das Leben bewältigen zu können (Coping, 10), und nicht daran zugrunde zu gehen. Das bedeutet bei aller Erwartung, sich dem Leben ergeben zu können, doch auch die geheime Hoffnung, es nach Wunsch gestalten zu können. Ab einem gewissen Stadium will er so leben, dass er mit sich und der Welt im Reinen ist. Wesentlich bleibt, dass er das will!
Anteil an seinen Erinnerungen hat unter anderem auch die Religiosität (9):
Als Kind, mir selbst überlassen, durch Schmeicheleien verführt, durch Eitelkeit verblendet, durch Hoffnung getäuscht, durch Not gezwungen, ward ich katholisch; aber ich blieb immer ein Christ, und nach und nach gewann mein Herz eine wahre Neigung zu meiner neuen Religion. [...] Die ländliche Einsamkeit, in der ich die Blüte meiner Jugend verlebte; die Lektüre guter Werke, der ich mich gänzlich ergab, kamen meiner natürlichen Anlage zu zärtlichen Gefühlen zu Hilfe, und machten mich andächtig, beinahe wie Fenelon. Das stille Nachdenken, das Studium der Natur, die Betrachtung des Universums zwingen einen Einsiedler, sich zum Urheber der Dinge zu erheben, und mit einer süßen Unruhe den Endzweck dessen, was er sieht, die Ursache dessen, was er fühlt, zu suchen. Da mich mein Schicksal wieder in die Welt warf, fand ich nichts mehr darin, das meinem Herzen nur einen Augenblick hätte wohltun können. (57)
Religion ist eine Möglichkeit, Sinn und Zweck im Leben zu finden (Religiosität, 9). Aber Rousseau sucht auch die Emotionen zu überwinden:
Mein Geist gewöhnte sich nach und nach daran, seine Beruhigung in meinem Gewissen zu finden, so, daß keine fremde Lehre, sei sie alt oder neu, meine Ruhe mehr stören kann. (67)
Die eigene Ruhe, die Seelenruhe, ist ein Indiz dafür, dass die Kontrolle (6) so weit gediehen ist, dass „alles“ zu schaffen sein wird (7), und dass auch das Unbeherrschbare zum Teil des Rousseauschen Systems gehört.
In einem weiteren Schritt kommt es Rousseau darauf an, sowohl Macht über sich selbst auszuüben als auch das Leben „machen zu lassen“: „Ich bin ruhig bei dieser Verfassung, und finde, nebst der Zufriedenheit mit mir selbst, die Hoffnung und das Zutrauen, dessen ich in meiner Lage bedarf.“
Rousseau lernt aus seinen Beobachtungen und durch Lektüre, wie er im Vierten Spaziergang bekennt. Er weiß, was er will:
Der Mensch, den ich wahrhaft nenne, tut gerade das Gegenteil. In ganz gleichgültigen Dingen, wo jener die Wahrheit so sehr verehrt, kümmert sie ihn wenig, und er würde sich kein Gewissen daraus machen, zur Unterhaltung einer Gesellschaft selbst Erzählungen zu erdichten, woraus kein unbilliges Urteil weder zum Nutzen oder zum Schaden irgend eines Menschen in der Welt entstehen kann. Aber er wird nie etwas denken, reden oder schreiben, was gegen Wahrheit und Billigkeit für jemanden Vorteil oder Nachteil, Achtung oder Geringschätzung, Lob oder Tadel hervorbringen könnte. Er ist gründlich wahrhaft auch gegen seinen Nutzen, wiewohl er es in gleichgültigen Dingen nicht zu scheinen trachtet. Er ist wahrhaft, weil er niemanden auführen will, weil er der Wahrheit, die ihn anklagt, eben so getreu ist, als der, die ihm Ehre bringt, weil er nie zu seinem Nutzen oder zum Schaden seines Feindes lügt (79).
Die Wahrhaftigkeit ist es, die hier erwähnt wird, also ein Zustand der Reinheit, der Seelenruhe und Gewissensruhe. Dass Rousseau solch einen Zustand in Erwägung zieht, bedeutet, dass er am System Welt leidet, dass er sich der Widerstände und Disharmonien bewusst ist, an denen er und die Gesellschaft leiden. Er spürt die Diskrepanz und die Differenz in allem und sucht etwas dagegen zu tun, indem er sich selbst leiden lässt und dieses Leiden gleichzeitig reflektiert, um es dann zu „sublimieren“.
Rousseau geht es darum, mit der Welt harmonisch und mit sich und der Gesellschaft im Reinen zu sein. In den Spaziergängen geht Rousseau dafür hart mit sich ins Gericht. Er verurteilt die kleinste Verfehlung, die Lüge, die er meist nicht aus Absicht einsetzte, aber auch den Versuch, niemandem zu schaden und damit sich selbst zu schädigen. Es schreibt: „so wenig war mir's darum zu tun, das Gute, so ich in meinem Charakter empfand, herauszustreichen“ (87). Im Mittelpunkt steht die „Wahrheitsliebe“ (87). Es sind beide Faktoren, die Wahrheit und eigene Regeln, die ihn bestimmen:
In diesen, wie in allen andern Dingen, hatte mein Temperament einen starken Einfluß auf meine Maximen: denn ich handelte nicht nach Regeln, und folgte in keinem Stuck andern Regeln, als dem Antrieb meines Naturells. Nie kam mir eine überdachte Lüge in den Sinn; ich hab nie zu meinem Vorteil gelogen, aber oft aus Scham, um mir aus einer Verlegenheit zu helfen in ganz gleichgültigen oder mich allein betreffenden Dingen. (81)
Wenn Rousseau sich keinerlei Lüge bedienen will, wenn er sich an seine Regeln hält, dann macht das deutlich, inwieweit seine Kontrollüberzeugung (6) ausgeprägt ist. Wie gesagt, er sucht die Welt ein stückweit zu beherrschen oder zumindest in seinem Sinne zu gestalten.
Er, der Autor der Bekenntnisse bekennt damit, dass sein Leben alles andere als einfach ist. Er nimmt die Menschen als Maschinen (83) wahr, was wohl meint, dass sie mit kausalem Kalkül beobachtet werden können. Und er empfindet sich selbst als maschinenhaft: „Mein Wille und mein Verstand hatten also keinen Teil an meiner Antwort, sie war bloß die maschinenmäßige Wirkung meiner Verlegenheit“ (83). Gerne wäre er unsichtbar geblieben („Wär ich unsichtbar und allmächtig, wie Gott, so wär ich auch wohltätig und gütig, wie Er.“).
Wenn er im Achten Spaziergang schreibt: „[...], denn ich halte mich an nichts mehr und stütze mich nur auf mich selbst“ (104, 39), mag dies eine späte Einsicht sein, denn Rousseau ist 65 Jahre alt. Es zeigt, dass er positives Selbstwertgefühl (5) anstrebt, was aber deshalb problematisch ist, weil die Umgebung dafür selten günstig ausfällt.
Selbstwertgefühl (5) hat den Nachteil, dass die Realität positiver gesehen wird, als sie ist. Obwohl dies bei Rousseau indirekt zutrifft, weil er die anderen in der Regel als ihm überlegen darstellt, wird er nach einer Lesart seiner Spaziergänge in eine deutliche Abwehrhaltung gegenüber dem Leben gedrängt. Selbstwertgefühl (5) sollte zur Folge haben, dass die positivere Einschätzung der umgebenden Welt aktiv gegen Disharmonie oder Widrigkeiten schützt. Für Rousseau trifft das Gegenteil zu, was er dem Leser mit dem folgenden Bild vor Augen führt:
Ein Ziegel, der vom Dache fällt, kann einen stärker verwunden, aber tut nicht so weh, als ein Stein, den eine boshafte Hand geworfen hat (139).
Kontrollüberzeugung (6) hingegen ist für Rousseau wesentlich:
Nach vielen unruhigen Jahren bekam ich wieder Mut, ging in mich selbst, und dann erst lernte ich den Wert der Zuflucht kennen, die ich mir aufgespart hatte. Überzeugt von allen Wahrheiten, die mir wichtig waren, verglich ich meine Maximen mit meiner Verfassung, und da fand ich, daß ich mir aus den unvernünftigen Urteilen der Menschen und aus den Zufällen dieses kurzen Lebens mehr gemacht hatte, als sie wirklich sind. (64)
Andererseits weiß der Philosoph Rousseau, dass Leben Veränderung bedeutet:
Auf der Erde ist alles in einer immerwährenden Bewegung. Nichts behält eine stete, bleibende Gestalt und unsre Neigungen, die sich an äußerliche Dinge heften, ändern sich notwendigerweise mit jenen. Sie sind immer vor oder hinter uns, rufen das Vergangene, das nun nicht mehr ist, zurück, oder zählen auf das Zukünftige, das oft nicht sein darf: es ist nichts Gründliches da, woran das Herz sich fesseln könnte. (97)
So weitsichtig dieser Gedanke sein mag, er verliert an Wert, wenn die Einschränkung den eigenen Pessimismus nährt:
Auch hat man hier nur vorübergehende Vergnügen, ich zweifle, ob ein dauerhaftes Glück bekannt sei. Kaum ist in unsern feurigsten Entzückungen ein Augenblick, von welchen das Herz mit Wahrheit zu uns sagen könnte ich wünschte, saß dieser Augenblick ewig währte. Wie kann man eine flüchtige Verfassung, die unser Herz noch unberuhigt und leer, die uns stets noch etwas vermissen oder verlangen läßt, Glück nennen. (97f)
Das Streben nach dauerhaftem Glück weicht dem Realismus, der in seiner Lebendigkeit nichts weiter ist, denn eine Anklage gegen sich selbst.
Aber ein Unglücklicher, der von der Gesellschaft getrennt, nichts Gutes und nützliches mehr tun kann, weder für andere noch für sich, findet in diesem Zustand einen Ersatz aller menschlichen Gückseligkeiten, die ihm weder das Schicksal noch die Menschen rauben können. (99)
Immerhin wird nun auch die Gesellschaft einbezogen. Der Einsame ahnt, dass er der Gemeinsamkeit bedarf und soziale Unterstützung (11) notwendig ist. Offensichtlich steckt hinter dieser Negativität die Sehnsucht, in die Sozialisation anderer einbezogen zu werden.
Rousseau zeichnet ein Bild von sich, dass es schwer macht, Resilienz in ihrer positiven Art zu erkennen: „Es gibt Widerwärtigkeiten, die die Seele erheben und stärken; aber es gibt auch andere, die sie darniederdrücken und abtöten: so ist die meinige.“ (79) Zwar sieht er das auch als Prüfung an, doch es häufen sich solche Urteile über andere: