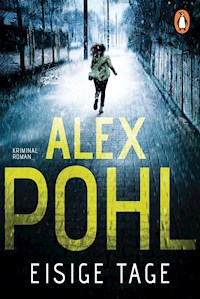
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Seiler und Novic
- Sprache: Deutsch
Die Welt des Verbrechens beginnt vor deiner Haustür ...
Winter in Leipzig, die Stadt erstarrt in Eiseskälte. In einem Auto am Elster-Saale-Kanal wird die steifgefrorene Leiche eines Anwalts gefunden. Was für die smarte Kommissarin Hanna Seiler und ihren starrköpfigen Kollegen Milo Novic zunächst nach einem Routine-Mordfall aussieht, entpuppt sich rasch als ein Dickicht krimineller Verstrickungen: Im Besitz des Toten finden sie skandalträchtiges Material, darunter das Foto eines minderjährigen Mädchens, das seit einer Woche vermisst wird. Während die Stadt im Schnee versinkt, müssen die Ermittler eine düstere Welt betreten, in der schon die Jüngsten gefährliche Spiele treiben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ALEX POHL hatte jede Menge Jobs, bevor er mit seinen Bestsellern das große Publikum eroberte – heute erreichen seine unter Pseudonym verfassten Thriller regelmäßig Auflagen in sechsstelliger Höhe. »Eisige Tage« ist der Auftakt einer neuen Krimireihe rund um den Tatort Leipzig und seine erste Veröffentlichung unter Klarnamen. Alex Pohl wohnt in Leipzig.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Alex Pohl
EISIGE TAGE
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2019 Penguin Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München.
www.ava-international.de
Umschlag: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Arcangel / Paul Bucknall; gettyimages / PhotoStock – Israel
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-22801-9V005
www.penguin-verlag.de
I never lie because I don’t fear anyone. You only lie when you’re afraid.
– John Gotti, amerikanischer Gangster
1952
Der Junge presst seine Hände so fest zusammen, dass die Knöchel grellweiß hervortreten. Aus seiner rechten Faust quillt Blut und tropft auf den Boden, aber er bemerkt es nicht einmal.
Der Hauptmann schon.
»Mach auf!«, herrscht er den Jungen an.
Der weiß erst gar nicht, was der Hauptmann meint, doch er begreift es schnell. Der erste Stiefeltritt trifft ihn am Kopf, und er geht zu Boden. Dann spürt er den Absatz des schweren Militärstiefels auf seinem Handgelenk, der Hauptmann verlagert jetzt sein ganzes Gewicht auf seinen Fuß. Irgendetwas knirscht im Arm des Jungen, dann verliert er die Kontrolle über seine Finger, und seine Faust öffnet sich. Darin liegt ein kleiner, glitzernder Gegenstand, blutverschmiert.
»Na sieh an«, sagt der Hauptmann und bückt sich, um den Gegenstand aufzuheben. Es ist eine Uhr, eine Kinderuhr, auf deren Ziffernblatt ein Panzer abgebildet ist, der gerade eine kleine Anhöhe bezwingt. Der Hauptmann wischt das Blut vom Uhrenglas und betrachtet lächelnd das Motiv. Die Spähluke des Panzers ist offen, und ein Soldat schaut heraus, das Fernglas in kämpferischer Pose gen Horizont gerichtet.
»Das ist eine schöne Uhr, Junge«, sagt er und steckt sie ein. »Mein Sohn Juri wird sich darüber freuen. Er hat bald Geburtstag, weißt du?«
Die Schmerzen im Handgelenk des Jungen sind unerträglich, er spürt seine Finger nicht mehr, nur ein dumpfes Kribbeln. Aber er vergießt keine einzige Träne, nicht eine.
Der Hauptmann zuckt mit den Schultern und steigt vom Handgelenk des Jungen. Dann dreht er sich um und geht zu der Pritsche, auf die sie seine Schwester geworfen haben. Jemand packt den Jungen am Kragen seines groben Leinenhemdes und reißt ihn auf die Beine.
»Bring ihn her«, ruft der Hauptmann dem Soldaten zu, dann grinst er den Jungen an. »Sieh dir das an, Kleiner! Vielleicht kannst du ja noch was lernen.«
Das Lachen der Soldaten antwortet dem Hauptmann, und der, der den Jungen am Kragen festhält, schleift ihn noch näher zu der Pritsche.
Der Junge versucht, sich loszureißen, doch der Griff an seinem Nacken ist unnachgiebig. Und er ist nur ein kleiner Junge.
»Halt ihn gut fest«, sagt der Hauptmann.
Nur ein kleiner, dummer Junge.
»Das hier wird dir gefallen«, sagt der Hauptmann.
Der Junge tritt nach hinten aus, erwischt überraschend etwas Weiches, und der Griff um seinen Nacken löst sich. Er reißt sich los, springt den Hauptmann an, prügelt blindlings auf ihn ein. Ein Floh, der einen Berg anspringt. Doch der Junge erwischt ihn. Einmal, zweimal, bevor sie ihn von dem Hauptmann runterzerren.
»Schafft mir dieses Vieh aus den Augen!«, tobt der Hauptmann. Ein Blutstropfen bildet sich an seiner Unterlippe, doch das ist nicht mehr als ein Kratzer.
Ein anderer Soldat packt den Jungen, schleift ihn zur Tür und wirft ihn in den Gang, wo er gegen eine Wand kracht.
»Bleib da«, sagt der Soldat, »das rate ich dir!«
Dann dreht er sich um und tritt die Tür mit dem Stiefelabsatz zu.
Jenseits der Tür beginnt seine Schwester zu schreien.
Der Junge streckt die Hand nach der Tür aus, verliert das Gleichgewicht und kippt vornüber. Ihm ist übel, etwas will seine Speiseröhre hinaufkriechen, doch da ist nichts in seinem Magen. Seit zwei Tagen nicht. Sie haben es aufgespart, in einem Versteck. Für unterwegs.
Der Junge spürt ein Kitzeln an seiner Stirn, und als er danach tastet, ist es feucht und klebrig. Er muss wohl mit dem Kopf voran gegen die Wand geprallt sein. Er wischt es fort.
Er ist immer noch benommen und kann nicht richtig sehen, doch er rappelt sich auf die Beine. Taumelt auf die Tür zu, legt die Hand auf den Türknauf, doch dann zögert er.
Blinzelt.
Bemerkt das Licht am anderen Ende des Ganges.
Wo es eine weitere Tür gibt.
Diese Tür, weiß der Junge, führt hinaus in den Hof. Der jetzt nicht bewacht ist, weil die Soldaten alle dem Hauptmann nach drinnen gefolgt sind. Da ist ein Wachhäuschen, in dem sie Decken aufbewahren, etwas zu essen. Warme Stiefel und Pistolen. Vielleicht sogar ein Gewehr. Das Wachhäuschen gehört zu einem Zaun, und jenseits dieses Zauns …
Immer noch steht der Junge reglos vor der Tür zu dem Zimmer, in dem die Soldaten sind und seine Schwester auf der Pritsche liegt. Doch sie schreit jetzt nicht mehr.
Vielleicht ist da ein leises Wimmern, aber dessen ist sich der Junge nicht sicher, durch die geschlossene Tür.
»Ich komme zurück, Mariko«, verspricht er leise. Ein Flüstern, das ungehört bleibt.
Dann wendet er sich ab. Schleicht den Gang entlang, auf die Tür zu, die hinaus auf den Hof führt, zu dem Wachhäuschen, und von dort in die Wälder.
Als er ins Freie tritt, schlägt ihm die Kälte wie eine Wand entgegen, doch er geht einfach weiter, durch den Schnee, mit nichts bekleidet als einem Paar Wollsocken und dem blutverschmierten Leinenhemd, geht einfach weiter.
Er wischt die Tränen fort und das Blut, das ihm über das Gesicht strömt, und er bemerkt, dass er seine rechte Hand nicht mehr richtig schließen kann, doch er spürt keine Schmerzen, keine Kälte.
Er spürt überhaupt nichts mehr.
TEIL I: ERSTER SCHNEE
Weg ohne Wiederkehr
12. Dezember
Leipzig, Lindenau
Er drückt die Klingel noch einmal. Lässt sie wieder los, kaum dass sie zu schellen begonnen hat. Wenn er diesmal keine Geräusche hinter der Tür hört, wird er sich umdrehen und verschwinden. Was er vermutlich längst hätte tun sollen.
Das Läuten verhallt im Inneren der Wohnung. Nichts, keine Reaktion. Dennoch bleibt er stehen. Betrachtet die rissige grüne Farbe, die von der Tür und dem Rahmen blättert. Die abgegriffene Messingklinke. Den Dreck.
Sein Blick wandert erneut zum Klingelknopf, dann seine Hand. Verharrt. Schließlich drückt er noch einmal drauf. Dann dreht er sich um, mit einem Ruck, wie um den Bann zu brechen.
Als er den Fuß auf die erste der Stufen setzt, die nach unten führen, hört er die Stimme jenseits der Tür.
»Ich komm ja schon, verdammt noch mal!«
Irgendetwas fällt im Inneren der Wohnung zu Boden. Ein gedämpfter Fluch, ein heiseres Husten, das in einen kleinen Anfall übergeht. Das muss von den Zigaretten kommen, denkt er. Unmengen von Zigaretten, die den Kerl eigentlich längst hätten ins Grab bringen müssen.
Für einen Augenblick ist er versucht, einfach davonzulaufen, die Stufen hinab. In der Hoffnung, dass ihn der andere nicht erkennt, bevor er den unteren Treppenabsatz erreicht hat und außer Sichtweite ist. Hinterherrennen wird der Kerl ihm nicht mit seiner Raucherlunge.
Aber er bleibt.
Dreht sich um. Erhascht noch einen letzten Blick auf die Reste der verwitterten, ehemals grünen Tür. Dann wird sie mit einem Ruck aufgerissen.
Ein graues Gesicht mit tief liegenden Augen starrt ihn an. Borstige Bartstoppeln, eingefallene Wangen. Der Kerl blinzelt. Noch mal. Die buschigen Brauen ziehen sich zusammen, und seine Miene verfinstert sich.
Dann: Erkennen.
Die Mundwinkel gehen beiderseits in tiefe Falten über, die aussehen, als hätte sie jemand mit einem Messer hineingeschnitzt. Daran ändert sich auch nichts, als sich die Gesichtszüge des Kerls zu so etwas wie einem Lächeln verziehen.
»Scheiße …«, bringt er hervor, und dann, nach einer Ewigkeit des ungläubigen Starrens, bittet er ihn hinein in die Schwärze und den Dreck und den Gestank von Fäulnis und nahendem Tod, der jenseits der ehemals grünen Tür auf den Besucher wartet.
»Komm rein«, sagt der Kerl, und es entgeht seinem Besucher nicht, dass er einen flüchtigen Blick ins Treppenhaus wirft, bevor er die Tür hinter ihnen beiden schließt.
Dann sitzen sie am Tisch in der Küche. Der Kerl hat einen gewaltigen Stapel schmutzstarrender Teller in die Spüle gewuchtet, um den Tisch freizuräumen. Als der Besucher versehentlich über die Tischplatte wischt, bleibt ein öliger schwarzer Film an seiner Fingerspitze zurück. Kalter Rauch hängt in der Luft wie eine Decke aus Blei. Als der Kerl sich eine neue Zigarette ansteckt, bietet er ihm auch eine an. Der Besucher nimmt sie, obwohl er eigentlich schon vor Jahren damit aufgehört hat. Er saugt den Rauch tief ein und hofft, dass das Gift in seinen Lungen hilft, den Gestank zu übertünchen.
»Ich brauche eine Waffe«, sagt er dann. Der Kerl atmet pfeifend ein und sieht ihn aus zusammengekniffenen Augen an. Beim Ausatmen scheint sich irgendwas in seiner Lunge zu lösen, und ein Hustenanfall lässt seine massige Gestalt beben.
»Scheiße …«, hustet er hervor, »eine …«
»Eine Pistole brauch ich.«
Der Kerl nickt zwischen den Eruptionen seines Hustenanfalls. Auf seinen Wangen haben sich tiefrote Flecken gebildet, was aussieht, als hätte ein Geisteskranker versucht, eine Leiche zu schminken. Der Anfall verklingt, und der Kerl nimmt einen tiefen Zug von seiner Zigarette.
»Eine Pistole«, wiederholt er nachdenklich, und für einen Moment hängt das Wort zwischen ihnen in der rauchgeschwängerten Luft. Macht sie noch etwas schwerer, noch etwas giftiger.
»Hast du Geld?«
Ja, sagt der Besucher, er habe Geld. Und dass er nichts Besonderes brauche. Nur eine Pistole und eine Ladung Munition dafür. Es heißt Magazin, verbessert ihn der Kerl, und nicht Ladung. Dann eben das, sagt der Besucher.
»Ich könnte dir eine Makarow besorgen. Russisches Fabrikat, neun Millimeter. Schon was älter, aber unverwüstlich. Kriegst du nicht kaputt, sozialistische Produktion eben.«
Jetzt grinst er, fletscht seine gelben, schief stehenden Zähne, und das lässt ihn noch ein bisschen mehr wie die Leiche aussehen, die er vermutlich schon bald sein wird. Die roten Flecken stehen immer noch auf seinen Wangen, das Grinsen ist ein Anstrich, eine reine Formalität. Der Besucher senkt den Blick auf die Tischplatte.
Dann nickt er. Ja, sagt er, und dass er die Makarow nehmen würde.
»Gute Wahl«, sagt der Kerl und kratzt sich die Brust unter der Jacke des schmutzigen Jogginganzugs, den er trägt. Dann steht er auf und geht zu einem Küchenschrank hinüber, auf dem sich leere Bierflaschen stapeln.
»Die stammt noch aus Suhl, aus dem Fahrzeugwerk ›Ernst Thälmann‹«, erklärt er, und der Besucher nickt pflichtbewusst. Aus Suhl oder vom Mond, ihm ist das völlig egal.
Der Kerl kichert, was erneut in einem Hustenanfall endet. Dann zieht er ein Schubfach auf und holt ein Päckchen daraus hervor, das er vor dem Besucher auf den Tisch legt. Er schlägt das ölfleckige Leinentuch beiseite und enthüllt eine schwarze Pistole mit dunkelbraunen Griffschalen aus Kunststoff, in die auf jeder Seite ein Stern eingeprägt ist. Der Geruch von Waffenöl schlägt dem Besucher entgegen. Als er danach greifen will, senkt sich die teigige Hand des Kerls auf die Waffe.
»Du bist dir ganz sicher damit?«, fragt er.
Der Besucher blickt ihn an. Mit Skrupel hätte er nicht gerechnet. Nicht bei dem Kerl. Dann nickt er, langsam. So als ob er sich seiner Sache wirklich sicher wäre. Oder irgendeiner Sache überhaupt. Er schmeckt die Galle, die seine Kehle heraufkriecht.
»Ist ein Weg ohne Wiederkehr, weißt du? Wenn man den einmal geht, gibt’s kein Zurück. Für die allermeisten jedenfalls nicht«, sagt der Kerl.
Unverhofft tiefgründig, findet der Besucher und nickt noch einmal. Rasch, bevor er es sich anders überlegt. Vermutlich amüsiert es den Kerl sowieso nur, eine Show daraus zu machen. Vermutlich macht er das bei jedem so.
Dann streckt der Besucher die Hand aus.
Der Kerl zuckt mit den Schultern und überlässt ihm die Waffe.
Das Mädchen
14. Dezember
Leipzig, Hauptbahnhof
Mittlerweile ist sie sicher, dass der Mann zu ihr herüberschaut. Dass er sie schon seit einer ganzen Weile beobachtet, aus dem Schatten neben dem Eingang zum Bahnhof heraus, wo er sich eine Kippe nach der anderen ansteckt. Ob er glaubt, dass sie ihn dort nicht sehen kann?
Jetzt geht er zur Straße hinüber, wartet sogar an der Fußgängerampel, obwohl das lächerlich ist, weil um diese Uhrzeit sowieso kaum noch Autos unterwegs sind. Der Mann schlingt den Mantel fester um seinen Körper, während er darauf wartet, dass die Ampel auf Grün springt. Das Mädchen weiß, was sein Ziel ist, noch bevor er sich in Bewegung setzt.
Er überquert die Straße, dann kommt er direkt auf sie zu. Sie spürt, wie ihr Puls sich beschleunigt. Warum sind ihr Kerle wie der da eigentlich früher nie aufgefallen? Weil sie nie nach ihnen Ausschau gehalten hat, lautet die ebenso simple wie einleuchtende Antwort. Manche Schatten sieht man erst, wenn man weiß, wo man hinschauen muss. Das hat sie schon vor langer Zeit begriffen.
Er setzt sich auf den freien Sitz neben sie, unter dem Vordach der Straßenbahnhaltestelle. Er schaut sie nicht an, als er zu sprechen beginnt. Dennoch ist klar, dass seine Worte nur ihr gelten können. Es ist sonst niemand in der Nähe.
»Bist du öfter hier?«, fragt er, und das Mädchen muss beinahe kichern. Sie hat schon originellere Anmachen gehört.
»Kann sein«, sagt sie. Nicht einmal abweisend. Neutral. Abwartend. Und hofft, dass er das Zittern in ihrer Stimme nicht bemerkt.
»Verstehe«, sagt der Mann.
Als ob, denkt sie.
Dann holt er eine Zigarette aus der Tasche, steckt sich den Filter in den Mund, zündet sie mit einem Feuerzeug an. Seine Bewegungen wirken irgendwie achtlos, als würde auch er nur einem vorher festgelegten Spielplan folgen. Als seine Zigarette endlich brennt, nimmt er einen tiefen Zug und stößt den Rauch in die kalte Nachtluft.
»Bekomm ich auch eine?«, fragt sie und wundert sich ein bisschen, weil er nicht von selbst auf die Idee gekommen ist, ihr eine anzubieten. Wäre doch eine prima Gelegenheit.
Der Mann erwidert nichts, aber er holt die Packung wieder aus der Innentasche seines Mantels hervor, klappt den Deckel auf und streckt sie ihr hin. Sie nimmt eine Zigarette.
Als er ihr sein Feuerzeug reichen will, sagt sie: »Für später«, und steckt sich die Kippe hinters Ohr.
Dazu muss sie die Kapuze abnehmen. Jetzt zuckt sein Blick herüber, wandert für den Bruchteil einer Sekunde über ihr Gesicht, das lange glatte Haar, bevor sie die Kapuze wieder aufsetzt. Sie weiß, dass ihm dieser eine Blick vorerst genügen wird. Sie ist hübsch, und ihr ist klar, wie sie das bei ihm einsetzen muss, es ist beinahe wie ein Instinkt. Sie liebt es, ihren Instinkten nachzugeben. Das redet sie sich zumindest ein.
Er sitzt schweigend da, zieht an seiner Kippe, und dann kommt der Moment, an dem es nicht mehr so läuft wie geplant.
Der Mann wirft die halb gerauchte Zigarette vor sich auf den Boden und macht sich nicht einmal die Mühe, sie auszutreten. Dann zieht er etwas aus seiner Manteltasche. Das Mädchen erkennt, dass er ein Foto in der Hand hält, und sie wirft einen Blick darauf. Das Foto zeigt ein Mädchen, etwa in ihrem Alter, vielleicht ein bisschen jünger. Die Kleine auf dem Foto lächelt, aber man kann sogar bei diesem miesen Licht erkennen, dass sie das ziemlich gezwungen tut. Es ist eins von diesen professionellen Porträts, wie man sie bei einem Fotografen machen lassen kann. Die Art Fotografen, die einen aus unerfindlichen Gründen immer zum Lächeln zwingen. Auch wenn einem gar nicht danach zumute ist.
»Hast du sie gesehen?«, fragt der Mann. Scheiße, denkt das Mädchen, ist der Kerl vielleicht ein Bulle? Oder ein Gestörter, also … über das zu erwartende Maß hinaus gestört, oder …
»Ich meine, hier irgendwo?«, sagt der Mann, und jetzt klingt er echt verzweifelt. Nie und nimmer ist der ein Bulle. Also ein Gestörter? Vielleicht.
Shit.
»Ist sie …« Der Mann räuspert sich. Dann versucht er es noch mal. »Ich meine, treibt sie sich hier irgendwo herum? Hast du sie gesehen?«
Das Mädchen hebt den Blick von dem Foto und schüttelt langsam den Kopf. Dabei streift sie seine Alkoholfahne. Er muss sturzbetrunken sein. Dass der überhaupt noch einigermaßen vernünftig laufen und reden kann, grenzt an ein Wunder.
»Nee«, sagt sie und rückt ein Stück von ihm weg.
Ihr Körper spannt sich, ist sprungbereit. Instinktiv. Mit dem Kerl stimmt ganz entschieden etwas nicht, und das hat nicht allein mit dem Alkohol zu tun. Es hat vor allem mit dem Foto in seiner Hand zu tun und damit, wie diese Hand jetzt zittert und wie ihm vorhin die Stimme beim Reden versagt hat und …
»Bist du sicher?«, fragt er, gleichzeitig schnellt seine Hand vor und packt ihr Handgelenk, bevor sie noch eine Chance hat, dem zu entgehen.
»Sieh es dir doch mal genau an«, jammert er und greift noch fester zu. »Bist du wirklich sicher?«
»Hey, Mann!«, schreit sie. »Lass mich los!«
»Aber …«
Sie reißt sich los und springt von ihrem Sitz auf. Er rührt sich nicht, guckt sie aus großen, feuchten Augen an, eine Hand ausgestreckt wie ein Bettler, in der anderen das Foto. Beinahe könnte man Mitleid mit ihm bekommen, aber das Mädchen weiß es besser. Ihr Instinkt sagt ihr, dass irgendetwas mit dem Kerl nicht stimmt und dass es im Moment ihre oberste Priorität sein sollte, möglichst viel Abstand zwischen sich und ihn zu bringen.
Sie greift in die Jackentasche, zieht ihr Handy hervor und hält es ans Ohr.
»Ja?«, sagt sie, obwohl niemand am anderen Ende der Leitung ist. Sie keucht, denn jetzt wummert ihr das Herz in der Brust, ihr ganzer Kopf dröhnt, sodass sie ihre eigene Stimme kaum hören kann. »Ja, ich bin noch hier, aber hier ist so ein Kerl. Oh, ihr seid gleich da? In Ordnung, ich warte.« Dann drückt sie auf das Display und beendet das fiktive Gespräch.
»Das war mein Freund«, sagt sie und geht noch einen Schritt auf Abstand. »Er und ein paar seiner Kumpels werden jeden Moment hier sein.«
Da begreift der Mann endlich. Er steht von dem Sitz auf, langsam. Ohne ein weiteres Wort dreht er sich um und entfernt sich in Richtung Ampel. Diesmal wartet er nicht, bis sie auf Grün schaltet, sondern geht gleich hinüber, um kurz darauf im Schneetreiben und in der Dunkelheit zu verschwinden.
Das Mädchen atmet erleichtert auf.
»Alles in Ordnung hier?«, fragt eine feste Stimme hinter ihr. Sie fährt herum. Die Bullen, denkt sie, weil die Stimme selbstsicher und irgendwie professionell klingt, ganz anders als die des Spinners von eben.
Verdammt, wieso hab ich die blöden Bullen nicht kommen sehen?
Es ist nicht die Polizei, sondern ein älterer Mann, der sie jetzt von oben herab anschaut. Auch er trägt einen Mantel, aber seiner sieht wesentlich teurer aus als das abgetragene Kaufhausmodell des Spinners. Und er lächelt. Sein Gesicht, leicht gerötet von der Kälte, wirkt gepflegt. Glatt rasiert. Freundlich. Sie schätzt ihn auf Ende fünfzig. In der Hand hält er einen Kaffeebecher aus Pappe, aus dem ein verführerischer Duft aufsteigt. Noch verführerischer ist allerdings das kleine Dampfwölkchen über dem Deckel des Bechers.
Alles klar, denkt sie und lächelt dem Mann zu. Viel besser.
Etwas Heißes könnte sie jetzt gut gebrauchen, und aus irgendeinem Grund pocht ihr Herz jetzt nicht mehr ganz so stark.
»Wollte der Typ was von dir?«, fragt der Mann, und ihr fällt auf, dass er das »R« ein bisschen rollt.
»Ach, das war nur so ein Spinner«, sagt sie.
»Verstehe«, sagt der Mann, lächelt und wirft einen flüchtigen Blick in Richtung Bahnhof. Dorthin, wo der andere Mann im Dunkel verschwunden ist.
Der hier bietet ihr keine Zigarette an und auch keinen Schluck von seinem Kaffee, leider. Er setzt sich auch nicht neben sie.
Er fragt: »Bist du allein?«
Sie nickt, und keiner von ihnen hört auf zu lächeln, während sie sich gegenüberstehen. Er flirtet, denkt sie, und das macht er nicht mal schlecht. Ganz beiläufig.
»Du weißt nicht, wo du hinsollst, hm?«, fragt er und lässt es wie unverbindliche Fürsorge klingen. Nicht zu bedauernd. Nur eine Frage im Vorübergehen.
»Doch, schon, na klar«, sagt sie. »Ich wohne bei einem Freund. Darf seine Wohnung benutzen, während er nicht da ist, wissen Sie?«
»Verstehe«, sagt der Mann, und sie glaubt, dass er das wirklich tut. Er macht das hier, im Gegensatz zu ihr, ganz bestimmt nicht zum ersten Mal.
Dann schweigt er eine Weile, vermutlich um ihr Zeit für den nächsten Schritt zu lassen. Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Denn bis jetzt ist das hier nur ein zufälliger Dialog zwischen einem netten Mann und einem frierenden Kind.
»Dahin war ich gerade unterwegs«, sagt sie. »Also, zu der Wohnung. Aber dann hab ich die Bahn verpasst, und die nächste ist auch nicht gekommen. Scheiß Straßenbahn.«
»Verstehe«, sagt er wieder. Sein Lächeln wird eine Winzigkeit breiter. Er hat sehr weiße Zähne.
Er sieht auf seine Armbanduhr, es ist eine goldene. Sie sieht teuer aus, bemerkt das Mädchen. Vielleicht eine Rolex. Ja, ganz bestimmt eine Rolex. Umso besser.
»Es wird keine Bahn mehr kommen«, sagt er und betritt damit nach kurzem Zögern das Drahtseil, das sie ihm soeben gespannt hat.
»Aber ich habe ein Auto.«
Natürlich hat er ein Auto, die normalste Sache der Welt, und vermutlich ein ziemlich cooles, wenn man dem Eindruck trauen darf, den sein Mantel und seine Armbanduhr erwecken. Auch wenn das vielleicht nicht erklärt, wieso er mitten in der Nacht am Bahnhof unter einem Wartehäuschen für eine Straßenbahn steht, die nie kommen wird, und ein dreizehnjähriges Mädchen anquatscht. Vermutlich könnte er das woanders sehr viel bequemer haben. Vielleicht braucht er ja den Kick oder so.
Sie nickt, langsam, als müsste sie noch überlegen.
»Ein Auto«, sagt sie dann. »Das wäre echt toll. Danke, Mann.«
»Kein Problem«, sagt er und wirft einen Blick hinüber zum Bahnhof, wo manchmal Polizisten patrouillieren. Jetzt sind keine hier.
Schließlich fragt er, immer noch lächelnd und beinahe unverbindlich: »Wie alt bist du?«
»Sechzehn«, sagt das Mädchen, und er nickt. Sie wissen beide, dass das nicht stimmt. Er dreht sich um und geht hinüber zum Parkplatz, wo vermutlich sein Wagen steht.
Sie folgt ihm.
15. Dezember
Malinowski
Leipzig, Elster-Saale-Kanal, Nähe Auensee
»Gott, es sind gerade mal fünf Grad unter null, Milo«, sagt Seiler. Sie lächelt ein bisschen, damit es nicht ganz so bemutternd wirkt. »Du siehst aus, als wolltest du nach Sibirien auswandern.«
»Mir ist kalt, Hanna«, antwortet Novic.
»Ist nicht zu übersehen«, seufzt Seiler und wendet ihren Blick wieder der Straße vor ihnen zu. Das heißt, sie versucht es. Die Scheibenwischer kommen kaum gegen die weiße Masse an, die sich auf sie herabsenkt, weich und fluffig wie Zuckerwatte, nur eine ganze Spur gefährlicher. Dennoch nimmt Hanna Seiler den Fuß kaum vom Gas, auch nicht als sie von der Straße abbiegen, um in einen schmalen Waldweg einzubiegen, der sich parallel zum Kanal tiefer in den Forst schlängelt.
»Wann haben sie ihn denn gefunden?«, will Novic wissen. Seiler glaubt zu hören, wie der Hauptkommissar ein Zähneklappern unterdrückt. Um seine Überempfindlichkeit gegenüber der Temperatur beneidet sie ihn wirklich nicht.
»Gegen sieben heute Morgen«, sagt sie. »Einer von diesen verrückten Joggern hat das Auto im Graben liegen sehen und … na ja, den Rest wirst du ja alles gleich selbst sehen.«
»Der Mann war verrückt?«, fragt Novic interessiert.
Seiler schüttelt den Kopf. »Also ehrlich, Milo. Manchmal weiß ich nicht, ob du dich über mich lustig machst. Ich meine, dass es doch verrückt ist, bei so einem Wetter morgens um sechs laufen zu gehen. Wo sich doch jeder normale Mensch in seinem warmen Bett noch mal rumdrehen würde.«
»Es soll ja gesund sein«, wendet Novic ein. »Gut für das Immunsystem.«
Und das aus seinem Mund. Sie gibt ein schnaufendes Lachen von sich. Ihres Wissens besteht Novics einzige gesundheitsfördernde Aktivität darin, gelegentlich seine Kaffeetasse zum Mund zu führen, während sie dreimal die Woche das Fitnessstudio besucht, um in Form zu bleiben, und jeden Morgen kalt duscht. Manchmal, wenn sie den spindeldürren Novic betrachtet, fragt sie sich trotzdem, wozu das alles eigentlich gut sein soll.
Als sie um eine Baumgruppe biegen, sehen sie schon den Krankenwagen und kurz darauf auch die Autos der Kollegen im trüben Grau des Wintermorgens, beleuchtet vom gleichmäßigen Flackern eines einzelnen Blaulichts. Dann entdecken sie die Baustrahler und schließlich auch die Kollegen, kaum zu erkennen in ihren weißen Schutzanzügen, wie sie schwerfällig durch den Schnee stapfen, der die Uferböschung bedeckt. Wie Raumfahrer auf einem fremden, weißen Planeten, denkt Seiler.
»Ich bin sicher, die freuen sich wie verrückt, hier draußen sein zu dürfen«, sagt sie düster. »Wo es doch so gesund ist fürs Immunsystem.«
»Ja«, sagt Novic, der den Witz wohl nicht kapiert hat. Dann steigen sie aus. Novic setzt sich seine übergroße Fellmütze auf und zieht sie tief ins Gesicht. Das Ding lässt ihn aussehen wie ein russischer Gesandter zu Rasputins Zeiten, findet Seiler und muss kichern, was zu einem nicht unbeträchtlichen Teil an der bierernsten Miene liegt, mit der Novic unter dem Fellungetüm hervorlugt.
»Was?«, fragt Novic.
»Nichts, Zar Alexander. Schöner Hut.«
»Das ist eine M-m-m-ütze«, sagt Novic zähneklappernd. »Und sehr warm.«
»Glaub ich glatt«, sagt Seiler, dann wendet sie sich kopfschüttelnd ab. Manchmal macht sich Novic unfreiwillig selbst zur Witzfigur, zumindest bis man ihn näher kennenlernt. Falls man je in den Genuss kommt, heißt das. Ihr ist nicht entgangen, dass er müde aussieht, abgespannt, und das schon seit einer ganzen Weile. Vielleicht hat ihn ja doch mal die Grippe am Wickel, denkt Seiler mit einem Anflug von Neid, auch wenn es das erste Mal bei ihm wäre.
Oder es ist das andere, wieder mal. Und darauf wäre niemand neidisch.
Für eine Weile stehen beide am Abhang und blicken die Böschung hinunter auf den schwarzen Audi und die weißen Gestalten drumherum. Jetzt zittert Novic am ganzen Körper, trotz der Uschanka und dem marineblauen Lodenmantel, und deutet auf den Wagen. Durch klappernde Zähne presst er hervor: »Das … das war kein Unfall.«
»Der Winkel«, sagt Seiler, und Novic nickt.
Der Wagen steht fast rechtwinklig zum Ufer des Kanals. Niemand würde auf diese Weise versehentlich vom Weg abkommen. Vielmehr sieht es aus, als wäre der Wagen absichtlich die Böschung hinabgesteuert worden.
»Also wenn der im Wasser landen sollte …«, sinniert Seiler.
»… w-w-war der Fahrer jedenfalls nicht halb so gut wie du«, überrascht sie Novic mit einem Kompliment. Falls es eins war.
»Na, dann finden wir mal heraus, was dieses Manöver stattdessen bezwecken sollte. Und wieso sie uns hier überhaupt brauchen.«
Novic nickt, dann steigen sie hinunter, Novic auf seine gewohnt staksige Art, die Seiler an eine Spinne mit Muskelkater denken lässt. Sie kriegt dabei Schnee in ihre flachen Schuhe, was sie mit einem leisen Fluch quittiert. Die gefütterten Stiefel sind ihr zu warm fürs Büro und es hatte ja keiner ahnen können, dass sie ihren Tag ausgerechnet mit einem Ausflug in die Arktis beginnen würden. Neue Schuhe, irgendwas Atmungsaktives. Sie setzt es gedanklich auf ihre Einkaufsliste, gleich unter die Lego-Burg, die sich Jonas dieses Jahr zu Weihnachten wünscht, und vielleicht irgendwas Kleines für Isabelle. Oder lieber doch nicht. Sie schüttelt den Kopf und konzentriert sich wieder auf den Abstieg.
Eine der weiß gekleideten Gestalten kommt ihnen entgegen – der Erste, der sie überhaupt zur Kenntnis zu nehmen scheint, seit sie angekommen sind. An der Absperrung oben sind sie problemlos vorbeigekommen, genauso gut hätten sie Schaulustige oder Pressefotografen sein können. Dann allerdings welche mit einem ausgeprägten Hang zum Masochismus – bei diesen Temperaturen.
Es ist Weiß, der Chef der Kriminaltechnik, der erst Novic und dann Seiler die behandschuhte Rechte entgegenstreckt. Man sieht ihm an, dass er genauso gern hier draußen ist wie sie.
»Na dann«, sagt er, ohne sich mit dem obligatorischen »Guten Morgen!« oder sonstigen Nettigkeiten aufzuhalten, dann dreht er sich um und stapft ihnen voran auf das Fahrzeug zu. Der Wagen wirkt erstaunlich niedrig, was daran liegt, dass sich die Vorderreifen tief in die feuchte Erde des Flussufers gewühlt haben. Die Fahrertür steht offen, der untere Teil des Blechs ist verbeult und steckt eine Handbreit tief im Boden.
Davon abgesehen ist der Wagen noch verblüffend gut in Schuss. Es ist ein schwarzer A6 mit getönten Scheiben. Nicht das neueste Modell und ein bisschen schmutzig, aber für einen Gebrauchtwagenhändler wäre es sicher immer noch ein guter Fang.
Weiß deutet auf die offene Fahrertür oder vielmehr ins Innere des Wagens. Der Fahrersitz und die linke Seite des Armaturenbretts sind von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Unter anderem.
»Wann ist es denn passiert?«, fragt Seiler, und Weiß zuckt mit den Schultern. »Gestern Nacht vermutlich«, sagt er dann, »oder in den frühen Morgenstunden. Ich warte noch auf die Daten vom Wetterdienst.«
Novic zieht eine kleine Taschenlampe aus der Tasche seines Mantels. Er versucht sie anzuknipsen, aber das gelingt ihm nicht gleich wegen der dicken Wollhandschuhe, die er trägt. Geduldig fummelt er weiter an dem kleinen Metallzylinder herum, bis Seiler, die inzwischen einen ihrer Handschuhe ausgezogen hat, ihm zu Hilfe kommt. Weiß schüttelt den Kopf.
Dann schauen die drei ins Innere des Wagens, das jetzt unbarmherzig vom Licht der kleinen Lampe erhellt wird.
»Scheiße …«, entfährt es Seiler.
Novic sagt gar nichts.
Der Mann liegt hingestreckt auf dem Beifahrersitz. Sein Körper ist in einer Pose erstarrt, die an einen römischen Imperator erinnert, der sich auf einer Liege räkelt, während ihn ein Jüngling mit Weintrauben füttert und ein anderer ihm mit einem Palmwedel Luft zufächert.
Wenn da nicht der Kopf wäre oder vielmehr das, was davon noch übrig ist.
Das bleiche Gesicht ist zu einem stummen Ausdruck der Überraschung verzogen, in der Unterlippe klafft ein senkrechter Riss, das Kinn ist blutbeschmiert.
Novic zeigt darauf und fragt: »Das könnte bei der Kollision passiert sein, nicht wahr?«
Seiler nickt. »Aber dazu hätte er auf dem Fahrersitz sitzen müssen, wo das Lenkrad ist. Auf dieser Seite gibt es nichts in der richtigen Höhe. Oder er hatte das schon. Schließlich hat er sich noch das ganze Kinn vollgeblutet, bevor …«
Sie zeigt auf das Einschussloch mitten auf der Stirn des Mannes. Bevor jemand sein Herz und damit weitere Blutungen gestoppt hat.
Novic und Weiß nicken synchron.
Abgesehen von den Blutspritzern auf dem ansonsten blütenweißen Hemdkragen wirkt der Mann gepflegt, ein Geschäftsmann im besten Alter. Glatt rasiert, das grau melierte Haar links gescheitelt und im Frost erstarrt, als hätte er ein besonders kräftiges Haarwachs benutzt. Auf den Pupillen der aufgerissenen Augen haben sich ein paar Schneeflocken niedergelassen. Sie müssen einmal blau gewesen sein, bemerkt Seiler, jetzt wirken sie wie verwaschen, milchig-grau. Darüber prangt ein etwa pfenniggroßes Einschussloch, rundherum ist etwas Schmauch zu erkennen.
Aus der rötlich-grauen Masse, die großzügig auf der Rückenlehne des Fahrersitzes und dem Armaturenbrett verteilt ist, lässt sich schließen, dass der größte Teil des Hinterkopfes fehlt.
»Aus n-nächster … N-N-Nähe«, stottert Novic mit klappernden Zähnen.
»Ja«, sagt Weiß. »Kaliber neun Millimeter, wenn ich raten müsste, aber das werden wir bald genau wissen. Wenn Sie hier fertig sind, werden wir den Wagen abschleppen lassen und ihn auseinandernehmen, bis wir die Kugel gefunden haben. Sie ist definitiv hinten wieder rausgekommen, wie Sie sehen.«
Seiler wird ein bisschen bleich und wendet den Blick ab. Ihr ist eingefallen, woran sie das Muster auf dem Armaturenbrett und den Sitzbezügen erinnert. Franz hatte sich eine Zeit lang für die Gemälde von Jackson Pollock begeistert.
»Falls sich die Kugel im Wagen befindet«, wendet Novic ein.
»Ja«, sagt Weiß. »Aber davon gehe ich aus. Die Scheiben sind alle noch heil und die Karosse, soweit ich das sehen kann, auch. Und alles andere …« Er deutet auf die im Auto verteilte Hirnmasse. »Alles andere ist ja auch noch da.«
Seiler versucht, den Pollock (Rubinroter Zirkus, hieß das Bild, wenn sie sich richtig erinnert) aus ihrem Kopf zu kriegen und an etwas Erbaulicheres zu denken. Kandinsky, vielleicht. Oder zur Not Picasso.
Sie wendet sich an Weiß und fragt: »Selbstmord können wir wohl ausschließen?«
Weiß nickt düster. »Es lag keine Waffe im Wagen oder in der Nähe. So, wie er liegt, hat man ihn erst auf den Beifahrersitz gehievt, nachdem er erschossen wurde. Ergo war er nicht allein im Auto.«
»Das ist ein schöner Anzug, den der Mann anhat«, sagt Novic unvermittelt, zieht seinen rechten Fausthandschuh aus und drückt ihn Weiß in die Hand. Dann setzt er vorsichtig einen Fuß in den Einstieg und beugt sich hinein.
»Maßgefertigt, würde ich vermuten«, sagt Weiß. Novic nickt. Er beugt sich noch etwas tiefer in den Wagen, wobei er peinlich darauf achtet, weder den Leichnam noch dessen zahlreiche Hinterlassenschaften zu berühren.
»Ist aber kein neuer Anzug. An den Ellenbogen ist er ein bisschen abgenutzt«, brummt seine Stimme aus dem Wageninneren.
Als der Kopf des Kommissars mit der riesigen Fellmütze wieder auftaucht, hat er einen Kaffeebecher aus Pappe in der Hand.
»Der steckte in der Getränkehalterung«, sagt er.
Seiler fällt auf, dass Novic weiße Latexhandschuhe anhat. Die muss er schon während der Fahrt hierher unter seinen Fäustlingen getragen haben. Clever.
Novic pult den schwarzen Plastikdeckel ab, und sie schauen in den Kaffeebecher. Der Rest der gefrorenen Flüssigkeit bedeckt geradeso den Boden, ein schlammfarbener Klumpen Eis. Hädinger’s Backshop steht in geschwungenen Lettern auf der Außenseite des Bechers, darunter ein Werbespruch. »›Das Lächeln gibt’s bei uns gratis dazu!‹ Na wundervoll«, liest Seiler mit einem schiefen Grinsen vor.
Novic übergibt den Becher an Weiß, der ihn etwas unschlüssig in den ebenfalls gummierten Händen hält, bevor er ihn schließlich in einen Asservatenbeutel steckt.
»Hatte der Mann Papiere dabei?«, fragt Seiler, und Weiß zuckt mit den Schultern.
»Wir haben ihn noch nicht angerührt. Schließlich wollten wir am Tatort alles so lassen, wie wir es …«
Er verstummt, als Novic noch einmal auf Tauchfahrt geht. Diesmal stützt er sich mit einer Hand auf der Mittelkonsole ab, um besser an die Leiche auf dem Beifahrersitz heranzukommen. Dann macht er sich an dem steif gefrorenen Oberkörper zu schaffen.
Aus der Innentasche des nicht mehr ganz neuen Maßanzugs zieht er ein schwarzes Lederetui hervor. Vorsichtig legt er es auf den Fahrersitz und schlägt es auf. Es ist auch steif von der Kälte. Darin befindet sich ein Personalausweis mit einem Passfoto, das zweifellos den Toten zeigt, wenn auch in jüngeren Jahren und in deutlich besserem Zustand.
»Michail Jegorowitsch Malinowski«, liest Novic vor.
Seiler stößt die Luft geräuschvoll aus ihren Lungen und blickt dann wieder schweigend auf den Kanal hinaus. Trotz der Kälte ist alle Farbe aus ihren Wangen gewichen. Ein toter Russe, ausgerechnet. Shit.
»Hier steht«, sagt Novic, »dass er in Wolgograd geboren wurde.«
Als das keine erkennbare Reaktion bei irgendwem auslöst, schaut Novic beide Kollegen mit großen Augen an und fügt dann hinzu: »Das ist nämlich in Russland.«
Aljoscha
Leipzig, Hauptbahnhof
»Hey«, sagt sie. »Aljoscha.«
»Kiska«, sagt er und verzieht den Mund zu diesem ganz speziellen Lächeln, irgendwie mit nur einem Mundwinkel, und schaut sie an, wie nur er es kann.
Kiska heißt Kätzchen, hat er ihr erklärt. Sie mag, dass er sie so nennt. Mag es, sein Kätzchen zu sein. Immerhin ist Aljoscha beinahe sechzehn. Aber manchmal ist er trotzdem einfach wie ein großes Kind. Aber selbst dann ist er so viel cooler als die anderen Jungs, die sie kennt. Die, mit denen sie früher nach der Schule abhing. Was für Kinder.
Aljoscha ist anders, aufregend. Mit dem geht immer was ab. Er ist wie ein krasses Abenteuer. Er ist lebendig, und damit steckt er sie an. Mit ihm rumzuziehen ist ein Kick.
Und nur das zählt schließlich.
Nur der Kick.
Aljoscha drückt sich lässig von der Mauer ab, an der er gelehnt hat, dann bleibt er dort stehen. Er trägt eine ziemlich coole Lederjacke. Sie läuft auf ihn zu, nicht umgekehrt. Auch das ist völlig anders. Die anderen Jungs sind höflich zu ihr, versuchen, ihr zu gefallen. Sind nett. Langweilig. Aljoscha ist ganz das Gegenteil.
Das mag sie an ihm. Aljoscha weiß, was er will, und dabei lässt er sich von niemandem reinreden. Schon gar nicht von ihr, seiner Kiska.
Grinsend beugt er sich zu ihr herab und schließt sie in die Arme. Es sind starke Arme, das gefällt ihr. Arme, in denen sie sich geborgen fühlt. Tief atmet sie den Geruch seiner Lederjacke ein. Er tut so, als wollte er sie küssen, aber dann spürt sie seine Finger, die durch ihre Leggings nach ihrem Hintern greifen.
»Lass das!«, sagt sie und schlägt seine Hand beiseite, aber sie kichert dabei. Und wünscht sich vielleicht auch, er würde trotzdem weitermachen, wenigstens noch ein bisschen. Das hat sie sich weiß Gott oft genug vorgestellt, nachts in ihrem Bett und manchmal sogar in der Schule. Die meisten Jungs in ihrer Klasse stellen sich bestimmt noch überhaupt nichts vor, nachts in ihren Betten. Außer vielleicht irgendwelchen Kinderkram mit Prinzessinnen, die sie retten müssen.
Er geht einen Schritt zurück. Grinst. In einer gespielt entschuldigenden Geste hebt er die Hände und verschränkt sie hinter seinem Rücken. Dann beugt er sich plötzlich runter und küsst sie diesmal wirklich. Sie öffnet sofort den Mund, weil sie glaubt, dass man es so machen muss. Sie spürt, wie sich seine Lippen zu einem Lächeln verziehen, also macht sie es vermutlich richtig. Als sie diesmal seine Hände an ihren Hüften spürt, lässt sie es geschehen. Auch als sie tiefer wandern. Es kribbelt, und irgendwie ist es ungewohnt. Aber das stört sie kein bisschen. Nein, es macht sie neugierig. Und wenn sie sich jetzt ziert, merkt er das am Ende noch und hält sie für ein Kind.
Unvermittelt hört er auf, sie zu küssen, packt ihre Hand, und dann stürmt er los, zieht sie hinter sich her wie ein Gepäckstück. Sie rennen um die Ecke an der Ostseite des Bahnhofs und über den großen Parkplatz, wo die Busse stehen. Dabei lachen sie und kümmern sich nicht um das Fluchen der Passanten, die sie dabei mit Schneematsch bespritzen. Die Spießer werden sich schon wieder einkriegen. Seine kräftige Hand schließt sich groß und angenehm warm um ihre eigene. »Fick dich!«, ruft sie einem der Spießer zu. Lachend rennen sie weiter.
Später spazieren sie durch die Stadt, und sie friert jetzt ganz schön in ihren dünnen Leggings, aber das ist es wert, findet sie. Er zieht ihren Körper an seinen, um sie zu wärmen, und das ist voll süß von ihm. Ab und zu wandern seine Lippen in ihren Nacken und senden zusätzliche Schauer über ihren Rücken. Vermutlich mag er die Leggings an ihr. Ihre Eltern würden sie umbringen, wenn sie sie darin sähen. Aber ihre Eltern sehen sie nicht.
»Ey, Elise«, sagt er plötzlich, und es entgeht ihr nicht, dass er sie bei ihrem richtigen Namen genannt hat. Gott, sieht er gut aus, wie ihm das Haar so unter seiner Wollmütze in die Stirn fällt, ein bisschen feucht noch vom Schnee, der sich darin gesammelt hat. Sie könnte ihn auf der Stelle wieder küssen und am besten gar nicht damit aufhören. Vielleicht sogar mit Zunge.
»Was geht?«, fragt sie stattdessen und tut betont gelangweilt.
»Ich hab mir was Neues stechen lassen«, sagt er und grinst sie an.
»So?«, sagt sie träge. »Und?«
»Willst du’s sehen?«
Sie zuckt nur mit den Schultern. Natürlich will sie es sehen, auf der Stelle will sie das. Sie liebt seine Tattoos, damit sieht er nämlich noch männlicher aus als so schon. Die beiden Sterne auf seiner Brust unter den Schultern, die ein bisschen aussehen wie Windrosen auf einem Kompass. Sein Geburtsdatum auf der Innenseite seines Handgelenks und – am coolsten – die Wörter auf den Fingerknöcheln seiner Hände. Die sind schon krass, er sieht aus wie ein Rockstar damit. Die kyrillischen Buchstaben kann sie nicht lesen, aber er hat ihr erklärt, dass sie die Wörter »Hass« und »Liebe« ergeben. Je nachdem, hat er gesagt und sie schief angegrinst. Je nachdem.
Es kostet sie einige Anstrengung, ihre Gedanken wieder zurück in die Gegenwart zu bugsieren. Inzwischen hat Aljoscha den linken Ärmel seiner Jacke nach oben gezogen und präsentiert ihr seinen Unterarm. Da ist ein neues Tattoo, tatsächlich.
»Es ist ein bisschen verwischt, weil es noch ganz neu ist«, kommentiert Aljoscha, und sie nickt nur abwesend. Was da auf seinem Arm steht, ist nicht in kyrillischen Buchstaben geschrieben. Damit sie es lesen kann, begreift sie. Aber es ist ein russisches Wort. Kiska steht dort nämlich, und daneben liegt ein kleines Kätzchen, das sich zufrieden zusammengerollt hat, wenn es dabei auch ein bisschen schief aus der Wäsche guckt. Wer immer ihm diese Tätowierung verpasst hat, versteht offenbar mehr davon, geschwungene Buchstaben zu zeichnen als kleine Kätzchen, aber das ist nicht weiter wichtig.
»O mein Gott!«, ruft sie und ist ganz aus dem Häuschen. Vorbei ist es mit dem Cooltun.
»Für meine Kiska«, sagt er beiläufig. »Für dich.«
Da schlingt sie ihre Arme um seinen Hals und küsst ihn und öffnet ihren Mund dabei ganz besonders weit, obwohl sie es irgendwie eklig findet, wenn er seine Zunge so tief in ihren Mund schiebt wie jetzt. Aber das spielt gerade überhaupt keine Rolle. Er hat sich tätowieren lassen, nur für sie!
Als sie spürt, dass sich etwas Hartes gegen ihren Bauch drückt, dauert es einen Moment, bis sie begreift, was das sein muss. Da zuckt sie erschrocken zurück, aber dann entscheidet sie, dass auch das okay ist, und kuschelt sich wieder an ihn. Sei nicht so ein verdammtes Kind, ärgert sie sich. Immerhin hat er sich ihren Kosenamen auf den Arm tätowieren lassen. Ihren Namen. Kiska. Und das andere bedeutet eben auch irgendwie, dass er auf sie steht, na und?
Als er seine Lippen schließlich von ihren nimmt, vergräbt sie ihr Gesicht in seiner Halsbeuge und flüstert: »Ich liebe dich, Aljoscha«, und Aljoscha nickt. Dann greift er wieder nach ihrer Hand und zieht sie weiter.
»Hey, wo willst’n du hin?«, will sie wissen.
»Wirst du schon sehen«, sagt er und zieht sie einfach weiter in eine Nebenstraße hinein, auf einen kleinen Laden zu. Es ist ein Spezialgeschäft für russische Lebensmittel, erkennt Elise.
»Hast du denn Kohle?«, fragt sie.
Er schüttelt grinsend den Kopf und betritt den Laden. Drinnen geht er schnurstracks auf ein paar Regale zu, vorbei an einem älteren Typ mit einer dicken Hornbrille und kaum noch Haaren auf dem Kopf, der im Eingangsbereich hinter seiner Kasse steht. Vermutlich ist das der Besitzer.
Aljoscha nestelt am Verschluss seiner Jacke herum und öffnet sie. Es ist angenehm warm hier drin, aber sie werden wohl nicht lange bleiben dürfen. Auch Elise hat kein Geld dabei.
»Guck mal«, sagt Aljoscha. Er hat seine Jacke ein Stück beiseitegeschoben, und als Elise hinsieht, dauert es ein bisschen, bis sie begreift, was da aus dem Hosenbund seiner Jeans hervorlugt. Erschrocken schnappt sie nach Luft.
»Bist du irre?«, zischt sie. »Ist das etwa eine echte …?«
»Klar ist die echt«, sagt Aljoscha stolz. »Ist ’ne Neunmillimeter.«
»Scheiße!«, ruft Elise leise. »Willst du etwa den Laden ausrauben? Bist du verrückt? Ich meine … die haben bestimmt Kameras und …«
Aber irgendetwas in ihr findet, dass das eine echt übertrieben krasse Aktion wäre. Irgendetwas in ihr will vielleicht sogar, dass er weitermacht, wie dieser Teil von ihr auch will, dass er weitermacht, wenn er seine Hand auf ihren Hintern legt. Etwas in ihr will, dass er die Waffe zieht und … und ist es nicht so, dass ihnen in dem Alter sowieso noch nichts passieren würde? Aber dann fällt ihr ein, dass die Bullen es ihren Eltern trotzdem sagen würden, und ihr wird ganz schlecht.
»Nee, wirklich«, sagt sie, und ein flehender Ton hat sich in ihre Stimme geschlichen. »Lass uns abhauen, Aljoscha … bitte.«
»Keine Angst, Kiska«, sagt er. »Hab ich gar nicht nötig. Ich hab hier auch so das Sagen, dafür brauch ich die gar nicht. Wirst schon sehen.«
Dann schiebt er sein T-Shirt wieder über den Griff der Waffe. Aber die Jacke lässt er offen. Total gangstermäßig, wie im Film.
»Aber wozu brauchst du das Ding denn?«, fragt Elise flüsternd. Ihr ist noch immer ganz flau.
»Och, nur für den Fall«, sagt er geheimnisvoll und schließt den Reißverschluss seiner Jacke.
In ihrer Erleichterung fällt Elise erst jetzt auf, dass es wohl die Pistole war, die sie vorhin an ihrer Hüfte gespürt hat.
»Was lachst’n so blöd?«, fährt er sie an.
»Nichts«, sagt sie und zwingt sich, mit dem Lachen aufzuhören.
»Hast du Hunger, Kiska?«
»Klar. Und für einen Kaffee würd ich töten«, sagt sie, weil sie findet, dass das cool klingt. Sie hat natürlich noch nie Kaffee getrunken, aber sie weiß, dass ihre Mutter den morgens immer trinkt. Unmengen davon. Unter anderem.
»Yeah, das ist meine Bitch … äh, Kiska«, sagt er. Sie weiß, dass er diesen »Versprecher« mit voller Absicht gemacht hat. Nicht, dass es sie groß stören würde. Kätzchen oder Bitch, das ist schließlich kein allzu großer Unterschied, oder? Nicht, wenn man mit einem wie Aljoscha abhängt. Nicht, wenn man seine Kiska ist.
Sie tritt ihn scherzhaft mit ihrem Knie in den Oberschenkel, aber dabei lächelt sie. Er tut, als hätte er ihren Tritt nicht mal gespürt. Ein Tropfen löst sich von einer der Haarsträhnen, die ihm in die Stirn hängen, und zerplatzt auf seiner Wange. Beinahe wie eine einzelne Träne. Zum Sterben schön, findet sie.





























