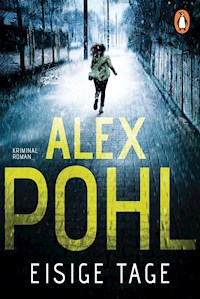7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Seiler und Novic
- Sprache: Deutsch
Ein Mord, der eine ganze Stadt entzweit
Am Ufer eines Sees südlich von Leipzig wird ein Politiker tot aufgefunden. Zunächst sieht alles nach Selbstmord aus, aber Indizien am Tatort lassen das Ermittlerduo Hanna Seiler und Milo Novic zweifeln. Durch sein soziales Engagement hatte sich der Tote viele Feinde gemacht, unter ihnen ein Bauunternehmer mit Kontakten zur rechten Szene. Schnell geraten Seiler und Novic unter Druck – sogar ihr Vorgesetzter stellt sich plötzlich gegen sie. Dass im Hintergrund weitaus gefährlichere Kräfte einen perfiden Plan verfolgen, erkennen die beiden Ermittler erst, als es schon fast zu spät ist …
+++ Alex Pohl ist Co-Autor des Nr.1-Bestsellers »Abgefackelt« von Michael Tsokos! +++
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Alex Pohl hatte jede Menge Jobs, bevor er unter anderem Namen ein riesiges Thrillerpublikum begeisterte. Mit Eisige Tageerschien 2019 der Auftakt einer neuen Krimireihe um das charakterstarke Ermittlerduo Hanna Seiler und Milo Novic – und um den Tatort Leipzig, seine Heimatstadt.
Außerdem von Alex Pohl lieferbar:
Eisige Tage
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Alex Pohl
HEISSES PFLASTER
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
1. Auflage 2020
Copyright © 2020 by Penguin Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München.
www.ava-international.de
Umschlag: bürosüd GmbH
Umschlagmotiv: Getty Images / Denis Tangney Jr.; bürosüd
Redaktion: Hannah Jarosch
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-22802-6V001
www.penguin-verlag.de
Vorwort
Alle in diesem Roman beschriebenen Personen sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt. Die meisten der in diesem Buch vorkommenden Schauplätze, Unternehmen und Behörden sind ebenfalls fiktiv, aber sie basieren teilweise auf Geschehnissen und Zusammenhängen aus der jüngeren Vergangenheit.
Ich habe mir im Zuge der Geschichte einige Freiheiten genommen, was die lokalen Gegebenheiten in und um Leipzig betrifft. So gibt es hier zum Beispiel keinen Victor-Adler-Platz, und meines Wissens wurden am Zwenkauer See bislang keine Leichen angespült.
Besetzte Häuser, Plätze und Wagenburgen gibt es hier aber durchaus. Und das ist auch gut so.
Alex Pohl
»Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht.«
– Karl Marx
»All you need to change the world is one good lie and a river of blood.«
– John Price
In Flammen
Romana
Ein greller Blitz, dann Dunkelheit.
Der Rauch ist überall, undurchdringliche Finsternis, schwer wie eine Wolldecke. Unterbrochen nur vom gierigen Schnalzen der Flammenzungen aus einem Loch, wo früher mal eine Tür war. Hitze, die sie zu ersticken droht, aber sie stolpert weiter.
Seit der ersten Detonation hat sich ein hohes Pfeifen auf ihre Gehörgänge gelegt, eine drückende Stille, die alle anderen Geräusche in den Hintergrund drängt: Schreie von Menschen oder vielleicht das Kreischen einschlagender Geschosse. Nicht zu unterscheiden.
Irgendetwas explodiert hinter ihr, instinktiv wirft sie sich auf den von Trümmerteilen übersäten Boden. Granata!
Dann regnet es neue Trümmerteile und Aschebrocken, die sich überall in ihrer Kleidung und in ihrem Haar festsetzen.
Sie kriecht weiter, denn das muss sie – weg hier um jeden Preis –, bleibt an einem scharfen Stück Metall hängen, reißt sich los und schneidet sich tief in die Handinnenfläche. Aber das bemerkt sie kaum. Später wird sie ein Tuch drumwickeln. Falls es ein Später für sie gibt.
»Milo!«, kreischt sie durch den Rauch. »Pomozi mi – hilf mir!«
Niemand hört es in dem Lärm, der sie umgibt.
Also kriecht sie weiter. Durch Trümmer, durch verbogenes Blech und verkohltes Holz und irgendwelche anderen brennenden Dinge. Brennende Menschen vielleicht. Selbst der Boden ist heiß wie eine Asphaltstraße an einem langen Sommertag.
Doch hier gibt es keinen Sommer und keine Sonne mehr. Nur schwarzen Rauch und zuckende Flammen.
Keuchend rappelt sie sich vom Boden auf, alles um sie herum beginnt zu verschwimmen, sie wischt die Tränen fort, doch das hält die Welt nicht davon ab, immer weiter aus den Fugen zu geraten. Alles dreht sich um sie herum. Tiefschwarz und Feuerrot im immer schneller werdenden Kreisel.
Schreie und keuchendes Husten sind jetzt überall zu hören. Irgendwo rechts von ihr erwacht eine Flamme brüllend zum Leben, die Hitze versengt ihr beinahe das Gesicht.
Sie stolpert weiter.
Denn nach den Granaten kommen die Männer.
Die Soldaten.
Die Panik greift mit gierigen, nachtschwarzen Krallen nach ihr. Sie unterdrückt den übermächtigen Impuls, sich einfach hier auf den Boden zu legen, inmitten der öligen Finsternis. Sich zusammenzurollen wie ein Baby und zu warten, bis die Flammen sie endlich erreichen, ihre Lungen ganz mit ihrem schwarzen Giftatem füllen – und allem ein Ende machen.
Doch sie bleibt aufrecht, gerade so.
»Milo!«, ruft sie wieder, krächzt es aus ihrer zerschundenen Kehle. »Gdje si ti? – Wo bist du?«
Sie hört jemanden ihren Namen rufen, und das holt sie in die Realität zurück.
Keine Soldaten, keine Männer, die den Granaten folgen werden. Aber der Rauch und das Feuer sind echt.
Sie stolpert und fällt auf die Knie, während die ölige Schwärze über ihr zusammenschlägt wie die Flutwelle eines Tsunamis.
Und gleichsam stürzt das Dach der Welt ein – einer Welt, die bereits lichterloh in Flammen steht.
TEIL I:
VERWIRRUNG
Nun vernehmet die List, und wie der Fuchs sich gewendet,
Seine Frevel wieder zu decken und andern zu schaden.
Bodenlose Lügen ersann er, beschimpfte den Vater
Jenseit der Grube, beschwerte den Dachs mit großer Verleumdung,
Seinen redlichsten Freund, der ihm beständig gedienet.
So erlaubt’ er sich alles, damit er seiner Erzählung
Glauben schaffte, damit er an seinen Verklägern sich rächte.
– Johann Wolfgang von Goethe, Reineke Fuchs, Fünfter Gesang
10. März
14 Tage zuvor
Leipzig, Holzhausen. Grundstück der Familie Wenger
Der Geländewagen steht auffallend schräg in der Einfahrt zu Wengers Grundstück. Zum einen liegt das daran, dass Gerd Wenger das überaus dringende Bedürfnis nach Erleichterung seiner Blase verspürte, als er den SUV dort parkte, und das Manöver daher dementsprechend hastig vorantrieb. Zum anderen hatten er und seine beiden Freunde ihren kapitalen Jagderfolg natürlich gleich an Ort und Stelle mit ein wenig Zielwasser begießen müssen – was nicht unbedingt zur Verbesserung von Wengers Navigationskünsten beigetragen hatte. Ohnehin ist der Hummer aufgrund seiner schieren Größe nicht leicht in die Einfahrt zu bugsieren. Die übrigens den wesentlichen Grund dafür darstellt, dass Gerd Wenger gleich drei davon besitzt.
Der einst stolze Rothirsch, den sie zu dritt auf die Ladefläche des SUV gewuchtet haben, ruht nun zum Großteil – oder vielmehr: zu großen Teilen – in Gerd Wengers Gefriertruhe. Betsy und Karlo, die beiden Schäferhunde, laben sich an den Innereien, und der Rest liegt, in Form von saftigen Steaks, bereits auf dem Grill.
»Mordsvieh«, sagt Wenger immer wieder, während er gedankenverloren das Fleisch wendet. »Das war echt ein Mordsvieh, Leute.«
Inzwischen sind Wenger und seine beiden Jagdgenossen zu kostspieligem Single Malt in geschliffenen Kristallgläsern übergegangen. Der wärmt von innen, das Feuer von außen. Die beiden Wärmepilze, die sie aus dem Schuppen herübergeschleppt haben, tun ihr Übriges, auch wenn einer davon bedrohlich schief in der Gegend herumsteht.
»Wie die Alten«, sagt Andi etwas zusammenhanglos.
Klaus, der ältere von Wengers beiden Jagdgenossen, stimmt ihm mit einem kräftigen Nicken zu.
Die Männer sind, ebenso wie Wenger, von auffallend bulliger Statur, wenn auch deutlich durchtrainierter als der Unternehmer. Außerdem wirken beide, als wären sie immer irgendwie ein bisschen auf dem Sprung. Andi, der Jüngere von beiden, ist ein regelrechter Riese, vollgepumpt bis zum Gehtnichtmehr mit Anabolika, wie Wenger vermutet. Ein richtiger Mutant, denkt er mit einem Anflug von Neid.
Das Haar tragen die beiden zu pflegeleichten, seitlich gescheitelten Kurzhaarfrisuren, was sie ebenfalls von Wenger unterscheidet, der es vorzieht, alle zwei Wochen in Leipzigs angesagtestem Salon einen Hunderter auf den Tisch zu knallen, weil das bei seinen finanzstarken Kunden im Immobiliengeschäft besser ankommt als ein allzu militärischer Kurzhaarschnitt. Und bei den jungen Friseurinnen natürlich auch.
»Gibt nichts Besseres«, sagt Wenger und lässt offen, was genau er mit dieser Äußerung meint. Dann drischt er die Fleischgabel in ein besonders dickes Stück Fleisch, lässt sich in einen der Campingstühle fallen und wuchtet die Füße auf einen Hackklotz daneben.
»Bloß gut, dass dich die Bullen nicht angehalten haben«, sagt Andi kichernd und deutet mit einem Kopfnicken in Richtung des innovativ geparkten Geländewagens in der Einfahrt.
Wenger dreht den Kopf und macht eine wegwerfende Geste. »Und wennschon«, sagt er leichthin. »Sollen die mich doch anhalten. Kostet mich genau einen Anruf, und ich fahr weiter. Wenn du verstehst.«
»Echt?«, fragt Andi anerkennend und lacht. Er versteht.
»Du, Gerd«, sagt Klaus. »Wir haben dir was mitgebracht. Kleines Geschenk. Zur Feier des Tages.«
»So ein Quatsch!«, ruft Gerd Wenger hocherfreut. »Ich hab doch gar nicht Geburtstag, ihr Spinner!«
»Macht doch nichts.« Klaus erhebt sich grinsend.
»Wird dir gefallen«, versichert Andi augenzwinkernd.
Wenger schenkt sich Whisky nach, obwohl er das Glas noch nicht mal halb geleert hat.
Als Klaus nach einer Weile zurückkommt, lässt er im Vorbeigehen einen flachen weißen Pappkarton in Wengers Schoß fallen. Der stellt sein Kristallglas neben sich auf die Erde und dreht das Paket in den Händen.
»Was denn?«, fragt er. »Keine Schleife? Was ist’n da drin, etwa ’ne Bombe?« Er kichert ein bisschen.
»Nee.«
»Sondern?«
»Na, dein Hochzeitskleid, Prinzessin!«, erwidert Klaus, und sie brechen allesamt in brüllendes Gelächter aus.
Wenger reißt das Paket auf.
»Schöne Grüße von Spartakus«, sagt Andi, aber Wenger ist schon vollauf mit dem Paket beschäftigt.
Drinnen liegt etwas, das in rotes Seidenpapier eingeschlagen ist, richtig noble Aufmachung. Als Wenger das Seidenpapier zurückschlägt, erstarrt er förmlich. »Alter Falter, Leute«, flüstert er. »Ist die echt?«
»So echt wie deutsche Treue«, sagt Klaus. »Wirf mal einen Blick auf die Kragenspiegel. Siehst du? Leibstandarte, mein Freund. Vom Allerfeinsten.«
»Wow!« Wenger fährt ehrfürchtig mit den Fingerspitzen über die silberfarbene Stickerei am Kragen der Uniform. Betastet die silbernen Doppel-S-Runen und das Totenkopfabzeichen.
»Das ist was ganz Besonderes«, sagt Klaus.
»Für deine Sammlung«, ergänzt Andi.
»Verdammt, Leute!«, stößt Wenger atemlos hervor. »Die ist ein kleines Vermögen wert, ist euch das eigentlich klar?«
Klaus zuckt nur mit den Schultern. »Aus unseren Beständen. Alles original.«
»Alter Falter«, sagt Wenger noch einmal, dann holt er das nachtschwarze Kleidungsstück ganz aus dem Karton, dreht es andächtig hierhin und dorthin, während er es eingehend betrachtet. »Und dann noch in erstklassigem Zustand. Praktisch wie neu.«
»Oh«, sagt Klaus, »die wurde aber getragen, Gerd, und zwar im Einsatz. Da kannst du Gift drauf nehmen. Die haben eben noch auf ihre Klamotten achtgegeben damals, die Alten.«
Wenger fährt wortlos damit fort, das Textil in seinen Händen zu bestaunen. In Gedanken korrigiert er den Preis des Sammlerstücks noch ein wenig nach oben.
»Und?«, fragt Andi. »Wie sagt man da?«
Klaus wirft ihm einen drohenden Blick zu. Der Unternehmer, noch völlig gefesselt, bekommt davon nichts mit.
»Danke, du Blödmann?«, fragt Wenger gut gelaunt. »Nein, im Ernst, die ist großartig. Da habt ihr echt was gut bei mir, Jungs.«
Klaus nickt zustimmend. »Auf die alten Zeiten!«, sagt er dann, während er sein Glas in Wengers Richtung erhebt.
Vorsichtig legt dieser die Uniformjacke in die Schachtel zurück, dann greift er sich sein Whiskyglas und reckt es den beiden entgegen. »Auf die alten Zeiten!«, sagt er. »Und auf die, die bald anbrechen werden.«
»Hört, hört!«, sagt Klaus.
Dann trinken sie.
15. März
Aus der Leipziger Volkszeitung vom 15. März
Beliebter Leipziger Politiker immer noch vermisst
Leipzig. Der seit zwei Tagen vermisste Amtsleiter des Leipziger Liegenschaftsamts, Guido Ehrlich (75), bleibt nach wie vor verschwunden.
Aus Polizeikreisen verlautete, dass es bislang keine verwertbaren Hinweise zum Verbleib des Politikers gebe. Ehrlich (parteilos) hat sich seit seinem Amtseintritt für ein vielfältiges und multikulturelles Leipzig eingesetzt.
Unter anderem hat er die Kampagne »Buntes Leipzig« ins Leben gerufen, in deren Rahmen Leipziger Graffitisprayern öffentliche Flächen zur Verschönerung zur Verfügung gestellt wurden. Ehrlich wurde zuletzt in der Nähe seines Hauses in Knautnaundorf bei Leipzig, nordöstlich des Zwenkauer Sees, gesehen. Seit Freitag fehlt von ihm jede Spur.
Interimschef des Liegenschaftsamts ist derzeit Dr. Falk Giesow (42), der kürzlich aus dem Amt für Wirtschaftsförderung überwechselte. »Wir alle hier hoffen«, so Giesow, »dass es Guido Ehrlich gut geht und er baldmöglichst in sein Amt zurückkehren kann.«
Wer Hinweise zum Verbleib von Guido Ehrlich machen kann (Foto links), wende sich bitte an eine der lokalen Polizeidienststellen oder die zentrale Informationsstelle unter der Rufnummer …
17. März
1. Kapitel
Leipzig, Augustusplatz. Vor der Oper
Hanna Seiler zuckt zusammen, als es an der Scheibe klopft. Sie steckt ihr Handy weg, ringt sich ein Lächeln ab und hebt den Kopf. Dann muss sie wirklich lächeln, denn statt wie erwartet Novic zu erblicken, sieht sie nur eine überdimensionale verspiegelte Sonnenbrille. Darin erkennt sie sich selbst. Beinahe in Lebensgröße. Die Gläser lassen das Gesicht ihres Kollegen aussehen wie das eines riesigen Insekts.
Novic läuft um das Auto herum, wobei er die Arme an den Körper presst, was dem komischen Anblick irgendwie die Krone aufsetzt. Aus dem Insekt ist jetzt eine Art Taubenmensch geworden. Allerdings trägt er keine Mütze heute, was Seiler einigermaßen seltsam findet. Sie beugt sich über den Beifahrersitz und öffnet ihm die Tür. Kurz darauf lässt er sich neben ihr in die Polster fallen. Hastig schließt er die Tür und schnappt nach Luft, als hätte er die Luft angehalten, bis er das sichere Innere des Autos erreicht hat.
»Morgen, Milo«, sagt Seiler, und er nickt ein paarmal hastig in ihre Richtung, während er versucht, zu Atem zu kommen. »Schöne Brille.«
»Die Sonne scheint«, sagt Novic, Herald des allzu Offensichtlichen.
»Zum ersten Mal in diesem Jahr, wie?«
Er nickt, diesmal zur Scheibe raus. Als Seiler den Wagen startet und ausparkt, beginnt er sich zu entspannen.
»Wusste gar nicht, dass sie um diese Uhrzeit schon Vorstellungen in der Oper geben«, sagt Seiler.
»Tun sie nicht«, erklärt er knapp. »Generalprobe.«
»Und da darfst du zuschauen?«, fragt sie beeindruckt.
»Zuhören«, korrigiert er. »Es ist eine Oper.«
»Verstehe.«
»Der Tontechniker ist ein Freund von mir. Er bittet mich manchmal um Hilfe beim Sound.«
»Sieh an, Milo Novic, ein Mann vieler Talente«, witzelt Seiler.
»Wir haben uns über eine Annonce in der Zeitung kennengelernt.«
Jetzt muss Seiler kichern. »Was? Wer?«
»Der Ulrich und ich. Ulrich ist der leitende Tontechniker des Opernhauses. Er wollte ein Paar Geithain RL 900 verkaufen. Das sind Hi-Fi-Boxen.«
Ja, genau. Novic und sein anderer Fimmel.
»Und das war der Anfang einer wundervollen Beziehung zwischen euch beiden.«
»Ja. Ich habe ihm die Boxen nicht abgekauft. Die sind riesengroß, und ich glaube, er wollte sie gar nicht wirklich loswerden. Manchmal treffen wir uns und hören gemeinsam Opern an. Auf seinen Geithain.«
»Und blättert dabei verträumt in alten Rundfunkzeitschriften. Süß.«
»In Hi-Fi-Magazinen«, korrigiert Novic.
Wieder mal hat Seiler keine Ahnung, ob er sie gerade auf den Arm nimmt. Aber die Vorstellung bringt sie zum Schmunzeln. Was allerdings auch an der Sonne liegen könnte. Man sieht es dem Thermometer nicht an, aber es ist ein verdammt schöner Tag. Zumindest bis jetzt.
»Wie lange darf ich dich eigentlich noch herumkutschieren, Milo?«, erkundigt sie sich, während sie sich in den morgendlichen Berufsverkehr einfädelt. Sogar der scheint heute flüssiger zu laufen als sonst.
»Übermorgen soll sie fertig sein«, erwidert er. »Der Mechaniker klang sehr zuversichtlich.«
»Zuversichtlich, ja?«, wiederholt sie grinsend. »Dir ist aber schon klar, dass die dich da ohne Ende abzocken, oder?«
»Der Preis ist in Ordnung«, behauptet er.
»Mag sein. Aber irgendwie steht der Wagen öfter in der Werkstatt als auf der Straße, findest du nicht? Und dabei kann deiner nicht mal fliegen.«
Gemeint ist Novics alter Citroën DS. Ein Modell, das eine gewisse Berühmtheit dadurch erlangte, dass es dem damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle das Leben rettete, indem es nach einem Attentat auf den Felgen der zerschossenen Räder einfach weiterfuhr. Und durch die Fantomas-Filme mit Louis de Funès, in denen der geniale Maskengauner damit durch die Gegend geflogen war. Seiler hat das recherchiert, nach einer entsprechenden Lektion seitens ihres Kollegen.
»Sie ist ein sehr guter Wagen.«
»Sie?« Seiler konzentriert sich mit hochgezogener Augenbraue auf den Verkehr. Und darauf, nicht allzu sehr zu grinsen.
»DS«, erklärt Novic mit einem Anflug von Ungeduld. »Déesse. Das bedeutet ›Göttin‹, auf Französisch. Daher ist sie weiblich.«
»Das erklärt es natürlich«, sagt Seiler.
»Es ist wegen der Hydropneumatik«, führt Novic aus. »Das ist ziemlich kompliziert. Der Hub und die Bremsen, alles hängt da dran, und die Leitungen sind ziemlich anfällig. Das Alter macht ihnen zu schaffen.«
»Verstehe«, lügt Seiler. »Und mal einen neuen Wagen kaufen, wie wäre das?«
Novic starrt sie an, als habe sie ihm soeben vorgeschlagen, dass er, wenn er das nächste Mal Hunger verspürt, doch einfach seinen linken Arm abhacken und verspeisen könnte. Jetzt muss sie doch ein bisschen grinsen. Das ist fast noch besser als die ersten Sonnenstrahlen.
»Was ist denn eigentlich los?«, fragt Novic nach einer Weile. »Der Reuter klang mal wieder, als sei es furchtbar dringend. Aber das tut er ja immer.«
Inzwischen haben sie fast die Stadtgrenze erreicht, und das, zugegeben, in eine Richtung, in der sie nur selten dienstlich unterwegs sind. Die Häuser werden weniger, die Zwischenräume größer. Ein paar Bäume hier und da.
»Weiß glaubt, er habe den Guido Ehrlich gefunden«, sagt Seiler.
»Chef des Liegenschaftsamts, seit Tagen vermisst«, murmelt Novic, und Seiler nickt anerkennend. Offenbar liest Novic also doch gelegentlich die Zeitung.
»Genau genommen heißt es Amtsleiter und nicht Chef, aber ja, um genau den geht’s.«
»Und jetzt wird er nicht mehr vermisst«, sagt er.
»Nein.« Sonst hätten sie nicht unser Dezernat verständigt. »Weiß sagt, sie hätten seinen Ausweis bei ihm gefunden. Man hat die Leiche noch recht gut identifizieren können.«
»Hm«, macht Novic und schaut zum Fenster hinaus auf die vorbeiziehende Landschaft, der die Häuschen am Stadtrand nun allmählich weichen. Lange Sonnenstrahlen funkeln verführerisch durch die Äste scheintoter Bäume.
Seiler glaubt, ein paar erste grüne Triebe zu erkennen, aber vielleicht bildet sie sich das nur ein.
»Dieser Ehrlich hatte wohl eine Menge Bewunderer?«, fragt Novic und guckt weiter der vorbeiziehenden Landschaft beim zögerlichen Erblühen zu.
»Was man so hört«, bestätigt Seiler. »Er soll sich für eine Menge unbequemer Dinge starkgemacht haben. Problematische Jugendliche, Drogensüchtige, Flüchtlinge, so was eben.«
»Merkwürdige Aufzählung«, findet Novic.
Sie nickt. »Alles Dinge, die die meisten Politiker höchstens mal für den Wahlkampf nutzen, wenn gerade kein Baby zum Küssen zur Hand ist. Und dann möglichst schnell wieder vergessen, sobald sie im Amt sind. Aber Ehrlich war da anders. Habe ich zumindest gehört.«
»Ah«, sagt Novic. »Ein Idealist.«
»Und dein Problem damit ist …?«
»Idealisten«, sagt Novic und wendet sich Seiler zu, mit seiner komischen Brille, die nun gar nicht mehr so komisch wirkt, sondern einfach nur daneben. »So fängt es meistens an. Weil es immer die Idealisten sind, denen die Leute folgen. Und dann gib einem Idealisten ein bisschen Macht und setz ihm die Idee in den Kopf, dass er mit dieser Macht etwas verändern kann am Weltgefüge. Ein paar Jahre später hast du einen Stalin, einen Mao, einen Nicolae Ceaușescu. Oder einen Milošević.«
»Oha«, sagt Seiler. »Milo Novic erklärt die hohe Politik.«
Daraufhin schweigt Novic.
»Wie geht’s Romana?«, erkundigt sie sich dann, um das Thema zu wechseln.
»Gut, glaube ich. Ich werde sie mal fragen, ob sie diesen Ehrlich kannte, wenn ich sie demnächst sehe. Wo sie doch eine von den Problemjugendlichen ist und außerdem ein Flüchtling.«
»Gott, haben wir eine Laune heute, Milo.«
Lange erwidert Novic nichts, dann: »Entschuldige. Das hab ich nicht so gemeint. Es ist nur …«
»Du kannst Politiker nicht leiden, schon kapiert.«
»Nein«, sagt Novic. »Nicht Politiker. Politik.«
Seiler nickt und verkneift sich die Bemerkung, dass sie beide, Beamtenstatus und das alles, vielleicht auch ein bisschen zu diesem Zirkus gehören, der sich Politik nennt. Der eine mehr, der andere weniger.
»Dein Lippenstift, Hanna«, sagt Novic unvermittelt.
»Was?«
»Er ist ein bisschen verschmiert.«
Seiler wirft einen Blick in den Rückspiegel. Er hat recht.
Mist.
»War ein bisschen in Hektik heute Morgen«, sagt sie hastig. »Jonas hat krank gespielt, weil sie heute irgendeine Arbeit schreiben müssen und … Na ja, du kennst ihn ja.«
Im selben Moment bekommt sie Gewissensbisse, weil sie ihren Sohn vorschiebt, der mit dem Lippenstift überhaupt nichts zu tun hatte und in Wahrheit ausgesprochen gern zur Schule geht, wie ihr Kollege nur allzu gut weiß. Er muss zumindest ahnen, wodurch sich ihr Lippenstift gelegentlich verschmiert, schließlich ist er kein Idiot. Er kann sich denken, dass sie auch nach Franz’ Tod gewisse Bedürfnisse hat. Was er allerdings nicht weiß, ist …
»Milo, ich …«, beginnt sie, dann bricht sie den Satz ab. Die verbleibende Fahrzeit würde nicht ausreichen, um das zu erklären. Vermutlich nicht mal, wenn sie dabei um den halben Globus düsen würden. Sie kann es sich ja noch nicht mal selbst erklären.
Novic nickt nur, dann guckt er wieder zum Fenster raus.
Vielleicht ist es wirklich noch zu früh für erste grüne Triebe.
2. Kapitel
Zwenkauer See, Neuseenland, am Rande von Leipzig
»Sieh an«, begrüßt sie Weiß, der Chef der Kriminaltechnik, als sie am Tatort eintreffen. »Die Dame und der Herr Ermittler. Schön, dass Sie es einrichten konnten.«
Man schüttelt sich reihum die Hände und stopft sie dann zurück in die Taschen gefütterter Jacken. Dass die Sonne scheint, macht es nicht unbedingt zu einem warmen Tag, aber zumindest verdient er auch nicht mehr das Attribut frostig. Es wird Frühling, unausweichlich. Irgendwann demnächst.
»Ich musste erst noch den Kollegen Novic abholen«, erklärt Seiler. »Sein Oldtimer wird gerade mal wieder getunt.«
»Wie überraschend«, kommentiert Weiß und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Auch er kennt die Göttin und ihre mannigfachen Altersbeschwerden.
»Ich war in der Oper«, sagt Novic.
»Wie schön für Sie. Um diese frühe Zeit?«
»Ich hatte zu viele Überstunden«, antwortet Novic und starrt am Kriminaltechniker vorbei auf den See hinaus. Wo ein Fall auf sie wartet.
»Hm«, macht Weiß. »Verstehe. Und jetzt habe ich Ihnen das schöne Abbummeln versaut, wie?«
»Nein.« Novics Mundwinkel verkrampfen sich ein bisschen. »Nicht Sie. Sondern der Herr Reuter.« Dann nimmt er seine Sonnenbrille ab. Die Sonne knallt ihm daraufhin derart heftig in die Augen, dass er sie augenblicklich zu Schlitzen verengt, während er versucht, sich an das viele Licht zu gewöhnen. Er steckt die Brille in die Tasche seines Mantels.
Irgendwie hat er den Eindruck, dass sie die Leute verwirrt, aber er weiß nicht so recht, wieso. Sie ist eine echte Vintage-Rarität, und dieser eine Kerl, Reuben, in Ocean’s Eleven trägt schließlich auch genauso eine, und keinen stört es. Vielleicht sollte er einen Rollkragenpullover dazu tragen, damit sie besser zur Geltung kommt?
»Dann darf ich Ihnen jetzt die Tour geben?«, fragt Weiß.
»Bitte«, sagt Seiler, und dann folgen sie Weiß ein Stück den Weg entlang, der neben dem Seeufer verläuft. Raureif bedeckt den sandigen Boden, vereinzelt sprießen tapfere Grasbüschel.
Besagte Tour beginnt bei einem Mann in einer Latzhose, die in kniehohen Gummistiefeln endet. Daneben sitzt ein Hund und blickt gelangweilt vor sich hin. Ganz im Gegensatz zu seinem Herrchen, dem die Nervosität ins Gesicht geschrieben steht, als sich die Polizisten nähern.
»Das ist der Herr Tschernig«, stellt Weiß vor. »Er hat ihn gefunden.«
Tschernig reißt die Hand aus seiner Hosentasche, dann stoppt er mitten in der Bewegung, sodass die Hand unentschlossen in der Luft zwischen ihnen hängt. Seiler ergreift sie. Schüttelt sie kräftig, was den Mann sichtlich erleichtert. Aber nur ein bisschen.
»Sie haben also den Körper gefunden?«, fragt Novic.
Er spricht in solchen Fällen lieber von einem Körper als von einer Leiche, und er scheut sich ein bisschen davor, die sterblichen Überreste eines Menschen noch als Person zu bezeichnen.
»Den …?« Für einen Moment guckt ihn der Mann namens Tschernig verständnislos an, dann haspelt er: »Ach so, ja. Also, eigentlich nicht ich, sondern die Luzie.«
Als ihr Name genannt wird, hebt die Hündin zu seinen Füßen kurz den Kopf, dann guckt sie wieder gelangweilt in Richtung See. Oder vielleicht schaut sie einfach immer so drein, denkt Novic.
»Ah«, sagt Novic. »Und was haben Sie hier gemacht? Sie und die Luzie?«
»Na ja, wir waren … ähm, also, dort hinten. Beim Bootssteg. Da ist sie dann ein bisschen stromern gegangen und …«
»Stromern?«, unterbricht Novic interessiert und wendet seinen Kopf in die Richtung, in die der Mann deutet. Da ragt ein verlassener Bootssteg auf das steingraue Wasser des Sees hinaus. Eine ziemlich triste Angelegenheit, findet Novic, trotz der ersten Sonnenstrahlen.
»Die Luzie hat die Gegend erkundet«, erklärt der Mann. »Vermutlich war ihr ein bisschen langweilig. Dann hat sie angeschlagen und wollte nicht wieder damit aufhören. Also hab ich nachgesehen, und … na ja, da lag er dann. Ich hab gleich die Polizei gerufen, als ich gemerkt hab, dass … also, dass er tot ist.«
»Das haben Sie gut gemacht.« Novic nickt ernst. »Außer natürlich, Sie sind der Mörder.«
»Was?«, schnappt der Mann und fährt zusammen.
Aus den Augenwinkeln sieht Novic, wie Seiler den Kopf schüttelt und sich ein Grinsen verkneifen muss. »Was haben Sie eigentlich da drüben gemacht?«, fragt er. »Beim Bootssteg?«
»Wir waren, äh … spazieren. Gassi gehen.«
»Tun Sie das immer in Gummistiefeln?«, mischt sich Seiler ein. Novic hat keine Ahnung, worauf sie damit hinauswill.
»Äh«, macht der Mann wieder, senkt den Kopf und betrachtet die Stiefel an seinen Füßen, als sähe er sie jetzt zum ersten Mal.
»Sie haben keinen Angelschein, oder?«, fragt Seiler.
Tschernig schüttelt langsam den gesenkten Kopf.
»Und Ihr Angelzeug?«
»Im Gebüsch«, flüstert der Mann, und Novic hat den Eindruck, dass er den Tränen nahe ist.
»Was kostet so ein Angelschein?«, erkundigt sich Seiler.
»So um die zweihundert Euro«, haucht der Mann. »Alles in allem.«
»Dann sollten Sie anfangen, auf einen zu sparen«, sagt sie. »Verstehen wir uns?«
Tschernig nickt eifrig, wie ein ausgescholtenes Kind.
»Haben wir die Personalien von Herrn Tschernig?«, fragt Seiler, was Weiß, der das kleine Schauspiel offenbar enorm genießt, bejaht, während er den Zeugen mit strafenden Blicken durchbohrt. »Gut. Dann können Sie jetzt nach Hause gehen, Herr Tschernig. Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir weitere Fragen haben sollten, in Ordnung?«
Der Mann nickt wieder und wendet sich hastig zum Gehen. Luzie steht auf, schüttelt sich, niest und folgt ihm dann.
»Und vergessen Sie nicht Ihr Versprechen in Bezug auf den Angelschein«, ruft ihm Seiler hinterher.
Tschernig verspricht es noch mal, dann eilt er davon, begleitet von seiner Hündin, die stoisch neben ihm hertrottet. Nur ein weiterer Tag in ihrem Hundeleben. Und für eine Weile keine morgendlichen Fischzüge in eisiger Kälte mehr. Auch gut, denkt sie vermutlich.
»Das war also der Herr Tschernig«, kommentiert Weiß grinsend. »Auf zur nächsten Attraktion.«
3. Kapitel
Der Chef der Kriminaltechnik führt sie hinunter zum Ufer, wo, umgeben von den üblichen Markierungsfähnchen, ein Leichnam liegt, halb im Wasser und halb draußen. Der Tote liegt gnädigerweise auf dem Bauch, wie Novic erleichtert feststellt. Seine Kleidung hat einen einheitlich dunklen Farbton angenommen, weil sie vollkommen mit Wasser vollgesogen ist. Die Hände und der Halsansatz stechen grellweiß daraus hervor, ebenso die Halbglatze, über der ein paar schwarze Haarsträhnen kleben, wie mit zu viel Pomade drangeklatscht.
Traurig findet Novic das, wie er da so treibt, der alte Mann, in seinen abgewetzten Cordhosen und dem mit Wasser vollgesogenen Anorak. Die Beine, deren Enden im tieferen Wasser versinken, wogen träge hin und her, als gehörten sie zu einem müden Schwimmer, der sich nur noch treiben lässt.
Sie hocken sich um die Leiche in den Ufersand, was Novic ein bisschen an Aasgeier denken lässt, über die er mal was im Fernsehen gesehen hat.
»Wir haben ihn aus dem Wasser gezogen und dann erst mal so liegen lassen«, erklärt Weiß. »Fotos haben wir auch schon gemacht, und daher würden wir ihn dann gern umgehend ins Labor schaffen, sobald Sie hier fertig sind.«
Novic nickt. »Aber so lag er im Wasser, Gesicht nach unten, ja?«
»Ja. Ich habe ihn dann mit einem der Jungs auf die Seite gedreht, um ihm den Ausweis aus der Jackentasche zu stibitzen und mir sein Gesicht anzuschauen. Schließlich wollte ich sichergehen. Kein schöner Anblick, aber …« Weiß seufzt. »Er ist es, keine Frage. Guido Ehrlich.«
»Kannten Sie ihn?«, fragt Seiler.
»Nicht wirklich«, sagt Weiß. »Hab aber jede Menge über ihn gehört. Ein Jammer, das.«
Novic nickt schweigend, dann steht er auf und geht einmal um den Leichnam herum. »Er wird immer wieder in diese Position getrieben, sehen Sie? Ans Ufer ran. Wie Treibgut.«
»Wie lange liegt er wohl schon so da?«, fragt Seiler.
»Schwer zu sagen«, gibt der Kriminaltechniker zu. »Aber ich bin sicher, er lag schon eine ganze Weile im Wasser. Zwei Tage, vielleicht auch mehr. Er ist ziemlich aufgedunsen. Aber das wird Ihnen Dr. Löwitsch genauer sagen können.«
Novic nickt. »Ja, dann kann er jetzt raus«, sagt er, und dann erheben sich auch die anderen aus ihrer Aasgeierposition.
Weiß gestikuliert zwei Mitarbeiter in Schutzanzügen heran, die den Leichnam mit vereinten Kräften aus dem Wasser ziehen und ihn anschließend auf einen schwarzen Plastiksack hieven, den sie eigens dafür mitgebracht haben. Als sie ihn umdrehen, saugt Seiler scharf die Luft ein.
In der Tat kein schöner Anblick.
»Eher zweiundsiebzig Stunden«, murmelt Novic nach einem Blick ins Gesicht der Leiche.
Seine Kollegin atmet ein paarmal kontrolliert ein und aus.
Seltsamerweise riecht Novic diesmal nichts außer einem intensiven Aroma von Seetang. Die Welt versinkt nahezu in einem moosgrünen beruhigenden Schimmer. Das faulige Gelb, das dem Körper entstammt, riecht man nur, wenn man ganz genau darauf achtet.
»Ihm fehlt ein Schuh«, stellt er fest, »der rechte.«
»Stimmt.« Weiß hockt sich wieder hin, diesmal zu Füßen des Körpers. Dann hebt er den Fuß an, der in einer mit Wasser vollgesogenen Wollsocke steckt, und dreht ihn ein wenig zur Seite. Das gibt ein quietschendes Geräusch, ein schlammiger hellbrauner Brei tröpfelt aus dem dicken Stoff der Socke. Schlamm oder Sand vom Ufer, vermutlich. »Mit dem Fuß stimmt was nicht. Der Knöchel ist ein bisschen geschwollen.«
»Gebrochen?«, fragt Seiler interessiert.
»Nein«, sagt Weiß nachdenklich. »Ich glaube nicht. Wohl eher verdreht. Aber das kann auch passieren, während der Körper im Wasser treibt. Vielleicht ist er irgendwo hängen geblieben. Wenn die Strömung stark genug ist, kann sie sogar Knochen brechen. Löwitsch wird es genauer sagen können.«
Plötzlich ist das Gelb voll da.
Novic taumelt einen Schritt zurück, lässt dabei aber die Augen nicht von der Leiche. Weshalb es ihm vermutlich als Erstem auffällt. »Da ist was in seinen Taschen.« Er deutet aus der Ferne auf die Jackentaschen des Toten, während er Daumen und Zeigefinger auf seine Nasenflügel presst.
Weiß, der immer noch zu Füßen des Toten kauert, beugt sich vor und greift in die linke Tasche, holt etwas heraus und legt es behutsam auf dem schwarzen Plastik des Leichensacks ab.
Ein rund geschliffener Kiesel, von der Form eines platt gedrückten Hühnereis.
Weiß fördert noch mehr von den Steinen zutage, in verschiedenen Größen, und dazu jede Menge feuchten Sand. Dann macht er mit der anderen Tasche weiter, mit ähnlichem Resultat. Schließlich liegen fünf Steine neben dem Toten. Weiß schickt einen seiner Mitarbeiter los, damit dieser die Kamera holt, um auch das zu fotografieren.
Als die Assistenten fertig sind, winkt Weiß die Ermittler mit Verschwörermiene zu sich heran. Beinahe so, als wolle er nicht, dass der Tote zu seinen Füßen mithört, geschweige denn seine Assistenten. »Freimaurer«, flüstert er und schaut sie dann erwartungsvoll an.
»Freimaurer?«, fragt Seiler.
»Auf diese Weise kennzeichnen sie einen, der gegen ihre Regeln verstoßen hat«, erklärt Weiß. »Das, oder sie hängen ihn kopfüber von einer Brücke.«
»Hier gibt’s aber keine Brücke«, sagt Novic, nachdem er sich intensiv umgeschaut hat, nur für den Fall.
»Die sind noch sehr aktiv«, fährt Weiß fort. »Hier in Leipzig ganz besonders. Die Freimaurer, meine ich. Das Völkerschlachtdenkmal, hm? Das kennen Sie, oder?«
Er schaut sie aus großen Augen an, wodurch er noch mehr wie ein Storch aussieht als sonst. Schließlich hat er diesen Spitznamen nicht nur wegen des seltsamen Helms, den er trägt, wenn er allmorgendlich auf seinem DDR-Moped der Marke Schwalbe auf dem Parkplatz einreitet.
»Das Völkerschlachtdenkmal?«, wiederholt Seiler. Vermutlich nur, um ihm einen Gefallen zu tun. Novic hört genau heraus, wie genervt sie von Weiß’ Verschwörungstheorie ist. Und er muss ihr recht geben, die ist Blödsinn.
»Erbaut nach Entwürfen des Berliner Architekten Bruno Schmitz, eingeweiht im Jahr 1913«, rasselt er runter in der Hoffnung, die Sache damit schnell zu beenden.
»Genau!« Weiß spießt mit seinem langen Zeigefinger in die Luft vor Seilers Brust. »Und dieser Kerl, dieser Schmitz, war ein Freimaurer, und zwar ein hochrangiger. Das ganze sogenannte Denkmal steckt voller Symbole und geheimer Botschaften.«
»Und Steine«, ergänzt Novic, worauf Seiler ein prustendes Lachen entfährt. Aber sie hält sich die Hand vor den Mund und tut so, als ob sie husten müsste. Immerhin stehen sie hier über einer Leiche. Aber wenn Weiß erst mal mit seinen Theorien anfängt … Wo er es doch besser wissen sollte.
»Okay«, sagt Seiler, als sie sich wieder beruhigt hat. »Wir werden das in unsere Ermittlungen einbeziehen, vielen Dank für den Hinweis.«
Weiß nickt ernst. Er sieht fast aus, als habe er jetzt ein bisschen Angst um sie beide.
»Die Steine hat er im See aufgesammelt«, widerspricht Novic brüsk und fängt sich damit einen verletzten Blick von Weiß ein. »Als der Körper da am Strand im Wasser getrieben ist, sind sie in seine Taschen geraten. Genau wie der Sand und der Schlamm in seiner Socke.«
»Oder er könnte sie vorher am Ufer gesammelt haben«, überlegt Seiler laut.
»Ja, ja«, sagt Weiß. »Schon möglich.« Und grummelt vielleicht etwas wie »Spielverderber«.
»Wenn wir auf weitere Hinweise auf die Machenschaften irgendwelcher Geheimgesellschaften stoßen sollten, lassen wir es Sie umgehend wissen, versprochen!«, sagt Seiler. »Oder sollten wir …« Sie schaut sich um und senkt die Stimme. »Oder sollten wir lieber in Geheimschrift kommunizieren?«
Jetzt kann sie das Grinsen nicht mehr unterdrücken, und Weiß spielt die beleidigte Leberwurst. Schließlich ist ihm ja längst klar, welche finsteren Mächte da im Hintergrund die Strippen ziehen.
»Sagen Sie nachher nur nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt«, brummt er, bevor er zu seinen Leuten am Einsatzwagen hinüberstapft, um den Abtransport der Leiche zu organisieren.
4. Kapitel
Rundkapellenweg, Knautnaundorf bei Leipzig, in der Nähe des Zwenkauer Sees
»Nicht mal ein Computer, hm?«, fragt Seiler, während sie den Blick durch Guido Ehrlichs privates Arbeitszimmer schweifen lässt. Das ist klein, aber aufgeräumt und sauber. Durch ein Doppelfenster hat man einen schönen Blick auf ein kleines Wäldchen in der Nähe. Und wenn man direkt davorsteht, auf einen Innenhof mit einem kleinen Kräutergarten.
»Na und?«, entgegnet Novic verschnupft. »Es soll ja noch Leute geben, die auch ohne diese Dinger etwas auf die Reihe bekommen. Zumindest privat.«
»Du hast aber immerhin ein Smartphone.«
»Nicht freiwillig. Reuter hat mir das Ding aufgebrummt.«
»Aber es macht dir Spaß, damit herumzuspielen.«
»Nein.«
»Aber es ist schon ganz nützlich manchmal, oder? Das Navi zum Beispiel, oder Google. Wikipedia, nein?«
»Kann schon sein«, murmelt Novic, aber Seiler ist klar, dass er ihr schon längst nicht mehr zuhört. Er ist damit beschäftigt, das Innere der Wohnung in sich aufzusaugen. Gleichsam Ehrlichs Leben, oder den Teil davon, der zum Privaten gehört. Oder auch nicht, in diesem speziellen Fall. Das Arbeitszimmer ist der größte Raum in der Wohnung, und es sieht aus, als habe Ehrlich seine meiste Freizeit hier verbracht.
»Interessant, dass du das sagst«, meint sie leise.
»Hm?«, grunzt Novic abwesend, aber seinem Blick zufolge ist er allmählich damit fertig, den Schwamm zu spielen. Allzu viel gibt es hier wirklich nicht aufzusaugen, zumindest nicht auf den ersten Blick.
»Das mit dem Privatleben, Milo. Guido Ehrlich scheint nämlich überhaupt keins gehabt zu haben, Computer hin oder her. Irgendwie traurig, findest du nicht?« Sie deutet auf das Wandbord hinter dem Schreibtisch, auf dem jede Menge Fotos stehen, die offensichtlich Jugendliche zeigen, die an Förderprojekten teilgenommen haben, Preise und strahlende Gesichter in die Kamera recken. Da sind zwei kleine Mädchen vor einer indisch anmutenden Kulisse zu sehen, die ein selbst gemaltes Schild hochhalten, auf dem in bunten Lettern das Wort Danke! steht. Patenkinder, vermutet sie.
Auf manchen Fotos ist auch Ehrlich selbst zu sehen, der fast untergeht in der Masse seiner Schützlinge, die ihn umringen. Er lächelt auf keinem der Bilder, er sieht einfach nur beschäftigt aus. Und ein bisschen auf dem Sprung, als ob er sich vor einer Fotolinse nicht so recht wohlfühlt in seiner Haut.
»Ein Idealist«, sagt Novic noch mal, und Seiler findet es fast befremdlich, wie offensichtlich er sich diesmal Mühe gibt, dieses Wort wertungsfrei auszusprechen.
»Du glaubst immer noch, dass wir ein paar Leichen in seinem Keller finden werden, oder?«, fragt sie.
Novic geht um den Schreibtisch herum, bevor er ihr antwortet. Dieser ist penibel aufgeräumt, die Mitte bis auf eine große lederne Arbeitsunterlage leer. Jede Menge Papiere gibt es, aber die sind allesamt ordentlich in mausgraue Plastikschalen eingeordnet. Eingang. Ausgang. Zu bearbeiten, steht auf kleinen Schildchen in Schreibmaschinenschrift. Daneben die Schreibmaschine selbst, eingespannt ist ein frisches, vollkommen leeres Blatt Papier. Relikte, wie auch Ehrlich allem Anschein nach eines war.
»Was die Leichen betrifft«, greift Novic ihren Faden auf, nachdem er seinen Rundgang beendet hat. »Ich habe die Erfahrung gemacht, dass letztlich jeder welche im Keller hat. Wenn man nur tief genug danach gräbt.«
Er verzichtet darauf, Seiler einen intensiven Blick zuzuwerfen, was sie aber irgendwie fast erwartet hätte. Beginnende Paranoia vermutlich, wegen des verschmierten Lippenstifts unter anderem.
Sie zieht eins der Schubfächer auf. Noch mehr Papiere, eng bedruckt mit Schreibmaschinenschrift, dann mit einem Kuli überarbeitet. Offenbar Entwürfe von Briefen, die er an seine zahlreichen Schützlinge geschickt hat. Sie nimmt den obersten Stapel raus, gräbt weiter. Am Boden der Schublade findet sie eine Schachtel Pillen, die Packung ist weiß mit einem roten Streifen an der Seite. Seiler holt sie heraus und legt sie auf die Schreibtischplatte, damit auch Novic sie sehen kann.
»Nitronal«, liest der. »Die nimmt man bei Herzproblemen und Atemnot.«
»Verschreibungspflichtig?«
»Ja«, sagt Novic und schnappt sich die Packung. »Zerbeißkapseln. Man nimmt sie nicht regelmäßig ein. Du beißt erst drauf, wenn du Schmerzen verspürst.«
»Schmerzen?«
»In der Brust zum Beispiel, oder in der linken Schulter.«
»Ah. Und die würde man verschreiben, wenn …?«
»Wenn der Patient über Symptome für einen Herzinfarkt klagt oder entsprechend vorbelastet ist. Wenn es dann akut wird, steckst du dir einfach eine von den roten Pillen in den Mund und beißt drauf. Dadurch wird der Wirkstoff direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen. So geht es am schnellsten.«
»Aha. Und dann?«
»Es weitet die Gefäße. Sehr schnell.«
»Damit das Blut wieder richtig fließen kann?«
Novic nickt. »Im Prinzip ja.« Er öffnet mit behandschuhten Fingern die Packung und schüttet den Inhalt auf den Tisch. Zwei kleine Blister. Im oberen fehlen zwei Pillen. »Wir sollten Weiß mal fragen, ob er solche auch bei der Leiche gefunden hat.«
»Gute Idee«, murmelt Seiler, dann holt sie ihr Handy hervor, pult sich umständlich den Latexhandschuh von ihrer rechten Hand und tippt eine SMS an Weiß.
Die Antwort kommt praktisch postwendend.
»Nein«, sagt Seiler. »Bei der Leiche haben sie keine Pillen gefunden.«
»Interessant«, sagt Novic. »Vielleicht.« Dann tütet er die Pillenpackung ein und macht noch ein Foto davon mit seinem Handy.
Seiler öffnet indes das nächste Schubfach. Darin liegt ein Stapel Briefe, die Absender sind allesamt diverse Spendenvereinigungen, Patenschaftsorganisationen und gemeinnützige Vereine. Alle scheinen sich bei Ehrlich für irgendetwas zu bedanken. Es sieht nicht so aus, als würde man hier unbezahlte Rechnungen oder Morddrohungen finden.
Seiler deutet auf den Stapel. »Ist dir mal der Gedanke gekommen, Milo, dass manche Leute vielleicht einfach keinen Keller haben? Und daher keine Intentionen, irgendetwas zu verstecken? Dass sie einfach nur das sind, was sie zu sein scheinen?«
»Ja«, sagt Novic. »Bis sie aus einem See gezogen werden.«
Sie schüttelt den Kopf und lässt sich seufzend auf Ehrlichs Schreibtischsessel fallen, der augenscheinlich aus demselben Zeitalter stammt wie die Schreibmaschinenschildchen an den Plastikschalen. Dann kommt ihr das irgendwie unpassend, fast pietätlos vor, und sie steht wieder auf. Sie wandert zu einem Holzglobus in der Ecke, allzu offensichtlich eine schlechte Tarnung für Ehrlichs Minibar. Als sie ihn öffnet, folgt eine weitere Enttäuschung. Statt Alkohol findet sie darin nur eine kleine, noch verschlossene Rolle Gummidrops. Beinahe ist sie geneigt, ihrem Kollegen zuzustimmen: Der Mann war fast schon zu tugendhaft, um echt sein zu können.
»Glaubst du, er könnte vielleicht Probleme gehabt haben?«, fragt sie. »Ich meine, psychischer Art.«
»Depressionen?«
»Na ja. Das alles hier erweckt den Eindruck, als habe der Mann so gut wie kein Privatleben gehabt, und das bisschen, das er hatte, hat er ausschließlich Menschen in misslichen Lagen gewidmet.«
»Und das macht ihn zum Selbstmörder?«
»Das habe ich nicht gesagt, Milo. Wir sollten es nur nicht ausschließen. Jedenfalls ist das nicht gerade ein typisches Verhalten. So für Menschen im Allgemeinen.«
»Kann sein«, sagt Novic, während er in einer weiteren Schublade wühlt. Nicht eben vorsichtig, wie Seiler auffällt.
»Entschuldige«, sagt sie. »So habe ich das nicht gemeint. Es ist nur … Ich finde das hier alles ein bisschen trist.«
»Und ich finde es wohltuend aufgeräumt«, sagt Novic. »Liegt wohl alles im Auge des Betrachters.«
»Okay«, seufzt Seiler. »Machen wir hier Schluss für heute.«
5. Kapitel
Leipzig-Connewitz
»Der Ehrlich ist tot«, sagt der Mann in der weinroten Bomberjacke, während er ein Stöckchen ins Feuer wirft.
»Was?«, fragt Romana und schmeißt ebenfalls ein Stöckchen in die Flammen.
»Guido Ehrlich. Sie haben seine Leiche gefunden.«
»Verdammt.« Sie schaut auf. »Wo denn?«
»Am Zwenkauer See. Lag da tagelang am Ufer rum, wie man hört.«
»Ach verdammt«, wiederholt Romana, dann fällt ihr auf, dass sie bisher eine ziemlich eintönige Konversation betreibt. Das liegt vor allem daran, dass es schwer zu glauben ist, was sie da hört. Ehrlich, ausgerechnet.
»Ist er …«, beginnt sie. »Ich meine, das war ein Unfall oder so, richtig? Er war ja schon ziemlich alt und …«
»Ein Unfall«, unterbricht sie der Mann und zieht eine Augenbraue hoch. »Na klar.«
Alle nennen ihn nur Bonsai, seit er hier angekommen ist. Ein dämlicher Spitzname, denn er überragt die Zweimetermarke um etliche Zentimeter. Und man sieht ihn nie ohne seine Bomberjacke, die ihn noch ein bisschen breiter und muskulöser erscheinen lässt, als er ohnehin schon ist, schöner Bonsai.
Romana hat ihn erst ein paarmal hier im besetzten Viertel gesehen, die anderen haben ihr erzählt, dass er aus Berlin stammt und für ein paar Jahre weg vom Fenster war. Was auf einige Erfahrung im kriminalistischen Bereich hindeutet oder vielmehr im kriminellen.
»Die haben ihn gestern aus dem See gefischt«, sagt Bonsai. »Was glaubst du, wie er da reingeraten ist?«
»Hm.« In der Tat findet Romana, dass es da gleich mehrere Möglichkeiten gibt. Und dass es vermutlich keine gute Idee ist, allzu voreilige Schlüsse zu ziehen. Besonders nicht, wenn es sich um Guido Ehrlich handelt.
Ein Mädchen namens Annie starrt derweil in die Flammen und tut so, als würde sie gar nicht zuhören, womit sie jedoch nur zu überspielen versucht, dass sie ihnen wie gebannt lauscht. Ganz besonders dem Typen namens Bonsai.
So hat sie sich das Ganze vermutlich nicht vorgestellt, denkt Romana, als sie zu uns gestoßen ist. In der Kälte um ein Feuer hocken und sich über jüngst verstorbene Politiker unterhalten. Romana tätschelt ihr ein bisschen den Arm. Wird schon werden, Kleine.
»Der hat da gewohnt«, meldet sich einer der anderen zu Wort. »Am Zwenkauer See. Wir waren mal auf einer Grillparty von dem, in seinem Garten.«
Das ist Jan, ein schmächtiges Jüngelchen, das die Angewohnheit hat, sich ständig irgendwelche selbst gestochenen Piercings zu verpassen. Manchmal fangen sie an zu eitern. Davon abgesehen ist er ein netter Kerl und ein zäher Bursche, wenn er es sein muss. Er spricht nicht drüber, aber Romana weiß, dass auch er schon ein paarmal einsaß, wenn auch nie für lange Zeit. Ein bisschen Diebstahl, Zerstörung öffentlichen Eigentums, wenn er ein bisschen zu viel getrunken hatte, einkassiert bei einer Demo, solche Sachen eben. Jan bleibt meistens für sich, redet nicht viel.
»Was willst’n damit sagen?«, fragt Bonsai ihn.
»Na, er könnte doch um den See spaziert und reingefallen sein oder so. Angeblich ist er gern wandern gegangen. Hab ich gehört.«
»Ja«, höhnt Bonsai. »Und dabei ist er vermutlich direkt in den See hineingewandert. Und weißt du was? Der Weihnachtsmann hat zugeschaut, und der Osterhase hat ihm dabei einen runtergeholt. Genau so muss es gewesen sein.«
Damit erntet er ein paar träge Lacher, die schnell wieder verebben.
Jan, der nicht lacht, schaut ihn eine Weile an, dann zuckt er mit den Schultern, senkt den Blick und fährt fort, mit einem Stöckchen in der Glut des Feuers zu stochern, um das sie versammelt sind. Immer wieder zuckt sein Blick dabei zu Annie hinüber, die darauf mit einem schüchternen Lächeln antwortet, wenn sie es bemerkt.
Annie ist ein hübsches Mädchen, hat kein einziges Piercing und sieht auch in jeder anderen Hinsicht aus, als wäre sie viel besser auf einem Internat aufgehoben als hier. Aber hey, denkt Romana, irgendwann haben die meisten von uns vermutlich auch mal so ausgesehen, und verurteilt wird hier keiner. Nicht wegen seines Aussehens zumindest.
»Scheiß drauf«, sagt jemand jenseits des Feuers, dessen Gesicht Romana nicht erkennen kann. »Letztlich war der auch nur ein Politiker.«
Zustimmendes Gemurmel, aber Jan schüttelt den Kopf.
»Nein«, entgegnet er. »Der Ehrlich war einer von den Guten, das könnt ihr ruhig glauben. Ich mein, ohne den wären wir schon lange nicht mehr hier.«
Jemand schnaubt verächtlich.
»Na, und wollt ihr da jetzt ’ne Schweigeminute für den einlegen, oder was?«, fragt ein dicklicher Kerl mit einem knallgrün gefärbten Irokesenschnitt. Markus, einer von den Urgesteinen hier im Kiez.
Bonsai schüttelt wieder den Kopf und starrt weiter in die Flammen. Jetzt ist da eine Härte in seinen Zügen. Oder, denkt Romana, so etwas wie Entschlossenheit. Er hebt den Kopf und guckt die Runde an, einen nach dem anderen.
»Ich sag euch, den hat jemand plattgemacht. Und genau das werden sie jetzt auch mit uns machen. Das war nämlich der Zweck der Übung. Der Ehrlich musste weg, und als Nächstes sind wir dran. Wegen der Häuser, darum geht’s hier.«
»Bullshit!«, blafft Markus. »Der war einfach nur ein alter Kerl. So was passiert eben.«
Ein Blick von Bonsai lässt ihn verstummen.
»Ich sag euch«, sagt der, »wenn wir nicht aufpassen, rücken hier demnächst die Bullen an, jagen uns raus, und dann machen sie Luxusbuden aus den Häusern rundum. Genau so.«
»Ach Quatsch!«
»Das haben sie in Plagwitz auch erst gesagt«, meldet sich Jan zu Wort.
»Es wird Zeit, dass hier mal was passiert!« Bonsai streckt sich zu seiner vollen beeindruckenden Größe. »Das ist alles, was ich dazu zu sagen hab.«
»Und wie stellst du dir das vor?«, fragt Annie mit leiser Stimme, ohne ihn dabei anzuschauen. »Also, was genau soll denn passieren?«
Bonsai mustert sie lange schweigend, dann beginnt er zu lächeln. Sie blickt vom Feuer auf und lächelt zurück. Es ist ein anderes Lächeln als das, mit dem sie Jans ungeschickten Avancen ausweicht. Ein gänzlich anderes.
»Na ja.« Bonsai scheint jetzt hauptsächlich zu Annie zu sprechen, was auch dieser nicht entgeht. »Aktiver Widerstand eben. Wir sollten dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, was da so gespielt wird hinter den Kulissen. Und zwar bevor die Stadt hier alles plattmacht und es keinen mehr interessiert.«
Das bringt ein bisschen Schwung in die anderen, die jetzt kräftig nicken und ihre Zustimmung kundtun. Aktiver Widerstand klingt gut.
Romana schüttelt den Kopf. Sosehr sie ihre Freunde mag, aber entschlossene Entscheidungen zu fällen, war noch nie die Stärke dieser Art von Gremien. Und vielleicht ist das auch ganz gut so.
»Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Aktionsplan«, sagt Markus, plötzlich ganz Feuer und Flamme von der Sache. »Und …«
»Aber was ist denn nun mit Guido Ehrlich?«, unterbricht ihn Jan, während er mit schmutzigen Fingern sein neuestes Piercing befummelt. Sein Ohr hat an der Stelle bereits eine leuchtend rote Färbung angenommen. »War das nun ein Unfall oder nicht?«
»Vielleicht sollten wir erst mal warten, was die Bullen noch rausfinden«, schlägt Romana vor.
Man antwortet ihr mit ein bisschen Gelächter, das sich standardmäßig auf die Erwähnung der Polizei bezieht, aber es kommt auch kein wirklicher Protest.
Diese Sitzung ist vertagt, denkt sie. Immerhin.
6. Kapitel
Liegenschaftsamt, Neues Rathaus Leipzig
Hanna Seiler reicht der Frau ein weiteres Taschentuch, das bezeichnenderweise aus der Vorratsbox stammt, die auf dem Schreibtisch ihres ehemaligen Vorgesetzten steht. Dem Ehrlich wäre beinahe zuzutrauen, dass er sie genau aus diesem Zweck dort stehen hatte, schießt es Novic durch den Kopf. Wie fürsorglich.
Mit einem dankbaren Nicken nimmt Martina Kreisig das Taschentuch entgegen, schnäuzt sanft hinein und benutzt es dann, um die Tränen wegzutupfen, die ihr über die Wangen laufen.
Novic lässt indes seinen Blick durch das Büro schweifen, das noch immer ganz von der Präsenz des ehrlichen Ehrlich erfüllt ist – und das vermutlich in Kürze sein Nachfolger übernehmen wird. Seltsam, findet er. Der Gedanke, es sich auf dem Schreibtischstuhl eines Toten bequem zu machen. Oder vielleicht bekommt man in einem solchen Fall ja standardmäßig eine neue Sitzgelegenheit verpasst, aus Pietätsgründen.
In mehr als einer Hinsicht gleicht dieses Büro dem Arbeitszimmer in Ehrlichs kleiner Wohnung auf geradezu frappante Weise: sauber, aufgeräumt, alles hat seinen Platz. Eine Tatsache, die den Mann in Novics Ansehen augenblicklich hatte steigen lassen, mochte sich nun Düsteres hinter seiner allzu sauberen Fassade verbergen oder nicht. Ein Workaholic reinsten Wassers – so was kann Novic verstehen.
Auch hier gibt es jede Menge Fotos. Schulkinder, Straßenkinder, Obdachlose, Besucher eines Auffangzentrums für Drogensüchtige. Ihnen allen ist gemein, dass sie etwas tun, das in ihren vom Leben gezeichneten Gesichtern seltsam deplatziert wirkt: Sie lächeln. Alle außer Ehrlich.
Ein Bild in der Mitte der Sammlung sticht besonders heraus. Darauf erkennt Novic den – ebenfalls lächelnden – Oberbürgermeister, der Ehrlich die Hand schüttelt und ihm dabei einen übergroßen Scheck überreicht. Ehrlich dagegen sieht auf diesem Foto aus, als würde er sich am liebsten irgendwo verkriechen, um nicht vor den Kameras posieren zu müssen.
Novic beugt sich vor und nimmt das Foto vom Schreibtisch, um es näher betrachten zu können. Der Scheck ist auf ein Projekt namens »Buntes Leipzig« ausgestellt. Und, erkennt er, man sieht in diesem Bild sofort, wer hier das zu küssende Baby ist und wer der Politiker, der keine Gelegenheit auslässt, es vor laufenden Kameras in die Höhe zu halten.
»Konnten Sie eigentlich gut mit Ihrem Chef?«, fragt Novic die Frau und wendet sich ihr zu. Es kommt beiläufiger heraus, als es geplant war. Auch ein bisschen zweideutiger.
Seilers Kopf ruckt herum, ein warnendes Glitzern in den Augen. Ehrlichs Sekretärin starrt ihn verständnislos aus tränenfeuchten Augen an.
»Ich meine, wie war er so?«, präzisiert Novic seine Frage. »Als Chef? Als Mensch? Wie ließ sich mit ihm arbeiten?«
»Oh«, sagt sie. »Ach so.«
Die Frau überlegt.
Schon mal gut, denkt er. Dann hat sie vermutlich nicht vor zu lügen. In dem Fall hätte sie nämlich bereits etwas vorbereitet, irgendeine Lobeshymne auswendig gelernt.
»Er war der beste Mensch, mit dem ich je zusammenarbeiten durfte«, presst die Frau mit tränenerstickter Stimme hervor.
Also doch eine Lobeshymne?
»Wie meinen Sie das genau?«, bohrt Novic weiter. Nur für den Fall, dass die Frau ihnen jetzt doch noch mit einem einstudierten Vortrag kommt.
Das tut sie nicht.
»Die Arbeit mit den Menschen, dafür hat er gelebt«, sagt sie. »Also, natürlich ist er seinen Pflichten hier im Amt nachgekommen, aber er hat sich auch immer für die Geschichte der Leute interessiert. Für ihn waren das nicht einfach nur Grundstücke und Häuser, sondern … Ich weiß nicht, für ihn war das alles ein Teil der Stadt, wie auch die Menschen, die in diesen Häusern leben, und … Entschuldigung!«
Ihre Stimme bricht, und sie wendet sich ab, um ein weiteres Mal geräuschvoll in ihr Taschentuch zu schnäuzen. Nein, entscheidet Novic, die lügt keinesfalls. Aber sie ist vielleicht ein bisschen naiv.
»Dieses Projekt«, sagt sie, als sie sich wieder einigermaßen beruhigt hat, und zeigt auf das Foto in Novics Hand. »Das war sein Herzensprojekt. ›Bunt, so will ich mein Leipzig sehen.‹ Das sagte er immer, der Gui… der Herr Ehrlich.«
»Verstehe«, sagt Novic, aber das tut er nur teilweise.
Die Frau tut ihm den Gefallen und schiebt eine Erklärung nach. »Er war immer für die Vielfalt. Er fand, dass die Stadt genau dafür stehen sollte. Dass es ihre Geschichte ist, bunt zu sein, seit die erste Handelsmesse im Mittelalter hier stattgefunden hat. Und weil die Menschen hier ’89 friedlich gegen ein Regime auf die Straße gegangen sind. Gegen Mauern und Grenzen, auf dem Papier und in den Köpfen. Menschen von überall sollten es hier schön haben, fand er. Unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und sozialen Verhältnissen.«
»Ich habe davon in der Zeitung gelesen«, sagt Seiler und deutet auf das Foto. »›Buntes Leipzig‹. Da gab es auch eine Graffitiwand, nicht wahr, Frau Kreisig?«
»Das war nur der Anfang.« Die Frau lächelt Seiler mit feuchten Augen an. »Er hat immer gesagt: ›Vandalismus ist es nur, wenn wir es dazu machen.‹ Es war ein schönes Sommerfest damals, und alle haben mitgeholfen. Es war … es war, als wäre sein Traum da schon ein kleines bisschen in Erfüllung gegangen. Bevor er …«
Wieder bricht ihre Stimme.
»Das muss schön gewesen sein«, sagt Seiler, und die Frau nickt stumm.
»Worum ging es denn da noch?«, erkundigt sich Novic. »Bei diesem bunten Leipzig? Es wird ja kaum ein bloßes Sommerfest und eine Wand voll Farbe gewesen sein.«
»Nein«, sagt die Sekretärin. »Natürlich nicht. Guido … ich meine, Herr Ehrlich hat damit natürlich noch andere Ziele verfolgt. Unter anderem ging es darum, die Städteplaner und Gentrifizierungsgegner an einen Tisch zu bekommen und …«
Novic schaut sie stirnrunzelnd an.
»Es geht darum, städtische Grundstücke in private Hand zu verkaufen.«
»Schon klar«, sagt Novic. »Aber genau das war doch seine Aufgabe, nicht wahr? Als Amtsleiter des Liegenschaftsamts?«
»Der An- und Verkauf städtischer Grundstücke und Immobilien gehört zu unserem Aufgabenbereich, ja«, sagt Frau Kreisig und holt tief Luft. »Das ist es ja, was die Sache so vertrackt macht.«
»Vertrackt?«
»Natürlich ist die Stadt daran interessiert, gewinnbringend zu verkaufen«, fährt sie fort. »Hier muss sie natürlich unternehmerisch denken.«
»Natürlich.«
»Andererseits soll sie dabei ja auch das Wohl ihrer Bürger im Auge haben.«
»Ah!«, sagt Novic. »Wie in Plagwitz!«
Die Frau legt die Stirn in Falten. »Wie meinen Sie das?«
Aha, denkt Novic, ich bin also nicht der Erste, der diesen Nerv trifft. Vielleicht ist es ja inzwischen schon ein wunder Nerv.
»Die Leute verlassen ihre Billigwohnungen in sanierungsbedürftigen Häusern«, doziert er, »welche dann an private Investoren verkauft werden. Anschließend werden diese kostspielig saniert und für ein Mehrfaches des ursprünglichen Preises vermietet. Darum geht es doch in etwa, oder? Bei der Gentrifizierung.«
»In etwa, ja. Manchmal.«
»Und ich schätze, bei so etwas ist für eine Menge Leute eine Menge Geld zu holen.«
»Schon, ja«, sagt die Frau. Ihre Tränen sind plötzlich versiegt. »Es gibt da durchaus ein paar ziemlich skrupellose Leute in der Immobilienbranche, die uns praktisch ständig in den Ohren liegen.«
»Hm. Und Ihr Chef hat sich dafür eingesetzt, dass bei dieser Art von Handel auch die Menschen nicht zu kurz kommen«, sagt er. »Also die Menschen, die sich keine Luxusmieten leisten können.« Er wirft Seiler einen vielsagenden Blick zu, den diese, ungesehen von der Sekretärin, mit einem angedeuteten Nicken quittiert.
Auch die Sekretärin nickt und fängt wieder ein bisschen zu weinen an. »Er war so ein lieber Mensch, der Guido«, erklärt sie ihrem Taschentuch.
Womit sie in Novics Augen nur einen Fakt unterstreicht: Auch ein Mann, der versucht, niemandem auf die Füße zu treten, kann sich bei diesem Eiertanz eine Menge Feinde schaffen – nicht auszuschließen, dass es sich in diesem Fall um ein paar äußerst finanzkräftige Feinde handelte. Feinde, die vielleicht auch vor einem Mord nicht zurückschrecken würden.
»Okay«, sagt Seiler. »Ich glaube, wir müssen Sie fürs Erste nicht weiter stören, Frau Kreisig. Und ich möchte Ihnen nochmals« – Seitenblick auf Novic – »unser herzliches Beileid aussprechen.«
Novic brummelt eine Zustimmung.