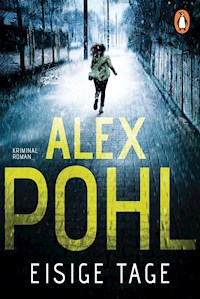7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Seiler und Novic
- Sprache: Deutsch
Eine Leiche im Wald, ein grausamer Serienmörder und die Rache für ein DDR-Verbrechen
In einem Wald in der Nähe von Leipzig werden die von Wildschweinen angefressenen Überreste eines Mannes gefunden. Was zunächst wie ein Suizid aussieht, entpuppt sich als grausame Bluttat: Dem Toten wurde kurz vor seinem Ableben eine Hand abgetrennt. Und es bleibt nicht bei diesem einen Mord. Hat es das Ermittlerduo Hanna Seiler und Milo Novic mit einem perfiden Serienkiller zu tun? Ihre Ermittlungen führen sie in die verfallene Ruine eines DDR-Kinderheims – und auf die Spur eines Verbrechens, das auch vierzig Jahre später nicht verjährt ist ...
Nach »Eisige Tage« und »Heißes Pflaster« ein fesselnder neuer Fall für Hanna Seiler und Milo Novic: Alle Bände der Reihe sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ALEX POHL begeisterte unter dem Pseudonym L. C. Frey ein riesiges Thrillerpublikum. Mit Eisige Tage, Heißes Pflaster und Stumme Hölle erscheint seit 2019 eine neue Krimireihe um das charakterstarke Ermittlerduo Hanna Seiler und Milo Novic – und um den Tatort Leipzig, seine Heimatstadt. Alex Pohl ist außerdem Teil des erfolgreichen Autorenduos Oliver Moros.
Die Seiler & Novic-Reihe in der Presse:
»Echte Typen mit echter Vergangenheit. Leipzig hat eine neue Attraktion.«
3sat Kulturzeit über Eisige Tage
»Spannend! Tatort-Fans werden dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen können.«
Inge Löhnig über Heißes Pflaster
Außerdem von Alex Pohl lieferbar:
Eisige Tage. Kriminalroman
Heißes Pflaster. Kriminalroman
Als L. C. Frey: Target. Du bist das Ziel. Thriller
Alex Pohl
STUMME HÖLLE
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München.
www.ava-international.de
Redaktion: Hannah Jarosch
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagabbildung: Getty Images, Steve Mahy, www.buerosued.de
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel GmbH, Köln
ISBN 978-3-641-26203-7V002
www.penguin-verlag.de
Vier Wochen zuvor
Südfriedhof, Leipzig
Reglos steht die Frau vor dem Grab. Eine schlichte Platte aus grauem Stein, darauf ein einzelner Name und zwei Datumsangaben. Kein Spruch, kein Auszug aus einem Gebet, keine tröstenden Worte.
Kein Bild von einem weinenden Engel.
Nur Geburt und Tod in grauem Stein.
Langsam senkt die Frau den Blick, schaut auf die Blumen in ihrer Hand, als sähe sie die zum ersten Mal. Gelbe Margeriten. Weil heute der Geburtstag einer Toten ist. Die Frau trägt einen dünnen Regenmantel, alt und schmutzig und grau wie der Stein. Oft gewaschen, gelegentlich geflickt. Der Wind zerrt daran und lässt die Schöße fliegen, doch die Frau bemerkt es nicht. In den Kronen ferner Bäume raschelt dieser Wind, doch sie hört es nicht. Gelbe Margariten, denkt sie, die hat sie immer am liebsten gehabt.
Der Wind wird sich zum Sturm erheben.
Bald schon.
Die Frau hebt den Blick und schaut hinüber zum Krematorium, hinter dem die schwarze Silhouette des Völkerschlachtdenkmals thront. Es hockt auf seinem Hügel wie ein gedrungener Riesenkönig, der auf die ganzen Toten zu seinen Füßen starrt und auf die paar Lebenden, die sich dazwischen mit müden Gliedern bewegen. Doch was kümmert das einen Giganten aus Stein?
Sie bückt sich und ächzt dabei, ihre Kniegelenke schmerzen bei jeder Bewegung. Zum Arzt geht sie nicht deswegen. Da ächzt sie lieber und erträgt es. Vorsichtig lässt sie sich auf ein Knie nieder, auch das tut höllisch weh.
Sie haucht einen Kuss auf das Sträußchen selbst gepflückter Margeriten und legt es auf die flache, schmucklose Grabplatte. Dann kommt ihr der Gedanke, dass der Wind die Blumen vielleicht wegwehen wird, also sieht sie sich nach etwas um, womit sie sie beschweren kann. Sie entdeckt ein paar flache Steine, die jemand auf dem Grab nebenan aufeinandergestapelt hat. Vielleicht ein Kind, dem langweilig war. Dieser Grabstein ist ganz neu, sieht teuer aus. Die Gravur ist mit Goldfarbe ausgemalt, und am Kopfende ist ein Relief von Dürers betenden Händen herausgemeißelt. Die Frau hat kein schlechtes Gewissen, als sie einen der flachen Steine stibitzt und ihn benutzt, um damit die Margeriten zu beschweren.
»Hab sie selbst gepflückt, im Wald hinterm Haus«, murmelt sie und kniet noch für eine kleine Weile auf dem kühlen Stein, als warte sie auf eine Reaktion. Den Wald haben sie immer gemocht, damals.
Aber da ist nur der Wind, der ihr antwortet und dabei nach Regen riecht.
Das Aufstehen ist noch schmerzvoller als das Hinknien, und als sie es endlich geschafft hat, atmet sie schwer und schwankt für einen Moment. Doch das hat nicht nur mit ihren alten Knien zu tun. Ihre Hände öffnen und schließen sich, während sie sie an ihre Seiten presst, so als würde sie einen unsichtbaren Teig kneten. Auf und zu und auf und zu, während sie sich zwingt, langsam und gleichmäßig zu atmen. Vielleicht, denkt sie mit einem Anflug trüber Sehnsucht, wird es ja irgendwann keine Blumen mehr geben. Vielleicht ist es irgendwann vorbei. Sie flüstert: »Ich lass dich nicht allein, wirst schon sehen. Am Ende werden wir wieder zusammen sein.«
Aber sie schämt sich ein bisschen, weil sie weiß, dass sie das jedes Mal sagt, wenn sie hier steht, und es schon viel zu oft dem Wind versprochen hat und den Toten, die nichts mehr hören können.
Plötzlich erträgt sie den Anblick des Grabsteins und der mickrigen, zerquetschten Blumen darauf nicht länger. Sie hebt den Kopf und blickt in den Himmel hoch, wo die Wolken jetzt nicht mehr bleigrau sind, sondern fast schwarz. Es wird ein mächtiger Sturm werden, ein zorniger, der die Erde umpflügen und Bäume entwurzeln wird. Einer, der zu dem düsteren schwarzen Steinriesen droben auf dem Hügel passt. Und zu der Wut in ihr. Sie sollte sich jetzt wirklich auf den Heimweg machen, aber dann zögert sie doch, wie jedes Mal wenn sie hier ist. Wartet auf die Tränen, die auch diesmal ausbleiben. Da ist keine Trauer mehr in ihr, schon lange nicht mehr. Nur die Wut.
Immer nur die Wut.
Schließlich dreht sie sich abrupt um und stapft den Weg zwischen den Grabreihen zurück zu der kleinen Allee. Den Bus müsste sie noch erwischen, wenn sie sich jetzt ein bisschen beeilt. Also beschleunigt sie ihre Schritte, während sie die Baumreihen durchschreitet, die den Weg begrenzen wie Soldaten im Spalier und in deren Kronen der Wind die Blätter zum Tuscheln bringt. Sie zieht den Kopf zwischen die Schultern, als sie zwischen ihnen dahineilt, so schnell es geht, auf den Ausgang zu, nur fort von hier. Vielleicht, denkt sie, hätte ich diesmal wirklich nicht herkommen sollen. Die Toten interessieren sich nicht mehr für Geburtstage und gebrochene Versprechen.
Die Toten interessieren sich für gar nichts mehr.
Als die Gestalt zwischen den Bäumen hervortritt, fährt die Frau zusammen. Die Nägel ihrer Finger schneiden kleine blutige Halbmonde in das Fleisch ihrer Handballen, die sie instinktiv zu Fäusten ballt, doch das wird sie erst später bemerken. Die Gestalt, es ist ein Mann, kommt jetzt auf sie zu, und die Frau kann nichts tun, als dazustehen und die Erscheinung aus aufgerissenen Augen anzustarren. Sie ist wie festgewachsen. Wie von ferne hört sie, wie ihr das Herz in der Brust zu hämmern beginnt. Es pocht ihr hinauf bis in den Hals, der wie zugeschnürt ist.
Dann macht sich Erkennen breit in ihren Augen, als der Mann einen weiteren Schritt auf sie zukommt. Erst ist es nur ungläubiges Entsetzen, doch dann kommt der Schock und spült alles andere fort.
Beinahe ein friedliches Gefühl, das jetzt von ihr Besitz ergreift, die Akzeptanz des Unausweichlichen. Denn sie erkennt, dass ein Geist vor ihr steht. Einer, der seit Jahrzehnten tot ist – tot sein muss. Aber jetzt ist dieser Tote hier, auf dem Friedhof, und das Rauschen in den Wipfeln der Bäume verstummt, als hielte die Welt den Atem an.
Er ist hier, hat sie gefunden, und als sie tonlos mit den Lippen seinen Namen formt, nickt er stumm.
Und dann, endlich, kommen die Tränen.
TEIL I: HANDLANGER
1. Kapitel
Wermsdorfer Forst, in der Nähe von Leipzig
Montag, 9. Juni 15:45 Uhr
Kopfschüttelnd starrt Gruber auf die Verheerung. Da hat der Sturm was angerichtet, und das in einer einzigen Nacht. Die Rotbuche liegt entwurzelt auf der Lichtung, ist mitten in den Jungbestand gefallen, den sie damit auch gleich wieder großflächig dezimiert hat. Ein kerngesunder Baumriese, der einen normalen Sturm mit Leichtigkeit überstanden hätte, aber das, was in den letzten beiden Tagen über weite Teile Deutschlands hereingebrochen ist, war kein normaler Sturm, sondern ein wütender Orkan. Da spielt es keine Rolle mehr, ob ein Baum gesund ist, groß oder klein. Da herrscht das Chaos, auch im Wald. Und es soll noch schlimmer werden in den nächsten Tagen.
»Komm, Dux«, sagt der Förster zu dem Teckel, der seinem Blick mit wachen Hundeaugen folgt und sich nun gleichsam in Bewegung setzt, als sich Gruber von der Lichtung abwendet und zurück zu dem Wildpfad geht, der sie hergeführt hat.
Das mit der Rotbuche wird eine Arbeit von mehreren Wochen werden, aber jetzt lohnt sich das nicht, nicht bei dieser Wetterprognose. Da hilft nur abwarten und beten, dass es der einzige Kahlschlag dieses Ausmaßes bleiben wird in diesem Sommer. Aber so richtig glauben kann das Förster Gruber nicht. Die Stürme werden schlimmer, genau wie die Trockenheit, wenn das Land nicht gerade von Regenfluten überschwemmt wird. Da ist eine steigende Tendenz zu beobachten. Die Natur schlägt zurück. Chaotischer, ungestümer, zerstörerischer, von Jahr zu Jahr. Endzeiten.
Auf ihrem Weg kommen sie an weiterem Sturmholz vorbei, doch diese Schäden sind zum Glück nur Lappalien im Vergleich zu der Verheerung auf der Lichtung. Ein paar abgerissene Äste und eine morsche Pappel, die einfach abgeknickt ist. Den meisten Windbruch kann Gruber gleich an Ort und Stelle vom Hauptweg räumen, aber auch darum wird er sich später noch ausführlicher kümmern müssen. Das Zeug muss ja raus aus dem Wald, um nachwachsende Triebe nicht zu behindern. Ein Kampf gegen Windmühlen ist das und jedes Jahr aufs Neue, aber er hat sich diesen Kampf nun mal auf die Fahnen geschrieben. Und die stillen Spaziergänge mit Dux sind es allemal wert, findet Förster Gruber. Was anderes arbeiten, in der Stadt bei dem Lärm und den Menschenmassen, das könnte er gar nicht.
Schweigend ziehen sie weiter, bis sie die Futterstelle mit der Krippe erreichen. Die hat die Stürme bisher unbeschadet überstanden, immerhin, aber der tagelange Regen hat die Erde drumherum aufgeweicht, und die Wildtiere haben ihr Übriges getan, um den Waldboden in einen regelrechten Schlammpfuhl zu verwandeln. Gruber hockt sich hin, betrachtet ein paar der Fährten. Die Rehe sind hier gewesen und wohl auch die Wildschweine, welche die Stelle kürzlich für sich entdeckt zu haben scheinen. Gruber lässt den Blick schweifen und erkennt den für die Schwarzkittel typischen Verbiss an ein paar jungen Bäumen in der Nähe. Auch das setzt er gedanklich auf die Liste der Dinge, um die er sich bei Gelegenheit kümmern müssen wird.
Als er aufsteht und sich umdreht, um den Weg fortzusetzen, bemerkt er, dass Dux etwas gewittert hat. Der kleine Hund steht in Habachtstellung mit aufgerichtetem Schwanz auf ausgestreckten Vorderläufen, zitternd vor Aufregung, und reckt die Nase in den Wind. Gruber wirft einen Blick in Richtung der Futterkrippe, auf die es der Teckel abgesehen zu haben scheint, kann aber nichts entdecken und schüttelt den Kopf.
»Komm, Dux, wir müssen weiter. Gibt noch viel zu tun für uns, bevor es dunkel wird.«
Aber Dux rührt sich nicht vom Fleck, sondern starrt aufgeregt zur Futterkrippe hinüber.
»Was hast du denn bloß?«, fragt Gruber, dann setzt er vorsichtig einen Fuß in die aufgewühlte Erde um die Krippe. Er sinkt sofort ein paar Zentimeter ein, aber seine Schuhe sind sowieso längst voller Schlamm. Dux folgt ihm nicht in den Matsch, dazu sind seine Beine zu kurz, aber während Gruber auf die Futterkrippe zuläuft, gibt der Hund ein leises Knurren von sich, um seinem Herrchen anzuzeigen, dass er in die richtige Richtung unterwegs ist.
Dann sieht Gruber das Ding.
Etwas steckt im Schlamm vor der Futterkrippe, etwas Helles, vielleicht ein Stück eines abgeschlagenen Astes, den die Wildschweine hergeschleppt haben. Nein, überlegt er, als er noch ein Stück näher geht. Das ist kein Ast, der da im Morast steckt, sonst hätte Dux nicht angeschlagen. Vielleicht ein kleines totes Tier, ein Junges vielleicht. Er schaut sich um, findet einen dürren Ast, der auf dem Boden liegt und hebt ihn im Vorbeigehen auf, bevor er noch näher herangeht an das bleiche Ding, das da vor ihm im Boden steckt und das, da ist er jetzt sicher, der Kadaver irgendeines felllosen Tieres sein muss. Vielleicht ein Frischling, der es nicht geschafft hat oder der von seinen Eltern getötet wurde – Wildschweine machen auch vor Kannibalismus nicht halt, wenn sie Hunger haben.
Grubers Schuhe geben schmatzende Geräusche von sich, mit jedem Schritt sinkt er tiefer in den feuchten Waldboden ein. Als er nah genug heran ist, bohrt er die Spitze seines Stocks in die weiche Erde und versucht, das Ding aus dem Boden zu kriegen. Das klappt nicht gleich, weil es ziemlich feststeckt, aber schließlich gibt es nach und löst sich mit einem widerlichen Ploppgeräusch aus dem Schlamm.
Einen Moment später taumelt Gruber zurück, der Stock entgleitet seinen kraftlosen Händen. Seine Schuhe stecken in der zähflüssigen Erde, und beinahe bringt ihn diese unvermittelte Rückwärtsbewegung zu Fall, doch im letzten Moment fängt er sich wieder, während der Teckel zweimal kurz anschlägt.
Es ist kein Wildschweinbaby, das da tot im Schlamm steckt.
Es ist überhaupt kein Tier.
2. Kapitel
Polizeidirektion Leipzig, Dimitroffstraße 1
Montag, 9. Juni 16:50 Uhr
»Wird bald wieder regnen«, erklärt Hauptkommissar Milo Novic dem Fenster. Er steht, die Kaffeetasse in der Hand, seit einer Viertelstunde da und starrt nach draußen – ein untrügliches Zeichen dafür, dass er gelangweilt ist.
Auf ihren beiden Schreibtischhälften stapeln sich die Akten genauso hoch wie immer, aber, da muss ihm seine Kollegin Hanna Seiler insgeheim recht geben, die sind leider wenig inspirierend. Soll heißen: nicht so furchtbar eilig, dass man es nicht auch noch irgendwann später erledigen könnte.
Draußen tobt der Sturm jetzt richtig los, rüttelt wütend an den Fensterscheiben. Schwere Regenwolken jagen über den Himmel, jeden Moment ist Weltuntergang, scheint es.
Endlich stellt Novic die Kaffeetasse auf dem Fensterbrett ab, schüttelt sich, dreht sich um und verschränkt dann die Arme vor der Brust, während er mit angeekeltem Gesichtsausdruck ins Leere starrt. Hat vermutlich den Fehler gemacht, am Inhalt dieser Tasse zu nippen, denkt Hanna Seiler mit einem Anflug von Schadenfreude. Selbst schuld.
»Soll noch schlimmer werden in den nächsten Tagen«, sagt Novic gedankenverloren. »Jedenfalls laut meiner Wetter-App. Schwere Unwetter im Laufe der Woche und Stürme apokalyptischen Ausmaßes. Jahrhundertregen und so. Das kommt alles vom Klimawandel, meint Romana.«
»Gehts ihr gut?«, fragt Seiler.
»Hm?«
»Deiner Schwester, Milo. Romana. Gehts ihr gut, nach der Sache … in Connewitz?«
»Klar, wir haben gestern mal wieder telefoniert. Sie hat jetzt eine eigene Wohnung und zur Abwechslung mal nicht in einem besetzten Haus.«
»Glückwunsch«, sagt Hanna Seiler und meint das auch wirklich ernst. Nach der Sachein Connewitz – nämlich der Detonation einer Bombenbatterie auf dem Viktor-Adler-Platz – kann sie Romana gut verstehen, das hat bei ihnen allen Spuren hinterlassen. In Seilers Fall außerdem eine Narbe am rechten Arm, die von einem Streifschuss herrührt. Unruhige Zeiten, fürwahr.
Sie angelt ihr Handy von der Schreibtischplatte und entsperrt es.
»Jonas geht jetzt übrigens auch demonstrieren«, sagt sie, während sie versucht, ein Foto, das ihr Sohn heute Morgen mit ihrem Handy geschossen hat, mittels eines Filters so zu bearbeiten, dass die Farben knallen wie ein Regenbogen auf Steroiden. Das Foto zeigt ihr heutiges Frühstück: Bircher Müsli mit Naturjoghurt. Jonas hat drauf bestanden, dass sie das fotografiert und auf seinem Instagram-Account hochlädt, damit es alle seine Freunde sehen können. Wozu das letztlich gut sein soll, entzieht sich allerdings ihrem tieferen Verständnis.
»Demonstrieren?«, wiederholt Novic verwirrt.
»Ja, damit machen sie auf den Klimawandel aufmerksam, die ganze Schule macht da mit, globaler Umweltschutz und so. Kennst du doch, diese Fridays for Future.«
»Aha«, meint Novic. »Wie kleine Achtundsechziger, hm?«
»Genau«, sagt Seiler lachend.
»Na ja«, brummelt Novic. »Solange sie nicht anfangen, Bankmanager zu entführen und Autos in die Luft zu sprengen, ist das vermutlich eine gute Sache. Und dabei heißt es immer, die jungen Leute seien so politikverdrossen.«
»Sagte der König aller Politikverdrossenen«, spottet Seiler. »Warst du überhaupt schon mal wählen in deinem Leben?«
Novic schüttelt den Kopf. »Das würde sie nur ermutigen.«
»Kapier ich nicht«, sagt Seiler, verspürt aber eigentlich auch keine Lust auf weiterführende Diskussionen zu dem Thema. Novic tritt jetzt hinter sie und schaut ihr über die Schulter. »Jonas möchte ein eigenes Smartphone«, erklärt sie, während sie weiter an dem Farbfilter herumbastelt. »Damiter der Welt zeigen kann, was sie so tun bei ihren Freitagsdemos. Na ja, und was wir zum Frühstück essen.«
»Aha«, sagt Novic stirnrunzelnd. »Also, das mit dem Telefon ist doch eine gute Idee. Dann kann er dich von unterwegs anrufen. Oder du ihn, wenns mal wieder später wird.«
»Richtig, Milo. Aber ein Telefon hat er seit drei Jahren. Es geht darum, dass er ein Smartphone will. Mobiles Internet, verstehst du? Sie machen diese Woche einen Schulausflug, morgen bis Sonntag, und er meinte, er müsse dafür unbedingt eins haben. Als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, sagt er.«
»Verstehe. Und dann macht er damit Fotos vom Frühstück im Sommerlager.«
»Nicht nur.« Seiler scrollt durch ein paar Fotos, die Jonas’ Freunde gepostet haben.
Novic schüttelt bei dem Anblick den Kopf. »Die sehen ja alle aus, als hätten sie gerade ihre jährliche Botoxeinspritzung bekommen«, kommentiert er die makellos schöne Mosaiklandschaft unnatürlich glatter Gesichter.
»Das sind Fotofilter«, erklärt Seiler, richtet die Kamera des Handys auf das Gesicht ihres Kollegen und drückt ab.
»Hey!«, empört der sich, doch da ist sie schon dabei, dem Foto einen digitalen Filter zu verpassen, und ratzfatz sind Novics naturgemäß eher gelblichen Zähne blendend weiß, seine Haut ist plötzlich straff und frisch, die tiefen Augenringe sind verschwunden, und seine Pupillen glänzen, als wäre er auf schweren Aufputschmitteln.
»Ha!«, ruft sie und muss kichern, weil das einfach zu dämlich aussieht und kaum noch was mit ihrem Kollegen gemein hat. »So hast du also mit zwanzig ausgesehen, Milo. Schick, schick.« Nur zum Spaß verpasst sie ihm auf dem Foto noch zwei Schlappohren und eine Häschennase, ein Feature, das sie erst vor Kurzem in der Foto-App entdeckt hat.
»So habe ich nicht ausgesehen mit zwanzig«, widerspricht Novic und verlangt, dass sie das ganz schnell wieder löscht.
Aber das tut sie nicht. Sie wischt das Bild bloß weg, weil es einfach zu komisch ist und sie es später Jonas zeigen will.
In diesem Moment klingelt das Telefon auf ihrem Schreibtisch, gleichzeitig beginnen fette Tropfen, gegen die Fensterscheiben zu klatschen, und es hat sich was mit dem hoffnungsvollen Sommerfeeling, nach dem es heute Morgen noch aussah. Ein paar Kollegen an den anderen Schreibtischen fangen an, leise zu fluchen. Seiler nimmt das Telefon ab und muss den Hörer ans Ohr pressen, denn in diesem Moment wird aus den paar Tropfen draußen schlagartig ein wütendes Prasseln, bei dem man kaum noch sein eigenes Wort versteht. Es ist, als begehre das Unwetter jetzt aufgebracht Einlass. Als Seiler ein paar Sekunden später auflegt, ist die Welt draußen komplett hinter einem Vorhang aus Regen versunken, als befände sich ihr Büro direkt unter einem Wasserfall.
»Arbeit für uns«, ruft sie Novic zu, der daraufhin einen letzten missmutigen Blick durch die Scheibe und dann einen fragenden in ihre Richtung wirft.
Draußen blitzt es, und einen Augenblick später kracht ein Donner, der die Scheiben des Präsidiums erzittern lässt. Mit einem Seufzen dreht sich Novic um und schnappt sich den Regenmantel, der über der Lehne seines Stuhls hängt und für den Seiler ihn heute Morgen noch belächelt hat.
Jetzt wünscht sie sich, sie hätte beim Frühstück ebenfalls mal ihre Wetter-App gecheckt, anstatt auf Instagram nach spaßigen Fotofiltern für Jonas’ Müslifotos zu suchen.
3. Kapitel
Polizeidirektion Leipzig, Dimitroffstraße 1
Montag, 9. Juni 17:10 Uhr
Kriminaloberrat Reuter quittiert die Tasse Kaffee, die ihm Isabelle auf den Tisch stellt, mit einem knappen Nicken und fährt dann fort, seine Brille zu putzen, während der Regen mit ohrenbetäubendem Getöse gegen die Fensterscheiben prasselt. Der Leiter des Leipziger Dezernats 1 für höchstpersönliche Rechtsgüter blickt der hübschen jungen Frau stirnrunzelnd nach, die mit schwingenden Hüften aus seinem Büro schwebt und dann die Tür hinter sich schließt.
Möglich wärs schon, denkt er. Und vielleicht ist es tatsächlich möglich, dass Isabelle sich von seinem PC aus eingeloggt und versucht hat, auf die Verschlusssache »Franz Seiler« zuzugreifen, in der Hoffnung, er – Reuter – würde das nicht mitbekommen. Was er aber natürlich hat, nicht umsonst schuldet ihm der Systemadministrator des Dezernats einen Gefallen. Reuter kann sich nicht erinnern, die Akte in letzter Zeit aufgerufen zu haben, aber jemand hat definitiv von seinem Rechner aus danach gesucht – wenn auch vergeblich, denn der Sperrvermerk für diesen längst abgeschlossenen Fall lässt auch für Reuter keinen direkten Zugriff auf deren Inhalt zu. Die übliche Verfahrensweise, wenn es um Ermittlungen in den eigenen Reihen geht, noch dazu mit Todesfolge für einen Kollegen. Vielleicht war sie nur neugierig, überlegt Reuter, denn das wäre durchaus eine plausible Erklärung. Hat vielleicht gar nicht nach Franz Seiler gesucht, sondern nach Hanna, seiner Witwe. Warum auch immer sie das getan haben sollte. Herrgott, vielleicht war es auch ein Versehen seinerseits. Auszuschließen wäre das nicht. Er hat extra in seinem Terminkalender nachgesehen, und zu der Zeit hatte er jedenfalls keine Termine außer Haus.
Bei näherer Betrachtung ist es dann doch eher unwahrscheinlich, dass Isabelle ihren Job mit so etwas aufs Spiel setzt, ganz zu schweigen von seinem Wohlwollen, nur wegen ein bisschen Klatsch, für den sich längst niemand mehr interessieren sollte. Ganz besonders nicht Hanna Seiler, die Witwe von Reuters ehemaligem Ermittlungspartner Franz, der dieser Akte seinen Namen gegeben hat, indem er sich am Weihnachtsabend vor sechs Jahren mit der Dienstpistole das Hirn aus dem Kopf geblasen hat – motiviert durch einen rapiden dienstlichen Abstieg, der seinen Tiefpunkt in Franz Seilers Versetzung in die Vermisstenabteilung erreicht hatte. So zumindest die offizielle Version.
Reuter nippt an dem Kaffee. Der ist gut. Kaffee kochen kann sie jedenfalls, die junge Kollegin.
Dann steht er auf und geht zur Wand hinüber, an der zwischen den Aktenregalen ein Tresor eingelassen ist, versteckt hinter einem Bild, das einen Schnappschuss von ihm beim Händeschütteln mit dem Oberbürgermeister zeigt. Reuter hängt das Bild ab, entriegelt den Tresor und öffnet ihn. Dann nimmt er eine Aktenmappe heraus, zu der er sich erst durchwühlen muss, denn sie liegt ganz unten im Stapel, wie ein Schwarzer Peter in einem schlecht gemischten Kartenspiel. Suizid zum Nachteil von Franz Seiler, steht auf dem Aktendeckel.
Er schlägt die Mappe auf und lässt die Blätter langsam durch seine Finger gleiten. Getippte Berichte, Fotos vom Tatort und aus der Rechtsmedizin. Unappetitlich sind die allesamt. Es sieht nun mal nicht schön aus, wenn einem ein aus nächster Nähe abgefeuertes 9-mm-Parabellum-Projektil zum Hinterkopf wieder rauskommt. Da bleibt nämlich nicht viel von besagtem Hinterkopf übrig.
Für eine Weile wiegt Reuter den Ordner in der Hand und denkt, dass er gerade vor einem ähnlichen Dilemma steht wie ein krummer Unternehmer, dem eine Steuerprüfung ins Haus steht. Soll er den Buchprüfern die Version des Hauptbuchs zeigen, die behauptet, dass die Firma glänzend läuft, oder doch lieber die andere, der zufolge sie kurz vor der Pleite steht – oder vielleicht gar keine davon? Ihm fällt auf, dass ihm sein Oberhemd unter der Achsel klebt und dass es plötzlich ziemlich eng und stickig ist in seinem Büro. Ein Blitz taucht das Zimmer für einen Sekundenbruchteil in gleißendes Licht, dann kracht ein ohrenbetäubender Donner, während Reuter einen missmutigen Blick in Richtung Fenster und auf die dahinter befindlichen entfesselten Elemente wirft.
Schließlich legt er den Ordner zurück in den Tresor, verschließt ihn sorgfältig und verschiebt die Entscheidung, was nun mit Franz Seilers Akte anzustellen sei, ein weiteres Mal. Er kehrt zu seinem Schreibtisch zurück, zieht sein Handy aus der Tasche des Jacketts, das über der Lehne seines Bürostuhls hängt, und wählt eine Nummer aus dem Gedächtnis. Eine, die er eigentlich gar nicht anrufen möchte, weil er dann unweigerlich das Gefühl hat, sich gleichsam in eine Vergangenheit einzuwählen, mit der er längst abgeschlossen zu haben glaubte.
Aber das ist die Sache mit der Vergangenheit, nicht?, denkt er. Sie neigt dazu, einen in den Hintern zu beißen, und zwar immer dann, wenn man das am wenigsten gebrauchen kann.
Nach dem dritten Klingeln wird am anderen Ende abgenommen.
4. Kapitel
Wermsdorfer Forst, in der Nähe von Leipzig
Montag, 9. Juni17:40 Uhr
Die Kriminaltechniker sind bestimmt schon seit über einer Stunde hier im Wald zugange, schätzt Novic, als er den Blick schweifen lässt. Sie haben ihre Baustrahler aufgebaut, die den Platz um die Futterkrippe herum taghell ausleuchten. War bestimmt nicht einfach, das ganze Zeug hierherzuschleppen und mit Strom zu versorgen. Rundherum ist nicht viel außer Büschen und Bäumen, die nächste Straße – jetzt natürlich gesperrt und inzwischen völlig chaotisch zugeparkt von allen möglichen Einsatztruppen – ist mindestens zweihundert Meter entfernt. Abgesehen davon gibts nur einen richtig finsteren Märchenwald, dazu mittlerweile eine regelrechte Sturzflut von oben, und es sieht auch nicht so aus, als würde sich alsbald was an diesem Wetter ändern, jedenfalls nicht zum Besseren. Fraglich, ob sich überhaupt noch verwertbare Spuren finden lassen werden, bevor hier alles knöcheltief unter Wasser steht.
Novic blickt auf seine Schuhspitzen und seufzt. Der Waldboden ist ein einziger Morast. Während er der Nässe nachspürt, die bei jedem Schritt durch das Leder seiner Schuhe dringt, folgt er Seiler, die vorausgegangen ist und sich bereits mit einer der Gestalten in den lehmverschmierten, ehemals weißen Overalls unterhält. Als er auf die beiden zugeht, bemerkt Novic etwas abseits einen Mann in einem dunkelgrünen Regenponcho und einem für die Jägerzunft typischen Hut mit breiter Krempe. Dieser lehnt an einem Baum und redet dabei leise auf den kleinen Hund ein, der zu seinen Füßen hockt. Beide machen einen irgendwie kränklichen Eindruck.
»Ah, der Herr Novic beehrt uns!«, ruft der Mann im weißen Ganzkörperanzug, als Novic sich zu Seiler und ihm gesellt. Erst jetzt erkennt ihn Novic – es ist Weiß, der Chef der Kriminaltechnik.
»Guten Tag«, sagt Novic.
»Wie mans nimmt«, brummt Weiß zur Erwiderung.
Womit er recht hat, findet Novic. Angesichts der Umstände wirds wohl kein allzu guter Tag mehr werden. Dass sie jetzt hier sind, bedeutet außerdem, dass jemand vor Kurzem einen ausgesprochen schlechten Tag hatte, nämlich seinen letzten. Mal abgesehen von dem am Baum lehnenden Förster, der sich vermutlich auch noch eine Weile an das hier erinnern wird, so blass, wie der aussieht, und wohl kaum im Guten.
»Der hat ihn gefunden, hm?« Er deutet auf den Jägersmann, der jetzt eine Hand unter seiner Regenjacke verschwinden lässt und sie kurz darauf wieder zum Vorschein bringt, mit einem kleinen silbernen Flachmann darin, den er mit zitternden Fingern aufschraubt und dann an die Lippen setzt.
Weiß nickt, dann sagt er: »Aber er hat nicht ihn gefunden, Herr Kollege. Sondern sie.«
»Eine Frau?«, fragt Novic verblüfft, der sich dunkel daran erinnert, in Seilers Zusammenfassung während der Fahrt irgendwas von einer männlichen Person gehört zu haben.
»Nein, keine Frau«, schnauft Weiß kopfschüttelnd. »Eine Hand. Kommen Sie, ich führ Sie beide mal hin.«
Also folgen die Polizeibeamten ihm, wobei sie sich Mühe geben, fluchende Spurensicherer möglichst weitläufig zu umgehen. Fluchen tun die deshalb, weil ihre Markierungsfähnchen in dem aufgeweichten Waldboden einfach nicht halten wollen. Novic lässt das an die Sandburgen von Kindern am Strand denken, immer wieder fortgespült von der Flut. So hat eben jeder sein Kreuz zu tragen.
»Wir haben die Fundstelle ein bisschen freigelegt«, erklärt Weiß, der jetzt auf eine Stelle auf dem Waldboden deutet, wo jemand offenbar ziemlich erfolglos versucht hat, ganz besonders viele Fähnchen im Boden zu befestigen. »Ansonsten ist noch alles so, wie wir es gefunden haben. Aber wir mussten sie ein wenig freilegen, um zu schauen, was noch so dranhängt an der Hand.«
Mehr muss er nicht sagen, so weit reichen Novics und Seilers Anatomiekenntnisse dann doch noch. Was an dieser Hand dranhängt, ist ein halber Unterarm, teilweise skelettiert. Sowohl Elle als auch Speiche enden bei etwa zwei Dritteln ihrer eigentlichen Länge in gezackten Bruchrändern, soweit sich das bei all dem Schlamm, der daran klebt, erkennen lässt.
»Sieht aus wie abgerissen«, sagt Seiler. »Ein Unfall? Ist da vielleicht ein Wanderer irgendwo reingeraten?«
»Reingeraten, ja«, sagt Weiß. »Aber nicht gerissen, nein. Sondern …«
»Abgefressen«, ergänzt Novic das zumindest für ihn Offensichtliche. An dem Knochen des Unterarms – es ist übrigens ein linker – sind eindeutig Bissspuren zu erkennen, und zwar ziemlich frische, an den Fleischresten ebenfalls. Das hat was von einem gegrillten Hähnchenschenkel, den jemand angeknabbert hat, der eigentlich gar keinen richtigen Appetit mehr hatte.
Erst jetzt bemerkt Novic, dass die beiden anderen ihn anstarren. Weiß ein bisschen anerkennend, Seiler einfach nur entsetzt.
»Angefressen?«, wiederholt sie leise.
Weiß nickt. »Aber keine Angst, Frau Seiler. Nicht von Kannibalen. Sondern Wildfraß, das meint übrigens auch der Förster Gruber – der Herr in Moosgrün, der da drüben am Baum lehnt. Allesfresser, sagt er, Wildschweine zum Beispiel.«
»Da fehlen zwei Finger«, stellt Novic fest, nachdem er sich hingehockt und mit seiner behandschuhten Rechten ein wenig im Schlamm um den Fund herumgestochert hat. »Mittel- und Ringfinger.«
»Ja«, bestätigt Weiß, »und außerdem das erste Glied vom Daumen. Wir suchen noch danach.«
»Dann haben wir also streng genommen noch gar keine Leiche?«
»Na ja«, sagt Weiß. »Geben Sie uns mal ein paar Stunden. Der Arm ist jedenfalls noch ziemlich frisch, das sieht man an dem Gewebe, da sind kaum Verwesungsspuren. Daher nehme ich an, dass hier irgendwo in der Nähe auch die restlichen Teile liegen. Vermutlich ist die Leiche von jemandem vergraben worden, der nicht damit gerechnet hat, dass es derart stark regnen würde. Hat es aber, und dabei hat es den Arm wohl freigespült.«
»Lässt sich schon was Genaueres über den Todeszeitpunkt sagen?«, will Seiler wissen.
»Gute Frage.« Weiß dreht sich zu einem seiner Männer in den Schutzanzügen um und brüllt ihn an: »Hey, wo ist eigentlich der Löwitsch?«
Der Mann antwortet ihm mit einem unbeteiligten Schulterzucken und fährt dann fort, seine Fähnchen aufzurichten, die ihm schon wieder in den Schlamm gefallen sind.
»Doktor Löwitsch wird es natürlich genauer sagen können«, sagt Weiß, »nachdem er mit der Obduktion durch ist, aber ich glaube, mit etwa achtundvierzig Stunden liegen wir ganz gut im Rennen.«
»Glaub ich auch«, sagt Novic und wendet sich dann ab, um zu dem einsamen Förster hinüberzugehen, der immer noch an seinem Baumstamm lehnt, inzwischen aber in sich zusammengerutscht ist, den Hosenboden im nassen Dreck. Was ihn aber nicht zu stören scheint, oder er bemerkt es gar nicht. Novic hört noch, wie Weiß hinter ihm verkündet, sie würden die Hand mit dem halben Arm dran jetzt eintüten und zu Doktor Löwitsch in die Rechtsmedizin bringen, wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will und so weiter.
»Herr Gruber.« Novic streckt dem Mann die Hand hin. Der guckt die Hand ein bisschen entsetzt an, ergreift sie aber nicht. Der Hund gibt ein klägliches leises Kläffen von sich. »Zunächst wollte ich Ihnen danken«, improvisiert Novic. »Dass Sie uns angerufen haben, meine ich. Also, wegen der … wegen Ihres Fundes. Das haben Sie gut gemacht. Ihre Bürgerpflicht erfüllt, sehr gut. Ich bin Hauptkommissar Novic. Von der Kriminalpolizei Leipzig.« Seine Hand schwebt immer noch in der Luft zwischen ihnen, und der Förster starrt sie an. Irgendwie eine blöde Situation. Aber schließlich greift Gruber danach und lässt sich von Novic auf die Beine ziehen.
»Entschuldigung«, murmelt er dann leise. »Wollte mich nicht so gehen lassen. Es ist nur, diese Hand da im Schlamm und all das … Mann, mir ist jetzt noch übel. Ich heiße Gruber, Andreas Gruber. Bin hier der Revierförster.«
»Schön, Sie kennenzulernen.« Novic versucht sich an einem aufmunternden Lächeln. »Würden Sie mich vielleicht ein Stück begleiten? Kleiner Waldspaziergang, hm?«
»Wie bitte?«, ächzt der Förster.
»Na, nur ein Stück in den Wald rein. Ich würde Sie gern was fragen, wo Sie doch der Revierförster sind, Herr Gruber, und hier«, er deutet mit dem Daumen über die Schulter, »gibts für uns beide ja erst mal eh nicht mehr viel zu tun.«
Das nimmt der Förster Gruber ausgesprochen dankbar auf und stößt sich von dem Baumstamm ab. Sie entfernen sich ein Stück von der Lichtung mit der Futterkrippe und dem ganzen Tamtam und gehen in den Wald hinein. Novic läuft voran, den Blick scharf auf den Boden gerichtet, denn er hat durchaus ein Ziel oder wenigstens eine Idee, die er jetzt überprüfen möchte. Gruber stolpert hinterdrein, dann folgt der Dackel mit eingezogenem Schwanz.
»Ich war unterwegs, um die Sturmschäden von gestern Nacht zu begutachten«, erklärt der Förster mit tonloser Stimme. »Es hat eine große Rotbuche entwurzelt, die ist mitten in den Neubestand gekracht. Wird ewig dauern, das alles wieder aufzuforsten.«
»Aha«, brummelt Novic, bevor er abrupt das Thema wechselt. »Sagen Sie, kennen Sie eigentlich die gängigen Malbäume hier in der Gegend?«
»Malbäume?« Der Förster mustert ihn verwirrt.
»Ja. Bäume, an denen sich die ansässige Wildschweinpopulation eben so gemeinhin die Schwarte scheuert. Wo sind die hier?«
»Äh …«
»Die sollten uns helfen, den Weg der Sippe zur Suhle nachvollziehen zu können, meinen Sie nicht? Deshalb frag ich.«
»Sie kennen sich aber gut aus«, staunt der Jägersmann, während er Novic mit einem zutiefst verunsicherten Blick mustert. »Sind Sie denn Jäger, Herr …«
»Novic. Und nein, bin ich nicht, sondern nur Hauptkommissar bei der Polizei. Ich war aber als Kind manchmal mit meinem Großvater jagen. Beinahe wäre ich sogar mal Pfadfinder geworden.« Er vermeidet es, Gruber zu erzählen, dass das von einem Bürgerkrieg verhindert wurde, an dessen Ende Novic keinen Großvater mehr hatte und auch keine Eltern mehr oder – abgesehen von seiner Schwester Romana – sonst irgendwen, den er mal in dem Dorf gekannt hatte, in dem er aufgewachsen ist.
Jedenfalls scheint das dem Förster Gruber fürs Erste als Erklärung zu genügen, denn er nickt eifrig und führt Novic durchs Unterholz zu einem Trampelpfad, dessen aufgewühlte Natur nur den Schluss zulässt, dass dieser eine Art Hauptverkehrsstraße der örtlichen Wildschweinsippe sein muss.
»Ah!«, macht Novic.
»Die Suhle ist gleich da vorn«, erklärt Gruber. »Nicht mehr weit.«
Wildschweine lieben es, sich im Schlamm zu suhlen, daher der Name für dieses animalische Schlammbad. Zwar könnten sie das momentan fast an jeder Stelle im Wald tun, weil der Waldboden komplett aufgeweicht ist vom Dauerregen, aber auch so ein Schwein ist schließlich ein Gewohnheitstier, schätzt Novic, während sie weiter dem Pfad folgen und er hin und wieder nach unten sieht, um nicht komplett in einem Schlammloch zu versinken.
»Ach du Scheiße!«, zischt Gruber plötzlich, und dann gibt er eine Art glucksendes Rülpsen von sich, bevor er sich hastig zur Seite abwendet und sich mitten in ein Gebüsch hinein erbricht. Auch sein Dackel kriegt was ab, bevor er, einen empörten Quietschlaut ausstoßend, die Flucht ergreifen kann.
Novic wendet den Blick ab und schaut hinüber zur Suhle. Bingo, denkt er, während der Förster neben ihm ächzend auf die Knie sinkt.
Dann zückt der Hauptkommissar sein Telefon.
5. Kapitel
18:00 Uhr
Langsam steigt der Mann auf die Trittleiter. Er nimmt sich Zeit für jede Bewegung. Umfasst mit beiden Händen die Holme, spürt das kühle Metall unter seinen Fingern. Er zieht das zweite Bein auf die Sprosse, verharrt, zehn Zentimeter über dem Boden, dann steigt er höher und immer weiter, bis er schließlich die Plattform am Ende der fünfstufigen Leiter erreicht. Oben angekommen, hadert er für einen Moment mit dem Gleichgewicht, dann findet er es wieder. Er streckt den Rücken durch, steht jetzt aufrecht und ganz gerade, den Blick in die Schwärze gerichtet, die ihn umgibt, in das Nichts hinein.
Atmet ein.
Atmet aus.
Dann greift er nach der Schlinge, die vor seinem Kopf baumelt, beschienen vom sanften Licht eines einzelnen Spots irgendwo über seinem Kopf. Es ist ein grobes Hanfseil, das von oben herabhängt, grellweiß angestrahlt sticht es aus dem Dämmerlicht ringsum heraus, wie ein Requisit in einem Theaterstück. Das Seil fasst sich angenehm rau an, als er es zwischen seinen Fingern spürt. Es vermittelt ihm ein Gefühl von Zuverlässigkeit.
Er zieht das Seil zu sich heran, fasst es mit beiden Händen, denn er will keine Bewegung dem Zufall überlassen. Die Schlinge hat genau die richtige Höhe, um den Kopf hindurchzustecken, und das tut er jetzt. Er spürt das Kratzen der rauen Hanffasern an seiner Gurgel, das Gewicht des Knotens in seinem Nacken.
Genau richtig.
Er greift nach oben und zieht den beweglichen Knoten entlang des Seils ein Stück herunter, damit sich das Seil noch enger um seinen Hals schmiegt. Auch das klappt problemlos. Es ist ein guter Knoten – geknüpft von jemandem, der weiß, wie man das machen muss.
Der Mann öffnet sein Hemd. Knopf für Knopf, sorgsam darauf bedacht, auch hier keine fahrige oder überflüssige Bewegung zu machen, die sein Ritual stören würde. Das Hemd gleitet von seinen Armen, landet mit leisem Rascheln auf dem weichen Boden. Der Mann sieht an sich herab. Seine Brust ist eingefallen, und darunter ist der Ansatz eines Schmerbauchs zu sehen, der wabbelt, wenn er sich bewegt. Dichte, krause Wolle auf der Brust, das Haar schon grau und dünn, dazwischen winden sich die Kabel der Elektroden. Alt ist er, dieser Körper, verfallen, gezeichnet durch die Jahre. Schon lange nicht mehr in Form, dabei hat er mal intensiv Sport betrieben, aber wie lange ist das jetzt her?
»Hier wird dich keiner finden«, verspricht eine Stimme aus der Dunkelheit, und er nickt. Es ist eine weibliche Stimme von betörender Sanftheit, die so ruhig und gleichmäßig spricht, als wäre das, was er hier tut, eine völlig belanglose Angelegenheit. Etwas ganz Alltägliches. Die Ansage der nächsten Station in der S-Bahn, mehr nicht.
Er wird sich bewusst, dass er schwitzt, und einen Augenblick später kann er den Schweiß tatsächlich riechen, der ihm aus jeder Pore dringt.
»Und weißt du auch, wieso?«, fragt die Stimme gelassen. Das weiß er natürlich, aber er schüttelt dennoch den Kopf. Er will es hören. Will, dass die Stimme es ausspricht. »Weil niemand nach dir suchen wird«, sagt sie. »Weil du ganz allein bist, hier in der Einsamkeit.«
Ja.
Er nickt, und dann ist es endlich so weit. Er lehnt sich vor, testet die Schlinge, die sich durch die Bewegung noch enger um seinen Hals zusammenzieht, ihm jetzt ins Fleisch schneidet, seine Luftröhre zusammenpresst. Er spürt das Pochen seines Herzens, als die Adern in seinem Hals anschwellen von dem aufgestauten Blut. Bald, jetzt, klopft sein aufgeregtes Herz, gleich! Er gibt sich dem Gefühl des Schwebens zwischen den Möglichkeiten noch ein wenig hin, dann tritt er vor, an den Rand der obersten Plattform.
»Bereit?«, fragt die Stimme, und er nickt wieder.
Dann stößt er die Leiter unter seinen Füßen weg.
6. Kapitel
Wermsdorfer Forst, in der Nähe von Leipzig
Montag, 9. Juni 18:10 Uhr
Um die Futterkrippe herum versinkt derweil alles immer weiter im Schlamm. Der Regen prasselt unaufhörlich auf die Blätter der Bäume nieder, es ist ein ohrenbetäubendes Getöse.
Seiler kann es den Frauen und Männern der kriminaltechnischen Abteilung kaum verdenken, dass sie schnellstmöglich von hier weg und zurück aufs Revier wollen, wo sie die gefundenen Spuren in aller Ruhe und vor allem im Trockenen analysieren können. Der Feierabend ist inzwischen für sie alle in utopische Ferne gerückt, aber natürlich murrt keiner. Alle wissen, dass frische Spuren vom Auffindeort oberste Priorität haben, gerade bei einem Wetter wie diesem, bei dem in jeder Minute Unmengen an fallrelevanten Hinweisen fortgespült werden und dann für immer verloren sind.
»Der Gruber meint, das war nur ein Vorgeschmack«, sagt Weiß neben Seiler, während sie zuschauen, wie zwei seiner Mitarbeiter umständlich versuchen, den angefressenen Unterarm und die Hand aus dem Schlamm zu ziehen und in einem Asservatenbeutel zu verstauen, ohne dabei selbst im Dreck zu landen.
»Hm?«
»Nur ein Vorgeschmack von dem Sturm, der noch kommen wird, sagt der Förster Gruber.«
»Na, das sind tröstliche Aussichten«, murmelt Seiler.
»Soll sich den ganzen Sommer nicht ändern«, reitet Weiß weiter auf dem Wetter herum. »Sommerstürme, sagt er, ganz üble Sache, und es wird immer schlimmer. Kommt wohl von der Erderwärmung, Klimawandel, irgendwas.«
»Hm«, macht Seiler wieder und muss ein bisschen lächeln, als sie an Jonas und sein neuestes politisches Engagement für die Umwelt denken muss. Der könnte ihnen vermutlich ganz genau erklären, was es mit den immer drastischeren Wetterumschwüngen auf sich hat und wie es die Menschheit mal wieder in Rekordzeit geschafft hat, auch diese Sache zu verbocken. Sie nimmt sich vor, ihn bei Gelegenheit danach zu fragen.
In diesem Moment beginnt eine kreischende Stimme zu singen, dass dies der finale Countdown sei und dass wir alle zusammen irgendwo hingehen werden. Seiler zieht ihr Handy aus der Tasche und beendet den berühmten Europe-Song mit dem infantil-prophetischen Text, indem sie auf »Anruf annehmen« drückt.
»Ja?«
Es ist Novic, der wissen will, ob Weiß schon weg sei mit der Hand. Nein, erwidert Seiler, aber sie, also die Hand, wäre bereits eingetütet, und Weiß habe in der Tat vor, damit jetzt zu Löwitsch zu fahren, der übrigens angerufen habe und verlauten lasse, dass er nicht wegen eines bloßen Körperteils aus dem Haus gehen würde bei diesem Sauwetter.
»Halte den mal auf, den Weiß«, verlangt Novic.
»Wieso?«
»Er braucht die Hand nicht mehr zum Löwitsch zu fahren, der Löwitsch muss herkommen.«
»Was?«
»Ja, Hanna. Wir haben den Rest gefunden.«
7. Kapitel
18:30
Der Mann hängt jetzt frei in der Luft, die Schlinge hat sich fest um seinen Hals zusammengezogen, sie drückt seine Luftröhre ein, schnürt die Halsschlagader ab, nimmt ihm die Luft, die sein Körper zum Atmen braucht, während seine zuckenden Fußspitzen zwei Handbreit über dem Boden schweben. Sein Herz kämpft tapfer gegen den Sauerstoffmangel an, wummert wie wild in seiner Brust.
Gleich.
Gleich ist er da.
Das alles unter wachsamen Augen. Unsichtbar, irgendwo im Dunkel, das ihn allseits umgibt. Das weiß er, aber es berührt ihn kaum noch. Für ihn ist es ein physikalisches Experiment. Eines, das er schon oft durchgeführt hat. Methodisch, mechanisch, wie es sich für einen Wissenschaftler gehört. Gleichsam ist er in diesem Moment Schrödingers Katze selbst; er befindet sich in der Quantenwelt zwischen Leben und Tod, im unscharfen Zustand. Aber nicht mehr lange. Gleich wird die Schwärze kommen, endlich. Und er wird in sie eingehen, wie es ihm von Anfang an bestimmt war. Er wird das Bewusstsein verlieren, und dann …
»Jetzt!«, dringt die Stimme der Frau wie aus weiter Ferne an sein Ohr.
Da lässt er los, verliert jedes Zeitgefühl, während er in den Strudel der absoluten Finsternis eintaucht, nicht länger gefangen zwischen null und eins. Hinein in den Tod, der nicht Bruder ist oder Freund und auch nicht Feind, sondern einfach nur das Ende. Schwärze. Null.
Ein letztes Aufbäumen seines Herzens.
Ein letzter Impuls, den die Elektrode überträgt.
Dann das Nichts.
In diesem Moment lockert sich der Strick, und er ist frei. Der Strick fällt und hängt um seinen Hals wie eine groteske Krawatte, während er gierig die Luft in seine Lungen saugt, grausam zurückgerissen aus der Schwärze. Eine schmerzhafte Wiedergeburt, ein erster Atemzug.
Schrödingers Katze lebt für einen weiteren Tag.
Viel später kniet er auf dem weichen Boden, die Ellenbogen auf den Oberschenkeln, die Knie und Hände zittern ihm noch, aber auf seinem Gesicht liegt jetzt ein Lächeln. Er ruht in sich, während der euphorische Rausch allmählich in wohlige Zufriedenheit übergeht. Für einen Moment kann er die Schwärze noch halten, keine Gedanken denken, einfach nur sein.
Dann ist auch dieser Moment vorbei, viel zu schnell.
Es wird hell, ganz allmählich.
Da sind Konturen, die sich aus den Schatten schälen, und gleichzeitig hebt sich die Finsternis. Im erwachenden Kunstlicht kommt der Raum um ihn herum nun vollends zum Vorschein. Die Illusion löst sich auf, als die ersten sanften Akkorde eines Cool-Jazz-Stückes erklingen. Der Mann glaubt, sich vage an das Stück zu erinnern. John Coltrane vielleicht oder irgendwas aus dem Frühwerk von Miles Davis, die ihn willkommen heißen, zurück in der Welt, ein weiteres Mal.
Es wird Zeit zu gehen.
Also erhebt er sich, immer noch ein bisschen unsicher auf den Beinen, immer noch lächelnd. Stakst hinüber, wo er hinter schwarzen Vorhängen eine Tür weiß. Er schiebt den schweren Stoff beiseite, öffnet die Tür. Dann betritt er das kleine Badezimmer dahinter.
Unter der Dusche lässt er das Wasser auf sich einprasseln und schließt die Augen, in der Hoffnung, den Rausch, wenn auch in abgeschwächter Form, ein weiteres Mal durchleben zu dürfen, solange die Erinnerung noch frisch ist. Es gelingt ihm, die Bilderflut für einen Augenblick erneut heraufzubeschwören, die vor seinen Augen vorbeizog, in jenem Moment, da er in die Schwärze trat. Das rote Rennrad, das ihm seine Eltern zum Geburtstag geschenkt haben, seine erste Fahrt drauf, seine Graduierungsfeier. Freunde, Kollegen, lieb gewonnene Menschen und Erinnerungen. Der Abend, an dem er seine spätere Frau kennenlernte. Tränen längst vergessen geglaubter Freude und kindlicher Dankbarkeit schießen ihm in die Augen – es ist ein Rausch, den keine Droge der Welt hervorrufen kann.
Nur die Reinigung, die das Sterben bringt, ist dazu in der Lage.
Dann ist auch das vorbei. Er greift nach dem Duschgel – es ist dasselbe, das er auch daheim benutzt – und sinniert, dass das, was er gerade erlebt hat, wohl nur wenige Leute außerhalb seines Fachgebiets verstehen würden. Eine spezielle Neigung, würden es wohl manche nennen, aber das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Er verbindet nichts Sexuelles damit. Er empfindet es als eine spirituelle Läuterung, als einen Neustart. Als wenn man mit einer Drahtbürste Rost von der eigenen Seele kratzen würde. Wenn er das, was er für andere mit sich herumträgt, nicht mehr zu ertragen glaubt, kommt er hierher.
Wenn er das nicht täte, glaubt er, würde er selbst verrückt werden.
Als er fertig ist, trocknet er sich ab, lässt das Handtuch zu Boden gleiten und zieht dann den Anzug an, den er mitgebracht hat. Es ist der, den er gern zu wichtigen Anlässen trägt, Tagungen und dergleichen, aus marineblauer Schurwolle, und dazu die weinrote Seidenkrawatte, die ihn – das sagt zumindest seine Frau – immer ein bisschen wie einen Politiker aussehen lässt, was sie vermutlich als Kompliment meint.
Als er aus dem Badezimmer tritt, beginnt er, leise ein Lied vor sich hin zu summen. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein.
Und dann geht er, hinein in die Welt.
8. Kapitel
Wermsdorfer Forst, in der Nähe von Leipzig
Montag, 9. Juni19:10 Uhr
Als Doktor Löwitsch aus dem Unterholz tritt, sieht der Rechtsmediziner nicht allzu beglückt aus über den Umstand, dass sich nun doch der Prophet zum Berg hat bemühen müssen. Und das hat sicher nicht nur mit dem Wetter zu tun. Die, die schon länger hier sind, verkneifen sich ihre Schadenfreude, was ihnen nicht mal schwerfällt, denn dank Novics Entdeckung des Leichnams wird das hier nun für alle Beteiligten länger dauern, auch für das Fußvolk.
Es schüttet weiter wie aus Kannen, und obwohl die Sonne angeblich erst in ein paar Stunden untergehen wird, ist es bereits stockdunkel im Wald.
»Es ist dahinten«, sagt Seiler, nachdem sie und Doktor Löwitsch sich die Hände geschüttelt haben, und deutet in die Richtung, in die Novic und Förster Gruber früher am Abend verschwunden sind.
Inzwischen hat der Rechtsmediziner schon einen raschen Blick auf den eingetüteten Unterarm geworfen und sollte daher eine gewisse Vorstellung haben, was ihn gleich noch erwarten wird. Seine mürrischen Proteste sind augenblicklich verstummt, als er den Inhalt des Asservatenbeutels betrachtet hat. Jetzt ist da nur noch hoch konzentriertes, professionelles Interesse.
Wenig später erreichen sie die Stelle, an der Novic sich im Moment um den Förster kümmert, der kaum noch aufrecht stehen kann und hin und wieder vergeblich würgt. Der Mann ist bleich wie ein frisch gestärktes Laken und hat sich, wie Seiler jetzt erst bemerkt, teilweise auch auf den Rücken seines Dackels übergeben, den Novic gerade mit ein paar Blättern sauber wischt, während das Tier klägliche Fieplaute ausstößt.
Dann erreichen sie die Suhle. Seiler nun schon zum zweiten Mal, aber das macht den Anblick nicht erträglicher. Was da an dem Baum hängt, sieht aus wie das Ergebnis eines Massakers – verübt an einem einzigen Menschen. So richtig kann man eigentlich auch gar nicht mehr Mensch dazu sagen, schließlich sagt man zu Hackfleisch ja auch nicht mehr Kuh. Zwei Baustrahler reißen das Ding unbarmherzig aus der Finsternis, beleuchten es bis in den letzten Winkel.
Technisch gesehen hat Seiler schon mit ein paar noch übler zugerichteten Leichen zu tun gehabt; eine zum Beispiel, die nur noch aus dem Rumpf einer Prostituierten bestand, alles andere – inklusive des Kopfes – war mit einer aus Tschetschenien stammenden Machete abgehackt und dann an verschiedenen Stellen in den Elster-Saale-Kanal geworfen worden. Sie hatten zuerst den Torso rausgefischt und dann nach und nach mithilfe von Tauchern auch den Rest gefunden, das meiste davon zumindest. Aber das hier ist trotzdem irgendwie schlimmer. Vielleicht weil man die Umrisse eines Menschen immerhin noch ganz gut erahnen kann. Das hier sieht aus wie ein Requisit aus einem richtig üblen Horrorfilm. Bloß ist es keins, sondern echt.
Der aufgedunsene, dunkel verfärbte Körper des Mannes hängt von einem dicken Ast, aufgeknüpft mit einem handelsüblichen weißen Stromkabel. Allerdings hat der Sturm den Ast vom Baum geknickt, weshalb der Körper jetzt viel zu tief hängt. Er würde mit den Beinen auf dem Waldboden schleifen, wenn noch Beine dran wären und nicht nur die angenagten Reste seiner Oberschenkel. Bei den beiden Armen ist es das Gleiche, da fehlt alles ab dem Ellenbogen. Seiler presst sich die behandschuhte Linke auf Nase und Mund. Ihr Verstand krallt sich an dem Geruch von Latex und Talkum fest, weil er sich an irgendwas klammern muss, das aus der richtigen Welt und nicht aus diesem Albtraum dort drüben stammt.
Der Kopf des Mannes ist auf seine Brust gesunken, so als starre er fassungslos auf seinen eigenen verstümmelten Körper. Die Leiche trägt ein ehemals vermutlich weißes Anzughemd und darüber ein an den Ärmeln zerfetztes Jackett, das vielleicht mal dunkelblau gewesen ist – schwer zu sagen, denn es ist durchweicht vom Regen und den diversen schleimigen Flüssigkeiten, die der Leichnam absondert. Eine Hose trägt der Mann nicht und auch keine Unterhose, aber von dem, was diese Kleidungsstücke normalerweise aus Anstandsgründen bedecken würden, ist ohnehin nicht mehr allzu viel vorhanden. Sie gehen näher ran, obwohl Seiler liebend gern darauf verzichten würde.
»Das war die Sippe«, sagt Novic, als er seine Taschenlampe hervorzieht und sie anknipst, um dem Toten von unten ins Gesicht zu leuchten. »So nennt man eine Wildschweinfamilie. Das hier ist ihre Suhle. Für die war der Körper des Mannes ein unerwartetes Festmahl. Und dann noch mitten in ihrem Wellnessbereich, sozusagen.«
»Milo!«, zischt Seiler und presst den Handschuh stärker auf ihr Gesicht. Latex. Talkum. Geistesabwesend fragt sie sich, warum Novic sich diesmal so gar nicht an dem strengen Geruch zu stören scheint, den der Körper verströmt. In Löwitschs Obduktionssaal kriegen ihn keine zehn Pferde wegen seiner überempfindlichen Nase, aber jetzt scheint er das völlig vergessen zu haben. Vielleicht hat er seine Probleme nur in geschlossenen Räumen, wer weiß. Oder nur dann, wenn er möglichst viele damit nerven kann.
»Suizid?«, fragt Doktor Löwitsch, und Seiler nickt.
»Davon gehen wir erst mal aus, Doktor Löwitsch. Es sei denn natürlich, Sie finden etwas anderes heraus.«
»Abschiedsbrief?«
»Bis jetzt haben wir noch keinen gefunden. Und wir haben keine Ahnung, wer der Mann ist. Ich meine … sein Gesicht …«
»Schon klar«, sagt Löwitsch und starrt den Leichnam aus zusammengekniffenen Augen an. Als wäre der ein Verdächtiger, der ihm etwas zu verheimlichen versucht.
»Geplant war das aber nicht so«, sagt Novic und deutet auf den abgeknickten Ast.
Seiler nickt. Es ist ein ziemlich dicker Ast, und die Bruchstelle ist noch ganz hell, also frisch. Ohne den orkanartigen Sturm in der vergangenen Nacht wäre das nicht passiert, da hat Novic recht. Dann hinge der Tote jetzt noch immer einen knappen Meter über dem Boden, und die Schweine wären leer ausgegangen.
»Das war ein älterer Mann«, sagt Löwitsch. »Um die siebzig vielleicht.«
»Dann wars vielleicht ein Alterssuizid«, sagt Novic und klingt dabei wie ein Musterschüler. »Seit ein paar Jahren tritt das nämlich häufiger auf. Alte Menschen verfallen in Depressionen. Sie kommen sich unnütz vor, die Rente reicht nicht, keiner besucht sie. Aufhängen findet man gerade in ländlichen Gegenden noch immer manchmal als gewählte Todesart, besonders bei Männern. Weit beliebter allerdings sind überdosierte Medikamente oder eine Plastiktüte über dem Kopf.«
Seiler schüttelt den Kopf. Praktisch mag es ja sein, die halbe Kriminalstatistik auswendig zu können, aber Novic präsentiert das so, als würde er von den aktuellen Modetrends der Saison sprechen. »Na, jedenfalls wissen wir jetzt, wie er die Hand verloren hat.«
Novic nickt. »Da steckt ein Stuhl im Schlamm.«
Das Sitzmöbel ist rot lackiert und liegt auf der Seite, halb versunken im Morast. Vier Beine, Sitzfläche, Lehne. Ein simples Möbelstück ohne Schnickschnack. Und offenbar alt, denn die rote Lackierung ist schon an vielen Stellen abgeplatzt.