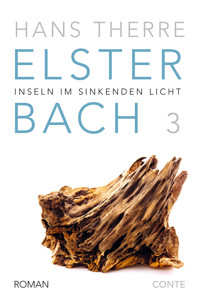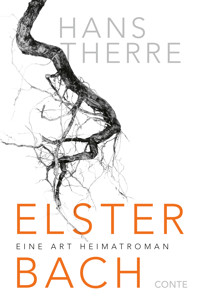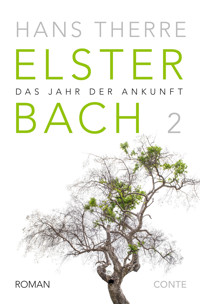
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Elsterbach-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der Schriftsteller Anders Nieheim ist nach vierzig Jahren aus Berlin in seine saarländische Heimat zurückgekehrt. Nach der Ankunft versucht er, seinen Alltag neu einzurichten. Er besucht nach Jahren wieder Sankt Wendel und Saarbrücken. An die Stelle der Erinnerung tritt gleichberechtigt eine fremde Wirklichkeit, die auch von seinen Träumen bedroht wird. In einer Zeit, in der um den Begriff »Heimat« gerungen wird, stellt Hans Therre die großen Fragen: Sind die Menschen, die wir kennen und kannten, Heimat? Die Orte, die untrennbar verwachsen sind mit unseren Geschichten? Ist sie geographisch gebunden oder eher ein Gefühl, das wir in uns tragen, wohin uns das Leben auch treibt? Sprachgewaltig und emotional erkundet »Elsterbach« durch die Augen eines Heimkehrers nicht nur die Seele eines Landes, sondern lässt die Leser den Weg von Anders Nieheim mitgehen: Wir erobern uns die Heimat nicht, sie schlägt ihre Wurzeln in uns.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Hans Therre - Elsterbach 2
Das Jahr der Ankunft
Kapitel 1 – Ankunft im Alltag
Kapitel 2 – Über die Dörfer
Kapitel 3 – Wiedersehen mit Sankt Wendel
Kapitel 4 – Alte Feinde, neue Freunde
Kapitel 5 – Tücken des Landlebens
Kapitel 6 – Wiedersehen mit Saarbrücken
Kapitel 7 – Besuch von einemHerzensfreund
Kapitel 8 – Panacea Coelestis
Kapitel 9 – Belladonna
Kapitel 10 – Alte Freunde, alte Fotos
Kapitel 11 – Winkelglück mit Bienenhaus
Kapitel 12 – Wiedersehen mit der großen Jugendliebe
Kapitel 13 – Besuch von einer Herzensfreundin
Impressum
Seitenliste
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113
113
114
115
116
117
118
119
121
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
209
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
281
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
311
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
337
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Navigationspunkte
Cover
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Textanfang
Impressum
Das Jahr der Ankunft
»We both know what memories can bring, they bring diamonds and rust.«
Joan Baez
Kapitel 1 – Ankunft im Alltag
Elsterbach, im Frühling des ersten Jahres
Erzählen wir vom Augenblick, der aus der Zukunft ins Licht des Tages sprießt und in die Vergangenheit sinkt.
Zukunft? Für einen Einundsechzigjährigen ist das nichts weiter als heute Morgen, heute Mittag, heute Abend, heute Nacht. Und Traum, in dem alle Zeiten wachsen, blühen und welken.
Nach der verheißungsvollen Osterankunft und einer langen Wanderung durch brandneues Erleben und im neuen Glanz leuchtendes Erinnern bin ich endlich im Alltag meines neuen Lebens angelangt. Es kommt mir jetzt so vor, als wäre ich danach ein zweites Mal von Berlin in einem Luftschiff oder bescheidener: einem Fesselballon in die neue alte Heimat eingeschwebt und hätte erst dann herabsteigen und aus dem Korb klettern können, nachdem unten am Boden hilfreiche Hände die eigenhändig über Bord geworfenen Stricke an in der Erde steckenden Pflöcken notdürftig festgezurrt hätten. Und als ich dann die Füße auf die neue Erde setzte, hätte man mir als erstes einen betagten, halblahmen Klepper, eine Rosinante, aufgenötigt, um wie ein alter, nicht sattelfester und reitunkundiger Don Quixote gegen mehr Windmühlen anzurennen als in der gesamten Mancha der Ritter von der traurigen Gestalt, der immerhin einen wackeren Knappen in Gestalt des Sancho Pansa an seiner Seite hatte.
Was ist ein Umzug doch für ein aufwendiges, abzuratendes Unterfangen für einen älteren herzkranken Mann. Umzug? Was für ein idyllisches Wort für einen Aufstieg aus einem Schattenreich glühenden Schmerzes und lähmender Trauer. Gut nur, dass die Karenz der vier Ostertage einen leidlich wehrhaften Schild schuf, mit dem ich die nun auf mich einprasselnden Schocks abfangen kann. Wie alle leibschwachen Geistesarbeiter neige ich dazu, die materielle, mit körperlicher Arbeit verbundene Seite eines Umzugs zu überschätzen und den Aufwand der verwaltungstechnischen Prozeduren zu unterschätzen. Es ist gar nicht so einfach, einen in drei Jahrzehnten geschaffenen, noch so bescheidenen Zivilstand von einem Ort zum andern zu verlagern.
Aber alles der Reihe nach.
Kaum einen Schritt habe ich getan in den neuen Alltag, da meldet sich Berlin zurück mit mehr oder weniger eindringlichen Mahnungen, die weniger sichtbaren Restbestände meines dortigen Lebens hinweg zu räumen, reinen Tisch zu machen.
Erfreulich ist die erste Mahnung: Herr Yildiz, der wackere türkische Sancho Pansa, möchte ich ihn nun fast nennen, schickt mir einen Brief mit einer CD, die zeigt, wie wortgetreu redlich er die Berliner Wohnung renoviert hat. Wie da das Aschenputtel, das ich verließ, auf den von Herrn Yildiz gemachten Fotos in unbeflecktem Weiß erstrahlt, bereit, einen anderen Mieter aufzunehmen! Noch erfreulicher ist wenige Tage später ein Schreiben der am Ende etwas zickig gewordenen Hausverwaltung, die mir die »Abnahme« der renovierten Wohnung bestätigt. Weniger erfreulich ist der Hinweis, meine zu Beginn des Mietverhältnisses gezahlte Kaution erst nach etlichen, mir ganz undurchsichtigen Verwaltungsprozeduren zurückzahlen und überweisen zu können. Ja, liebe Leute, mit dieser Überweisung habe ich aber fest gerechnet! Wie soll ich denn meine Schmutzwäsche ohne Waschmaschine waschen, die ich mir von genau dieser Rückzahlung kaufen wollte? Soll ich etwa Linda und Jan damit behelligen, sie zu den Schwestern nach Grüneiche schleppen oder sie gar im Elsterbach waschen? Nun, das sind Fragen, über die ich mir am besten selbst den Kopf zerbreche.
Unnötig, denn schon wenige Tage später kommt die erfreulichste Nachricht vom Campingplatzbesitzer, dem ich nach Solvejgs Tod und vor meiner Abreise aus Berlin unseren Wohnwagen zu einem redlichen Preis verkaufte, der meine Not nicht ausnutzte, um ein Schnäppchen zu machen, und der mir nun das Geld überwiesen hat. Jetzt ist Geld genug da für alle Eventualitäten und nicht allzu ernste Notfälle.
Und dann geht es los: Besuch von Herrn Hornbläser, des sympathischen rotblonden örtlichen Elektrofachmanns, der sich das defekte Fernsehgerät anschaut und es, wenig überraschend für mich, für unreparierbaren Schrott erklärt. Gegenbesuch in seinem Geschäft, in der seine Mutter, eine freundliche Dame in meinem Alter, die vor einigen Jahren ihren Mann an den Krebs verlor, mir nicht nur einen neuen Fernseher, sondern gleich auch eine Waschmaschine und einen Mikrowellenherd verkauft, die prompt geliefert und angeschlossen werden. Der Fernseher, ein neues, billiges Modell aus China, ist ungefähr so kompliziert zu bedienen wie eine Mondrakete. Doch der Fachmann schafft alles, und nun habe ich einen großen Flachbildschirm und kann, anders als in Berlin mit meiner mickrigen Zimmerantenne, über die Satellitenschüssel des Vormieters genau Siebenhundertfünfzig Programme einfangen. »Ein geniales Gerät«, kommentiert der Fachmann. Na gut, warum nicht ein geniales Fernsehgerät, wenn es schon zu Zeiten von Robert Musil geniale Rennpferde gab? Es wird sich dann aber schon bald herausstellen, dass von den siebenhundertfünfzig Programmen am Ende rund fünfzig übrigbleiben, mit denen ich vielleicht etwas anfangen kann. Wir werden sehen. Ach, was waren das für Zeiten, als man nur ein einziges, schwarzweißes Programm empfangen konnte, und oft auch nur dann, wenn man dem Gerät der Marke Saba mit viel Tätscheln gut zuredete! Ich erinnere mich, dass mein Vater, der die Filme von Charlie Chaplin und Buster Keaton geradezu närrisch liebte, manchmal die ganze Sendung lang mit der kleinen Zimmerantenne in der erhobenen Hand an genau der Stelle stehen bleiben musste, wo der Empfang am besten war. Dann lachte und lachte er, krümmte sich vor Lachen, alles mit der Antenne in der Hand.
Und nun beginnt der Reigen der Ämter: Einwohnermeldeamt, Friedhofsverwaltungen, Kfz-Amt, Jobcenter. Mein neuer »Fallmanager« ist kein Saarländer, sondern Pfälzer aus Birkenfeld, sympathisch, intelligent, schreibt Erzählungen in seiner Freizeit, hat ein Buch über die hohe Kunst des Fußballspiels veröffentlicht. Es gibt keine Probleme.
Als ich wegen des Urnengrabs und der Überführung der Urne vorspreche, schaut mich die Gemeindeangestellte in der Friedhofsverwaltung an, schweigend, tief, sie schaut mich Alten an, der ihr Vater sein könnte, wie eine Mutter ihren Sohn. Ein Heimatblick.
In der Liebe geht es um das Unzertrennliche. Hölderlins Satz »Alles Getrennte findet sich wieder« kommt als Spruch auf Solvejgs Grabstein.
Dann zum neuen Hausarzt, der mich begrüßt wie einen lang verschollenen Verwandten. Ja wieso eigentlich? Braucht er so dringend neue Kunden? Sitzen nicht genug hustende und schniefende Patienten mit Leidensmienen in seinem kleinen Wartezimmer? Ist er womöglich gar kein Saarländer und freut sich über einen wie er hochdeutsch redenden Klienten? Wie auch immer, lassen wir es im Geheimnis. Doktor Freimuth, Mitte vierzig, mit blondem, schon fliehendem Haar, ruft seine Frau, etwa gleichaltrig oder gar etwas älter, mit in einem interessanten Karottenrot gefärbtem Haar, und seine hübsche, braunhaarige und etwa zwanzigjährige Tochter herbei, erstere führt mit ihm die Gemeinschaftspraxis, die Tochter studiert Medizin und lernt in der elterlichen Praxis. Die ganze Familie raucht und sieht auch nicht danach aus, als würde sie einen guten Tropfen verschmähen. Der Arzt verschreibt mir anstandslos meine Blutdrucktabletten und misst meinen Blutdruck: 160/80. Er sagt: okay. Ich auch. Ein Arzt, der zu diesem Blutdruckwert okay sagt, kann nur ein guter Arzt sein. Er will aber demnächst aktuellere Blutwerte haben. Muss das sein? Was will er denn mit diesen aktuelleren Blutwerten anfangen? Weiß ich nicht selber am besten, wie es mir geht? Es ist leider auch hier eine Gängelung, wenn nicht Nötigung vorhanden, und alles nur, weil ich, wie meine Berliner Ärzte mit gerunzelter Stirn immer wieder betonten, ohne Blutdruck senkende Medikamente nicht auskommen kann.
Und sollten wir nicht auch demnächst eine kleine Vorsorgeuntersuchung machen?
Vorsorge?, frage ich. Lieber nicht, ich habe schon Sorgen genug, da hat mir eine Vorsorge gerade noch gefehlt.
Doktor Freimuth lässt es mit einem Lachen (vorläufig) bewenden. Wer will denn gleich einen neuen Kunden vergraulen?
Endlich noch zur Sparkassenfiliale im Ort, wo ein neues Girokonto das alte Berliner Konto bald überflüssig machen wird.
An einem der ersten Abende nach Ostern koche ich mir eine gute Erbsensuppe, probiere danach den schicken neuen Fernseher aus, und da auf den vielen Kanälen außer Mord und Totschlag nichts Interessantes läuft, schaue ich mir den netten Schwachsinn »Der Schuh des Manitu – Extra large« an. Ich halte es mit Paul Valéry, der meinte, nach getaner Arbeit habe er das Recht auf Verblödung.
Nach einer Woche ist das Gröbste überstanden, Ruhe und Alltag kehren ein, und das Geld für den Wohnwagen ist fast weg. Ich mache mich an die Arbeit an dem Buch, das ich Solvejg versprochen habe und das eine Hommage an sie sein soll.
Wie sieht mein Arbeitstag jetzt aus?
Nachts um drei stehe ich auf, ohne anderen Wecker als meine innere Uhr, nehme mein erstes Frühstück mit schwarzem Kaffee aus dem lindgrünen Becher mit der historischen Patina meiner Freundschaft mit Martin und einem Brot mit Marmelade oder Nutella, setze mich dann mit der ersten Zigarette an den Schreibtisch, schalte den Computer ein, rufe den Ordner »Dichterleben« auf, denn so soll das Buch heißen, dann die Datei der laufenden Arbeit. Nun arbeite ich bis ungefähr sieben Uhr morgens im nicht augenfreundlichen Kunstlicht der Schreibtischlampe an meinem Text. Dann bin ich meist müde, hin und wieder auch geistig und seelisch erschöpft vom Ansturm der Gedanken, Gefühle und Erinnerungen.
Vor der dringend nötigen Morgensiesta esse ich ein weiteres Brot mit Margarine und Käse, das ich im Stehen vor dem Fenster verzehre, während ich der Sonne bei ihrem Aufgang über dem Elsterbachtal zuschaue und durch die frische Morgenluft einlassende Balkontür den ersten Stimmen des anbrechenden Tages lausche. Auf der Straßenseite donnern hauserschütternd schon seit einer ganzen Weile Lastzüge vorbei, das wird im Lauf des Tages noch bunter werden. So ähnlich donnerte in Berlin auch die S-Bahn an meinen Fenstern vorbei, das ist wahrlich nichts Neues. Bloß ist dieser Ohrenschmaus jetzt doppelt so teuer. Aber auf der ländlichen Seite des Hauses ist die Morgenluft erfüllt von Vogelgesang, dem Muhen der Kühe und dem Wiehern der Pferde aus den Ställen des Bauernhofs nebenan. Manchmal schwebt ein Fischreiher herab, landet elegant im Elsterbach, um dort sein Frühstück zu suchen. Bisweilen höre ich von jenseits des Elsterbachs auf dem Feldweg zum Jagdschlösschen den Hufschlag eines Reiters. Ja, diese in eine lärmende Straßenseite und eine stille, wohlklingende Landseite gespaltene Wohnung ist eine Schizophrenie mit symbolischem Potenzial: Innenwelt begegnet Außenwelt. Seht zu, wie ihr miteinander zurechtkommt. Dass ihr euch ja nicht in die Haare geratet! Aber wie können sich Arkadien und Inferno miteinander vertragen?
Wir werden sehen.
Im Schlafzimmer (Straßenseite!) halte ich bei herabgelassenen Rollläden meine Morgensiesta. Vorher lese ich noch eine halbe Stunde leichte, traumbekömmliche Lektüre, im Augenblick Tolkiens Saga »Herr der Ringe«. Ein bisschen langweilig ist sie schon.
Hier darf ich mir, nach etlichen Fehlgriffen und Missgeschicken, endlich einmal zu einem geglückten Kauf gratulieren: im Globus-Kaufhaus in Sankt Wendel, dem größten im ganzen Kreis, habe ich für nicht allzu viel Geld eine neue Bettlampe gekauft, nachdem die schöne alte Lampe aus einem Berliner Trödelladen ihren Geist aufgab, und zwar, traut man den Fachleuten, für immer. Die Neuerwerbung ist durchaus nicht schön, das heißt, nur dann, wenn man ultramodernes Design mag, aber zweckmäßig. Aus einem schweren runden Metallfuß ragt die schlanke Stange, die in alle Richtungen beweglich ist und von mir am oberen Ende so umgebogen wurde, dass der schmale, tulpenförmige Schirm aus dickem Milchglas genau auf die Stelle gerichtet ist, wo das Buch, in dem ich lese, an der Kopfwand des Bettes lehnt. Das ist schon recht praktisch. Noch praktischer wird die Lampe dadurch, dass man die gewünschte Lichtstärke in drei verschiedenen Stufen regeln kann, ohne dass man Knöpfe oder Schalter drücken muss. Ein leichtes Antippen des oberen Stangenteils mit der Hand genügt zum Ein-, Um- und Ausschalten. Die schwächste erste Stufe verbreitet ein angenehmes, dem Wachdämmern nach dem Schlaf und dem Nachsinnen eines Traums günstiges Dämmerlicht. Für die stärkere zweite Stufe habe ich noch keine Verwendung gefunden, zum Wachträumen ist das Licht zu grell, zum Lesen noch zu schwach. Die dritte und stärkste Stufe ist dagegen ideal zum Lesen: punktgenau beleuchtet der Tulpenkelch aus Milchglas die aufgeschlagene Buchseite.
So viel zu einem kleinen Alltagskomfort, für den ich und meine immer schlechter und empfindlicher werdenden Augen dankbar sind.
Gegen zehn oder elf wache ich auf, meist mit Träumen oder Traumbrocken im Kopf, die, falls sie was taugen, nach dem zweiten Frühstück (eine Dublette des ersten) unverzüglich entweder ins Tagebuch oder gleich in den Computer wandern.
Wenn der Tag keine Belästigungen in Form von Alltagsgeschäften bereithält, wandere ich, wohl versehen mit Proviant, nach dem Frühstück hinaus ins Land, wie die Laune es mir eingibt. Mein Lieblingsweg, das hat sich rasch ergeben, ist eben der Weg, den ich zum ersten Mal an jenem schon fast denkwürdig gewordenen Ostermontag (er liegt nur wenige Wochen zurück) ging, Richtung Jagdschlösschen, durch den Bergwald (um meine Raucherlungen zu reinigen), vorbei am Bauernhof des Vetters Anton, zur Picknickbank an der Elsterbachmühle. Dort esse ich ein Brot, rauche eine Zigarette, schaue zu dem alten Bauernhaus hinüber, in dem Maya, falls es denn Maya war, verschwand und bisher auch nicht wieder auftauchte.
Ach ja, Maya! Oder gar Solvejg? Als ich vor Tagen auf dieser Picknickbank saß und über unsere Begegnung nachdachte, ist mir noch etwas eingefallen, etwas Beunruhigendes. Am Vortag hatte ich mir noch einmal Fotos von Solvejg als junges Mädchen im Alter von Maya angeschaut und dabei mit einer Gänsehaut bemerkt, wie sehr sich die beiden sogar als Kinder glichen. Ja und?, dachte ich, junge Mädchen von sieben bis zehn Jahren gleichen sich oft, und außerdem: wer sagt dir, dass deine Erinnerungen an das Kind Maya dich nicht trügen? Legst du nicht das deutliche, nein: gestochen scharfe, durch wohlbekannte Fotos dokumentierte lebendige Bild von Solvejg über deine schon fast schattenhafte Erinnerung an Maya, wodurch sie erst zu einem deutlicheren, Solvejg ähnelnden Bild wird? Warum habe ich bei unserer Begegnung an der Bank am Elsterbach zuerst und mit jähem, wonnevollem Erschrecken geglaubt, nicht Maya, sondern Solvejg träte mir aus den Auwiesen entgegen? Ein Wunschtraum, angeregt durch die Ähnlichkeit der Erscheinung in einem langen Kleid, das dem von Solvejg zum Verwechseln glich?
Aber dann, auf der Bank vor mich hin sinnierend, fiel mir noch etwas ein, was mich mehr beunruhigte als jene womöglich an den Haaren der Wunschphantasie herbeigezogene Ähnlichkeit. Als Maya (nennen wir sie so lange so, bis ich mehr von ihr weiß) neben mir auf der Bank saß, körperlich nur durch den Blumenkorb von mir getrennt, den sie, einfach so oder mit einer tieferen Absicht?, zwischen uns gestellt hatte, glaubte ich eine atmosphärische Veränderung wahrzunehmen, eine leichte elektrostatische Aufladung und Verzerrung der Luft. Ich erinnere mich deutlich, dass die Luft um sie herum plötzlich wie eine zum Reißen straffe Leinwand oder wie ein riesiges durchsichtiges Trommelfell war, das bei der geringsten Berührung mit einem ohrenbetäubenden Knall zerplatzen würde. Zuerst musste ich mich gegen den lächerlichen Eindruck wehren, Maya sei gar kein realer Mensch, sondern ein makelloses Hologramm, eine Lichtprojektion. Im Gespräch gewann ich dann den Eindruck, durchaus nicht mit einem Hologramm zu reden, sondern mit einem Menschen aus Fleisch und Blut, der in eine Art Schutzschild oder Energieschild eingehüllt sei. Mehr noch: ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass, würde ich Maya berühren, ich unversehens durch eine Art Sternentor in eine andere Welt, eine Parallelwelt oder in eine andere Dimension gezogen würde. Das war nun aber eindeutig Humbug und Hokuspokus, ich habe wohl zu viele Science-Fiction-Filme gesehen. Doch der Eindruck blieb, wurde zur Obsession. Ich musste dem Impuls widerstehen, Maya anzufassen und mich von ihrer körperlichen Realität zu überzeugen. Und sie schien das zu spüren, denn als sie aufstand und sich verabschiedete, reichte sie mir die Hand zum Abschied. Ich ergriff sie wie einen rettenden Strohhalm, der mich aus den Fängen meiner Phantasmagorie gezogen hätte, und es war dann nur eine ganz menschliche, etwas raue und warme Frauenhand.
Das war es, was mir vor Tagen einfiel, als ich in der Sonne auf der Bank saß und zur Elsterbachmühle hinüberschaute.
Doch weiter mit meinem Werktag. Wenn ich nachmittags von meinen Wanderungen heimkehre, arbeite ich vor dem meist frühen Abendessen noch eine Weile am Bildschirm, übertrage die auf den Wanderungen gesammelten Notizen und Gedanken in mein digitales Tagebuch oder vertiefe mich in meine Tageslektüre. Hin und wieder greife ich zur Gitarre, singe und spiele mehr schlecht als recht einige meiner Lieblingslieder. Das sind immer englische Songs, denn ich kann kein einziges deutsches Lied auf der Gitarre spielen. Das wird sich ändern müssen. Es sind Songs der Trauer, der Wehmut und des Vermissens: Scarborough Fair, Dust in the Wind, Sounds of Silence, Diamonds and Rust, um einige zu nennen.
Abends führe ich Tagebuch oder lese in Solvejgs Tagebüchern. Seit sie mich kennenlernte und zu lieben begann, sind ihre Tagebücher zu einem großen Teil Briefe an mich, die sie nicht abgeschickt hat. Jetzt, siebenundzwanzig Jahre später und nach ihrem Tod, lese ich diese Briefe an mich, die mich mit einer unsäglichen Trauer erfüllen. Ich möchte weinen angesichts des grausamen Unwissens, das bei und in uns beiden herrschte und aus dem fast alle Leiden der folgenden Jahre entstanden sind. Sind wir dazu verdammt (von wem?), immer erst dann das Richtige und Gute wissen zu können, wenn es zu spät ist? Kann dem im Bernstein der Zeit eingefangenen und offenbar erstarrten Leben jetzt, nachträglich, noch etwas hinzugefügt werden, das den Harzpanzer der Zeit sprengt und ihn für ein weiteres Leben, eine weitere Erfahrung öffnet? Kann das Versäumte, Versehrte des Lebens vielleicht doch im nicht nur Symbolischen, sondern auch Wirklichen nachgeholt und geheilt werden?
Wie liebe ich Solvejg, wenn ich lese, wie sie mich liebt und hasst, wie sie mich liebkosen, erdolchen und danach meinen toten Körper betrachten und zeichnen will. Diese Leidenschaft einer Tosca oder Carmen hätte ich meiner sanften Geliebten gar nicht zugetraut.
Kapitel 2 – Über die Dörfer
Türkismühle, im Frühling
Unterwegs nach Sankt Wendel nach vielen Jahren. Keine Stadt außer Berlin ist erinnerungsgesättigter als diese ehemals verschlafene Kleinstadt, einst und vielleicht auch noch heute eine jener À-cause-des-chats-et-du-sommeil-Städte, die Algernon Blackwood in seiner gleichnamigen Gruselgeschichte beschreibt. Solche Städtchen sind nie groß, und es gibt sie überall: es sind Zeitlöcher – oder vielleicht auch Zeitkapseln. Kommst du mit dem Zug auf dem Bahnhof an, warnt dich in Blackwoods Geschichte ein freundlicher Fahrgast, lieber nicht auszusteigen. Warum?, fragst du erstaunt und erhältst als Antwort: »Wegen der Katzen und wegen des Schlafs.« Das ist eine rätselhafte Auskunft, du willst mehr wissen, aber der Schaffner pfeift, der Zug fährt langsam an, du musst aussteigen und erfährst nur noch dies: einen Tag lang darfst du hier verweilen, aber nicht übernachten. Übernachtest du, läufst du Gefahr, nie mehr weg zu kommen, auf ewig zum Inventar der Stadt zu werden. Schon als Schüler, wenn ich mich auf meinem alltäglichen Schulweg zum Gymnasium befand, stellte ich mir gern vor, dass die Bewohner dieser Stadt nie altern und nie sterben. Und wenn sie dann doch endlich sterben, sterben sie eine ganze Ewigkeit lang.
Ich nähere mich der Stadt behutsam, gleichsam auf Katzenpfoten. Oder wie ein wahrer Waidmann, für den der Pirschgang Teil der Jagd ist. Ich nehme nicht den Zug wie der Held in Blackwoods Geschichte, verschmähe die Schnellstraße, wahrhaftig ein sprechender Name, der noch mehr als mit dem Eigenschaftswort schnell etwas mit dem Tätigkeitswort schnellen zu tun hat. Die Frage ist nur, wer oder was da schnellt und wer oder was da geschnellt wird. Es ist nämlich eine Straße, auf der man, hat man sich ihr erst ausgeliefert, von da nach dort geschnellt wird. Das ist viel und kommt auch gut an bei vielen, selbst wenn es während des Schnellens oder Geschnelltwerden weder eine Landschaft noch irgendeine andere Natur zu sehen gibt. Denn dafür geht der Vorgang des Schnellens viel zu schnell. In den Medien gibt es immer wieder grausige Bilder und bluttriefende Berichte von missglückten Schnellungen, denen stundenlange Stillstände oder gar Sperrungen folgen, die das gerade Gegenteil des Schnellens und Geschnelltwerdens sind.
Nicht mein Fall. Ich gondele in meiner alten weinlaubfarbenen Kiste der Marke Citroën über die Dörfer, leider längst nicht so saumselig, wie ich es gern möchte, denn auch die gute alte Landstraße wird immer mehr von an Schüttellähmung Erkrankten heimgesucht, von da nach dort Geschnellten, von Kriegszitterern des modernen Verkehrswesens. Schon nach zwei Wochen war mir klar, dass Autofahren auf saarländischen Landstraßen und durch saarländische Dörfer gefährlicher ist als eine lange Fahrt quer durch Berlin.
Wohlan! Gondeln wir los, so gut und so saumselig es eben geht. Erst einmal geht es in die Ortsmitte von Türkismühle, wo ich im Zeitschriften- und Tabakladen meinen Lottoschein ausfülle und abgebe. Oh ja, auch Dichter spielen Lotto, vor allem, wenn sie arme Dichter sind. Der Besitzer des Zeitschriften- und Tabakladens ist ein großer blonder Mann jenseits der Fünfzig, und er steht hinter seinem kleinen, ihm bis an die Hüfte reichenden Holztisch und seiner Ladenkasse da wie ein Seemann am Steuerrad eines Fischkutters. Anders als Pessoas berühmter Tabakladenbesitzer lächelt er nicht. Warum nicht?, fragst du dich und gibst dir selbst die Antwort: weil er, der strikte Nichtraucher, die Unschuld des Tabakverkaufens verloren hat.
Den Ort Türkismühle habe ich durch Lektüre, Gespräch und diverse Einkaufsgänge inzwischen etwas besser kennen gelernt, und ich weiß jetzt auch, woher sein Name stammt. Meine schmuckliebende Schwester Hanna stellte sich früher unter dem reizvoll klingenden Namen »Türkismühle« eine mit Türkisen geschmückte Mühle vor. Ich war noch naiver: ich glaubte, in diesem Ort gäbe es eine Mühle, eben die Türkismühle, wo die Edelsteine aus Idar-Oberstein gemahlen oder geschliffen würden. Ach Anders, Parzival, du tumber Tor!
Da aber bei diesem Ortsnamen die historischen Tatsachen ein einziger schwankender Sumpfboden sind, packen wir beherzt die Legende am Schopf, ziehen sie aus eben diesem Sumpf und geben sie frech als die einzige und blanke Wahrheit aus.
Und das ist nun die einzig wahre und wundersame Geschichte der Namensgebung des Orts:
Es war einmal ein Soldat, der diente im türkischen Heer. Als es Anno 1687 während des Großen Türkenkriegs Wien belagerte und von »Prinz Eugen, dem edlen Ritter« und seinen Mannen mächtig aufs Haupt geschlagen wurde, hatte dieser für uns bisher namenlose türkische Soldat die Nase voll vom Metzeln und Gemetzeltwerden. Er nutzte eine günstige Gelegenheit, desertierte aus dem Heer, begab sich auf Wanderschaft durch Europa und kam schließlich nach Nohfelden, wo es ihm offenbar gefiel. Vor allem aber gefiel ihm, wie er das Umland erkundete, das enge Tal der Nahe auf der Höhe des heutigen Orts Türkismühle, wo damals entlang des Flusses ein von Fußgängern und Fuhrwerken frequentierter Weg über Birkenfeld naheabwärts bis zum Rhein und in der Gegenrichtung in die Saargegend um Saarbrücken und weiter nach Frankreich führte. Hier ließe sich doch, dachte der offenbar gewitzte Fahnenflüchtige, eine kleine Schankwirtschaft einrichten, wo hungrige und durstige Reisende sich stärken und erfrischen könnten. Gedacht, getan. Die Wirtschaft wurde eingerichtet und erwies sich zwar nicht gerade als Goldgrube, aber auch nicht als Fass ohne Boden.
So vergingen einige Jahre, bis dem zum Schankwirt gewordenen ehemaligen Soldaten der Gedanke kam, neben der Wirtschaft an der Nahe eine Mühle zu errichten. Die Baugenehmigung war aber für einen muselmanischen Türken nicht so einfach zu erhalten, und so schwor er seinem Glauben ab, den er vielleicht schon vorher im Kriegsgemetzel verloren hatte, wurde Christ, nahm den Namen Heinrich Türkis an und heiratete, wohl ein saarländisches Mädchen, wie zu vermuten ist. Mit diesem soliden Christenstatus und Zivilstand ausgestattet, erhielt er nun 1698 vom Herzog in Zweibrücken die begehrte Genehmigung zum Bau der Mühle, die im Umland schon bald als Türkismühle bekannt wurde. Von da an ging es wirtschaftlich bergauf. Bauern, Handwerker, Waldarbeiter, Händler begannen sich um Gasthaus und Mühle anzusiedeln, und so entstand nach und nach der Ort Türkismühle. Als im 19. Jahrhundert der Bau der Bahnstrecke Bad Kreuznach – Neunkirchen – Saarbrücken begann und der Ort 1860 einen Bahnhof erhielt, war es zwar vorbei mit der Mühlenidylle am rauschenden Fluss, aber wirtschaftlich ging es weiter steil aufwärts, natürlich nicht mehr mit dem Mühlengründer, der längst gestorben war, sondern mit seinen Erben. Aus der ganzen Gegend brachten Bauern und Handwerker ihre Produkte mit Fuhrwerken zur Bahn, und um den Bahnhof herum entstand ein reges Markttreiben. Auch die Arbeiter aus dem näheren und weiteren Umland benutzten die Eisenbahn, um zu ihrer Arbeit in die Gruben und Hütten des Saarlandes zu fahren.
Die Gastwirtschaft und Mühle der Nachfahren des Heinrich Türkis, vor allem aber der Bahnhof zogen weitere Geschäftsleute mit guten Nasen für Gewinne an. Neue Wirtshäuser und Geschäfte wurden gebaut, Gewerbe und Industrie siedelten sich an. Eine Post wurde eingerichtet, Holz, Holzkohle, Eisen und Leder produzierende und verarbeitende Industrie kamen hinzu. Ein Ort mit regem Handel und Wandel war geboren. So kam es zu dem seltenen Fall, dass ein türkischer Einwanderer zum Gründer und Namensgeber eines deutschen Dorfs wurde. Und ein Dorf entstand, das anders als die meisten Dörfer im Saarland seine Wurzeln nicht in keltisch-römischem Erdreich hat.
Inzwischen ist viel Wasser die Nahe hinabgeflossen. Wo früher die Mühle des Heinrich Türkis rauschte und klapperte, steht heute eine von einer asiatischen Familie geführte Pizzeria, und an ihr vorbei rauschen und klappern alltäglich unzählige Lastwagen, Lastzüge, Pkws, Motorräder, Busse und Wohnmobile. Sitzt man auf der Terrasse der Pizzeria, muss man schreien, wenn man ein Gespräch führen will. Von den giftigen Abgasen, die man einatmet, will ich hier schweigen. So viel aber muss ich sagen, dass wie überall in den Dörfern, durch die ich bis jetzt gefahren bin, eine Verkehrsplanung, die den Dorfbewohnern zugute kommt, nicht mal in Ansätzen zu erkennen ist.
Der Ort hat mit dem Bahnhof nun zwar einen Kern, ist aber immer noch sehr zersiedelt. Es sieht so aus, als seien die Häuser und Häuserzeilen, ja ganze Straßen in wilder Flucht (vor den Hochwassern der Nahe, dem Lärm der Straße, dem Rattern der Eisenbahn?) in alle vier Himmelsrichtungen auseinandergestoben, dann aber doch an den Hängen zweier Berge, dem Türkenkopf und dem Meckenheimer Hang, die das Dorf im engen Nahetal links und rechts einkesseln und buchstäblich in den Schwitzkasten nehmen, gescheitert und von der geheimnisvollen Gravitation des Ortskerns eingeholt und festgebannt worden. So kann der Ort, zerschnitten von der lärmenden und stark befahrenen Durchgangsstraße, weder ein- noch ausatmen. Und wie soll sich im Getöse und Gestank der Kleinwagen, Lastwagen, Busse und der noch fürchterlicheren Lastzüge ein Dorfleben mit saumseligem Einkauf, geruhsamem Stehenbleiben zum Schwatzen und Tratschen entwickeln? Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Und wenn man nach dem Besuch beim nicht lächelnden und nicht rauchenden Tabakhändler Lust bekommt, auf der anderen Straßenseite im Garten der Pizzeria einen Imbiss zu nehmen, muss man höllisch aufpassen, dass man selbst beim Überqueren des Zebrastreifens nicht direkt ins Krankenhaus oder gar in die ewigen Jagdgründe geschnellt wird.
Ja, in der Vergangenheit des Landes und seiner Ortschaften lässt es sich wohl sein, weniger aber, wie es scheint, in ihrer Gegenwart.
Lindenthal, im Mai
Nun aber zurück auf die Landstraße nach Walhausen, einem uralten Köhlerdorf, wo sich schon im Mittelalter ein Kupfer- und Bleibergwerk befand und seit Urzeiten Holzkohle hergestellt wird. Nein, Wale hausten hier nie, der Ortsname stammt, so vermutet man, von dem nahen Buchenwald Waldhausen. Die Scharfrichter der Gegend stammten aus Walhausen, und berühmte wundermächtige Zauberer soll es hier gegeben haben. Außerdem gibt es irgendwo im Ort einen Hinkelstein, aber da ich heute nur auf der Durchfahrt bin, bleibt er mir verborgen. Der im deutschen Sprachraum gebräuchliche volkstümliche Name Hinkelstein entstand schon im Mittelalter aus dem Wort Hünenstein, das im Lauf der Zeit nicht mehr verstanden wurde, wohl weil es keine Hünen mehr gab. So schrumpfte es zu Hühnerstein und mundartlich zu Hinkelstein. Was ich jetzt und heute von Walhausen sehe, ist ein schlichtes und sauberes kleines Dorf ohne jeglichen Handel und Wandel. Kein Mensch ist in Sicht. Kein Obelix liefert Hinkelsteine aus oder kehrt mit seinem Kumpel Asterix schwerbeladen von der Wildschweinjagd im nahen Wald zurück. Aber eine schwarze Katze überquert in zwanzig Metern Entfernung die Straße, ganz gemütlich, ohne sich von meinem näher kommenden Auto hetzen zu lassen. Die hat ja die Ruhe weg, denke ich, während ich stark abbremse. Schlechtes Omen? Nein, ein gutes.
Weiter geht es auf einer schmalen holprigen Landstraße, die noch aus den Zeiten der Postkutschen und Postillone hoch auf dem gelben Wagen stammen könnte, wäre sie nicht asphaltiert, durch eine liebliche, sanft geschwungene Landschaft hinauf nach dem kleinen und alten Dorf Steinberg. Hier gibt es nun schon etwas mehr Handel und Wandel. Ich sehe Restaurants, eine Bäckerei, eine Autowerkstatt, während ich durch die fast menschenleere, allerorten mit Autos gut bestückte Ortschaft fahre. Dann geht es auf der, man glaubt es kaum, noch schlechter werdenden Landstraße nach Güdesweiler, dem Geburtsort meines Schwagers Willi, dessen Familie ich als Kind und Jugendlicher oft besuchte. Zu Fuß, wohlgemerkt. Der schon im Mittelalter vorhandene Ort ist recht schön, und sein Gesicht hat sich, soweit ich mich entsinne, in den letzten Jahrzehnten kaum verändert. Los ist auch hier nichts, zwei Kneipen und ein paar kleine Geschäfte machen Siesta. Die Einwohner offenbar auch. In der einen Kneipe an der Mündung zweier Straßen liegt das alte Gasthaus ZumFlare, wo der junge Anders hin und wieder den Karneval feierte, Schwager Willi als Schauspieler in volkstümlichen Theaterstücken glänzte und die später weltberühmte Nicole als sehr junges Mädchen, ja schon als Kind ihre ersten Auftritte hatte und Erfolge feierte und danach todmüde von ihrem Vater durch die dichten Rauchschwaden des Saals nach Haus getragen wurde.
Im übrigen gilt auch hier wie für fast alle Orte, die ich bis jetzt gesehen habe: inmitten einer Sauberkeit, Reinlichkeit und Aufgeräumtheit, die in dieser hohen Dosis Ungutes, nämlich unter den Teppich Gekehrtes wittern lässt, herrscht allerorten eine große Menschenleere, die noch deutlicher empfunden wird, sieht man vereinzelt einen Fußgänger oder eine Frau, die im Garten Wäsche auf die Leine hängt. Nein, das sind, allen äußeren Ähnlichkeiten zum Trotz, nicht mehr die Heimatorte meiner Kindheit und Jugend, die sich vor lauter Leben nicht zu lassen wussten.
Endlich erscheint Lindenthal, die Nachbargemeinde meines Geburtsorts Grüneiche, mir von Kindheit an fast genauso vertraut und ans Herz gewachsen wie dieser. Ich will zwar nach Sankt Wendel, aber an diesem zweiten Heimatdorf kann ich nicht vorbeifahren, ohne auszusteigen und einen Blick auf die alten und die neuen Dinge und Menschen zu werfen.
Die Einfahrt gestaltet sich holprig, auch hier scheint die öffentliche Hand am Ende ihrer Kraft zu sein. Neben den schlichten Häusern von einst stehen neue Musterkataloghäuser, und daneben dösen halbe oder ganze Ruinen uralter Bauernhäuser ihrem Abriss entgegen. Was eindeutig kein gutes Omen ist. In diesen uralten Bauernhäusern wohnen nämlich die Geister der Ahnen, denen es nicht gefallen wird, dass man ihre Heimstatt mutwillig oder gedankenlos zur abrissreifen Ruine zerfallen lässt. Doch keiner glaubt heute mehr an Geister und Ahnen oder fürchtet sich vor ihrer Rache, vielleicht weil man selbst schon geisterhaft geworden ist?
Das Gesicht des Ortes hat sich nur wenig verändert seit vierzig Jahren, selbst die Geschäfte und Gaststätten sind, wie es scheint, noch die gleichen. Gegenüber der Apotheke steht das zweistöckige weiße Haus, in dem Marita, meine erste und einzige große Jugendliebe, mit ihrer Familie wohnte, fast so da wie vor Jahrzehnten. Marita und ihre Familie wohnen hier nicht mehr, das weiß ich von meinen Schwestern. Marita ruht neben ihrer älteren Schwester Anita auf dem Kirchhof, beide hat mit fünfzig Jahren der Krebs dahingerafft. Die Eltern sind längst tot und grablos, nur noch die jüngere Schwester Lilly ist am Leben und wohnt, allein oder nicht, irgendwo im Umland. Ich kannte sie alle drei gut, dieses jugendfrische Kleeblatt, bei dem ich manchmal nicht so genau wusste, welches Blatt ich am schönsten fand. Nun sind zwei Teile davon tot, wie meine Solvejg Opfer des allesverschlingenden Krebses.
Und schon bin ich in der alten Ortsmitte, am mehrstöckigen, langgestreckten, einst so berühmten und wunderbaren Kaufhaus Warich, das sich in einem jämmerlichen Zustand befindet. Die früher, passend zum Ortsnamen, lindgrün leuchtende Fassade ist zu einem schmutzigen bröckeligen Spinatgrün verkommen, die zum breiten Eingangstor führende Doppeltreppe ist in einem so schadhaften Zustand, dass man, vor allem als älterer Mensch, sich dort leicht den Hals brechen oder zumindest einen Knöchel verstauchen kann. Wären da nicht die Reklameschilder eines Discount-Markts, könnte man das ganze Gebäude für eine weitere Ruine halten.
Das will ich mir näher ansehen. Ich stelle das Auto in eine Parkbucht neben einer Konditorei (beide gab es früher noch nicht) und steige aus. Auch hier sind wie in Grüneiche und anderen Orten die Straßen auf merkwürdige Weise verschönert, wahrscheinlich in der besten Absicht, die Geschwindigkeit des Verkehrs zu drosseln, doch durch diese Verschönerungsmaßnahmen sind die ohnehin engen Straßen noch enger und unübersichtlicher geworden, und durch diese Schläuche pressen sich die Autos, die sich anders als die Menschen wie Karnickel vermehrt haben, nicht mit gedrosselter, sondern erhöhter Geschwindigkeit. Früher hätte ich hier stundenlang wie ein Hans Guck in die Luft herumlaufen und vor mich hin träumen können, ohne Leib und Leben zu riskieren. Heute sind die Straßen und nicht nur sie, sondern auch die zum Teil wild zugeparkten Bürgersteige zu Minenfeldern geworden. Auf Schritt und Tritt muss man auf der Hut sein vor diesen dummen Blechbüchsen, die im Lauf der Jahrzehnte zum Lieblingskind fast aller Deutschen geworden sind. Ja, die Römer, die natürlich auch hier waren, haben sich mit ihren Bleibechern vergiftet, die hiesigen Nachfahren vergiften sich mit den Abgasen ihres Lieblingskindes.
Ich überquere eilig hopsend die schmale Straße, gehe zum ehemaligen Kaufhaus Warich hinüber, dessen paradiesischer Warenglanz erloschen ist. Hier schlug einmal das Herz nicht nur von Lindenthal, sondern der ganzen näheren Umgebung. Fast alle Kleider, die ich als Kind und Jugendlicher am Leib trug, fast alle Spielwaren, mit denen ich spielte, meine Rollschuhe und Schlittschuhe, mein erstes Fahrrad und längst Vergessenes stammten aus diesem Kaufhaus, dessen Verkäufer und Verkäuferinnen wie mir scheint immer freundlich waren, selbst zu Kindern, die damals anders als heute als zahlende Kunden noch nicht viel zu bieten hatten, und dessen Warenangebot sich neben dem der großen Kaufhäuser der Kreisstadt durchaus sehen lassen konnte. Beinahe andächtig gehe ich die schadhafte Treppe zum Eingang hoch. Aber der ist geschlossen und verrammelt. Aha! Ein Schild warnt vor dem Betreten der Treppe. Zu spät, ich bin schon da, gehe weiter in Richtung der Reklameschilder an der rechten Seite des Gebäudes.
Da ist nun weiter nichts mehr als der Discount-Markt, auch er mit einem reichlich schäbigen Gesicht. Draußen vor dem Eingang liegt in Warenkörben der übliche Plunder aus den »Billiglohnländern« der sogenannten »Dritten Welt«, die, zumindest was Afrika angeht, einmal die Erste Welt war. Ich will nicht verschweigen, dass auch das eine oder andere Brauchbare oder Nützliche darunter ist.
Ich betrete den düster und depressiv wirkenden Discount-Laden, um mir ein paar Billigzigaretten zu kaufen und fange mit der genauso depressiv wirkenden einzigen Verkäuferin, die dem Akzent nach aus einem der Länder des ehemaligen Jugoslawien stammt, ein kurzes Gespräch an. Von den herrlichen und glanzvollen Zeiten des Kaufhauses weiß sie gar nichts. Kein Wunder, war sie doch damals mit Sicherheit noch gar nicht geboren. Dafür erfahre ich von ihr, dass nicht nur die Tage des Discount-Ladens gezählt sind, sondern auch des ganzen Gebäudes, das in diesem oder nächsten Jahr abgerissen werden soll. Ach! Und was soll an die Stelle treten? Ein neues Rathaus, soviel sie gehört habe. Das alte sei wohl zu klein und alt geworden. Mehr weiß die Metökin nicht zu erzählen, die, selbst wenn sie schon lange im Ort lebt, hier keine Wurzeln und damit auch keine Erinnerungen hat. Ich verlasse den Laden mit meinen Billigzigaretten, die inzwischen so teuer geworden sind, dass man sie eigentlich nicht mehr billig nennen kann. Kein Wunder, »Vater Staat« kassiert rund 80% des Preises, damit er mit aufgeblasenen Backen weiter über die Raucher herziehen kann.
Draußen gehe ich in Richtung des ehemaligen großen Freigeländes, wo sich früher der Kirmesplatz befand. Schon von weitem hörte ich damals das Durcheinanderplärren der mit technisch oft sehr dürftigen Megaphonen bewaffneten Marktschreier, falls sie es nicht vorzogen, allein ihrer Stimmgewalt zu vertrauen, die Musik allerunterschiedlichster Güte von den Karussellen und beschleunigte meine Schritte. Dann stand ich auch schon auf dem sonst meist leeren, jetzt vollgerammelten Platz inmitten einer sinnenverwirrenden Fülle von Klängen, Gerüchen und Farben. Ich roch die Bratwürste der Bratwurstbuden und die süßlichen Ausdünstungen der Buden mit Zuckerwatte, Lakritz, Bonbons, Speiseeis und weiß der Himmel was noch. Ich hörte das Kettenrasseln des Kettenkarussells und das Donnern der Berg-und-Tal-Bahn, das helle Knallen der Schießgewehre an den Schießständen und das dumpfe Poltern der nach Blechpyramiden geworfenen Bälle. Caterina Valente lag im Wettstreit mit Freddy Quinn oder gar Rocco Granada, vereinzelt mischte sich eine Drehorgel in den Klangsalat, dazu das Stimmengewirr, Schreien und Lachen der Kirmesbesucher aller Altersklassen, das lauthalse Brüllen der Marktschreier, das Dudeln und Bimmeln von Automaten, wenn eine Stoffkatze oder ein Plüschbär als Hauptgewinn erzielt wurde. Und in all dem betäubenden und die Sinne mehr als jeder Alkohol berauschenden und aufputschenden Treiben, inmitten einer dichten, in alle Richtungen wogenden Menschenmenge, jauchzender, jammernder, an den Hosenbeinen der Väter und Rockschößen der Mütter zerrender Kleinkinder stand ich erst einmal eine Weile herum und wusste nicht so recht, wohin ich mich als erstes entführen und von was ich mich bezaubern lassen sollte.
Drei Orte waren es, die mich vor allem anzogen, egal ob ich allein oder mit Kameraden unterwegs war: die Schieß- und Wurfbude, die Berg-und-Tal-Bahn und als Krönung des Ganzen die Autoscooterbahn. Die Schieß- und Wurfbude suchte ich deshalb gern auf, weil ich trotz Kurzsichtigkeit und sie korrigierender Brille ein guter Schütze war, der eigentlich immer etwas gewann, und wenn es auch nur eine Plastikrose oder eine Gipsballerina für mein Mädchen war. Einmal, ich erinnere mich genau, habe ich sogar den Hauptpreis gewonnen, ein damals noch seltenes und begehrtes Kofferradio. Nicht so groß wie ein Koffer, eher wie ein kleiner Schulatlas. Und dann, ja leider, trieb ich mich an den Schießbuden auch deshalb gern herum, weil ich gern schoss. Ich liebte es, den meist alten Schießprügel an die Backe und Schulter zu setzen, mit einem zusammengekniffenen Auge über Kimme und Korn lässig das Ziel anzuvisieren und abzudrücken. Jaja, Zinnsoldaten-, Indianer- und Cowboy-Kindheit ging nahtlos in kriegerisch gestimmte, in Waffen vernarrte Pubertät über. Während ich hier also eine Menge Zeit verbummelte und Geld ausgab, manchmal aber auch gewann, wenn irgendein armer Dussel, der meine Schießkunst noch nicht kannte und dem Brillenträger nichts zutraute, sich zu einer Geldwette verlocken ließ, tat ich die Wurfbude meist mit links ab. Außerdem gewann man hier selten etwas Brauchbares, war doch die Pyramide aus Blechdosen so raffiniert aufgebaut, dass man sie zwar meist schon mit dem ersten Wurf zum Einsturz bringen, fast nie aber alle Dosen mit den restlichen zwei Würfen abräumen konnte. Kinderkram und Bauernfängerei in einem.
Die Berg-und-Tal-Bahn war interessant, weil sie, wenn ihre auf und ab rasende Kreisfahrt richtig in Schwung kam, ein Stoffverdeck ausfahren konnte, das sich als perfekter Sichtschutz über die einzelnen Sitzkabinen herabsenkte, so dass man für kurze Zeit mit seinem begehrten Mädchen allein und im Dunkeln geborgen war, lange genug jedenfalls, um die eine oder andere Umarmung zu riskieren oder von der Liebsten ein paar Küsse zu rauben. Mehr war nicht drin, aber damals, Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre, waren die jungen Leute, wie in fast allem, auch in der Erotik nicht so anspruchsvoll und verwöhnt wie heute. Ich fuhr trotz diesen erotischen Genussversprechungen nicht sonderlich gern in dieser Bahn, denn die auf und ab rasende Kreisfahrt machte mich leicht schwindlig im Kopf. Manchmal wurde mir sogar kotzübel, und statt die erhofften Zärtlichkeiten zu ernten, musste ich alle Willenskräfte aufbieten, um meinen Mageninhalt dort zu behalten, wo er hingehörte.
Das an der Dachdecke funkensprühende große Rechteck der Autoscooterbahn war dagegen reine Magie. Seine Anziehungskraft, mit jedem Lebensjahr stärker werdend, wirkte unwiderstehlich, und ich erinnere mich, auf manchem Kirmesfest so gut wie meine ganze Barschaft an der Kasse dieser Spielwiese für angehende Auto-Matadore gelassen zu haben, wo mir der Fahrschein (oder war es ein Coupon aus Blech?) von abenteuerlich und piratenhaft ausstaffierten, braungebrannten Burschen mit muskulösen und tätowierten nackten Armen und goldenen Ringen im Ohr oder von grell geschminkten, tief dekolletierten Zigeunerinnen in die vor Aufregung schwitzenden Hände gedrückt wurde.
So viel steht fest: anders als am Schießstand war ich auf der Autoscooterbahn alles andere als ein Meister. Ich hatte sogar, um die Wahrheit zu sagen, oft Angst (Schiss hieß das damals), mich in einen dieser engen Scooter zu quetschen, wo man die Beine, wenn man nicht gerade kurzbeinig war, kaum unterbringen konnte. Hinzu kam, dass meine Brille, die am Schießstand für blendende Tarnung sorgte, sich hier als schwerer Nachteil erwies. Bei manchen heftigen und überraschenden Zusammenstößen flog mir das Ding nämlich leicht von der Nase, und es war keine geringe Schmach, wenn ich, neben meinem Mädchen sitzend, im Beinraum des Fahrzeugs oder gar mitten auf der Fahrbahn nach ihr fischen gehen musste, dabei die Gewalt über das Steuer verlor und, als lauerten alle Mitfahrer auf diesen Augenblick der Schwäche, von allen Seiten attackiert, in eine schmachvolle Enge getrieben und gnadenlos zusammengestaucht wurde.
Ja, Lorbeeren als Autoscooter-Matador habe ich nie geerntet, und dennoch war ich versessen auf diese schlingernden und Kurven schlagenden Kreisfahrten, bei denen es hin und wieder auch zu recht schmerzhaften Blessuren und Verstauchungen kam. Nichts war schöner als auf einer nicht überfüllten Fläche elegant und mit einem lässigen Arm um die Schulter meines Mädchens gelegt dahinzugleiten, von Kameraden oder Bekannten, die neben der Fahrbahn zuschauen mussten, begafft und beneidet zu werden, und inspiriert von einem wilden Elvis-Presley-Song, Devil in disguise etwa, der endlich die öden Schlagerschnulzen vom musikalischen Parkett fegte, alle Vorfreuden des künftigen Autofahrerlebens auszukosten.
Ach ja, auch dieser herrliche Rummel- und Tummelplatz ist nicht mehr da, wo außerhalb der Kirmeszeit immerhin ein von Jung und Alt gern besuchter Sportplatz war, auf dem sich an den Sonntagen der FC Grüneiche und der SV Lindenthal feurige und heftig beklatschte oder ausgepfiffene, nicht immer glanzvolle Fußballduelle lieferten. Jetzt und schon seit langem ist hier (zu recht gesalzenen Preisen) ein Wohn- und Konsum-Schlaraffenland erstanden, das neu errichtete Einkaufsparadies, das ich zwar von einem früheren Besuch bei der Familie schon kenne, mir aber noch einmal anschauen will. Vorher bemerke ich noch, dass das alte Gasthaus, in dessen großem Saal ich als junger Mann hin und wieder das Tanzbein schwang und die eine oder andere Familienhochzeit mitfeierte, ebenfalls verschwunden ist. Stattdessen stehen dort zwei Neubauklötze, in denen sich zwei Bankfilialen eingenistet haben. Ja, Banken pflastern unsern Weg in die abschüssige Zukunft. Nein, es sind nur die Filialen zweier Sparkassen, die die Spargroschen ihrer örtlichen Kundschaft möglichst redlich verwalten und vermehren und keine Spekulantengeschäfte auf Kosten ihrer Kunden betreiben. Oder doch? Lassen wir die Frage offen. Gegenüber der direkt an der Straße liegenden Sparkasse gibt es noch eine winzige Postfiliale, die gleichzeitig ein Schreibwarenladen und auch noch so manches andere ist. Ich gehe hinein, kaufe bei einem wortkargen Ehepaar ein paar Notizbücher und ein dickes Buch über meinen Heimatort. Ich bin gespannt, was da drin steht. Es gibt noch eine ganze Reihe Bücher und Fotokalender über die Heimat zu kaufen, die ich mir leider nicht leisten kann. Das gerade gekaufte dicke Buch übrigens auch nicht.
Vorbei an einem funkelnagelneuen privaten Altersheim oder, wie es nun heißt, Seniorenwohnsitz, und einem Sonnenstudio, das auch schon sonnigere Tage gesehen zu haben scheint, gehe ich zum Einkaufsparadies, das aus einem U-förmigen Gebäudekomplex mit Geschäften im Erdgeschoss und Appartements im zweiten Stock und einer ganzen Reihe von fast kreisförmig gebauten Ladenanlagen besteht. Die Appartements (eins davon bewohnt Schwager Willis Schwester Angela) verleihen mit ihren blumengeschmückten Balkons dieser Seite des Platzes ein leicht südliches Flair. In der Mitte des Platzes klafft ein riesiger, wohlgenutzter Parkplatz. Ringsum sehe ich der Reihe nach eine Arztpraxis, eine Versicherungsgesellschaft (oder war es ein Steuerberater oder eine Anwaltskanzlei?), einen Kleider-Discounter, ein Brillenstudio, einen Edeka-Markt, einen Penny-Markt, einen Blumenladen, ein Nähstübchen und eine Apotheke. War das alles? Wahrscheinlich nicht, aber nichts von alledem gab es hier in der Zeit, als Lindenthal mein zweiter Heimatort war. Auch nicht den von Holzbänken gesäumten schönen kleinen Springbrunnen in der Mitte eines fast kreisförmigen, für eine Menge Geld totgepflasterten Rast- und Erholungsplatzes. Eine seltsame Dorfästhetik scheint hier im Schwang zu sein: alles scheint erst dann schön zu sein, wenn es viel Geld kostet und einen unbenutzten Anblick bietet. Soll alles, wie eine Dekoration, hübsch aussehen, aber nicht leben? Ja, Leben erzeugt Lärm, Unruhe, Schmutz, Unrat, Chaos, kurz: Folgekosten, also lasst es, das Leben, liebe Mitbürger, das lebendige Leben, unterstützt lieber unser heimisches Handwerk und Unternehmertum, ist doch wurscht, was es ausbrütet und anrichtet.
Wie ich nun auf der Bank sitze, eine Zigarette rauche und den sprudelnden Brunnen betrachte, habe ich das Gefühl, ich könnte ebenso gut in irgendeinem Dorf in Deutschland sein. Ein richtiges Heimatgefühl scheint sich nicht einfinden zu wollen, wenn das heimatliche Alte den Kampf gegen das noch nicht heimatlich gewordene oder wahrscheinlich auch nie heimatlich werdende Neue verloren hat. Trotzdem fühle ich einen Anflug von – Glück. Ja, Glück, einfach da sitzen, rauchen, mich von der wärmenden Sonne umschmeicheln lassen, dem Springbrunnen beim Sprudeln zuschauen und die Schulkinder betrachten zu können, die einige Bänke weiter weg sitzen und in ihre Handys kichern, inmitten der wenigen Fußgänger und nicht allzu reichlich vorbeifahrenden Autos in einem Dorf meiner Heimat zu sitzen, sei diese nun das Saarland oder Deutschland. Denn ich liebe auch die Atmosphäre der kleinen brandenburgischen Dörfer im großen Bannkreis Berlins, das Dorf Wiepersdorf im Fläming oder auch die Dörfer auf Rügen, bevor sie vom Massentourismus platt gemacht wurden, das portugiesische, das griechische und das europäische Land. Ja, wie ich jetzt so sitze und sinne, stelle ich überrascht fest, dass mein Heimatgefühl an den Grenzen Europas Halt macht und nicht weiter reicht. Nein, das ist kein Kontinental-Chauvinismus, erst recht kein Lokalpatriotismus, beide tragen Scheuklappen oder haben ein Brett vor dem Kopf, sondern weise Beschränkung, und wenn das von meiner Mutter früher oft fast wie ein Mahnspruch zitierte geflügelte Wort »Bleib im Land und nähre dich redlich« je einen Sinn für mich hatte, dann den: Bleib in Europa und nähre dich redlich vom unendlich reichen Schatz seines Erbes.
Als man James Joyce fragte, warum er nach jahrzehntelangem Exil nicht in sein Vaterland Irland zurückkehre, sagte er sinngemäß: Europa ist mein geistiges Vaterland, und mein leiblicher Vater hat mir immer geraten, dorthin zu gehen. So bin ich hingegangen.
Europa ist also mein Heimatland, und innerhalb Europas Griechenland, Portugal mit meinem dritten Heimatdorf Porto Novo, Deutschland, das Saarland, der Kreis Sankt Wendel, mein Geburtsort Grüneiche und seine Schwestergemeinde Lindenthal: hier schlägt das Herz meines Heimatgefühls.
Und neuerdings auch ein bisschen und noch sehr zaghaft in Elsterbach.
Fast alle sagen ja: um sich an einem Ort wohl und heimisch zu fühlen, kommt es nicht auf den Ort selbst an, sondern auf die dort lebenden Menschen. Die das sagen, sind die echten Heimatlosen. Sie sehen nicht, dass es gerade der Ort selbst ist, der die Menschen, mit denen sie sich wohl und heimisch fühlen, hervorgebracht und geprägt hat.
Es versteht sich vielleicht nicht von selbst, also sage ich es: ja, das Sein bestimmt in einem hohen Maß das Bewusstsein, aber dieser Satz bleibt dumm, solange nicht hinzugefügt wird, dass dieses Sein selbst ein höheres Bewusstsein ist, ein höheres Bewusstsein als ein einzelner Mensch hat. Nietzsche, der kein Dialektiker und Ideologe war wie Karl Marx, sondern ein Denker und Dichter, poeta doctus und poeta vates in einer Person, wusste das sehr gut.
Und ich liebe alle Sprachen, nicht nur Europas, sondern der Welt. Jedesmal zucke ich zusammen, wende mich ab oder werde gar zornig, wenn ich, gerade in meinem Heimatland Deutschland, höre: »Die haben ja so eine hässliche Sprache!« Ich habe noch nie eine hässliche Sprache gehört, es sei denn eine durch den Sprecher (Hitler oder sein Rumpelstilzchen Goebbels zum Beispiel) hässlich gemachte. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch glauben kann, eine Sprache sei hässlich oder weniger schön als die eigene, wo doch in jeder Sprache der Welt eine Mutter ihr Kind in den Schlaf singt und in die Seele des schon halb träumenden Kindes das Saatkorn der Poesie senkt. Und ich liebe auch alle Länder der Welt, denn ich weiß, dass es dort Liebende gibt, die die Sprache der Liebe sprechen.
Wer sich nicht vorstellen kann, dass für ein Kind, das einem Lied der Mutter lauscht, diese Muttersprache die schönste der Welt ist, dessen Vorstellungsvermögen muss sehr beschränkt und er selber schwach an allen Sinnen sein. Ich muss dabei an jene spanische Grenzbeamtin in mittleren Jahren denken, die auf der spanischen Seite der Grenze zu Portugal mit steinerner Miene und fast zur Ekelfratze verzerrtem Gesicht zwei arme portugiesische Bäuerlein unwirsch abfertigte, die in ihrer Naivität und Arglosigkeit nicht Spanisch, sondern Portugiesisch mit ihr redeten. Als ich dann nach den beiden Bauern an die Reihe kam und nach langer Fahrt zu müde war, die Sprache zu wechseln, und sie ebenfalls bequemerweise auf Portugiesisch ansprach, das ich nach einem halben Jahr Portugal fast fließend sprach, brach es klagend, ja anklagend aus ihr heraus: »Wie können Sie nur in dieser schrecklichen Sprache mit mir reden!? Die beiden vor Ihnen, die wissen und können ja nichts anderes, aber Sie, ein Deutscher aus Berlin, ein gebildeter Mensch, wie kann der auch nur ein Wort dieser schrecklichen Sprache über die Lippen bringen?!«
Ein ganz spontanes Heimatgefühl stellte sich ein, als ich auf der Insel Andros neben einer dicken Frau in mittleren Jahren an der Haltestelle saß und auf den Bus wartete. Während wir warteten, redete sie wie ein Wasserfall auf mich ein. Ich war zum ersten Mal in Griechenland und verstand kein Wort. In meiner Hilflosigkeit kramte ich einen der wenigen auswendig gelernten griechischen Sätze hervor. »Ich verstehe kein Griechisch«, sagte ich auf Griechisch zu der mir sympathischen Frau. Da lachte sie auf und schlug mir kameradschaftlich auf den Schenkel. So saßen wir dann einträchtig schweigend nebeneinander, bis der Bus kam.
Und hier auf der Bank im Zentrum der Heimatgemeinde Lindenthal muss ich jetzt an meine Jugendliebe Marita denken, an deren Elternhaus ich gerade vorbeikam.
Wie, wann und wo lernte ich dieses hübsche, schon sehr fraulich erblühte Mädchen kennen?
Ich war vierzehn, sie dreizehn, beide fuhren wir mit der Bahn zur Schule nach Sankt Wendel, ich, nachdem ich das Kloster verlassen hatte, zum Knabengymnasium, sie zur Handelsschule. Irgendwann, wohl erst nach zahllosen Hin-und-Herfahrten, die eine gewisse Nähe und Vertrautheit schufen, müssen wir ins Gespräch gekommen sein. Wahrscheinlich ergriff sie die Initiative, ich war damals Mädchen gegenüber so schüchtern, dass ich in ihrer Gegenwart kaum ein Wort über die Lippen brachte. Das Einzige, was ich mir in der Rückschau zutraue, sind suchende, möglichst vielsagende Blicke.
Irgendwie kamen wir ins Gespräch, freundeten uns an. Sie war meist in Begleitung ihrer ein Jahr älteren Schwester Marika, die auf eine andere Art, die der Lolita von Nabokov, sehr hübsch war, schon rauchte und ein wenig, in großer Unschuld, auf junger Vamp machte. Marita war zurückhaltender als ihre Schwester, schminkte sich aber gern, trug für die damalige verklemmte Zeit gewagt kurze, die Figur betonende Röcke und rote Schuhe mit hohen Absätzen. Ein hübsches, offenherziges Mädchen mit brünettem, etwas wolligem Haar und einem braunen, nicht ganz reinen Teint. Nach und nach schloss ich das über ziemlich tabuisierte Themen (Monatsregeln mit Blutungen, Binden und Schmerzen) freimütig plaudernde Mädchen ins Herz. Das waren neue Dinge, die mich brennend interessierten, umso mehr als über das Frausein und vor allem Frauwerden weder von meiner Mutter noch meinen Schwestern viel zu erfahren war. Der Nebel der sexual- und körperfeindlichen katholischen Gegenaufklärung lag wie ein grauer Star vor den Augen und verschleierte jede klare Sicht.
Während meine große Kindheitsliebe Maya noch sehr einer in den Wolken der Idealität schwebenden Madonna glich, war Marita ein herzerfrischendes, sinnenfrohes Arbeiterkind, das kein Blatt vor den Mund nahm. Der Vater war Maurer, rauchte und trank viel und tat sich schwer, die Familie zu ernähren. Die Mutter war eine stille, abgehärmte Hausfrau, die schon früh an Krebs starb. Wohl wegen des trinkenden Vaters, der oft die Arbeitsstelle wechselte, und ganz bestimmt auch wegen der beiden frühreifen Töchter hatte die Familie im Dorf keinen allzu guten Ruf. Was ich schon bald zu spüren bekommen sollte.
Wir fingen an, uns nach der Schule zu verabreden. Das war undenkbar im Dorf, nur möglich in der freien Natur. Damit weder sie noch ich allzu weit laufen mussten, trafen wir uns auf dem Lindenthaler Rötelberg, wo damals noch kein betriebsames Landschulheim stand, sondern ein stiller Kiesweg mit Blick auf die Teufelskanzel erst an Wiesen und Feldern entlang, dann im Wald an der Wildfrauenhöhle vorbei bis zur Waldkapelle bei Güdesweiler führte. Die Teufelskanzel war (und ist immer noch) ein weithin sichtbarer, aus einem Steilhang des Rötelbergs hervorspringender Fels. Warum dieser Fels seinen Namen erhielt, weiß ich bis heute nicht, wahrscheinlich hat auf dieser vorspringenden Steinplattform einmal der Teufel gepredigt. Ohne Erfolg? Nein, nicht ganz: In der Nähe wurden Achate gefunden, und es kam zu einem kleinen Achat-Rausch, aus allen Himmelsrichtungen, selbst aus dem Ausland kamen Achat-Sucher, die mit ihren Hacken und Schaufeln immer mehr und immer größere Löcher in den Steilhang buddelten, so dass die Gefahr bestand, der ganze Hang samt Teufelskanzel könnte instabil werden und sozusagen zur Hölle fahren. Und so wurde das Buddeln von den Behörden verboten. Über die Wildfrauenhöhle ist mehr, aber nichts Verlässliches bekannt. Einmal ist es eine Seherin, ein anderes Mal eine Hexe und wieder ein anderes Mal nur ein armes, wegen einer unehelichen Geburt von ihrem Dorf verstoßenes Weib, das in der Steinhöhle gehaust haben soll.
Wie auch immer, der Weg auf dem Rötelberg wurde zum Stelldichein für die frisch Verliebten. Dort gingen wir einen kurzen Frühling lang spazieren, plauderten über Gott und die Welt und dachten nicht einmal daran, den offenherzigen Worten Erkundungen sinnlicherer Bereiche folgen zu lassen. Für mich, den gerade erst den Klostermauern Entronnenen, war die sinnliche Erscheinung und Gegenwart meiner Freundin Wunder und Zauber genug. So etwas Grobes wie das, was man heute mit dem hässlichen Namen Petting noch hässlicher macht, hatte ich in meiner Liebe zu Marita gar nicht nötig. Allein meine Blicke, ja schon meine bloßen Gedanken an sie waren Liebkosungen, zart und unschuldig, fernab von der Zudringlichkeit der nackten, begehrlichen Berührung.
So ging Marita in der flirrenden Luft eines sonnigen Frühlingstags an meiner Seite auf ihren schlanken, kräftigen Fesseln mit ihrem energischen, beschwingten Schritt in ihren hochhackigen roten Schuhen, ihren Nylonstrümpfen mit Laufmaschen und erzählte mir, dem andächtig Lauschenden, von ihrer ersten Regel und wie dumm und peinlich es doch sei, als Mädchen geboren zu sein. Ich entsinne mich deutlich, dass ich meinen dunklen Kommunionsanzug trug, in dem ich schon Hochwasser hatte, und an meinen Blick, der hin und her wanderte zwischen meinen Schuhspitzen und ihrem um die wohlgeformten braunen Knie schwingenden bunten Rock, und was für eine allesbetäubende Lust und Berauschung es war, neben diesem schönen Mädchen herzugehen, das Marita hieß.