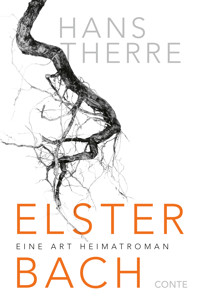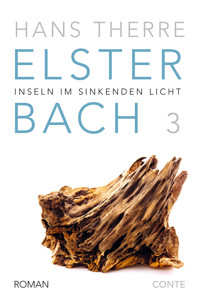
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Elsterbach-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der Schriftsteller Anders Nieheim hat sich, wie es scheint, nach einem Jahr an seinem neuen Wohnort Elsterbach in der alten Heimat eingelebt. Aber je mehr er sich einlebt, desto mehr muss er erkennen, dass er auch hier keine Heimat gefunden hat und keine finden wird. Nun sieht er, älter und müder geworden, die Jahre vorüberziehen. Um ihn herum sterben die Menschen, mit denen er ein festes Lebensband hätte knüpfen können, wäre er nicht vierzig lange Jahre fern von ihnen in der Welt herumgesegelt. Und da er zu arm ist, zu krank am Körper, im Herz und in der Seele, um wieder auf eine Reise zu gehen, setzt er sich hin und macht sich im geschrumpften Horizont seines Lebens auf die Suche nach einer bescheideneren Heimat. Die Suche wendet sich immer mehr nach innen, findet Heimatinseln, Heimatfragmente, Traumheimaten. Und am Ende seiner Suche kommt er an im Wunderbaren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Hans Therre – Elsterbach 3
Inseln im sinkenden Licht
Kapitel 1 – Das erste Jahr – Ausklang
Kapitel 2 – Das zweite Jahr
Kapitel 3 – Das dritte Jahr
Kapitel 4 – Das vierte Jahr
Kapitel 5 – Das fünfte Jahr
Kapitel 6 – Das sechste Jahr (Winter, Frühling)
Kapitel 7 – Das siebte Jahr (Sommer, Herbst, Winter)
Kapitel 8 – Das achte Jahr
Impressum
Seitenliste
3
4
5
7
7
8
9
10
11
12
13
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
285
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
353
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
Navigationspunkte
Cover
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Textanfang
Impressum
Inseln im sinkenden Licht
Kapitel 1 – Das erste Jahr – Ausklang
Glaubst du, du kannst dem Himmel etwas von der Hölle erzählen?
Herbst
Die Heimkehr liegt hinter mir, der Besucherstrom ist zum Rinnsal geworden, die neuen Eindrücke und Erlebnisse überstürzen sich nicht mehr, die Erinnerungsströme verlaufen sich und mäandern in die unmittelbar erlebte Gegenwart. Ich kann nun nicht mehr nur in großen, Wochen und Monate umspannenden Kapitelbögen erzählen. Wie auf den Autobahnen und Schnellstraßen kommt man auf ihnen zwar schnell voran, übersieht aber hier wie dort die Vielfalt und Vitalität der Augenblicke. Mein Weg führt jetzt über Tages-, Wochen- und Jahreszeitenbrücken, die es mir erlauben, die Vielgestalt der erlebten Wirklichkeit in möglichst reichhaltigen und farbigen, aber auch düsteren und dunklen Facetten zu erfassen und darzustellen.
Oder mit einem anderen Bild: In Buch I und II gab es ein stürmisches Anbranden alter Erinnerungen und neuer Erfahrungen. Nun beginnt mit Buch III der stete Rhythmus von Ebbe und Flut. Die erste große Erinnerungsflut hat sich aus meiner Lebensbucht zurückgezogen, und ich lese die kleinen Goldkörnchen, Bernsteine, Muscheln, Seesterne und seltenen Steine auf, aber auch den Tang, die verwesenden Kadaver, die Teerbrocken und den ganzen von der Flut angeschwemmten Zivilisationsmüll, Unrat und Gift. All das sind Botschaften. Ich bin ein wenig wie Robinson Crusoe auf seiner einsamen Insel, von den Menschen getrennt und doch mit ihnen verbunden durch die Dinge, die sie hinterlassen, weggeworfen oder verloren haben.
Ich muss mich auf dieses fragmentarische Erzählen einlassen, denn es spiegelt meine erlebte Wirklichkeit. Ich stehe allein mit meinen Wörtern in meiner Lebensbucht und bin im Wechsel von Ebbe und Flut immer neuen Anbrandungen von Erinnerungs- und Erfahrungsfluten ausgesetzt. Die impressionistische Form eignet sich am besten, um die Prosa des mit gesteigerter Aufmerksamkeit erlebten Alltags einzufangen. Sie sammelt Kleines und Verstreutes auf und wirft ein Licht auf das, was das Erzählen in großen Kapitelbögen vernachlässigt oder übersieht. So mögen denn mit jedem Tag meines Strand- und Landgangs in meiner Lebensbucht neue Mosaikteilchen auftauchen, die am Ende die Gestalt meines All-Tags in der neuen und zugleich alten Heimat in einem Panoramabild innerer und äußerer Landschaften aufleuchten lassen.
Heute vor einem Jahr ist Solvejg gestorben. Ihr Grabstein mit Hölderlins Satz »Alles Getrennte findet sich wieder« leuchtet vor Einsamkeit und Schönheit. Ich habe die braune Erde mit einem Strauß roter und weißer Rosen geschmückt, ein Licht angezündet, an Solvejg gedacht und mit ihr gesprochen. Ich fühle, dass es ihr gut geht. Von hier oben ist die Aussicht auf Dorf und Tal noch schöner als von meiner Wohnung.
Ich schreibe jetzt am Abend nichts mehr, will nur sitzen, Wein trinken, sinnieren und mich in meine Erinnerungen versenken.
Unsere Liebe war Ebbe und Flut, Geben und Nehmen, im Guten wie im weniger Guten. Und eine unendliche Geschichte, eine Sage. An einem Abend in Berlin, er ist mir noch so nah, dass ich glaube, unsere Stimmen zu hören, saßen wir uns gegenüber in meiner Wohnung, zurück vom guten Essen und Trinken in Nikos› Taverna, als Solvejg zu mir sagte: »Erzähl mir noch einmal, wie du mich gefunden hast, ich höre es so gern.« Und ich erzählte ihr, weil auch ich es gern erzählte und hörte, keinen Umweg und keinen Abweg auslassend, dass mein Lebens- und Liebesweg eine einzige lange Suche nach ihr war.
Über dem Waldhügel scheint ein freundlicher Vollmond wohltuend in mein Zimmer.
Ein neuer Tag. Ich habe viel geschrieben und in einer spannenden Rilke-Biographie gelesen. Das ist mein Lebensrhythmus: Lesen und Schreiben wie Einatmen und Ausatmen.
Schwermütig macht mich der Gedanke, in Berlin alle Freunde zurückgelassen zu haben. Nur Solange ist räumlich näher gerückt, doch ich fürchte, unsere Freundschaft ist bedrohlich nah am Verlöschen. Unsere Wege scheinen sich getrennt zu haben.
Die Natur, die Landschaften im wechselnden Licht der Tages- und Jahreszeiten sollen meine neuen Freunde und Verbündeten werden. Habe ich in der Katze Iris und im Kastanienbaum Jussuf nicht zwei neue Freunde gefunden? Sind mir die Pferde vom Bauernhof, die ich fast täglich sehe, nicht auch schon so vertraut geworden, dass sie, sprächen sie die menschliche Sprache, mich wohl längst duzen und grüßen würden? Und ist es jetzt, ein Jahr nach Solvejgs Weggang und nachdem ich das Jahr nicht mehr hinter grauen Stadtmauern jahreszeitenlos vorbeiziehen sehen musste, sondern von einem Frühling, Sommer und Herbst reich beschenkt wurde, trotz aller Trauer nicht heller in meiner Seele geworden? Habe ich nicht einen nach allen Himmelsrichtungen und für alle Wetterlagen offenen Zufluchtsort in Elsterbach gefunden?
Wie aber wird der erste Winter werden?
Tagsüber war ich Pilze suchen. Im nahen Tannenwald fand ich weder Maronen noch Steinpilze. Nur Knollenblätterpilze. Vielleicht hätte ich etwas gefunden, wenn ich den Steilhang hochgekraxelt wäre, aber die feuchte und schwüle Luft im Wald war zum Ersticken. Einen einzigen kleinen Schopftintling sah ich am Wegrand, aber was soll ich mit einem einzigen Pilz anderes anfangen als ihn freundlich anzuschauen und stehen zu lassen?
Vor der Nepomuk-Kapelle erzählte mir ein alter Einheimischer, man habe sowohl hier in der Kapelle als auch an der Marienstatue auf dem Weg zur Elsterbachmühle die Spendenkasse aufgebrochen und das Geld geraubt. »Die schlagen dich heute für fünf Euro tot!«, sagte er.
Abends sah ich im TV einen türkischen Dokumentarfilm über Istanbul, in dem man Gérard de Nerval zitierte. Der Dichter Nerval ist einer meiner Herzensfreunde. Ich kenne ihn schon seit einer Ewigkeit, habe sogar einige seiner Gedichte übersetzt. Mein Lieblingsgedicht von ihm heißt »El Desdichado«, und so lautet, auf Französisch, die erste Strophe:
Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé,Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie:Ma seule Étoile est morte, – et mon luth constelléPorte le Soleil noir de la Mélancolie.
Ich versuche eine Übersetzung:
Ich bin der Dunkle, – der Witwer, – ohne Trost,Der Prinz von Aquitanien mit zerstörtem Turm:Mein einziger Stern ist tot, – und meine SternenlauteTrägt die schwarze Sonne der Melancholie.
Inzwischen fast ein Porträt von mir. Fast …
Als der Dichter die schwarze Sonne seiner Melancholie auf seiner Sternenlaute nicht mehr sehen konnte, ging er hin und erhängte sich an einer Pariser Straßenlaterne.
Die türkische Sprache hat einen schönen Klang. Und die türkische Musik ist zauberhaft. Man spürt, dass ein Reitervolk sie geschaffen hat. In Berlin lebte ich immer auch in einer türkischen, italienischen, spanischen, persischen, arabischen, indischen, chinesischen Großstadt. Das hat abgefärbt, und dieses Flair vermisse ich in der hiesigen ethnischen Monokultur. Hier gibt es ausländisch aussehende Menschen nur an Kochtöpfen, Pizzaöfen und Dönerspießen. Auch Nikos, Ewa, Taverna Kythera und meinen Döner-Imbiss um die Ecke vermisse ich. Hier ist der nächste Grieche in Sankt Wendel, der nächste Döner-Imbiss in Theley, und der macht abends früh zu und morgens spät auf. Auch gibt es dort nicht täglich mehrere gute und günstige, auch vegetarische Gerichte. Und überallhin muss man mit dem Auto rollen.
Genug. Keine Fados. Ich bin froh, dass ich hier bin. Und wie der Vagabund Rilke habe ich mir in zwei, drei Tagen ein Heim geschaffen.
Ein Nie-Heim.
Winter
Als ich aufwache, ist das ganze Dorf eingeschneit, begraben unter russischen Schneemassen. Auch die Hauptstraßen. Es herrscht grimmige Kälte. Gestern Nacht hatten wir achtzehn Grad unter Null. Nie und nirgends in meinem Leben sah ich so viel Schnee. Nein, einmal sah ich mehr, in den Abruzzen, wo eine Lawine ein ganzes Bergdorf unter sich begraben hatte. Gerade war ich draußen, um den Bürgersteig freizuschaufeln. Es war klirrend kalt trotz Sonne, und nach zehn Minuten hatte ich Eiszapfen im Bart. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sieht die tief verschneite Landschaft zauberhaft aus. Ich müsste noch mal Kind sein, dann könnte ich rodeln, Eislaufen oder Ski fahren. Alle motorisierten Krachmacher fahren mit Schalldämpfern aus Schnee oder trauen sich erst gar nicht auf die Straße.
Freund Jonas hat abends angerufen. Ihm geht es gut, und er freut sich über mein Buch, das jetzt im Handel ist, und über die Widmung. Auch seiner griechischen Tochter Rosalina gefällt es, die für eine Woche bei ihm zu Besuch ist. »Jedes Gespräch ist eine Übersetzung«, sagte sie zu ihm.
Eine kurze Jahresbilanz:
Bei der Weihnachtsfeier, die diesmal bei Maria und Georg im Kreis der Familie stattfand, fiel mir auf, dass Georg schusselig und fahrig geworden ist. Er lässt dauernd Sachen fallen und sieht im Gesicht abgezehrt aus. Auch seine Nase ist spitzer geworden. Das sind keine guten Zeichen.
Mit Hanna und Willi sind kaum noch Spaziergänge möglich, da Willi immer schlechter laufen kann. Dafür bin ich oft mit Maria und Georg unterwegs, die gern mit mir zusammen zu sein und das Gespräch zu genießen scheinen.
Jonas ist weiter bettelarm und dadurch wie gelähmt. Mir scheint, er kommt nicht mehr aus Berlin hinaus.
Solvejgs beste Freundin Martha geht immer noch an Krücken. An einen Besuch bei mir ist gar nicht zu denken.
Winfried hat mich bei seinem einzigen Besuch bei der Familie in Grüneiche »verpasst«.
Martin scheint sich mit der äußeren Entfernung innerlich von mir entfernt zu haben. Er ruft fast nie an, schreibt nicht. Freilich tat er das früher auch nur selten.
Die Freundschaft zu Jana hat sich eher gefestigt, ist aber nach wie vor gewittrig.
Der Besuch von Solange zeigte fast so viele Schatten- wie Lichtseiten.
Das gemeinsame Essen mit Linda und Jan, das Linda an Ostern in Aussicht stellte, hat noch nicht stattgefunden. Unsere Hausgemeinschaft ist herzlich, leider aber auch recht oberflächlich geblieben.
Die Freundschaft mit Matthias hat sich erweitert und gefestigt. Das ist ein Licht im dunklen Wintertunnel.
Maya, oder wer immer mir an Ostermontag an der Elsterbachmühle begegnete, hat sich nicht wieder blicken lassen.
Es war ein Jahr voller Erlebnisse, Erfahrungen, Erschütterungen, Hochstimmungen, Begegnungen, Besuche. Es gab mehr Glücksmomente als in Berlin, deren Intensität mich manchmal fast atemlos machte.
Aber ich weiß nicht.
In mir, noch sehr fern, am äußersten Horizont meiner Wahrnehmung, breitet sich ein Gefühl der Trostlosigkeit, ja sogar der Unwirklichkeit aus, das langsam und heimtückisch wie eine Tsunami-Welle näher rückt und sich nähernd aufstaut zu einer alles verschlingenden Woge.
Kapitel 2 – Das zweite Jahr
»Alles aber erträgt man, sobald es geschieht.«(Sappho)
(Immer noch) Winter
Gestern war mein erster Silvesterabend in der alten Heimat. Das letzte Silvesterfest, das ich hier feierte, liegt in weiter Ferne, in der Kindheit meiner beiden Töchter. Ich verbrachte den Abend bei Hanna und Willi in Grüneiche. Maria, Georg, Michael, Tanja und Stephan feierten in ihrem Haus auf der andern Seite des Dorfs. Das früher übliche Zusammenfeiern der Familie findet zu meinem Bedauern, denn ich kann mich an schöne Feste erinnern, schon lange nicht mehr statt. Warum nicht? Vielleicht liegt es am Alter, das weinseliges Feiern bis nach Mitternacht nicht mehr gern sieht. Oder man ist schon so oft zusammen gewesen, dass man des Zusammenseins müde wurde. Also habe ich mich zu Hanna und Willi gesellt, die ohne mich wie in den vergangenen Jahren zweisam allein hätten feiern müssen.
Hanna hat ihr Bestes getan, den letzten Tag im Jahr zu dritt feierlich zu gestalten. Als ich gegen acht Uhr abends ankomme, brennen die Lichter am Weihnachtsbaum, Wohnzimmer und Tische sind mit Girlanden, Lametta und Kerzen geschmückt. Sehr altmodische Weihnachtsmusik klingt leise vom Plattenspieler. Als ich die altvertrauten Zimmer mit den noch immer ungewohnt niedrigen Decken betrete, beschleicht mich ein Gefühl der Leere, ja Verlorenheit. Ich kann die fehlenden Familienmitglieder, auch die schon toten, nicht aus den Räumen wegdenken, die nun voller Leerstellen und Löcher sind. Wir drei wirken ein wenig wie die letzten Feiernden an Bord einer familiären Titanic. Oder wie Spiritisten, die Tische rückend die Geister ihrer Verstorbenen zu rufen versuchen. Vor allem Solvejg, mit der ich in den letzten Jahrzehnten alle Silvesterabende feierte, reißt eine Lücke, die fast so groß ist wie die Welt.
Aber Heiterkeit soll diesen letzten Tag des Jahres auszeichnen. Unter teils munterem, teils melancholischem Geplauder über gute Vergangenheit und schlechte Gegenwart nach dem Motto »Früher war alles besser« setzen wir uns an den Esszimmertisch und verzehren das in der Familie übliche Silvesteressen: Wiener Würstchen mit Senf, hausgemachten Kartoffelsalat, frisches Baguette-Brot, Bier. Für später, nach Mitternacht, hat Hanna eine kalte Platte vorbereitet mit Schinken, Wurst, Käse, Russischen Eiern, Gurken, Tomaten und Gallerej, der typisch saarländischen Schweinesülze, die bei keinem echt saarländischen Silvesterfest fehlen darf.
Nach dem Essen setzen wir uns ins gemütlichere Wohnzimmer. Wein wird aufgetischt und eingeschenkt. Ich habe mir meinen eigenen Rotwein mitgebracht, denn Hanna mag lieber leichte halbtrockene Weißweine, die ich nicht mag, und Willi bleibt bei seinem Bier. Eine Menge Zeug zum Knabbern und Naschen bedeckt den Tisch, diverse Chips, Salzstangen, Weihnachtsgebäck, Pralinen, Bonbons: alles, was einen in gefährliche Nähe der sogenannten Wohlstandskrankheiten bringen kann. Das macht nichts, jedenfalls nicht heute Abend, denn sie sind, in überschaubarer Zahl und halbwegs erträglicher Stärke, sowohl bei mir als auch bei den beiden andern schon heimisch geworden. Aber noch immer klafft ein auch Hanna und Willi spürbares Vakuum im Raum, und so wird der nicht genug Action liefernde Plattenspieler ausgeschaltet und muss der Fernseher als Lückenfüller herhalten, um schon bald zum lärmenden Star des Abends zu werden. So also feiern die beiden seit langem ihren Silvesterabend.
Leider (oder zum Glück?) ödet mich schon bald das geistlose Treiben auf dem Bildschirm an. Ich merke, dass ich den Wein zu hastig trinke und mich nach einer Kiffzigarette sehne, um aus dem ängstlichen Pfeifen im Wald eine frohe Hymne der Drei Aufrechten machen zu können. Unglücklicherweise habe ich mein Haschisch zu Hause vergessen. Zum Zigarettenrauchen muss ich hinaus auf den Balkon, was mir gar nicht so unlieb ist. Draußen an der frischen Luft, vor mir die Lichter der im Bliestal verstreuten verschneiten Ortschaften, gibt es keine Lücken. Aber Wehmut. Mit dem Blick versuche ich durch das Nacht- und Zeitdunkel hinüber zu unserem Elternhaus vorzudringen, dort in die warme Silvesterstube zu schlüpfen.
Lass sehen. Ja, da sitzen wir alle um den bescheiden geschmückten Küchentisch in der gemütlichen warmen Wohnküche: Mutter, Vater, beide etwa in dem Alter, in dem ich jetzt bin, oder auch jünger, Hanna und Maria, junge schöne Frauen, Willi und Georg, junge hübsche oder, wie es hier heißt, schnatze Männer, und der Gymnasiast Anders, der sich wahrscheinlich auch schon damals ein wenig langweilt. Kinder sind noch keine da, und es werden außer Michael, seinem Sohn, meinen beiden Töchtern und meinen mir nur von Fotos bekannten Enkelkindern keine mehr dazukommen. Es gibt das gleiche Essen wie hier und jetzt, nur weniger üppig und reichlich, Wein gibt es auch keinen, nur Bier und eine Flasche Sekt, aber die muss noch bis Mitternacht warten. Die Gespräche, die wir damals führten, sind mir unvorstellbar geworden. Auch die Geselligkeiten. Bestimmt aber läuft das alte Radio in der Zimmerecke neben dem einzigen Korbsessel im Haus, in den sich der Vater setzt, um seine Pfeife anzuzünden und einen Sender mit einer Musik zu suchen, die weit entfernt ist von der Urwaldmusik, die sein Jüngster, und sonst keiner in der Familie, so fanatisch liebt. Wird gesungen? Musiziert? Und was? Wird gespielt? Ach, es ist alles verschwunden. Also lass ab, Anders, drück die Kippe aus, geh zurück ins Hier und Jetzt und verbreite Heiterkeit, auch wenn es eine Heiterkeit der Schiffbrüche ist.
Drinnen kreischt der alte Fernseher. Er ist sehr laut eingestellt, Hanna und Willi hören nicht mehr gut. Obwohl ich zur Vorbeugung eine Aspirintablette schluckte, als ich von daheim losfuhr, stellt sich ein Kopfschmerz ein. Soll das bis Mitternacht so weitergehen? Gut, es wird zwar nicht nur auf die Mattscheibe geglotzt, sondern auch geredet, aber dieses Gerede ist nicht viel mehr als ein Kommentar zum Bildschirmgeschehen. Beides fesselt mich nicht. Herrje, warum musste ich auch mein Haschisch vergessen? Mit diesem mir liebsten Dschinn würde alles leichter fließen. Außerdem ist er oft ein blendender und sogar geistreicher Maître de Plaisir. Da können die schlappen Showmaster in der Mattscheibe einpacken. Ja, Kulenkampff, zärtlich »Kuli« genannt, könnte mich jetzt vielleicht fesseln, jedoch nur, wenn er, wie manchmal gegen Ende seiner Sendung »Einer wird gewinnen«, schon reichlich beschwipst und in Hochform wäre. Aber der große »Kuli« ist schon seit zehn Jahren tot, und seine Nachfolger sind witzlose Wichte, stümperhafte Possenreißer. Neben Hanna auf der Couch hockend und fragwürdige Kommentare zum Geschehen beisteuernd, überlege ich immer noch, was sich früher abgespielt haben könnte an diesem langen Winterabend. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, es wurde gespielt, Mensch-ärger-dich-nicht, Dame, Mühle, Stadt-Land-Fluss, Spiele mit Würfeln und Mikadostäbchen. Und Willi zieht irgendwann ein Kartenspiel hervor und verblüfft alle mit seinen Zaubertricks.
Schon ist mein Vorschlag heraus, nach dem Ende der gerade laufenden Sendung zusammen etwas zu spielen. Willi, dem hin und wieder die Augen zufallen, winkt ab, seine Zaubertricks hat er alle vergessen. Hanna ist interessiert. Sie will auch gar nicht mehr das Ende der Sendung abwarten, sondern gleich loslegen. Eine Weile versucht sie, ihren Mann zum Mitspielen zu bewegen, scheitert aber an dessen felsenfester Unlust oder auch nur Trägheit. Du alter Spielverderber, du lahme Ente, sagt sie zu Willi, dann glotz allein weiter. Wir gehen hinüber an den Küchentisch. Hanna holt aus ihrem Bügel- und Nähzimmer (sie war ja einmal Schneiderin von Beruf) die Spielesammlung, die sich schon oft bewährt hat, wenn ich mit meinen beiden Töchtern zu Besuch war. Jetzt muss nur noch das Spiel gewählt werden. Lass uns mal mit Dame beginnen, sagt Hanna, das habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Tja, ich merke es. In wenigen Minuten ist das Spiel beendet. Zum Glück ist Hanna eine gute Verliererin, anders als Willi, der, als ich noch ein Knirps war, einmal wutentbrannt meine Spielkarten in den Ofen steckte. Jetzt will sie es mit Mühle versuchen, früher war sie darin sehr geschickt. Heute leider nicht mehr, und das Spiel ist noch schneller aus als das Damespiel.
Jetzt aber wird Mensch-ärger-dich-nicht gespielt, und zu meiner heimlichen Freude schlägt Hanna mich spielend aus dem Feld. Ha! Das tut gut. Noch eins. Und wieder gewinnt sie, sie würfelt einfach die besseren Zahlen und hat auch keine Hemmungen, meine Figuren mit Schwung vom Brett zu fegen.
Zu zweit wird das Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel leider schnell langweilig. Ich hätte Lust auf eine Partie Monopoly, aber dieses Spiel, das erst ab vier Personen so richtig Spaß macht, fehlt in der Spielesammlung. Und nun? Ich schlage Stadt-Land-Fluss vor. Zuerst sträubt sich Hanna. Ich weiß ja so wenig, sagt sie, und das Wenige, das ich mal wusste, habe ich vergessen. Dann wird’s Zeit, sage ich, dass es dir wieder einfällt. Außerdem können wir uns Zeit lassen, wir spielen ja nicht nach der Stoppuhr und um Geld.
Wir verteilen Blätter und Kugelschreiber und fangen an: zuerst wird gewürfelt, wer im Stillen das Alphabet aufsagt und wer laut Stop sagt: Hanna zählt, ich sage sofort Stop!: Stadt mit B: Berlin hat sie, ich Barcelona. Jeder zehn Punkte. Land mit B: Belgien hat sie, ich Brasilien. Je zehn Punkte. Fluss mit B: sie hat die heimatliche Blies, die zwar kein toller Fluss ist, sondern nur ein breiter Bach, das aber rund hundert Kilometer weit, ich auch. Jeder nur fünf Punkte. Tier mit B: Bär hat sie, Biber ich. Je zehn Punkte. Name mit B: Beate hat sie, Barbara ich. Je zehn Punkte. Beruf mit B: Bergmann hat sie, ich auch, klar. Je fünf Punkte. Berg mit B: Bosenberg hat sie, und mir will einfach kein Berg mit B einfallen, nicht mal der Brenner, was für eine Blamage. Zwanzig Punkte allein für die triumphierende Hanna. Und nun noch eine Pflanze mit B: Bohne hat sie, ich das Bilsenkraut. Je zehn Punkte. Hanna ist Siegerin der ersten Runde mit einem Vorsprung von zwanzig Punkten. Sie strahlt und lacht. Ihr Lachen lockt sogar Willi von der Glotze weg, er setzt sich zu uns, will aber nur zusehen, nicht mitspielen. Mit seinem Kopf ist wirklich nichts mehr los. Vielleicht hat er aber Angst zu verlieren und will sich nicht ärgern.
So geht das nun eine gute Weile, bis so ziemlich alle Buchstaben des Alphabets abgeklappert sind, wobei wir um die Buchstaben Q, X und Y einen Bogen machen. Nicht nur Hanna macht das Spiel Spaß, auch mir. Sogar Willi, der sich aufs Zugucken und Miterleben beschränkt. Ich habe es ja auch schon ewig nicht mehr gespielt. Am Ende bin ich zwar Sieger nach Punkten, Hanna hat sich aber auch für sie überraschend gut geschlagen.
Ein Eindruck: als ich mit Hanna die Punkte zähle, fällt mir ihre Handschrift auf, eine Mischung aus schülerinnenhafter Kindlichkeit und Alterssteife. Die Schrift eines jungen Mädchens, geschrieben von einer vierundsiebzigjährigen Hand mit Altersflecken.
Und wie die Zeit beim Spiel vergeht! Als ich auf die Uhr schaue, ist es halb zwölf. Rasch wird noch der geniale und immer wieder urkomische Sketch »Dinner for one« angeschaut und über den stoisch-heroischen Butler James gelacht, der immer betrunkener wird, da er für alle bereits verstorbenen Gäste mittrinken muss. Ja, dieses Dinner for one hat ein gewisse Ähnlichkeit mit unserem Silvester zu dritt. Ich öffne die Sektflasche, während Hanna den Tisch für den nachmitternächtlichen Imbiss deckt. Um Mitternacht erklingen die Gläser und Glückwünsche zum Neuen Jahr, wir nehmen die Sektgläser mit hinaus auf den Balkon, und erfreuen uns am Silvesterfeuerwerk. Über Grüneiche, Lindenthal, Bliesen bis nach Sankt Wendel steigen die bunten Raketen auf. Es ist ein schönes Feuerwerk, das Friede und Freude ausstrahlt, ganz anders als in Berlin, wo ich oft den Eindruck hatte, im Artilleriefeuer zu liegen. Dann werden noch Telefon-Glückwünsche mit dem Familienteil ausgetauscht, der am andern Ende des Dorfs feiert: ProschtNeujahr! Morgen sehen und treffen wir uns alle zum gemeinsamen Kaffee und Kuchen.
Beim Silvesterimbiss wird noch etwas geplaudert. Aber die alten Leute sind müde und wollen nun rasch ins Bett. Ich bin hellwach, kann nicht schlafen. Auch würde ich noch gern eine Kiffzigarette rauchen, ein wenig über den Abend nachsinnen und mit Solvejg reden. Und da ich im Lauf des Abends wenig Wein und noch weniger Sekt getrunken habe, bin ich nüchtern genug, um nach Haus zu fahren. Hanna will mich zwar von der Nachtfahrt abhalten, ist aber zu müde, um mich zu bremsen. So fahre ich, statt wie früher oben unterm Dach zu übernachten, gegen halb zwei durch eine wieder stille Nacht, saumselig und wie im Traum, über die tief verschneiten Dörfer heim. Auf der ganzen Strecke, die sonst genug Verkehr zu bieten hat, begegnet mir kein einziges Auto. Selten habe ich eine Nachtfahrt mehr genossen.
Als ich in Elsterbach in die Hauseinfahrt biege, sehe ich kein Licht mehr bei Linda und Jan. Weg sind sie nicht, wahrscheinlich haben sie sich im Bett fernsehend in den Schlaf gekifft. Das machen sie oft, sagt Linda. Auch ein Silvester zu dritt, wenn man die Hündin Karma mitzählt.
Seit Tagen herrscht grimmigste Kälte, nachts an die zwanzig Grad unter Null. Wo bin ich hier, in Sibirien oder im Saarland? Fehlt nur noch, dass Wölfe ins Dorf einfallen. Tun sie auch, in Gestalt von im Schutz der Dunkelheit immer dreister werdenden Einbrechern. Sie sind die Schattengänger des Wohlstands und der zum Zweck seiner Sicherung weit geöffneten Grenzen. Die Wohnung ist fast nicht mehr warm zu kriegen, obwohl ich, was ich hasse, abends und nachts alle Rollläden herunter gelassen und vor alle Fenster Decken gelegt habe. Die Tür zum Hausflur, unter der es eiskalt hereinzieht, habe ich mit meiner dicksten Steppdecke verhängt. Ich sitze mit einem Winterpullover, einer Weste und darüber einer weiteren Weste und mit zwei Paar gefütterten Socken im Wohnzimmer, traue mich nicht, mir den Kopf zu waschen aus Angst vor einer Grippe oder Schlimmerem. Jeden Tag ist die Garagen- und Autotür eingefroren und muss mit heißem Wasser und Entfroster aufgetaut werden. Wenn ich meine kurzen Spaziergänge mache, fallen mir nach einer halben Stunde die Ohren ab. Also was tun? Ich arbeite viel, rauche dabei wieder so viel wie lange nicht mehr, meine Augen brennen und zucken vor Überforderung. Gestern habe ich zwölf Stunden lang hochkonzentriert auf den Computerbildschirm geglotzt.
Abends ruft Jonas an, etwas bezwitschert. Durch Berlin fegen eisige Schneestürme. Hier bläst es zwar heftig, aber es schneit nicht. Wahrscheinlich ist es den Schneeflocken zu kalt. Heute Nacht und in den nächsten zwei Tagen soll es noch mehr Schnee geben, sogar Schneeverwehungen.
Weit, schön und grün war einmal das Saarland. Jetzt ist es durch den starken Verkehr, auch Flugverkehr, geschrumpft, enger und unfreier geworden.
Und hier sterben sie wie die Fliegen an Krebs, Junge wie Alte. Krebs ist die zentrale Metapher für unsere kranke Lebensweise: wer immer weiter wuchert und sich vermehrt, ohne sich um die Folgen zu kümmern, zerstört sich selbst. Und wer sich nur um die körperliche Gesundheit sorgt, dazu noch halbherzig und unwissend, und seine Seele verwahrlosen lässt, macht die Tür weit auf für den Krebs.
Seit seiner schweren Operation (Aneurysma) vor zwei Jahren hat Georg einen Altersknick: er ist seitdem ein Greis. Und meine immer noch recht jung wirkende Schwester Maria hat plötzlich bemerkt, dass sie mit einem alten Mann verheiratet ist. Neulich sagte sie über Georg halb verdrießlich, halb scherzhaft: »Der Mann verblödet immer mehr mit der Bild-Zeitung in der Hand.« Georg saß drei Schritte weiter im Sessel, die geliebte Bild-Zeitung auseinandergefaltet vor der immer spitzer werdenden Nase, und brummte eine gutmütige Zustimmung. Er nimmt die Altersverblödung so stoisch und gelassen hin wie ein alter Seebär einen schweren Sturm.
In diesem Monat Januar gab es nur wenige Strandgänge durch meine Lebensbucht, weil mir zu kalt war. Ich bin wie schockgefroren, hocke in der Ecke meiner Couch, vermummt in meine dicke Kleidung, eine Decke um den Leib geschlagen, sehe aus wie die Karikatur eines verweichlichten Bücherwurms, starre in die Froststarre hinaus und fasse mein Hiersein nicht. Noch ein paar Striche mehr an diesem Bild, und ich hätte Spitzwegs armen Poeten wie er heute in Elsterbach leibt und lebt.
Am Morgen habe ich unglaubliche Schneemengen geschaufelt. Es war ein zauberhafter Wintertag, sonnig, klar, eine traumverlorene Stimmung lag über dem verschneiten und still gewordenen Dorf. Leider kam ich beim Schaufeln rasch aus der Puste und musste in die Wohnung, um den Schweiß am ganzen Körper trocknen zu lassen. Das habe ich dreimal gemacht, dann war meine Garageneinfahrt fast frei. Morgen mache ich den Rest, denn der Gedanke, bei einem Notfall mit dem Auto im Schnee stecken zu bleiben, ist etwas beunruhigend. Abgesehen davon muss ich einkaufen fahren.
Frühling
Nun bin ich zweiundsechzig Jahre.
Was war an meinem Geburtstag? Eine für mich gerade richtige kleine Feier mit der Familie im Restaurant Baldend bei Kaffee, Kuchen und Gespräch. Leider wurde die Feier überschattet von Georgs schwerer Krebserkrankung. In einigen Tagen muss er operiert werden. Das ist eine ernste Sache bei einem siebenundsiebzig Jahre alten Mann, ich hoffe, dass alles gut wird. Aber mir ist bang und schwer ums Herz.
Nach zwei Wochen Krankenhaus mit Entfernung der Blase, Prostata, des Blinddarms und eines Teils des Dickdarms, da verkrebst im zweiten Stadium, schien Georg alles gut überstanden zu haben. Kaum ist er wieder zu Hause, hat er eine Darminfektion. Er hat heftige Durchfälle, ist sehr schwach und abgemagert, von den Armen hängt das fahle Fleisch in Lappen herab.
Er lag im Krankenhaus Neunkirchen, und da ich in den letzten Wochen oft hin und her pendelte, mal mit Maria, mal mit Hanna und Willi oder mit allen dreien zusammen, ich immer als Chauffeur, konnte ich ein flüchtiges Wiedersehen mit der Stadt feiern. Es hat sich nicht viel verändert. Neunkirchen scheint immer noch ein Aschenputtel zu sein, eine Saarpottstadt. Doch in manchen Ecken ist sie reizvoll, und beim Betrachten und Belauschen der Damenwelt musste ich an die Frauen im Sparta der Gegenwart denken. Ja wirklich, mich streifte in Neunkirchen an der Saar immer wieder eine spartanische Aura. Selbst das Missratene, Verunglückte, Desolate hat eine eigene aparte Note. Ich verstehe jetzt etwas besser, warum Hanna diese Stadt so mag. Der Ort hat was. Leider keine Studenten und so auch keine studentische Kneipenkultur. Hier könnte einiges getan werden.
Aber das Krankenhaus! Ein scheußlicher Massenbetrieb in einem scheußlichen Bau, dessen Anblick allein schon krank macht. Vor dem Krankenhaus hocken auf Bänken oder niedrigen Mauern ausgemergelte, bleichgesichtige, mit Verbänden zugepflasterte Kranke und nicht viel besser aussehende Besucher, trinken Bier und qualmen, was das Zeug hält. Man könnte über dem Eingang dieser architektonischen Missgeburt ohne weiteres Dantes Spruch über dem Tor zur Hölle anbringen: Lasst alle Hoffnung fahren, ihr, die ihr hier eintretet! Ich musste an Orwell denken, der Krankenhäuser als »Anstalten« bezeichnet, »die einem nach dem Leben trachten.«
In den Krankenzimmern geht es zu wie in einer Kneipe, nur dass sie hier nicht rauchen dürfen, aber trinken, johlen und Witze reißen, vorzüglich zotige. Überall stehen Geräte zum Desinfizieren der Hände, die selten oder gar nicht genutzt werden. Da kommen die lieben Besucher und schleppen ihre lieben Keime bei ihren lieben Kranken ein. Und umgekehrt, Geben und Nehmen. In den stickig warmen Zimmern ist es so eng, dass man sich kaum drehen und wenden kann. Drei kranke Männer liegen in einem Zimmer, in dem nur einer liegen sollte. Keine Intimsphäre. Kaum Menschenwürde. Ich schaue mir das Ganze an und denke: das ist also das so viele Milliarden verschlingende deutsche Gesundheitswesen fürs Volk. Nichts, kein einziges technisches Gerät, sieht auch nur im Entferntesten modern aus. Umso mehr aber das abgehetzte Pflegepersonal und die in schmutzigen Kitteln mit lebensmüden Gesichtern wie Lemuren herumhuschenden Ärzte. Kein Mensch, ich setze das Wort mit Bedacht, kann hier gesunden. Wer noch gesund ist, kann nur krank werden. Und die Apparatemedizin tötet nicht nur viele Kranke, sondern auch Ärzte und Pflegepersonal. Eine moderne Arztpraxis und erst recht ein modernes Großkrankenhaus sind gefährliche Arbeitsplätze.
Und wie geht es mir? Seit ich den Gift- und Lärmwolken Berlins entronnen bin, lebe ich in meinem kleinen Dorf in einer noch halb intakten Landschaft. Das Flüsschen Elsterbach fließt traut und saumselig vor meinem Fenster vorbei, Pferde vom nahen Bauernhof jagen wiehernd über die Wiese, und an manchen Tagen taucht die Sonne die Landschaft in ein epiphanisches Licht. Mit ein wenig mehr Übung werde ich eines Tages darin verschwinden können, vielleicht in einen größeren Traum. Etwas Heilsameres und Trostreicheres hätte ich nach dem Tod Solvejgs kaum finden können.
Der Mai ist gekommen, und Solvejg begeht ihren dreiundsechzigsten Geburtstag. Tristesse innen wie außen. Immer wieder Gedanken an Solvejg und Gespräche mit ihr. Immer wieder tiefe Trauer mit Anflügen von Verzweiflung. Doch auch Glaube an ihr und unser aller Weiterleben und die Hoffnung, manchmal sogar die Freude auf ein Wiedersehen. Aber ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so mutlos, man könnte auch lebensmüde sagen, wie in diesem Winter.
Am Morgen habe ich sechs Rosen auf Solvejgs Grab gestellt, seitdem regnet es. Es ist kühl und grau. In mir lauert immer noch die Depression. Ich rühre mich kaum, um diesen bösartigen Dschinn nicht zu reizen. Jetzt habe ich zu Abend gegessen, trinke edlen portugiesischen Wein aus dem Alentejo, zehn Jahre alt, zum Gedenken an Solvejg und unsere entschwundenen Tage. Vorher las ich Jürgen von der Wense, der mich auch nicht aufheiterte. Gestern fuhr ich Georg zusammen mit Maria ins Krankenhaus, der Dickdarm hat sich entzündet. Willi hat beginnenden Parkinson und Alzheimer. Er kann immer schlechter gehen. Hanna klagt immer öfter über Herzweh.
Ich bin nicht mehr in der Lage, bestimmte Dinge im Fernsehen zu sehen, zum Beispiel jetzt einen irischen Film mit dem märchenhaften Titel »Einst«, ein zarter Liebesfilm: zu schmerzhaft. Auch Filme, in denen Frauen sterben. Und die widerwärtigen Tatorte, Polizeirufe, Inspektor Dämlack, Kommissarin Nagellack und wie sie alle heißen, sollen zusammen mit ihren Produzenten in der Hölle schmoren! Renne ich mit dieser Verwünschung nicht schon offene Türen ein? Besteht Deutschland nicht nur im TV, sondern auch in der Realität, nicht schon längst flächendeckend aus Tatorten?
Diese Metzeleien sind Spiegel unserer Gesellschaft. Was sehen wir? Mörderische Fratzen und Polizistendarsteller, denen man ansieht, dass sie am Vorabend in ihrer Stammkneipe oder am Set tüchtig gezecht haben. Für so einen Mist geben die Fernsehbosse Milliarden aus, und das Volk vergeudet seine Lebenszeit mit Dreck und Tand.
Heute an Christi Himmelfahrt und Vatertag kämpft Georg um sein Leben. Am Montag mussten Maria und ich ihn wieder ins Krankenhaus nach Neunkirchen bringen, weil er starke Schmerzen im Darm hatte. Gestern führte eine eitrige Entzündung zu einem Darmdurchbruch, und er wurde fast den ganzen Tag lang operiert. Nun haben sie ihm auch noch einen weiteren künstlichen Darmausgang für die festen Ausscheidungen gelegt. Er ist sehr schwach, und jetzt in der Nacht, in der ich das hier schreibe, weiß ich nicht, ob er alles gut überstanden hat. Sein Leben hängt an einem seidenen Faden. Maria ist am Ende ihrer Kraft. Sechs Wochen lang soll er jetzt im Krankenhaus bleiben. Ich bete, dass er heil heraus kommt.
Den schönen, im Lauf des Nachmittags drückend heißen Maitag habe ich Hannas und Willis Rasen mähend und danach mit ihnen auf dem Balkon plaudernd recht angenehm verbracht.
Als gestern Abend die Hündin Karma unten in der Wohnung von einem Möbel zu Boden plumpste, dachte ich: Mein Gott, die arme alte Hündin muss bei den beiden Kiffern Jan und Linda ja dauernd stoned sein! Aber wer weiß, vielleicht genießt sie es. Ich musste an meine liebe Katze Khadidja denken, wie verwirrt sie immer war, wenn meine Joints sie benebelt hatten und sie sonst sichere Sprünge nicht mehr schaffte und daneben sprang. Dann lief sie empört aufmaunzend davon, setzte sich zwischen die Doppelfenster auf die Fensterbank und schmollte eine Weile. Diese Katze würde ich im andern Leben, dort wo Solvejg jetzt ist, gern wiedersehen.
Aber vielleicht ist meine Elsterbacher Iris eine wiedergeborene Khadidja? Sie sieht fast genauso aus, ist nur älter und kräftiger. Khadidja hatte den Liebreiz einer jungen Elfe, Iris hat die Anmut einer Frau. Sie hat den sibirischen Winter gut überstanden. Als ich neulich die Treppe hinabging und wieder Angst hatte, sie könnte von einem Lastwagen auf der Durchgangsstraße überfahren werden, hat sie mir ironisch zugeblinzelt.
Es ist zwar immer noch Frühling, aber ein herrlicher Sommer- und Feiertag, Fronleichnam, das Fest mit den Blumenteppichen und Blumenbildern an den Freiluftaltären. Ich wandere zum See. Dort herrscht Hochbetrieb. An einem Imbissstand esse ich eine Rostwurst, vertiefe mich diskret in die Physiognomien der Umstehenden und mache mich schnell wieder davon. Siebzig Prozent der Erwachsenen und sechzig Prozent der Kinder und Jugendlichen haben Übergewicht. Man sieht es auf den ersten Blick: diesen Menschen wird, was ihren ökologischen Fußabdruck angeht, ein Planet Erde nimmer reichen. Fast alle sind geschmacklos angezogen. Die jungen Erwachsenen, vor allem die jungen Männer, sind in einem schlimmen Zustand: fett, vulgär, laut, stupide Gesichter, miserabel gekleidet, oft scheußlich tätowiert. Ein junges Ehepaar mit Kind, eigentlich nett aussehend, hatte einen sehr hässlichen Kampfhund mit messerscharfen Zähnen dabei.
Dann erzählt mir Hanna, nachdem sie mit großer Anteilnahme und Betroffenheit von den Judenausrottungen in ihrer eigenen Kindheit und ihrem eigenen Heimatland sprach, die Römer seien das grausamste und barbarischste Volk der Geschichte gewesen, dicht gefolgt von den Azteken. Wenn ich so etwas höre aus dem Mund meiner Schwester (sie ist nur ein Beispiel, und längst kein schlimmes) möchte ich fliehenden Fußes auswandern. Nein, schon immer ausgewandert gewesen sein. Immer wieder wird mir erschreckend deutlich, wie leicht die Menschen Beute medialer Lügen werden, und wie wenig Chancen sie haben, zur noch so bescheidenen Wahrheit vorzudringen. Alle Versuche, sie aufzuklären, werden abgeschmettert von ihrem bombensicheren Unwissen.
Nach dem Spaziergang noch dies: in Türkismühle sitzt bei schönstem Sonnenschein im dunklen verdreckten Wartehäuschen an der Bushaltestelle eine etwa vierzehn Jahre alte, extrem dicke Schülerin, die ununterbrochen mit ihrem Smartphone hantiert, mindestens zehn Minuten lang, denn in dieser Zeit ging ich zweimal an ihr vorbei. Die Oberschenkel des Mädchens sind so unförmig fett, dass sie kaum sitzen kann, die genauso dicken Unterschenkel sind wegen der Fettmassen wie ein großes A auseinandergespreizt. Noch so jung und, falls sich nichts Entscheidendes ändert, fürs Leben schon verloren. Wer oder was hat dieses junge Mädchen so krank gemacht, und warum hilft ihm niemand?
Angesichts der an KZ erinnernden medialen Bilder aus Afrika und anderen Orten mit vom Hunger zum Skelett abgemagerten Kindern bietet dieses von der Natur völlig entfremdete, krankhaft fette und in seinem Wartehäuschen schon lichtscheu gewordene Wohlstandskind ein Bild des Jammers und Elends, ist aber auch ein Spiegel unserer lebensfeindlichen Lebensweise.
Sommer
Georg ist nach sieben Wochen Krankenhaus wieder nach Haus gekommen. Maria und ich haben ihn bei strahlendem Sommerwetter abgeholt. Er ist sehr klein und dünn geworden, als wäre er in diesen sieben Wochen zusammengeschmolzen. In letzter Zeit fürchte ich oft, dass er nicht mehr gesund und Willi ein Pflegefall wird. Was dann?
In diesen schweren Tagen hat von uns allen Georg die beste Haltung: er lässt sich nur ein bisschen gehen, ist fast immer tapfer und nicht unterzukriegen. Kein Kopfhänger. Er hat Mut und Willenskraft. Ich hoffe, das hilft ihm, gesund zu werden.
Eine Bruthitze liegt über Dorf und Tal, draußen ist nichts zu machen, drinnen wenig: lesen, lesen, lesen. Leider auch ab und zu auf dumme Gedanken kommen und Dinge kaufen fahren, die zwar kein Luxus, aber auch nicht unbedingt nötig sind: drei leichte Sommerhosen, zwei hätten genügt.
Inzwischen vermisse ich in meiner Umgebung doch ein wenig Gespräche wie mit Solvejg, Martin, Solange, Jana oder Jonas, Abendgespräche à la Stifter. Womöglich fange ich bald an zu delirieren und höre Stimmen, mit denen ich die Gespräche führe, die mir fehlen? Oder mir erscheinen Mayas und Solvejgs, wo gar keine sind?
Dann versuchte ich in der kurzen Abkühlung nach einem Schauer auf dem Balkon zu lesen: es war unmöglich, lauter als in Berlin. Dazu kamen noch gelegentliche Attacken von Bremsen, die den armen Pferden unten auf der Weide das Blut aussaugen.
Wäre ich besser in Berlin geblieben? Nein. Aber die Vereinsamung und Isolation ist manchmal bedenklich. Ich komme außer zum Einkaufen und Besuch der alten Leute in Grüneiche gar nicht mehr mit andern zusammen und hinaus, es gibt keinerlei ausgiebiges poetisches Gespräch bei einem guten Wein. Martin ruft selten an, wie ich liebt er das Telefon nicht. Jonas gibt keinen Ton von sich, oder sehr selten, nur Jana ruft noch öfter an. Aber ein Abendgespräch ergibt so ein Telefonat nicht. Mit Jan und Linda lässt sich nichts unternehmen, Linda ist zu abgehetzt und gestresst von ihrem Job, Jans bester Freund und Kumpel ist der Computer. Sie sind ein sympathisches, lässiges Paar, aber eben ein Paar, das in der Paarbeziehung Erfüllung genug findet. Beide segeln auf der Oberfläche des Lebens. Das ist auch schön, aber die Schiffbrüche, die man dort erleiden kann, sind nicht immer heiter. Doch sorgt der Kiff wohl für schöne Versenkungen, Einsichten und Tauchgänge.
Aber allerorten Paare. Oder Gruppen, Kreise, Cliquen, etwas mir Fremdes und Fernes. Ich bin ein Einzelwesen und liebe das Gespräch mit Einzelwesen.
Im Wohnzimmer sind es um acht abends noch einunddreißig Grad, und die Luft ist zum Ersticken. Draußen dasselbe.
Caramba! Ich habe genug TAO und ZEN in mir, um diese heißen Tage nicht nur zu überstehen, sondern auch zu pflücken. Jetzt rauche ich Kiff (gutes Zeug von einer Berliner Freundin), trinke Rotwein (gutes Zeug aus meiner Wahlheimat Portugal), schaue fern, dann Nachtlektüre (im Augenblick, mit zwiespältigen Gefühlen, die »Western Lands« vom alten Bill Burroughs). Dann Schlaf (wahrscheinlich kurz und unruhig).
Ach, sieh an! Da kommt ja noch unerwarteter später Abendbesuch: Der Dichter Schlomann, mein alter Freund und Doppelgänger, scheint mich trösten zu wollen und hat mir ein Haiku souffliert, das zu meinem und vielleicht auch zu seinem Kafard passt:
Sommernacht.Keiner im Haus.Nur Karma und ich.
Ich muss noch ein Wort zu diesem alten Freund Schlomann sagen, den ich schon vor vielen Jahren kennenlernte. Eines Tages, ich glaube, es war nach einer Lektüre in den Werken des armen Poeten Daniel Charms, stand er mir plötzlich ganz deutlich vor Augen. Wir begannen ein Gespräch, das sehr zufriedenstellend verlief, und seitdem sind wir im Gespräch geblieben. Er ist, wie gesagt, Dichter, und obwohl er mein Alter Ego und Doppelgänger ist, gleicht er mir in keiner Weise. Äußerlich hat er ziemlich große Ähnlichkeit mit meinem seligen Deutschlehrer Schulmann, sieht aber, da er kein Studienratsgehalt bezieht, sondern ein noch ärmerer Poet ist als ich, ziemlich verschlissen und schäbig-elegant aus. Er hat oft ein ironisches Lächeln um Mund und Augen, wie gerade jetzt, wo ich über ihn schreibe.
Sommerabend auf dem Balkon. Ich sitze erst jetzt zum ersten Mal länger draußen, weil ich, auch wegen Georgs Krankheit, ziemlich oft bei meinen Schwestern und Schwägern bin, mit denen ich nach den vielen Jahren des getrennten Lebens wieder tiefer ins Gespräch kommen will. Eben erst komme ich von Maria und Georg nach Haus. Georg erholt sich, und das ist gut.
Der Autoverkehr ist jetzt am Abend nicht mehr sehr störend. Iris springt wie ein Hase durchs hohe Gras, ohne mir mehr als einen Seitenblick zu gönnen, und auf unserer Wiese zu meinen Füßen pickt eine fette Elster an einem Stück Brot. Als ich sie anrufe, dreht sie den Kopf und schaut zu mir hoch. Dann pickt sie weiter.
Die schwatzhaften Schwalben kurven vor mir herum und halten ein schwatzhaftes Abendmahl. Es sind viele, sie nisten an einem ziemlich verwahrlosten Haus jenseits der Hauptstraße im Keltenweg. Dort wohnen auch Iris und ein altes Ehepaar. Der alte Mann kann sein Haus nicht mehr in Schuss halten (wahrscheinlich fehlt das Geld), aber im Mähen des großen Rasens vor dem Haus ist er ein Champion. Sobald die Grashalme ein paar Zentimeter zu lang sind, wirft er seinen Rasenmäher an und mäht wie rasend.
Nun kommt wie jeden Abend, wohl direkt aus der Hölle, der riesige, an einen vorsintflutlichen Drachen gemahnende Awacs-Flieger der Amis, dessen tiefes dunkles Grollen mir nicht nur physische, sondern auch metaphysische Angst macht. Donnert gleichzeitig mit dem Grollen ein Lastzug vorbei, erzittert nicht nur das ganze Haus, sondern auch die Erde. Diese Erschütterungen dringen bis in die feinsten Fibrillen meiner Nerven, stören meinen Gleichgewichtssinn. So verwandelt sich Terra firma in Terra infirma, sicheres Land in unsicheres Land. Dauert es länger, lang genug, um der Seele Zeit zum Nachsinnen zu geben, fällt man erst in einen Albtraum, endlich in einen Traum.
In der Nacht tobte ein schweres Unwetter mit einer so wüsten Gewitterflut, dass ich dachte, das Ende der Welt sei gekommen. Aus allen Himmelsrichtungen prasselten Blitze und Donnerschläge im Sekundentakt. Der Donner klang wie schweres Artilleriefeuer. Das Dorf und die Landschaft waren in ein fast taghelles, grell zuckendes, gleißendes Licht getaucht. In der Wohnung war es heiß wie in der Hölle, ich habe Bäche von Schweiß vergossen und kaum geschlafen. Auch hatte ich etwas Angst vor Blitzeinschlag und Feuer. Blitzableiter gibt es hier nicht. Das Licht war apokalyptisch. Wie in meinem Science-Fiction-Roman, den ich noch schreiben will und inzwischen gern im Kopf herumwälze: genau diese Szene hatte ich vor dem Einschlafen vor Augen. Dann wurde sie wahr.
Schon um zehn Uhr morgens war die Hitze am Rand des Unerträglichen. Ich weiß nicht, was ich bei diesen Temperaturen außer lesen und abends vor der Mattscheibe verblöden noch machen kann.
»Alles aber erträgt man, sobald es geschieht«, sagt Sappho, die Dichterseherin von Lesbos.
Auf der Fahrt nach Sankt Wendel zur Bücherei sehe ich wieder ein totgefahrenes Tier am Straßenrand, einen schönen Fuchs. Dieser Fuchs war mehr wert als das Auto, das ihn überfuhr, und wäre es das teuerste der Welt. Wer das nicht versteht, hat den Kontakt zum Wunder des Lebens, auch des eigenen, verloren oder nie gehabt.
Die Opfer, die der Motorgötze bis jetzt schon gefordert hat, sind unermesslich. Würden Terroristen so viel Unheil anrichten, hätten wir übers ganze Jahr hinweg einen Staats-Notstand, wie Nachkriegsdeutschland ihn noch nie erlebt hat. Aber die Erkenntnis, dass der Autoverkehr Massenmord und Krieg ist, findet keinen Anklang in einem Land, das sich zu Tode rast.
Auf dem Spaziergang zum See ist es so schwülheiß, dass ich das Gefühl habe, mich durch einen subtropischen Dschungel zu kämpfen.
Auf meiner Lieblingsbank vor dem See setzt sich eine junge, gerade flügge gewordene Blaumeise neben mich und fiept mich an. Sie will wohl Wasser und/oder Nahrung, die ich ihr leider nicht geben kann. Sie ist so zutraulich, dass sie sich von mir ohne Angst streicheln lässt. Schade: hätte ich meine Wasserflasche dabei gehabt, hätte ich ihr wenigstens zu trinken geben können. Das Tierchen war in Not, wohl erschöpft von seinem ersten Ausflug in die »raue Wirklichkeit des Lebens«. Was für eine ungeheuer intelligente und emotionale Leistung von diesem Tierchen, sich voller Vertrauen und Hoffnung an ein so beängstigend großes und fremdes Wesen wie einen Menschen um Hilfe zu wenden. Das Vögelchen saß noch ein Weilchen neben mir, ruhte sich aus, fiepte und schaute mich an, ließ sich streicheln und trösten, bevor es in die nahe Wiese weiterflog.
Flieg wohl, kleine Meise!
Gerade sah ich vom Balkon aus einen Motorradfahrer im Easy-Rider-Look und mit nacktem Oberkörper auf einer Harley Davidson vorbeifahren. Ich habe noch nie einen Motorradfahrer mit nacktem Oberkörper fahren sehen, außer in amerikanischen Road-Movies. Tja, das ist der Bostalsee im Hochsommer, Ferien, Hitzewelle. Am See stehen Töff Töffs aus ganz Deutschland und aus vieler Herren und Damen Länder: Franzosen, Holländer, Luxemburger, Amerikaner, Polen, Italiener, Österreicher, Schweizer und immer wieder auch Berliner, meine Ex-Landsleute. Kann dann ja nicht so schlecht sein, diese »Jejend«.
Unten auf dem Dorfplatz vergnügt sich die Dorfjugend. Die lauten Mädchenstimmen dominieren. Jetzt singen sie sogar. Richtige Lieder, keine Schlager, keinen Pop.
Ja, auch das ist meine neue Heimat: das Dorf. Und ganz tot gekriegt hat man es offenbar immer noch nicht. Diese an einem schönen Sommerabend auf dem Dorfplatz Lieder singenden Mädchen erinnern mich an ähnliche Abende in meiner Kindheit und Jugend, wenn wir vor dem Elternhaus im Garten auf der Bank saßen und aus schierer Lebenslust Lieder anstimmten.
Die Kinder scheinen genauso zu spielen wie ich vor fünfzig Jahren. Mit Lachen, Geschrei und Gesang. Vielleicht spielen sie sogar die gleichen oder ähnliche Spiele. Das ist tröstlich.
Was hat diese Jugend?
Nichts als ihre Präsenz. »Deine Präsenz ist deine Stärke«. In diesem Satz Rimbauds steckt das Elixier der ewigen Jugend, der ewigen Reife, des ewigen Alters, alles gleichzeitig. Ein mächtiger Zauberspruch. Dagegen sind alle Zaubersprüche Harry Potters oder Gandalfs Knallerbsen.
Stell dir vor: ich fahre fast täglich mit dem Auto auf der gleichen Straße, auf der ich vor Jahrzehnten mit meinem Moped fuhr. Auf der Strecke zwischen Güdesweiler und Steinberg, auch Namborn, wo ich zusammen mit einem Schulkameraden oft meine knatternden Runden drehte, habe ich manchmal sogar akustische Halluzinationen und höre das Röhren meiner Kreidler.
Vom Lemmes gepickt? Oder ein winziger Riss im Zeitgewebe?
Trennt wirklich, wie Ernst Jünger in seinem Essay behauptet, eine Zeitmauer nicht nur das Diesseits vom Jenseits, sondern auch jeden Augenblick vom andern? Oder ist es keine massive Mauer, sondern nur ein dünner Vorhang, ein Schleier? Vielleicht sogar nur eine Schwelle?
Wir wissen nichts.
Ich lege Stift und Schreibheft beiseite, es ist zu dunkel geworden. Ich denke an Solvejg. Trostbedürftig krame ich in den Kavernen meines Gedächtnisses nach einem Vers, einem Satz, der mir Trost spenden könnte. Und dies habe ich gefunden:
Untergegangen ist zwar der Mondund die Pleiaden. Nachtmitte schonund vorbei geht die Stunde.Ich aber schlafe allein. (Sappho)
Mit Hanna und Willi fahre ich zum jährlichen Trödelmarkt nach Eckelhausen. Ich komme aus dem Staunen und Erschrecken nicht heraus. Das ist nicht mehr der bescheidene, überschaubare Flohmarkt, den ich vor dreißig Jahren mit meinen in der Blüte ihrer Kindheit stehenden Töchtern besuchte, wo man am Ortsrand über ein Wiesengelände bummeln und die an einer kurzen Wegstrecke ausgebreiteten Schätze oft privater und nur vereinzelt kommerzieller Trödler in aller Muße mustern konnte, um nach gestillter Kauf- oder auch nur Augenlust am einzigen Imbissstand eine Rostwurst oder ein Eis zu verzehren. Heere von Autos auf der Suche nach einem Parkplatz, Heere von Menschen. Wir müssen auf einem zum Parken freigegebenen Wiesengelände weitab vom Brennpunkt des Markttreibens parken und vielen Gräsern, Blümchen und Tierchen den Garaus machen. Dann schlängeln wir uns durch die engen Gassen zwischen den Verkaufsständen und durch die Menschentrauben, die sich, wie mir scheint, in den letzten dreißig Jahren verzehnfacht haben. Nein, das ist kein Trödel mehr, der hier auf einer Fläche, die fast so groß ist wie das ganze Dorf, feilgeboten wird, sondern meist brandneue, von professionellen Händlern teuer verkaufte Ware. Gewiss, es gibt auch noch genug herrlichen und weniger herrlichen alten Plunder zu bestaunen und zu erwerben, alte Schinken in Öl und Rauschgoldrahmen von so kitschigen Gebirgslandschaften, dass es mir fast die Tränen in die Augen treibt, ob vor Schmerz, vor Lachen oder vor Rührung, wage ich nicht zu entscheiden, Gemälde von einem blonden langhaarigen Jesus, der mit seinen leicht schwul wirkenden Jüngern durch ein ebenso blondes Kornfeld wandert, oder von einer Schmerzensmutter Maria, die ihr mit einem kleinen Schwert durchbohrtes bluttriefendes Herz fast wollüstig zur Schau stellt, und Berge von altem Hausrat aus den Hinterlassenschaften verstorbener Omas und Opas. Es gibt auch schöne alte, liebevoll restaurierte Bauernmöbel, die freilich nur noch sehr prallen Geldbörsen erschwinglich sind. Und es gibt nicht mehr nur einen Imbiss- und Eisstand, sondern gleich ein halbes Dutzend, ambulante Restaurants, die eine ganze Speisekarte voller Gaumenfreuden anbieten. Am Ende meines Sinne und Verstand ebenso berauschenden wie vernebelnden Streifzugs habe ich bei einem zähen alten Schacherer, unverkennbar ein »Ossi«, einen Stoß Bücher, bei netten jungen Leuten zwei CDs (Beatles und Grateful Dead) und bei einer sympathischen und redseligen Frau aus Weiskirchen im saarländischen Hochwald und Almenland, ein schönes, von Hand gehäkeltes Tischtuch gekauft.
Nach dem nicht mehr wie einst entspannenden, sondern anstrengenden Bummel entlang den dicht belagerten Ständen, wo manches noch lockte, aber nicht gekauft wurde (nicht aus sokratischer Tugend, sondern schnödem Geldmangel), setze ich mich mit Hanna und Willi, die nur bestaunt, befingert und betrachtet, aber nichts gekauft haben, vor einer großen Imbissbude im Freien an einen langen Tisch mit Bänken zur Mahlzeit. Die beiden essen einen sehr fett aussehenden Schwenkbraten mit Pommes Frites, die, als ich einen Bissen probiere, wie in ranziges Öl getauchte Balkensplitter schmecken. Ich begnüge mich mit einer braven Currywurst und einem matschigen Brötchen. Der Tisch ist so voll besetzt, dass wir kaum Platz zum Essen haben.
Aufatmend heim.
Als ich den Markt zum ersten Mal mit meinen beiden Töchtern und Solvejg besuchte, gab es auch viel Gedränge an den Ständen, der Andrang der Autos aber hielt sich in maßvollen Grenzen. Auch gab es noch keine »antiken« Möbel für dreitausend Euro zu kaufen. Der ganze Trödelmarkt hat sich leider sehr kommerzialisiert und ist, hat man ihn vor dreißig Jahren besucht, nicht mehr wiederzuerkennen. Ja, hier auf dieser kleinen Fläche lässt sich wie unter einem Vergrößerungsglas gut erkennen, wohin das von allen hochgepriesene und herbeigesehnte Wachstum führt und wo es enden wird.
Sogar im schlichten und auf den ersten Blick eintönig grünen Waldhügel vor meinem Fenster schlummert ein ungeheurer Reichtum an Formen und Farbnuancen. Auf den ersten, meist von Sehgewohnheiten und Sehautomaten (Fotoapparat, Videokamera) verdorbenen Blick sieht alles irgendwie grün, unansehnlich und langweilig aus, erst dem geduldigen, empfänglichen Blick offenbaren sich die Wunder. Dann haben die gegängelten, dressierten, sensationsgierigen Augen schon längst abgeschaltet. Wunder lassen sich fast immer Zeit, und wer keine Zeit hat, erlebt kein Wunder, höchstens ein blaues.
Kann man das Zusammensein mit einem geliebten Menschen, obwohl es durchaus nicht immer »glücklich« zu nennen war, aus der Rückschau anders beschreiben als verklärend? Mit der »wilden Schwermut« (Ernst Jünger, Anfang der Marmorklippen, Bezug auf Dante), die einen ergreift in Erinnerung an »glückliche Tage«? Glücklich jetzt allein schon deshalb, weil wir beide, Solvejg und ich, in ihnen lebten. Das Glück selbst, das Glück an sich, gleichgültig in welcher Form und Gestalt, haben weder sie noch ich je erstrebt und gesucht.
Ernst Jünger dämonisiert wie Heidegger die Technik und sieht nicht die einfache Logik, dass immer mehr Menschen immer mehr »Ressourcen« verbrauchen. Eine der Natur und den Menschen dienende Technik zögert durch Erfindungen die Fatalität der Fehlentwicklung hinaus. Sinnvolle Inventionen und Investitionen könnten diese Fatalität vielleicht sogar aufhalten.
Aber den Begriff »Ressource« will ich aus meinem Wortschatz streichen: er ist materialistisch-nihilistischer Abstammung. Wasser zum Beispiel ist keine »Ressource«, sondern ein wunderbares Gottesgeschenk, der Quell allen Lebens. Wenn der Mensch die Welt als Gottes Schöpfung und Geschenk begriffen und erkannt hätte, stünden wir heute nicht am Abgrund. Einst, als der Mensch noch nicht so modern war wie heute, tat er es. Die Kelten errichteten im Elsass an der Quelle der Saar ein Heiligtum; als die Römer kamen, zerstörten sie das Heiligtum nicht, sondern bauten es zu einem Tempel aus.
Wie bei der weißen und schwarzen Magie gibt es bei der Technik eine weiße und schwarze Technik. Wenn es bei der Verteilung der aus den Gottesgeschenken gewonnenen Güter gerecht zuginge und wenn diese Güter auch gut wären, nicht etwa eine Knarre zum Töten und Getötet werden, wenn jeder Mensch seinen humanen Anteil erhielte, wären die Schätze der Erde noch längst nicht erschöpft. So kommt es zu der moralischen Perversität, dass in Afrika und an vielen anderen Orten der sogenannten Dritten Welt Kinder verhungern müssen, damit wir in Europa und Amerika mit unseren Autos und Maschinen die Natur verpesten und zerstören können. Das ist eine schwere Schuld, für die es eine Nemesis geben wird. Hokusais Woge wird kommen, das ist sicherer als das Amen in der Kirche.
Zweiter Dauerregentag. Dreizehn Grad Tagestemperatur. Im August! Ich habe die Heizung angestellt.
Vom vielen Lesen am Bildschirm und in Büchern brennen mir die Augen. Ich arbeite viel, selbst wenn ich schlafe. Mit der Reduzierung des Tabaks komme ich schlecht voran. Es liegt an meiner Hellwachheit, die mich, um die Spannung zu mildern, immer wieder zur Zigarette greifen lässt.
Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich gern wieder die Reisen vor allem in Griechenland nachfahren (in Portugal sind es zu viele), die ich mit Solvejg unternahm. Dabei Notizen machen, die ich damals versäumte. So die denkwürdige Wanderung von Leonidion zum Felsenkloster hoch in den Bergen. Wie genau sah es dort aus? Was für Pflanzen und Bäume wuchsen am Wegrand? Welche Gerüche und Düfte lagen in der Luft? Teilweise lässt sich die verblasste Erinnerung mit Hilfe von Fotos und Texten im Internet auffrischen. Vor allem Andros, Kythera, Korinth, Delphi, Mykene und der ganze Peloponnes wären mir wichtig.
Wir begegneten damals auf unserer Wanderung in sengender Sonne, uns von Baumschatten zu Baumschatten vorkämpfend und dort den Schweiß trocknend, einer Schildkröte, die auch auf dem Weg zum Kloster zu sein schien. Wahrscheinlich war sie eine Pilgerin. Wir gingen ein kleines Wegstück gemeinsam, und die Schildkröte schien unsere Gegenwart gern zu sehen. Einmal, als auch sie eine Rast machen musste, ging ich in die Hocke, redete freundlich mit ihr und streichelte ihren Kopf. Sie war überhaupt nicht scheu, zuckte kein einziges Mal zurück, sondern blickte mich aus intelligenten Augen freundlich an.