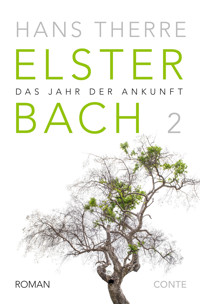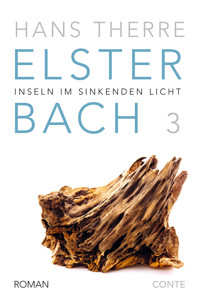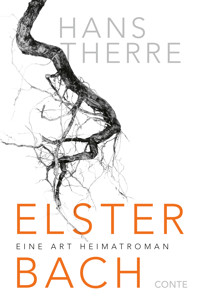
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Elsterbach-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der Schriftsteller Anders Nieheim kehrt nach vierzig Jahren aus Berlin in seine saarländische Heimat zurück. Doch seine Versuche, im Dorf Elsterbach neue Wurzeln zu schlagen, scheinen ins Leere zu laufen. Die Zeit hat nicht nur ihn verändert, auch die Heimat hat sich gewandelt – um die Wiesen der Kindheit stehen Zäune, die Freunde der Jugend sind alt geworden. Erinnerung, Realität und Lebensentwurf kollidieren miteinander. In einer Zeit, in der um den Begriff »Heimat« gerungen wird, stellt Hans Therre die großen Fragen: Sind die Menschen, die wir kennen und kannten, Heimat? Die Orte, die untrennbar verwachsen sind mit unseren Geschichten? Ist sie geographisch gebunden oder eher ein Gefühl, das wir in uns tragen, wohin uns das Leben auch treibt? Sprachgewaltig und emotional erkundet »Elsterbach« durch die Augen eines Heimkehrers nicht nur die Seele eines Landes, sondern lässt die Leser den Weg von Anders Nieheim mitgehen: Wir erobern uns die Heimat nicht, sie schlägt ihre Wurzeln in uns.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Hans Therre - Elsterbach
Widmung
Das Jahr der Heimkehr
Kapitel 1 – Aufbruch von Berlin
Kapitel 2 – Ankunft in Elsterbach
Kapitel 3 – Schöne neue Warenwelt
Kapitel 4 – Wiedersehen mit dem Heimatdorf I.
Kapitel 5 – Wiedersehen mit dem Heimatdorf II.
Kapitel 6 – Das Dorf Elsterbach
Kapitel 7 – Hausgenossen
Kapitel 8 – Abendgespräch
Kapitel 9 – Osterspaziergang
Kapitel 10 – Traumfährten
Kapitel 11 – Eine rotgescheckte Katze und ein alter Bauer
Kapitel 12 – An der Elsterbachmühle
Kapitel 13 – Eine Fee tritt aus dem Wald
Kapitel 14 – Gewittersturm
Kapitel 15 – Am Brunnen der Erinnerung – Ein Ausflug mit der Raumzeitmaschine
Impressum
Seitenliste
3
4
5
7
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
71
72
73
74
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
213
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
229
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
255
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
299
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
355
Navigationspunkte
Cover
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Textanfang
Impressum
Für Ingrid und Françoise in Liebe
Das Jahr der Heimkehr
»Die Fremde, die in die Heimat kommt, macht sich selbst nicht heimisch, die Heimat aber fremd.«
Franz Werfel, »Stern der Ungeborenen«
Kapitel 1 – Aufbruch von Berlin
Frühling
Berlin, Karfreitagmorgen
Der Aprilmorgen graut. Berlin gähnt sich wach. Ich liege am Boden meines Schlafzimmers auf einer Steppdecke und starre in den heller werdenden Raum. Ich habe die ganze Nacht kaum ein Auge zugetan. Unterwegs war ich doch, im Traum, und aufgewacht bin ich mit Solvejgs Lied, das jetzt verklingt.
Auch ich war einmal ein Wanderer, ein Stromer wie Peer Gynt, auch ich war in Arkadien, wanderte in seinem gelbroten Staub wie durch eine irdische Marslandschaft, ein Vagabund der Windrose, ein durch muddy waters rollender Stein, Ahasver ohne Kornfeld, Steppenwolf ohne Steppe, unbewanderter Wanderer in den Feldern der Welt. Ich wanderte und schwärmte über die Erdkugel, hin und her, auf und ab, kreuz und quer, bis ich mich im Netz der Spinne Stadt verfing. Nun, dürftiger denn je, gehe ich wieder auf Wanderschaft, am Ende verschwinde ich in ihr, werde Wind, Staub.
Ein Wanderer bin ich wieder, ein Landstreicher, Stromer auf Wegen und Straßen. Ist die Welt nicht voller Schönheit und Schrecken? Locken nicht dort drüben, am Horizont, noch immer die alten jenseitigen Träume? Meine Sehnsucht nach einer anderen Heimat als der ererbten hat mich mehrmals die Welt umrunden lassen. Und alles im kleinen Europa, dort aber von Peer Gynts Norwegen bis Aphrodites Insel Kythera. Und war ich dann in einer anderen Heimat, nach der ich mich im Vertrauten verzehrt hatte, gab es immer wieder Augenblicke, in denen mir diese andere Heimat nicht mehr heimatlich genug war. Dann sehnte ich mich nach einer neuen, noch unbekannten, heimatlicheren Heimat, nach einem Ort vielleicht, an dem ich frohlockend verzweifelnd alles Heimatliche in mir selbst finden würde.
Wäre dort dann der Kreis geschlossen, die Weltumrundung beendet, ich endlich in mir selbst einheimisch geworden?
Jetzt ist es wieder so weit, jetzt muss ich wieder weg, zum Auswanderer und Einwanderer werden, nach dreißig rastlosen Jahren. Nein, von einem Daheim muss ich nicht weg, doch von einer Karawanserei namens Berlin.
Da verlasse ich nun die Stadt, in der ich dreißig Jahre lebte wie der Nomade oder der Zugvogel in seinem Winterquartier, wie ein abgebrannter Poet in seiner Bleibe, die ihm Unterschlupf und Atempause bot, breche auf im Morgengrauen, beim ersten Hahnenschrei, wenn es in Berlin noch Hahnenschreie gäbe, wie einer, von dem man in den Zeitungen liest, der beim Frühkaffee seine Taschen abtastet und zu seiner Frau sagt, »Ich gehe mal rasch ein paar Zigaretten holen«, und weggeht und nie wiederkehrt. Aber dieses Bild ist falsch, ich habe keine Frau mehr, tot ist sie und liegt begraben seit sechs Monaten.
Solvejg ist tot, meine Gefährtin seit dreißig Jahren, und mit ihr ist die ganze Stadt gestorben. Lautlos implodiert. Keinem wurde ein Haar gekrümmt, nur mir wurde das Herz zerrissen.
Es ist sechs Uhr morgens. Ich stehe auf, koche mir in der ausgeräumten Küche den letzten Kaffee, esse im Stehen ein Brötchen, während ich mit leerem Blick auf die räudige Platane vor dem Fenster starre. Die Wohnung ist geräumt bis auf ein paar noch im Auto zu verstauende Reste. Ich packe diese letzten Habseligkeiten in eine Reisetasche, falte die bunten Steppdecken zusammen, auf und in denen ich zu schlafen versuchte, lege sie mir über die linke Schulter, die große Reisetasche nehme ich in die rechte Hand. So gehe ich durch die leere Wohnung, sehe überall die hellen Vierecke, da hingen einmal Bilder, Solvejgs Bilder, die sind jetzt schon an einem anderen Ort. Ich stehe da wie ein alter türkischer Teppichhändler und schaue mich um, eine letzte Impression: sieh genau hin, Anders, hier hast du unermesslich lang gelebt, allein, aber allein mit Solvejg, die hundert Schritte weiter in der Straße wohnte, allein, aber allein mit dir.
Und hier bist du alt und schlohweiß geworden.
Seit einem halben Jahr ist Solvejg tot. Der Krebs hat sie getötet, nachdem sie zwei Jahre kämpfte, litt und hoffte. Operationen, Chemotherapie, die ihr das schöne kastanienrote lange Haar raubte und nichts nutzte, Bestrahlungen, Medikamente, alles vergeblich. Ach die Heilkunst, so wenig Kunst, so wenig Heil.
Ein halbes Jahr brauchte ich, um fortzukommen. Der erste und wohl auch der zweite Monat waren wie ein Wachkoma, ich saß und ging herum wie ein Albtraumwandler. Das Nötige, so viel Nötiges, erledigte ich wie ein Automat, ein Roboter. Erst die Beerdigung, die tausend Formalitäten, die den Tod zum Todesfall machen. An einem grauen regnerischen Novembertag stand ich an ihrem Grab. Allein der Satz »Ich stand an ihrem Grab« ist ungeheuerlich, nie hätte ich gedacht, ihn jemals schreiben, noch weniger, den Inhalt dieses Satzes erfüllen zu müssen. Ihr Begräbnis fand statt, ein Grüppchen Trauernder drängte sich um ein Urnengrab, so klein, dass es wie ein Hundegrab aussah. Der Pfarrer war da, ein noch junger, kräftiger Mann, er brauchte eine Weile, um die Lautstärke seiner Stimme auf die schüttere Trauergemeinde einzustellen, aber dann hielt er eine schlichte, schöne Rede. Als er die Worte sprach, »In der Hoffnung auf Gott, der Leben schafft und vollendet, nehmen wir Abschied von Solvejg. Erde zur Erde, Asche zur Asche, Staub zum Staube. Ihr Leib vergeht, Gottes Treue bleibt«, erfasste mich ein solcher Jammer, dass ich mich am liebsten auf die Erde gelegt und für immer das Bewusstsein verloren hätte. Das ging aber nicht, die Erde war nass und kalt, das wäre nicht weiter schlimm gewesen. Bloß wäre es theatralisch gewesen und damit meinem Wesen fremd.
Es folgte die Räumung ihrer Wohnung. Was ich zu mir nehmen wollte und konnte, schaffte ich hinüber in meine kleine Bude, allein, ohne Hilfe, denn die hatte ich abgelehnt, wohl hundertmal bin ich schwer bepackt den Weg zwischen den beiden Wohnungen gegangen. Mein Kreuzweg, demütig und ins Leiden versenkt, ohne Anmaßung oder Blasphemie, jeder Mensch hat seinen Kreuzweg. Dann war meine Wohnung so vollgestopft, dass nichts mehr hineinging.
Die Räumung war schwer, an allem haftete ein Stück von der Geliebten. Ich musste mich verhärten gegen dieses Meteorfeuer der Erinnerung, ich wäre sonst verrückt geworden. Oh, es ist leicht verrückt zu werden, und das hier war schwer. Herr Yildiz half mir, ein sanfter, zartfühlender Mann, der mit seinem Familienbetrieb kam, räumte und renovierte. Verträumt stand er in Solvejgs Wohnung, betrachtete lange ihre Bilder, sagte kein Wort, schaute nur. Er hatte noch nie in der Wohnung einer Malerin gestanden, er selbst konnte ja nur Wände tapezieren und mit weißer Farbe bestreichen. Und dann kam er zu Anders, dem Schriftsteller, der jetzt Witwer geworden war. Sie rauchten eine Zigarette, sprachen wenig, auch einem Schriftsteller war Herr Yildiz außer in Büchern noch nie begegnet. Er sprach leise und behutsam, als fürchte er, eins seiner Worte könnte zu Boden fallen und mit einem Knall zerspringen. Am letzten Tag, als sie sich verabschiedeten, brachte er seinen zehnjährigen Sohn mit und sagte zu ihm: »Schau, das ist ein Dichter.« Und der Junge schaute mit großen dunklen Augen.
Als das getan und vorbei ist, sitze ich Tag und Nacht in meiner Wohnung, fast reglos, nach innen horchend. Was nun? Die Stadt, über Nacht in ein paradoxes Schwarzweiß getaucht, ist mir unversehens fremd und unerträglich geworden. Ich habe es mehr als einmal versucht, mein Stadtleben ohne Solvejg funktioniert nicht mehr. Die Vorstellung, bei meinen alltäglichen Besorgungen am Haus vorbeigehen zu müssen, in dem meine Gefährtin wohnte, flößt mir Grauen ein. Der Gedanke, einen unserer Lieblingsspaziergänge in und am Rand der Stadt nun allein gehen zu sollen, bereitet mir Seelenpein. Nichts in und an der Stadt, von unserem gemeinsamen Leben überall erfüllt und jetzt auch gezeichnet, lässt sich noch aufsuchen, alles ist wie verbrannt, und der Impuls, Berlin endlich zu verlassen, ist unabweisbar. Und da meine Verhältnisse nichts anderes erlauben, entschließe ich mich, nach vierzig Jahren Abwesenheit in meine alte Heimat zurückzukehren, in der noch einige von meiner Familie leben.
Es bleibt mir keine andere Wahl.
Aber ein Wunsch, ein Traum.
In den vier Jahrzehnten, in denen ich in Städten lebte, bin ich kein Stadtmensch geworden. Das Stadtleben ist mir immer fremd geblieben und gegen meine Natur erschienen. Schon mit dreißig Jahren wollte ich aufs Land zurück, freilich nicht in Deutschland und erst recht nicht in meine alte saarländische Heimat, deren Schatten sich in der Erinnerung noch längst nicht verklärt hatten. Auf meinen Reisen kreuz und quer durch Europa, in mehr oder weniger alten und klapprigen Autos, war ich über eine neue und, wie mir schien, von vergangenen Schatten unbelastete Heimat sozusagen gestolpert, ein kleines portugiesisches Dorf am äußersten Rand Europas. Aber alle im Lauf der Jahrzehnte unternommenen Ansiedlungsversuche scheiterten, und zwar an der Weigerung meiner Lebensgefährtinnen, sich mit mir in das ungewisse Abenteuer der Auswanderung zu stürzen. So blieb ich, wo ich war, in Berlin mein Brot als Schriftsteller und literarischer Übersetzer mehr schlecht als recht verdienend, immer wieder periodisch heimgesucht von brennender Sehnsucht nach der nun zwar gefundenen, mir aber nur für kleine Zeiträume offen stehenden neuen Heimat. Ich führte, kurzum, ein zwischen dem alltäglichen Da und dem ersehnten Dort hin und her vagabundierendes Leben.
Als ich mich endlich entschied, in meine alte Heimat zurückzukehren, war ich mir bewusst, dass in den vierzig Jahren meiner Abwesenheit nicht nur ich mich verändert hatte, sondern auch die Heimat. Als ich mit zwanzig meinem Heimatdorf Lebwohl sagte (oder hatte ich in der Eile gar vergessen, Lebwohl zu sagen?), war ich ein junger Student, der darauf brannte, wenn schon nicht die Welt selbst, so wenigstens die des Geistes aus den Angeln zu heben. Mein Heimatdorf war ein verschlafenes Kaff, in dem alles Leben in der abergläubischen Furcht vor jeder Veränderung und in tiefem Unwissen erstarrt zu sein schien. Wörter wie Freiheit und Selbstbestimmung waren unbekannt oder anrüchig, befremdend. Jetzt kehre ich heim, ein weißhaariger Witwer, und das Heimatdorf, das ich in den letzten Monaten mehrmals wiedersah, scheint mir auf den ersten Blick aus seinem jahrhundertelangen Dornröschenschlaf in der Moderne des 21. Jahrhunderts erwacht zu sein.
Welcher schöne Prinz es wohl wachgeküsst hat?
Aber blieb mir nicht doch eine Wahl, und habe ich sie nicht schon getroffen? Warum, wenn ich doch neue Wurzeln in der alten Heimaterde schlagen will, habe ich, Anders Nieheim, mich nun für Elsterbach als neuen Wohnsitz entschieden, ein Dorf, von früher zwar bekannt, aber nur flüchtig, vom Durchfahren, ein Dorf, das etliche Meilen von meinem Heimatdorf entfernt liegt?
Ja, da liegt schon der Hase im Pfeffer, ich mag mich noch so sehr drehen und winden, kann noch so sehr darauf verweisen, dass ich eben keine Wohnung in meinem Heimatdorf fand, aber immerhin eine in ziemlicher Nähe zu ihm, es wird mir keine Erklärung, keine Ausflucht genügen, ich muss diese Frage jetzt gleich beantworten.
Ich wollte von Anfang an nicht im Dorf meiner Kindheit und Jugend wohnen, zu dicht und zu nah gerückt wäre ich dem, was mein Heimatdorf an Altem, hinter mir Gelassenem, Verbrauchtem enthält, und die Gefahr, in ein mir fremd gewordenes, ja entrücktes Dorfleben verstrickt zu werden, wäre groß gewesen. Auch fürchtete ich, tagtäglich umgeben von Menschen, die mich von Kindheit an kannten und dann vierzig lange Jahre Zeit hatten, mich zu vergessen, nicht mehr denken, schreiben und vor allem veröffentlichen zu können, was ich will, Rücksichten auf die Empfindlichkeiten von Menschen nehmen zu müssen, die ich nicht mehr kenne. Und zum größten Teil auch nie wirklich kannte. Ich will weder ein Dorfdichter noch ein Heimatdichter sein, selbst wenn ich es nach meinen diversen Weltumrundungen noch könnte, ich habe Angst vor einer inneren Zensur, auch wenn es die der Liebe wäre. Und ich habe Angst, dann schon bald wieder fort zu müssen.
Nein, ich erwarte und suche keine Kindheitsidyllen. Doch, ein paar schon. Ich erwarte und suche vor allem die mit den Jahren immer schmerzlicher vermisste Nähe zur Natur und zum Landleben, denn das Stadtleben hat mich seelisch und körperlich krank und, was meine Beziehung zur Natur angeht, zum Gefühlskrüppel und Banausen gemacht. Ich erwarte und suche die Nähe zu den noch lebenden Familienmitgliedern, die mir in der Fremde etwas fremd geworden sind. Dunkel freilich bleibt mir vorläufig das Ausmaß dieser Entfremdung, ich glaube aber zu wissen, dass sie schon einmal größer war als jetzt. Und ich habe mir die Wiederentdeckung der alten Heimat und die Entdeckung der wie ich selbst vierzig Jahre älter gewordenen neuen Heimat zur Aufgabe gemacht, in der Hoffnung, in diesem Doppelspiegel untergegangene oder verlorene Fragmente meiner selbst und meines Werdegangs, meiner Lebensgeschichte zu Gesicht zu bekommen.
Spannend wird es für mich werden herauszufinden, was die Natur zu dem Spätheimkehrer sagt, ob sie überhaupt etwas zu ihm sagen wird. Denn die Entfremdung von der Natur ist da und, wie mir scheint, weit größer als die Entfremdung von den Verwandten, zu denen ich auch nach meinem Weggang nie den Kontakt verlor. Denn sie trat lebensgeschichtlich viel früher ein. Ohne zu übertreiben kann ich sagen, dass ich, das naturnahe und naturverliebte Kind, mit elf oder zwölf Jahren fast alle Verbindungen zur Mutter Natur verloren hatte. Schon früher als ich selbst, der sich kaum anders als die heutige Jugend mit Lichtgeschwindigkeit von der Natur und allem entfernte, was nach Nestwärme roch, hatte das meine Mutter bemerkt und mir immer wieder, leider vergeblich, das Beispiel meines mit achtzehn Jahren im Krieg gefallenen Bruders vor Augen gehalten, der anders als ich den Kontakt und die Liebe zur Natur bis zu seinem frühen Tod nie verlor.
Heimat aber ist für mich kein ein für allemal zum Begriff erstarrter Ort, keine schillernde, im Bernstein gefangene Fliege namens »Kindheit«, kein »Dort, wo ich einst Kind war«, sondern immer ein ganz konkreter Ort, sei es nun heute Elsterbach oder morgen vielleicht das kleine portugiesische Dorf am Rand des Kontinents, wo ich leben und arbeiten will. Heimat ist für mich die Entdeckung eines Lebensraums für alle Sinne, ein glücklicher Fund auf einem Wünschelrutengang, ein Ort, an dem ich möglichst ungestört vom Weltbetrieb meiner Arbeit nachgehen und mit guten oder wenigstens freundlichen Menschen in nicht allzu bedrängender Nähe zusammen leben kann. Wohl trieb mich schon immer, selbst in der Kindheit, als ich dafür weder Worte noch Begriffe hatte, die Suche nach einem versunkenen Atlantis, einer Insel der Seligen oder einem antiken Arkadien um. Ich erinnere mich, dass ich mich mit fünfzehn oder sechzehn Jahren in meiner Dachstube lange in ein Gemälde von Jean-Francois Millet versenken konnte, etwa in den Weiler Cousin bei Gréville, in das Abendgebet, oder in die Landschaft in der Dämmerung von Claude Lorrain oder auch noch das gefährlich nah am Gefühlskitsch vorbeigleitende Ave Maria bei der Überfahrt von Giovanni Segantini, und mitten im Herz der eingeborenen Heimat ein brennendes Heimweh nach diesen unbekannten Welten empfand. Ein anderes Mal, in einer anderen Stimmung, waren mir Millets Bilder zu pastoral und idyllisch, etwa sein frommes Angelusgebet auf dem Feld, und dann konnte ich Heimweh beim Betrachten von Gemälden meines Lieblingsmalers Van Gogh empfinden, die alles andere als pastorale Idyllen sind, sondern von äußeren wie inneren Luftwirbeln und Gewitterstürmen heimgesuchte Seelenlandschaften.
Meine Lebensgefährtin ist tot, und nicht nur das bloß noch von Schwermut und Trauer erfüllte Berlin, sondern auch die Stadt, genauer: die Großstadt als Lebensraum ist mit meiner Geliebten gestorben, und mit einem nicht nur meinen Freunden, sondern auch mir selbst unheimlichen Ungestüm mache ich mich nun daran, mein Zelt in Berlin abzubrechen und in der alten Heimat aufzuschlagen. Die Wahlheimat, das kleine portugiesische Dorf am Rand des Atlantiks, muss warten, solange Familienbande und andere Bindungen mich an Deutschland fesseln. Den Mahnruf Franz Werfels habe ich lange bedacht. Ist das so schlimm?, habe ich mich gefragt. Mir scheint, davon könnten beide Parteien profitieren.
Einen anderen Satz gilt es im Lauf dieses langen Weggesprächs auf mich selbst anzuwenden und auf seinen Wahrheitsgehalt zu überprüfen: »Ich hätte nicht zurückkommen sollen.« Das sagte vor vielen Jahren ein alter Grieche an Bord des Fährschiffs Martha,eines röchelnden alten Kahns, beim Anblick seiner Heimat Kythera, in schönster bayrischer Mundart zu seiner blonden deutschen Frau. Solvejg und ich standen in der Nähe des Paars, das in einem Alter war, in dem Solvejg und ich uns heute befinden, also Anfang sechzig, und das eine sehr angenehme, kultivierte Ausstrahlung hatte. Als ich, an der Reling lehnend und hingerissen auf die sich nähernde Insel schauend, diesen Satz hörte, wurde ich sofort hellhörig. »Warum«, fragte ich Solvejg, aber so, dass das Ehepaar mich nicht hören konnte, »fällt dieser alte Grieche, der nach vielen Jahren seine Heimat wiedersieht, schon beim ersten Anblick dieser zauberhaften Insel, auf der, so will es die Sage, die Göttin Aphrodite schaumgeboren aus dem Wasser stieg, ein derart bitteres und voreiliges Urteil? Wäre es denn nicht viel einleuchtender gewesen, wenn er gesagt hätte: ›Ich hätte nicht weggehen sollen?‹ Was sieht er, was wir nicht sehen?« Auch Solvejg wusste keine Antwort. Als wir dann schon wochenlang die wie durch ein Wunder vom Tourismus noch fast verschont gebliebene Insel durchstreift hatten, wurde uns der Satz des alten Griechen immer unbegreiflicher.
Nun, ich bin jetzt, in die alte saarländische Heimat aufbrechend, in einer ähnlichen Lage wie damals der alte Grieche. Ich werde diesen Satz, »Ich hätte nicht zurückkommen sollen«, in die Heimat mitnehmen, in der Hoffnung, vielleicht auch in der bangen Erwartung, endlich eine Antwort auf meine Fragen zu finden.
Und dann, am wichtigsten: bin ich, der Ruhelose, der alt gewordene Ahasver und Steppenwolf, insgesamt und überhaupt noch heimatfähig?
Jetzt stehe ich im Flur, werfe einen letzten Blick in die leere Wohnung. Ich habe Fotos von ihr gemacht, von der vor Tagen noch ungeräumten, jetzt geräumten Wohnung. Es ist verstörend zu sehen, wie rasch etwas verschwindet, das man ausräumt und verlässt. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass das Verlassene nun in der Erinnerung eine neue verlässliche Heimat gefunden hat.
Als ich auf die Straße trete und zum Auto gehe, das nicht weit vom Haus geparkt ist, wird es schon hell. Ein einziger Mensch ist unterwegs, ich kenne ihn, es ist der alte Türke aus meinem Haus, der jetzt wie ein Traumwandler die türkische Bäckerei ansteuert, um nicht allein zu frühstücken. Er sieht mich nicht, er träumt.
Mein Auto, das einmal Solvejgs Auto war, steht da, nicht ohne Angst vor nächtlicher Plünderung habe ich es am Vorabend vollgepackt bis zum Rand. Was ich nun bei mir trage, muss auch noch hinein, es geht, in einem Kombi lässt sich viel verstauen. Langsam fahre ich durch die noch stille Kopfsteinpflasterstraße, es ist fast eine Kamerafahrt. Die letzten Blicke sind immer die eindringlichsten.
Ich biege nach rechts in die Dominicusstraße, die schon nach wenigen Metern zum Sachsendamm wird, der schon nach wenigen Metern zur Autobahnauffahrt führt. Es sind nur wenige Fahrzeuge unterwegs. Noch ein paar Augen voll Stadtimpressionen: der elektrisch blinkende und Werbebilder abspielende Gasturm der Stadtwerke, die grellgelb erleuchtete Tankstelle, müde wie nach einer durchzechten Nacht, die drei metallgrauen Schlote des Wilmersdorfer Kraftwerks, Brücken, Häuserzeilen, bald schon der Funkturm, dann die Avus, sie führt, waldgesäumt, hinaus.
Ein letzter Blick zurück, er führt geradewegs in Solvejgs Wohnung, die jetzt still und verlassen ist. Ich werde diese Wohnung, fast so vertraut geworden wie die Haut meiner Geliebten, nie wieder betreten, nein, doch, aber nur noch durch Seelentüren. Schattenranken an ihrem Fenster, jäh entgleitend, angezogen vom schwarzen Loch des Nimmermehr ins Unwiederbringliche, Unvergessbare.
Ein anderer Blick führt zum Friedhof, wo Solvejgs Asche in einem Urnengrab ruht. Nicht lange wird sie dort ruhen, sie wird folgen.
Die Berliner Freunde bleiben zurück. Vor einigen Tagen habe ich mit ihnen Abschied gefeiert, in der Taverne von Freund Nikos. Alle, die hier leben, kamen, genau sechs an der Zahl.
Martin, der vertrauteste Freund, Saarländer wie ich, länger in Berlin als ich, Schriftsteller und literarischer Übersetzer wie ich, Blutsbrüder nannten wir uns gelegentlich, nicht nur im Scherz. Mit gerunzelter Stirn: »Du machst einen schweren Fehler.«
Jana, alte Freundin, Pfälzerin, Dichterin und Schriftstellerin, seufzend: »Es wird sehr schwer werden für dich dort unten. Das Terrain ist vermint. Die Heimat ist immer auch ein Tatort.«
Winfried, der Freund meiner Kindheit und Jugend, Kellner von Beruf, seit langer Zeit in Berlin. Er grinst: »Dein Umzug in die alte Heimat ist so absurd, dass es schon wieder gut ist. Halt die Ohren steif!«
Martha, die Sitar-Spielerin, geboren in Dresden, »Republikflüchtling« aus einer res publica, in der sie nichts zu melden hatte, Solvejgs beste Freundin. Sie kam an Krücken, wie sie schon zur Beerdigung an Krücken kam. Vor einem halben Jahr ist sie auf dem Rad mit einem Radfahrer zusammengeprallt, komplizierte Brüche, mit Nägeln zusammengefügt. Sie schweigt viel bei diesem letzten Treffen, aber dann sagt sie: »Könnte ich nur mitkommen!«
Jonas, der Maler, kein Hiesiger, sondern ein aus Droste-Hülshoffs Westfalen Hereingeschneiter, Gestrandeter, vor langer Zeit in Portugal zum Freund geworden, sagt: »Das Beste, was du tun kannst.«
Nikos, Restaurantbesitzer, Freund seit langem, sagt gar nichts, spendiert den Ouzo mit melancholischer Miene. Auch er lebt seit dreißig Jahren in Berlin, hat sich hoch gearbeitet, sein Deutsch ist besser als das der meisten Deutschen. In seiner Taverne verkehren angenehme Menschen. Die ersten zwanzig Jahre lebte er auf der Insel Kythera, seiner Heimat. Am Ende des Abends umarmt er mich, weinend. Er liebt uns beide, Solvejg mehr als mich.
Mein Blick schweift durchs Wageninnere. Auf den Rücksitzen stehen die Arbeitsgeräte Computer und Drucker, auch der alte feiste Fernseher, alles dick eingepackt in Decken. In den Fußraum vor dem Beifahrersitz habe ich mit Mühe und Not meine Gitarre gezwängt, vor langer Zeit auf dem Berliner Flohmarkt von einem vor Trennungsschmerz weinenden jungen Türken gekauft, ich streiche mit den Fingern über die Saiten, sie sind leicht verstimmt. Schon taucht das letzte Zeichen Berlins auf, die Grunewaldtankstelle, dann noch der zum Erinnerungsraum gewordene Ort, an dem die Grenzstation Dreilinden stand, Nadelöhr oft, durch das man sich winden musste, um die Transitstrecke zu erreichen, das Weite zu suchen. Jetzt habe ich die Stadt hinter mir gelassen, bin nur noch inmitten von Landschaft und Aufbruch.
Kapitel 2 – Ankunft in Elsterbach
Elsterbach, Karfreitagnachmittag
Die Autobahn, eine mit jedem Kilometer wachsende Betäubung und rasende Bewusstlosigkeit, liegt hinter mir. Der Tag ist schön geworden, selten habe ich eine so warme und sonnenreiche Aprilwoche erlebt. Am frühen Nachmittag fahre ich durch ein verschlafenes Birkenfeld. Das ist keine Waldgegend, wo Birken wachsen, sondern der Name der pfälzischen Kreisstadt dicht an der Nordostgrenze zum Saarland.
Als ich mich hinter Birkenfeld der alten Heimat nähere, liegt jenes weißgelb gleißende verheißungsvolle Licht über der Landschaft, das ich epiphanisch nenne. Ich sah es einst vor langer Zeit auf meiner Fahrt von Berlin nach Schloss Wiepersdorf zu Achim und Bettine von Arnim; heute erscheint es mir nicht über der waldarmen und eintönigen Hochebene des Fläming, sondern über den waldreichen, sanften und fruchtbaren Hügeln und Tälern des nördlichen Saarlands. Damals war ich unendlich stadtmüde, und die Landschaft selbst war mir die Verheißung, das Panorama auf Sichtbares und Unsichtbares, Tagwelt und Nachtwelt, die Aussicht, für einige Monate die Juckreize und Fratzen der Stadt los zu sein.
Heute, mich meiner alten Heimat nähernd, ist es anders. Zwar bin ich auch jetzt unendlich stadtmüde, aber anders als damals werde ich nicht wieder nach einigen Monaten in die Stadt zurückkehren müssen, sie liegt endgültig hinter mir, nicht nur Berlin, sondern jede Stadt. So verbindet sich nun mit diesem epiphanischen Licht eine ebenso epiphanische Musik, und in mir erklingt die schwermütige Sehnsucht von Edvard Griegs Suite Morgenstimmung aus der Oper Peer Gynt, die sich wie ein Klangschleier von innen nach außen über die Landschaft breitet, so dass ich minutenlang nicht durch die Landschaft fahre, sondern schwebe. Es ist ein langsamer, traumverlorener, verheißungsvoller Tanz.
»Schön, dass du da bist.« Als ich nach Solvejgs Tod zum ersten Mal nach langen Jahren der Abwesenheit wieder in die Heimat kam, um auf Wohnungssuche zu gehen, und mit dem Erreichen der Landesgrenze zum Saarland am Rand der Autobahn diesen Satz auf einem Schild las, war ich tief berührt von diesem »du« und diesem »da«, diesem Satz, in dem ich die nur leicht abgewandelte Formel des Augustinus wiederfand, die der Kernsatz aller Liebe ist.
Jetzt, traumwandelnd entlang der Nahe, die sich durch die Täler windet, erinnere ich mich wieder an diesen ersten Gruß der Heimat.
Und hoffnungsvoll schlechte Straßen gibt es, bucklig, krumm, hundertmal geflickt, an den Rändern oft wüst. Ich begrüße sie als Zeichen für die schöne Zurückgebliebenheit des Landes.
Das wird sich nun leider schon bald als gründliche Täuschung erweisen, als Zeichen für starken Verkehr und wenig Geld in der Landeskasse.
Die Straße folgt der Nahe flussaufwärts. Einen richtigen Fluss kann man sie hier kaum nennen, diese Nahe, lateinisch »nava«, ursprünglich keltisch Wilder Fluss, auch wild ist sie nicht, selbst wenn sie hin und wieder über Geröllbänke stolpert und strudelt und in kleinen Kaskaden anmutig von Fels zu Fels springt. Ja, die Römer waren schon hier, diese Weltbeherrscher, wie überall im Saarland, sie trafen auf die Kelten, lateinisch »celtae« und »galli«, griechisch »Κέλτοι« und »Γαλάται«, »die Tapferen, Edlen«, jene »unverständigen« Galater, an die der Apostel Paulus seinen Mahnbrief schrieb, in dem er der dortigen Frühchristengemeinde die Leviten las. Jene Galater hausten damals freilich in der nördlichen Türkei, hatten es wohl, Vagabunden wie ich, irgendwo nicht mehr ausgehalten und waren auf Wanderschaft gegangen.
Ich fahre an Nohfelden vorbei, Sitz der Gemeinde, in deren Nähe mein neuer Wohnort liegt. Ein runder Burgturm, offensichtlich altehrwürdig, vielleicht der von Rapunzel, deren Name nichts anderes bedeutet als »Mausohrsalat«, ragt aus dem Häuserrinnsal hoch in den Himmel. Ein Dorf mit dem märchenhaft klingenden Namen Türkismühle erscheint, nichts Märchenhaftes, eher Trostloses bietet sich dem Blick des Durchfahrenden. Hier muss, falls Märchenhaftes vorhanden, tiefer geblickt werden.
Und schon bald bin ich in Elsterbach, sehe aus der Ferne das Haus, in dem ich nun wohnen werde, weiß, zweistöckig, etwas abseits (leider nicht abseits genug, wie sich zeigen wird) der Hauptstraße gelegen. Ich parke das Auto vor meiner Garage neben dem verbeulten und verschrammten Auto der beiden Mitbewohner im Hochparterre und steige aus. Ich bin angekommen.
Wie ich nun da stehe, auf wackligen Beinen und mit von der langen Fahrt vibrierenden Nerven, umgibt mich die fast gespenstische Stille eines Karfreitags im Dorf und die jähe Gewissheit, dass es grundfalsch war, so lange in Berlin geblieben zu sein. Nein, es war richtig, denn Solvejg wollte nicht weg von Berlin, und ich nicht weg von ihr.
Wieder verwandele ich mich in den alten türkischen Teppichhändler, als ich nun schwer beladen die Treppe hochgehe, die Haustür öffne und mit meiner Last die Stufen zum oberen Stock erklimme. Ich schließe die Tür zur Wohnung auf und stehe in einem dunklen, kalten Flur, in dem es nach abgestandener Luft riecht. Vor drei Wochen war ich hier, als die Möbel kamen, ein paar alte aus Berlin und neue aus einem hiesigen Geschäft, und ich eine Woche lang mit dem Einrichten der Wohnung beschäftigt war. Seitdem war niemand mehr in der Wohnung, in der alle Rollläden und Vorhänge geschlossen sind. Die Wärme der letzten Woche hat die Innenräume nicht erreicht.
In der Abstellkammer gleich rechts vom Flur werfe und stelle ich meine Last ab. Ich öffne die Tür links vom Flur, die in ein als Ess- und Arbeitszimmer eingerichtetes Zimmer führt, ziehe überall die Rollläden hoch, öffne die Balkontür. Licht perlt in den Raum. Vom Küchenfenster werfe ich einen flüchtigen Blick auf die Dorfstraße, die beiden hohen Tannen hinter der Doppelgarage, das Nachbarhaus, wo eine Bauernfamilie wohnt, die neben anderen Haustieren auch Pferde hält. Ich setze mich mit dem Gesicht zum Raum auf die gepolsterte, steinblaue Sitzecke mit dem verwelkten Charme der 60er Jahre an den Esstisch, auf dem eine bunte Tischdecke liegt (Handarbeit von Solvejgs Mutter) und ein blauer Glasaschenbecher steht. Ich fummele eine Zigarettenpackung aus der Jackentasche, rauche und lasse die Blicke schweifen.
Ich bin angekommen. Angekommen auch in einem neuen Daheim? Wer weiß. Oh ja, eine schöne Wohnung habe ich gefunden, bis jetzt die schönste meines Lebens in Deutschland, und in den letzten dreißig Jahren war keine meiner Wohnungen auch nur annähernd schön, diese hier ist es, und sie hat einen großen Balkon, eine Aussicht auf Häuser, Wiesen und Weideland, auf den sich hinter Buschwerk verbergenden und vereinzelt von Weiden und Birken gesäumten Elsterbach, ein Stück Elsterbachtal und den nahen Wald auf zwei Hügeln, die wie buschige Augenbrauen den Südwesten des Tals umschließen, alles nicht sehr weit vom Bostalsee.
Von den beiden Hausgenossen unter mir ist kein Laut zu hören, sie scheinen nicht da zu sein, Linda, die fünfundfünfzigjährige dünne, nervöse, immer gehetzt wirkende Altenpflegerin und ihr etwas jüngerer langhaariger Freund Jan, der als Computergraphiker arbeitet und in allem die Ruhe weg hat. Eins tiefer, die Treppe hinab in den Keller, in der kleinen Einliegerwohnung im Erdgeschoss, wohnt noch eine junge Frau, die im nahen Gestüt irgendetwas mit Pferden macht, die jetzt auch direkt vor meinen Augen auf der Wiese des benachbarten Bauern herumtollen und wiehern. Das Haus liegt günstig, in der Nähe einer Bäckerei, von zwei Hotelrestaurants, einer kleinen Autowerkstatt und einem recht guten Tante-Emma-Laden, also fast mitten im Dorf. Eine Bankfiliale gibt es auch.
Die Vermieterin ist keine Saarländerin, sondern eine im uralten großen Dorf Tholey gelandete Erfurterin von fünfundsechzig Jahren, eine hübsche, schon etwas abgekämpfte und dezent geschminkte Frau vom Marlene-Dietrich-Typ. Sie fährt ein wunderschönes nachtblaues Mercedes Coupé, in dem ich, wäre ich ein Auto-Erotiker, der dann zu erwartenden Träume wegen gern einige Nächte am Meer schlafen würde. Als ich den Mietvertrag mit ihr unterschrieb, hatte sie sich schon vorher über Google ein wenig über mich informiert und nur noch einen flüchtigen Blick auf die recht frei erfundene »Verdienstbescheinigung« meines Berliner Verlegers geworfen. Vermieterin und Mieter verstanden sich auf Anhieb gut, auch ihr jüngerer Bruder, Gauloises rauchend, gefällt mir. Der Bruder scheint die ältere Schwester in einer Art Hausmeisterfunktion zu unterstützen.
Leider ist die Wohnung teuer, nicht generell, nur für mich und meinen schlaffen Geldbeutel. Nun, Garage und Garten müssen mitbezahlt werden, die Wiese muss im Turnus gemäht, Bürgersteig und Rinnstein müssen gekehrt werden, die beiden Mülltonnen müssen vor dem Haus auf den Bürgersteig gestellt und im Winter muss Schnee geräumt und Salz gestreut werden, Pflichten, die ich in Berlin nicht hatte. Im Sommer, so sagten mir die Hausgenossen schon bei unserer ersten flüchtigen Begegnung, wird es wegen der Seebesucher auf der Straße vor dem Haus lebhaft, ja turbulent. Auch meine beiden Schwestern und Schwäger sind dann öfter hier, sie lieben den See und seine Umgebung.
Mein Magen knurrt. Ich krame eine Butterstulle aus einer Stofftasche, gehe hinaus auf den Balkon, dort ist es warm. Ich setze mich auf einen verschlissenen Campingstuhl und esse.
Zu allem Unglück geht meine Zahnprothese kaputt, die ich schon mit Ende Zwanzig bekam, als alle Zähne aus dem zystenverseuchten Oberkiefer entfernt werden mussten. Schlechte Erbmasse in Verbindung mit Mangelernährung und Naschhaftigkeit in der Kindheit, lautete die Diagnose des gleichaltrigen und mit mir befreundeten Assistenzarztes, dem damals ein zahntechnischer Geniestreich gelang. Aber das Alter pirscht sich nun nicht mehr nur an, es geht schon ganz frech auf mich zu. Als ich beim letzten Besuch im März die neue Wohnung einrichtete, hatte ich einige Male Zahnschmerzen und musste Aspirin nehmen. Das muss also auch bald in Angriff genommen und bezahlt werden. Ich bin nicht gerade als gemachter Mann oder gar Krösus in meine alte Heimat zurückgekehrt.
Aber von einer Heimkehr des verlorenen Sohnes kann auch wieder nicht geredet werden. Sicher, ähnlich wie der verlorene Sohn habe ich mein schmales Erbteil und einen großen Teil meines sauer verdienten Gelds in der Fremde durchgebracht. Oder doch eher verjubelt? Als es mir einmal so richtig dreckig ging, ich vor Armut nicht mehr ein noch aus wusste und die Sehnsucht nach einer Heimstätte wie ein Orkan durch meine Seele brauste, hatte ich eine selbstquälerische Bilanz meiner Weltenbummelei gezogen. Das Ergebnis stimmte mich nachdenklich. Hätte ich auf meine sturm- und drangvollen Welterfahrungen verzichtet und mich mit den üblichen Urlaubsreisen zufrieden gegeben (Pauschalreisen in einem Pauschalleben), säße ich jetzt, am Anfang meines Lebensabends, in meinem eigenen Heim am warmen Kaminfeuer und würde die Hauskatze streicheln. Ja, und dann würde ich im bequemen Sessel sitzen und mir auf einem großen flachen Bildschirm die unzähligen Schnappschüsse und Videos von meinen Pauschalreisen anschauen, nicht ahnend, dass ich, selbst zum Spuk geworden, nur Spukbilder sähe.
Nein, es ging und geht auch immer anders, ganz ohne Milchmädchenrechnungen. Was ich von meinem Leben in fremden Ländern mitbrachte, lässt sich weder in Gold noch in Backsteinen aufwiegen. Länder und Landschaften in immer wechselndem Licht, Meere, Küsten und Inseln, fremde, längst in mir einheimisch gewordene Sprachen, Freundschaften und Liebschaften, Träume und Albträume, die in einem sesshaften Berufsleben nie erschienen wären, Einsamkeiten, deren Finsternisse allein durch in mir selbst entzündete Lichter zu erhellen waren.
Und wenn ich jetzt am Anfang meines Lebensabends jeden Euro (wunderbarer Name für eine oft erträumte europäische Währung) umdrehe und in zwei bis drei Jahren zwei oder drei Bücher fertig habe, die ich nicht zuletzt deshalb schreiben kann, weil mein Vagabundenleben mir den Stoff dazu lieferte, dann wird es schon gehen. Ich bin mit der Zeit recht tüchtig im Armsein geworden. Ich habe sogar in der »Schule der Armen« studiert.
Armut in tätiger Muße: kann ich mir etwas Besseres wünschen und erträumen?
Nein, ich meine nicht das Elend, auch nicht die Lohnsklaverei der modernen Arbeitswelt. Ich meine auch nicht Askese, nicht einmal Verzicht. Der »Dame Armut« des heiligen Franz von Assisi bin ich nie begegnet. Die Armut, die ich erträume und wünsche, ist eine Lebensphilosophie, eine Lebensweise, keine asketische Übung. Eine Lebensweise im Einklang mit der Natur und Menschenwelt. Eine Lebensweise in Freiheit und Würde.
Diese Lebensweise ist meine Utopie vom nicht glücklichen, doch geglückten Leben.
Ich bin müde von der Fahrt und der schlaflosen letzten Nacht in Berlin. Ich erwäge, eine Siesta zu halten, entscheide mich aber für einen starken Kaffee. Ich will noch heute das Auto ausräumen und meinen Arbeitsplatz am Schreibtisch mit Blick auf mein Lieblingsgemälde von Solvejg und auf das Elsterbachtal jenseits meines Fensters einrichten. In den letzten Monaten kam ich kaum zur Arbeit, nun muss ich aus dem Abgrund, in den mich Solvejgs Leiden und Sterben stürzte, wieder hinausfinden.
So mache ich mich ans Ausräumen, fünfmal gehe ich die Treppen auf und ab, keuchend und schwitzend, dann ist das Auto leer.
Als erstes stelle ich in der Küche Solvejgs gute Kaffeemaschine auf. Meine eigene habe ich in Berlin einem noch ärmeren Hausbewohner überlassen, der noch manches Andere abstauben durfte. Ich mache Kaffee. Während ich darauf warte, dass das Wasser durchgelaufen ist, stelle ich Computer, Drucker, Scanner, Kopierer, die letzten drei in einem Gerät, und zwei Stereo-Lautsprecher auf den nussbraunen Schreibtisch und schließe die Geräte an. Der Kaffee ist fertig, ich trinke ihn schwarz und mit Zucker, rauche eine Zigarette und lasse den Schweiß trocknen. Danach räume ich die mitgebrachten Sachen aus und ein: Haushaltsgeräte, persönliche Dokumente, meine und Solvejgs Tagebücher (ein mächtiger Berg), und sehe gleich, dass ich den Rest meiner Bücher nirgends mehr unterbringe. Ich muss ein neues Regal aufbauen, das im Abstellraum bereitliegt. Das dauert, die Fertigbauweise samt kryptischer Anleitung macht mich fertig, und am Ende habe ich vom Eindrehen der Schrauben eine Blase an der Hand. Ich lecke an der brennenden Blase und lächele etwas blöde vor mich hin. Meine handwerklichen Fähigkeiten sind, milde gesagt, unterentwickelt.
Nach einigen Stunden ist alles getan und eingeräumt. Ich zünde mir eine verdiente Zigarette an und lese das über dem Telefon mit Stecknadeln an der Wand befestigte Poster, das mein alter Verleger Adrian aus München, der jetzt an einem bayrischen See seinen Lebensabend gestaltet, aus Anlass der Werkausgabe der Schriften von Rahel Levin herausgab und mir schenkte. Was dort zu lesen ist, will ich oft lesen, es soll mein Mantra in dieser neuen Wohnung sein:
»Dass man, als Unsinniger, sein Leben in Schmutz, Unsinn, Dürre, Sand und Wust, in wahnsinnigen Torheiten, hinrinnen lässt, nicht beachtend, dass kein Tropfen zweimal fließt, der Diebstahl an uns selbst geschieht und grässlicher Mord ist. Bloß weil wir ewig Approbation haben wollen, aus der wir uns nichts machen, und nicht tapfer genug sind, menschlich Antlitz nicht zu fürchten, und dreist zu sagen, was wir möchten, wünschen und begehren. Nichts ist heilig und wahr, und unmittelbare Gottesgabe, als echte Neigung; ewig aber wird die bekämpft, für anerkanntes Nichts. Das Fremdeste lassen wir uns aufbürden, und so kommen wir uns selbst abhanden. Ich selbst, wie selten ich bin, komme ich zu Sinnen!«
Ich stehe da, vor dem Poster und Rahels Sätzen, rauche und sinne. Nein, diese Sätze sind kein Mantra mehr, sondern schon Nostalgie, längst eingefleischte Erfahrung.
Als mein Blick tiefer zum Telefon wandert, fällt mir ein, dass ich meine Schwestern anrufen sollte. Ich wähle die Nummer, und meine dreizehn Jahre ältere Schwester Hanna ist am Apparat. Wir plaudern eine Weile, und am Ende werde ich zum Mittagessen am nächsten Tag eingeladen.
Es ist früher Abend, und ich bin hungrig. Wie immer nach langer Autofahrt brauche ich ein kräftiges warmes Essen, das meine Wohnung mir noch nicht bieten kann. Morgen gibt’s einen großen Einkauf, damit ich über die Osterfeiertage versorgt bin. Als ich mich auf den Weg zum nahen Gasthaus mache, laufe ich auf der Außentreppe meinen Hausgenossen in die Arme. Wir begrüßen uns, und um die beiden für den geduldig ertragenen Lärm beim Einrichten der Wohnung vor drei Wochen zu entschädigen, lade ich sie für den nächsten Abend zum Essen ein.
Auf dem kurzen Spaziergang durch den milden Abend lebe ich auf. Die Luft kommt mir abgasfrei und viel sauberer vor als die berühmte Berliner Luft, die zum Kotzen schlecht ist. Das wird meiner Lunge und meiner Literatur gut tun, denke ich und freue mich zum ersten Mal seit langem wieder auf meine Arbeit. Auch auf meine Wanderungen in dieser vom prickelnden Duft der Natur und nicht von der Pestilenz der Abgase erfüllten Luft. Ich gehe am großen alten Bauernhaus vorbei, in dem der Nachbar mit seiner Familie und seinen Tieren wohnt. Auch von dort wehen würzig-deftige Landaromen herüber. Zur Straßenseite liegt ein großer, wohlbestellter Nutz- und Blumengarten. Wäre nicht schlecht, hier zur richtigen Jahreszeit nachts über den Holzzaun zu flanken und mich mit frischem Gemüse und Salat einzudecken. Oder wäre das doch schlecht? Oh ja, denn um Mundraub würde es sich hier wohl nicht handeln. Noch ein paar ältere Häuser, alle im vertrauten bäuerlich schlichten Baustil der Heimat errichtet, dann stehe ich vor dem Gasthaus, einem langgestreckten, dreistöckigen Gebäude, das früher wohl ein großer Gutshof war. Ich gehe einige Stufen hoch, öffne die breite gläserne Doppeltür und betrete das Gasthaus Baldend.
Eine hochgewachsene, stattliche Frau von etwa sechzig Jahren steht hinter einem langen Holztresen vor ihren Zapfhähnen wie ein Steuermann an seinem Steuerrad und begrüßt den Eintretenden mit nichts als Freundlichkeit. Ich grüße zurück, werfe einen Blick nach rechts und links und sage der Wirtin, ich wolle gern was essen. Nichts leichter als das, lacht sie, und weist mich in den rechterhand liegenden Flügel, wo an der holzgetäfelten Wand und in einem geräumigen Erker mit Blick nach draußen viele Tische gedeckt, aber nicht besetzt sind. Ich nehme in einer Sitzecke an der Wand Platz. Über mir hängen die gerahmten Konterfeis längst totfotografierter Matadore der politischen Arena, die sich hier auf Kosten des Steuerzahlers den Magen füllten. Linkerhand läuft der Tresen durch den anderen Flügel, wo auf Barhockern einige Männer sitzen, die sich die Hälse nach dem fremden Gast verrenken. An diesem Karfreitag scheint nicht viel los zu sein.
Die Wirtin kommt und fragt in einem wohl eigens für den offensichtlich Fremden parat gehaltenen Hochdeutsch mit Mundart-Striemen nach meinen Wünschen. Ich bitte um die Speisekarte, frage nach trockenem Rotwein. Es gibt nur zwei Sorten, Côte du Rhône und Bordeaux. Ich bestelle auf gut Glück einen Schoppen Bordeaux. Nicht ganz auf gut Glück, denn bei dem Wort Bordeaux sehe ich immer die mir wohlbekannte schöne Stadt am Atlantik vor mir, bei Côte du Rhône nur überschwemmtes Land. Die Kellnerin geht, und ich lausche dem Stimmengewirr, das von der Bar zu mir herüberschallt. Dort redet keiner Hochdeutsch mit Striemen, breiteste nordsaarländische Mundart ist da am Werk, ein wieselflinkes Geschnatter, einst so vertraut gewesen, jetzt so fremd geworden. Die Wirtin bringt den Wein und die Speisekarte. Zur Feier meiner Ankunft bestelle ich ein recht teures Pfeffersteak. Ich probiere den Wein, der mit etwas gutem Willen trinkbar ist, aber mehr kostet als eine ganze Flasche von meinen bevorzugten Tischweinen. Na gut, das ist hier keine Weingegend, und wenn doch eine, dann für Weißweine der Saar, Nahe, Mosel, man trinkt Bier, mit Vorliebe hiesiges, Karlsberg zum Beispiel. Mir ist der Geschmack an Bier längst vergangen, keine Ahnung warum, früher habe ich gern und viel (auch zuviel) Bier getrunken. Vielleicht hat die Chemie (oder gar Magie?) des Weins die Chemie (oder Magie?) des Biers aus meinen Blutbahnen verbannt.
Ich trinke den säuerlichen Wein und gerate ins Sinnen. Ich würde gern eine Zigarette rauchen, aber den Politik treibenden Aposteln, die ein Höchstes Wesen namens Gesundheit anbeten, ohne allzu viel Ahnung von einem Höchsten Wesen oder auch nur ihrem Fetisch Gesundheit zu haben, fiel es ein, das Rauchen in Restaurants zu verbieten. Auf den Zigarettenpackungen stehen schon seit langem Sprüche wie »Raucher sterben früher«, auch will die bürokratische Riesenkrake in Brüssel Schockbilder von Raucherlungen, zerstörten Zähnen, von Gangräne zerfressenen Raucherbeinen und noch andere besorgte Liebesgrüße unserer Gesundheitswächter auf die Packungen drucken, Schockbilder also, die den Raucher nicht als Kranken ansprechen, sondern als (hohe Steuern zahlenden) Kriminellen brandmarken und das Fürchten lehren sollen. Warum aber steht auf tausenden von Waren, zum Beispiel auf Wurstwaren, nicht: »Wurstesser sterben früher« oder gar »Fleischesser sind Kannibalen«? Denn kann der Verzehr von unter Folterbedingungen gehaltenen und getöteten beseelten Mitgeschöpfen beim Jüngsten Gericht nicht Anstoß erregen und zum Anklagepunkt werden? Nun ja, an das Jüngste Gericht glauben die Kapitalistenknechte ohnehin nicht mehr, es sei denn an das, das sie selbst anzetteln. Oder warum steht auf Schnapsflaschen nicht »Schnapstrinken endet im Leberversagen«? Und müsste man nicht auch noch auf die im Supermarkt käuflichen, fett und krank machenden Waren schöne aussagekräftige Schreckensbilder von Fettsüchtigen, Diabetikern, Alzheimerkranken und Komaleichen kleben? Und warum dürfen, während Tabakwerbung längst aus allen Medien verbannt ist, in TV-Werbespots sympathische Väter oder Mütter ihre sympathischen Kinder mit Würstchen aus der Blechdose vergiften? Oder warum dürfen bei jeder Werbeunterbrechung von ausgelassen lachenden Menschen zum Wohl erhobene schäumende Biergläser gezeigt und von verführerisch raunenden Stimmen der letzte Schnapsfusel so oft angepriesen werden, dass, folgte man den Verführerstimmen, am Ende eines Fernsehabends Abermillionen Deutsche im Koma lägen?
Andererseits können Gesetze, die schlechte Gewohnheiten bekämpfen, doch nur gute Gesetze sein, oder nicht? Das wird sich wohl erst zeigen müssen. Jedenfalls waren die Vorschriften und Maßnahmen zur Bekämpfung der verteufelten Selbstbefleckung, unter denen ganze Generationen zu leiden hatten, alles andere als gut. Was soll dann erst aus einem Gesundheitsideal werden, das sich aus Unglauben, Aberglauben, Unwissen und Lebensangst speist?
Dass Solvejg eine Biertrinkerin war, hat mir immer zu denken gegeben. Solvejgs Wesen brauchte ein Getränk, das sie hinunterstürzen und in größeren Mengen trinken konnte. Nicht umsonst habe ich sie, die gebürtige Hamburgerin, manchmal mit dem Namen Störtebecker geneckt. Ihr dahinstürzendes Wesen im Rausch war mir manchmal etwas peinlich, dann wieder war es voller Anmut und Zauber. Später, als ich mehr von ihrer Eigenart sah, liebte ich gerade dieses dahinstürzende Wesen.
Und meine eigenen Drogen? Ja, da gibt es etliche. Aber ich weiß über bewußtseinsverändernde Drogen gut Bescheid und nenne sie nicht Drogen, sondern Dschinns. Das Wort Dschinn, das jeder Leser der Märchen aus Tausendundeiner Nacht kennt, ist arabischen Ursprungs und bedeutet so viel wie Geist oder Dämon. Dschinns sind also keine chemische Substanzen, sondern Wesen, mit denen man wie mit allen Wesen ins Gespräch kommen kann – oder auch nicht. Siehe Goethes »Die Geister, die ich rief …« in seinem Gedicht Der Zauberlehrling. Erster schwerer Fehler der falschen Aufklärung über Drogen: entweder hat sie keine Ahnung von dieser ganz neue Erkenntniswege weisenden Gesprächsdimension oder sie verleugnet sie. Was Eltern oder Lehrer heute ihren Kindern oder Schülern über die Gefahr von Drogen erzählen, sind Ammenmärchen, die mich fatal an die pädagogische Schein-Aufklärung über die »Selbstbefleckung« erinnern. Und wenn jemand es damals gewagt hätte, sich als schwul zu outen, dann wäre er ganz gewiss kurzerhand von Gottes Blitzschlag in tausend Atome gesprengt worden. Solange eine Gesellschaft keine Ahnung hat oder haben will von ihren eigenen Tabus und blinden Flecken, kann sie immer nur Falsches wissen und falsches Wissen mitteilen.
Mindestens drei Dschinns habe ich in meinem Leben nacheinander aus ihrer Flasche befreit: mit dreizehn Jahren, ausgerechnet im Kloster, im Missionshaus bei Sankt Wendel, den Alkohol-Dschinn. Auch »Alkohol« ist ein arabisches Wort, dessen Bedeutung darauf hinweist, dass die Araber vor vielen Jahrhunderten schon mehr wussten als heute mancher Medizinprofessor. Denn Alkohol ist keine chemische Substanz, sondern ein Geist – wie in dem Wort Weingeist ja schon erkannt. Dieser Geist schenkte dem ganz unwissenden Jungen gar nichts, sondern brachte ihm als Viez nichts weiter als den Sinnenrausch des Augenblicks, einige glimpfliche Stürze auf dem Heimweg vom Alten Hof, dem Wirtschaftsbereich des Klosters, zum eigentlichen Kloster, ein paar saftige Ohrfeigen vom dicken apoplektischen Pater Jaus, selber ein begabter Pichler, und ein kotzübles Erwachen. Der gefürchtete Kater ist nichts anderes als missglückte Kommunikation, hervorgerufen durch Unwissen. Mit sechzehn Jahren, angeregt vom (ausnahmsweise eindeutig schlechten) Vorbild des Vaters, lernte ich den Tabak-Dschinn kennen. »Tabak« ist kein arabisches Wort, sondern stammt aus einer karibischen Indianersprache und bezeichnet nicht das bei fast allen Indianerstämmen als Heilpflanze bekannte Kraut, sondern das Rohr oder die Pfeife, mit der man den Geist dieser Heilpflanze in sich aufnimmt. Auch hier ist das Wissen der Naturvölker dem Wissen unseres hypothetischen Medizinprofessors weit voraus, haben sie doch die Natur selbst erforscht und nicht Naturwissenschaften aus dicken Folianten studiert. Dieser Pflanzengeist schenkte dem Sechzehnjährigen die konzentrierte Wahrnehmung und das schärfere Denkvermögen. Leider auch eine lebenslange Sucht. Zuletzt, mit zweiundzwanzig Jahren, zu Beginn meines Studiums in Saarbrücken, erschien der Haschisch-Marihuana-LSD-Dschinn. Über diese Troika oder irdische Dreifaltigkeit ließen sich Bände schreiben und sind auch geschrieben worden, es reicht aber zu wissen, dass, außer beim rein chemischen Produkt LSD, wieder ein Pflanzen-Geist am Werk ist, die Hanfpflanze, über die vor rund tausend Jahren die hochgelehrte Nonne Hildegard von Bingen mehr wusste als unser allmählich zum Gespött und förmlichen Windbeutel werdende Professor.
So viel oder so wenig zum Stand unseres modernen, allen andern Zeiten und Kulturen zweifelsfrei überlegenen Wissens. Dieser dreiköpfige Dschinn schenkte dem jungen Mann die Gabe der Versenkung und des Reisens in andere Welten. Er schenkte auch die Herrschaft über die Zeit, mehr: das Mittel, sie aufzuheben. Und er öffnete ihm Augen und Sinne für eine magische Sicht der Welt. Diese magische Sicht blieb auch nach dem Rausch als neue Erfahrung dauerhaft bestehen. Dieser Dschinn weihte mich ein in eine neue Art, die Welt zu sehen.
Alle Dschinns haben für diese Geschenke ihren Zoll gefordert.
Aber da ich im Lauf der Jahre immer besser verstand, dass ich es nicht mit irgendwelchen Drogen oder chemischen Substanzen, sondern mit lebendigen Wesen zu tun hatte, die mir bereitwillig ihre lichten und dunklen Seiten offenbarten, waren es gute Dschinns, keine Dämonen. Doch, natürlich waren es auch Dämonen, sokratische und faustische. Welcher Mensch kommt ohne Dämonen aus? Wer von denen, die das »Erkenne dich selbst« Apollons in sich erfahren haben, hat sich an seinen Dämonen vorbeigestohlen?
Und wie jeder Erkenntnissuchende musste auch ich durch die lange, dunkle, dämonenerfüllte Nacht des Unwissens gehen.
Das Pfeffersteak kommt, dazu gibt es leider keine Salzkartoffeln, die immer mehr von der Speisekarte verschwinden, sondern mit irgendeinem Brei gefüllte Kroketten und Salat. Bis auf die Kroketten schmeckt alles gut, der Preis ist angemessen, freilich nicht meinen finanziellen Verhältnissen. Während ich esse, versuche ich mich in die Wortmelodien einzuhören, die von den Barhockern herüberwehen.
Als ich Gabel und Messer weglege und aufschaue, steht, mit Schlagseite und schwankend wie ein Maibaum im Frühlingswind, ein blonder Mann um die Dreißig vor mir. Oh ja, das kenne ich von Berlin, aber anders als dort gibt es hier und jetzt kein leichtes Ausweichen. Und dieser junge Mann hat sich zum Abgesandten gemacht oder machen lassen, weil ein Dschinn ihm half, über seinen eigenen Schatten zu springen.
»Darf ich dich mal was fragen?« Seine Aussprache ist kaum beeinträchtigt und sein Zungenschlag fast hochdeutsch. Aber gleich hinein ins vertrauliche Du, das höflich distanzierte Sie hätte vielleicht seine Artikulationsfähigkeiten überfordert.
»Was denn?«
»Wir haben uns da drüben gesagt, dass du hier fremd bist, und uns gefragt, wo du herkommst. Du bist doch kein Saarländer, oder?«
»Doch«, sage ich und lächele, »ich bin Saarländer.«
Der Mann stutzt, eine Weile hat die Antwort ihm die Sprache verschlagen und ihn aus dem Konzept gebracht.
»Echt? Ehrlich? Wo kommst du denn her?« Liegt da nicht eine leichte Enttäuschung in Stimme und Miene?
»Nicht weit von hier, aus Grüneiche, gleich um die Ecke.«
Der Mann ist schon wieder sprachlos. Ich will ihn nicht weiter zappeln lassen und sage:
»Ich habe dreißig Jahre lang in Berlin und im Ausland gelebt, geboren bin ich aber hier im Saarland. Und jetzt bin ich wieder ins Saarland gezogen.«
Der Mann ist erleichtert. »Ei dachte ich mir’s doch, dass du nicht einheimisch bist. Und wo wohnst du jetzt?«
»Hier in Elsterbach. Gerade heute bin ich aus Berlin gekommen.«
Der Mann lacht, ja, er freut sich, strahlt, so einen Gast trifft er nicht alle Tage, erst recht nicht an einem toten Karfreitagabend. Er schaut über die Schulter zu seinen Zechgenossen am Tresen. Ich sehe es seinem Gesicht an, was er denkt.
»Darf ich dich zu einem Getränk an der Bar einladen?«
Na gut, ich wollte ohnehin gerade noch den zweiten Rotwein, den Côte du Rhône, probieren, warum nicht bei den Leuten an der Bar?
Wir gehen zur Bar. Da sitzen auf den Hockern noch zwei Männer, der eine im mittleren, der andere im etwas fortgeschrittenen Alter. Sie drehen sich erwartungsvoll zu mir um, grüßen freundlich. Ihre Neugier ist noch größer als ihre Freundlichkeit.
Der Mann, der mich ansprach, klettert recht mühsam auf einen Hocker. Ich greife mir einen andern und setze mich dazu. Hinter dem Tresen steht das stolze Weib mit erwartungsvoller Miene.
»Was willst du trinken?«, fragt der erste Mann.
»Einen Rotwein, wenn’s recht ist.«
»Dasselbe wie vorhin?«, fragt die Wirtin.
»Nein, ich möchte jetzt mal den Côte du Rhône probieren.«
»Hat der Bordeaux nicht geschmeckt?«
»Doch, doch, ich bin bloß neugierig auf den andern Wein.« Eine gute Notlüge ist oft besser als eine schlechte Wahrheit.
Die Wirtin ist zufrieden, nimmt eine Flasche aus dem Regal, gießt Wein in einen kleinen Krug, stellt Glas und Krug vor mich, gießt ein. »Zum Wohlsein!«
Oh ja, zum Wohlsein! Ich hebe mein Glas und proste allen Anwesenden zu. Alle heben ihre Biergläser und prosten mir zu.
Nun zeigt sich saarländisch-dörfliche Lebensart.
Der angetrunkene Mann um die Dreißig streckt mir die Hand hin: »Ich heiße Paul.«
Ich schüttele die Hand: »Ich heiße Anders.«
So geht es reihum. Der Mann in mittleren Jahren hat schwarze Haare und ein scharfgeschnittenes, von tiefen Furchen gezeichnetes Gesicht und heißt Jakob, der ältere Mann mit silbergrauen Haaren und gepflegtem Bart heißt Franz. Die Wirtin, blond, aber wohl nicht mehr in Natur, heißt Christine.
Man fragt mich ein wenig aus, fühlt mir auf den Zahn. Einhellige Ungläubigkeit herrscht darüber, dass ich das tolle Berlin gegen das mickrige Kaff eingetauscht habe, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen. Als ich mehr erzähle, von den dreißig Jahren in Berlin, meiner Stadtmüdigkeit, meiner Sehnsucht nach Dorf und Natur, von Solvejgs Tod, wächst das Verstehen. Man scheint sich jetzt zu freuen über einen so leidenschaftlichen Liebhaber des Dorf- und Landlebens.
»Und was machst du so beruflich?«, fragt Paul. Für diese Frage scheint er die ganze Zeit auf der Lauer gelegen zu haben, womöglich hat er mit den andern sogar eine Wette abgeschlossen.
»Ich schreibe Bücher.«
Paul klatscht in die Hände, dreht sich zu den beiden anderen Männern um und wirft ihnen einen triumphierenden Blick zu:
»Dachte ich mir’s doch, dass du irgendwas mit Kunst machst.«
»Und was macht ihr?«
»Ich bin Schuhmacher«, sagt Paul. »Spezialschuhe. Maßarbeit.«
Paul, der Schuh-Macher, und Anders, der Buch-Macher, stellen fest, dass es ihnen beiden in gewisser Weise ähnlich geht: niemand will mehr für einen guten Schuh, in dem man sich nicht die Füße ruiniert oder durch Schadstoffe vergiftet, einen redlichen Preis zahlen. Niemand will mehr für ein gutes Buch, in dem es um mehr als Sex & Crime geht, einen redlichen Preis zahlen.