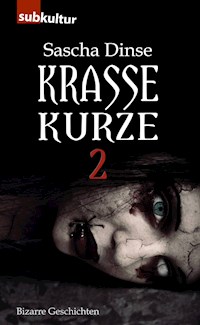9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition subkultur
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hinter der Kulisse der Wirklichkeit verbirgt sich Düsteres, Bedrohliches, Unvorstellbares. Parallelwelten kreuzen sich mit der unseren, verschmelzen mit ihr unheilvoll und unbemerkt. Es gibt kein Entkommen, denn sie sind immer da: die Ratten, die das Fundament der Welt erbauen, die lauernden Rehe, die sorgsam webenden Spinnen, die Wesen aus dem Dazwischen. Ist es wissenschaftliche Hybris, die die Protagonisten in den Abgrund treibt? Sind es übernatürliche Kräfte? Oder ist es gar der eigene Verstand … Stets schleicht sich das Gefühl, dass die Dinge nicht so sind, wie sie anfangs scheinen, von hinten an. Sascha Dinse ist ein Meister des subtilen Horrors und fordert in seinen elf Erzählungen dazu auf, den bereits bröckelnden Putz von der Fassade der Realität zu schlagen und den Blick dahinter zu wagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
edition.subkultur.de
Sascha Dinse
Sascha Dinse schreibt und lebt in Berlin. Vielleicht spielt ja deshalb in seinen unvergleichlichen Geschichten oft der Moloch Großstadt eine Hauptrolle. Ein ums andere Mal erwacht das Grauen aus dem Alltäglichen, schleicht sich von hinten an und zeigt zunächst ein freundliches Gesicht. Doch schon im nächsten Augenblick zieht es dem Protagonisten den Boden der vertrauten Wirklichkeit unter den Füßen weg, lässt ihn hilflos am Rand des Abgrunds taumeln, wankend, nur eine Handbreit von der Hölle entfernt. Ob sie von urbanen Schrecken, Visionen einer düsteren Zukunft oder dem Wahnsinn der Gegenwart handeln – Dinses Geschichten sind stets gespickt mit philosophischen und surrealen Elementen, bösen Twists und doppelten Böden.
Sascha Dinse hat Kurzgeschichten in diversen Anthologien veröffentlicht. Im Herbst 2018 erschien seine Geschichtensammlung »Aus finstrem Traum« bei p.machinery, im Frühjahr 2019 folgte der erste Sammelband »Krasse Kurze « im Selbstverlag.
Die »Kurzen« haben mittlerweile als Neuauflage den Weg in die Edition Subkultur gefunden, wo Ende 2020 auch der Nachfolger „Krasse Kurze 2“ das Licht der Welt erblickt hat.
Sascha Dinse
ELYSION
&
TARTAROS
Erzählungen
edition.subkultur.de
SASCHA DINSE: „Elysion & Tartaros – Erzählungen“ 1. Auflage, Oktober 2022, Edition Subkultur Berlin
© 2022 Periplaneta - Verlag und Medien / Edition Subkultur
Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin
subkultur.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden.
Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig
und im Falle dieses Buches auch ziemlich schlimm.
Korrektorat: Marion Alexa Müller Coverkonzept und Tiergrafiken: Farina Fröde (farina-froede.com) Satz & Layout: Thomas Manegold
Gedruckt und gebunden in Deutschland Gedruckt auf FSC- und PEFC-zertifiziertem Werkdruckpapier
print ISBN: 978-3-948949-20-4 epub ISBN: 978-3-948949-21-1
Mise en abyme
Unter meinen Sohlen klebt der Dreck der Stadt. Mit jedem Schritt bleibt irgendetwas Neues haften, etwas anderes fällt ab. Während ich auf dem Nachhauseweg bin, nach einem dieser Tage, die sich anfühlen, als wären sie nicht mehr als eine uninspirierte Kopie eines echten, wertvollen Tages, denke ich darüber nach, wie lange es wohl dauern mag, bis die Menschen in der Stadt den Dreck von ihrer einen Seite bis zur anderen getragen haben. Mehr als drei Millionen Menschen mit doppelt so vielen Millionen Füßen – diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen weniger als zwei Beine haben, mal außen vor gelassen. Vermutlich ist die Schmutztransferquote bei denen geringer, aber sie stellen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung, daher lasse ich sie aus meiner Rechnung raus. Wie lange würde es dauern, wenn jeder Mensch in der Stadt am Tag ein paar hundert Meter zu Fuß zurücklegt? Die Rechnung wird dadurch komplizierter, dass ich ja auch das Zurücktragen von Dreck einkalkulieren muss. Wenn jemand hin und her läuft, ist die Wahrscheinlichkeit nicht null, dass er den Dreck, den er hergebracht hat, auch wieder mit zurück nimmt. Und was ist mit Fahrradfahrern? Oder Autos? Der Straßenreinigung? Regen?
Ich biege um die Ecke, schlängle mich an menschlichem Gegenverkehr vorbei, unter dem Baugerüst entlang, das seit Monaten das Nachbarhaus umspannt wie die Klauen irgendeines mechanischen Biestes. Unmittelbar vor mir huscht eine Ratte über den Gehweg. Sie schießt aus einer Lücke im Mauerwerk des eingerüsteten Hauses hervor und verschwindet nur Augenblicke später in einem Gully am Rand der Straße.
Ich mag Ratten. Sie sind der Beweis dafür, dass es möglich ist, sich an ein Leben in der Stadt anzupassen. Das motiviert mich, nicht einfach aufzugeben, sondern zu versuchen, es irgendwie hinzubekommen, das Leben als erstrebenswert anzusehen. Ich bleibe stehen, schaue zu der Öffnung, aus der die Ratte kam und frage mich, was sie dahinter wohl gemacht hat. Welche Art von Beute lässt sich in einem entkernten Haus finden? Oder war es reine Neugier? Wäre ich eine Ratte, würde ich nachsehen. Doch so, mit einem Stoffbeutel voller Einkäufe, schwitzend und erschöpft von einem weiteren Arbeitstag, gehe ich einfach weiter. Mir fällt einmal mehr auf, dass, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit ich unter dem Gerüst entlanggehe, dort niemals irgendein Arbeiter zu sehen ist. Dennoch gehen die Arbeiten voran, manchmal liegt Schutt vor dem Gebäude, manchmal irgendwelche Bauteile, dann wieder sind plötzlich Teile der Fassade neu gestrichen. All das scheint in einer phasenverschobenen Paralleldimension zu geschehen, denn ich habe nicht ein einziges Mal irgendjemanden hier arbeiten sehen. Genauso gut könnten es die Ratten sein, die das Gebäude instandsetzen. Von denen sehe ich wenigstens ab und an welche.
Das Licht der Nachmittagssonne blendet mich, noch dazu wirft der Häuserblock ihre unbarmherzige Hitze auf mich zurück. Die letzten Tage waren beinahe unerträglich, und doch habe ich es fertiggebracht, als halbwegs normaler Mensch durchzugehen. Vor der Haustür fische ich den Schlüssel aus der Hosentasche, schließe mit einer Hand auf und flüchte mich vor Lärm und Glut in den kühlen Hausflur.
Ich schalte den Rechner aus, danach die Schreibtischlampe, gehe zur Balkontür und lasse den Blick über die nächtliche Stadt schweifen. Im Lichtschein der Straßenlaterne direkt gegenüber wimmelt es von Insekten, die einander zu jagen scheinen. Der Wirbel aus fliegendem Getier hält meinen Blick sekundenlang gefangen und mit jedem Atemzug scheint es, als würde er dichter, greifbarer, plastischer. Ich spüre Unwohlsein in mir aufkeimen, und ich weiß nicht, ob es an den erratischen Bewegungen der winzigen Tiere liegt oder an dem, was langsam dort entsteht, wohin ich sehe. Das flaue Gefühl im Magen wächst sich aus zu Übelkeit, doch ich halte stand, unbeirrbar auf diese Stelle schauend, an der die Realität gerinnt.
Die Ratte von vorhin kommt mir wieder in den Sinn. Vor meinem inneren Auge sehe ich, wie sie vor mir über den Gehweg huscht, kurz innehält, mich ansieht und … den Kopf schüttelt. Dieses Bild bricht meine Konzentration, lässt mich die Augen abwenden, nur Sekunden, bevor der Würgereiz dazu führen würde, dass ich mich über die Brüstung des Balkons übergebe.
Von Schwindel erfüllt, schleppe ich mich zurück ins Zimmer, taumle durch den dunklen Raum, suche den Weg ins Bad und benetze mein Gesicht mit Wasser. Was immer da gerade passiert ist, lässt mich am ganzen Leib zittern. Ich lege mich ins Bett und ziehe die Decke über meinen Kopf. Aus der Wohnung unter mir dringen kratzende Geräusche durch den Boden. Verschiebt jemand Möbel mitten in der Nacht? Wundern würde es mich nicht. Die Menschen scheinen mit jedem Tag seltsamer zu werden.
Am nächsten Morgen, nach einer Nacht traumlosen Schlafes, erwache ich zum Geräusch schwerer Hammerschläge. Sie kommen aus der Wohnung unter mir. Es klingt, als risse jemand eine Wand ein.
Zwanzig Minuten später, noch vor Sonnenaufgang, mache ich mich auf den Weg. Ich bleibe kurz an der Tür der Wohnung unter meiner stehen. Keine Geräusche mehr. Es ist totenstill. Ich schiebe den Briefschlitz auf und spähe hinein. Nichts. Minuten vorher noch klang es, als würde dort schweres Gerät eingesetzt, doch jetzt ist nichts mehr davon zu hören. Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Beim Runterlaufen zähle ich wie jeden Morgen die Treppenstufen auf jeder Etage. Verwirrt bleibe ich am Fuß des letzten Absatzes stehen. Sollten es nicht elf Stufen sein? Ich drehe mich um und zähle nach. Zehn. Sehr merkwürdig. Ich könnte schwören, dass es gestern noch eine mehr war.
Draußen empfängt mich die vertraute Mischung aus Lärm von Tausenden Autos und dem typischen Geruch der Großstadt, einer Melange aus Abgasen, Urin und dem fauligen Aroma verrottenden Mülls. Menschen strömen mir entgegen. Sie sehen aus, als hätten sie seit Tagen nicht geschlafen, ihre Augen sind glasig, die Pupillen geweitet. Ich dränge mich an ihnen vorbei, erreiche das Baugerüst am Gebäude um die Ecke und halte Ausschau nach der Ratte von gestern. Natürlich ist sie nicht da. Ich lächle ob meiner Annahme, dass das Tier hier auf mich warten würde. Trotzdem werfe ich einen Blick in das Loch in der Außenwand des Hauses, aus dem gestern mein pelziger Freund herausgekommen war. Es ist größer geworden. Ich hocke davor und bin sicher, dass es gestern nur wenige Zentimeter breit war, doch heute würde selbst ein Fußball hineinpassen. In diesem Augenblick fällt der erste Strahl der Morgensonne in die Öffnung vor mir. Wie ein Tunnel erstreckt sie sich weiter nach hinten, als sei sie nicht nur durch zerbröckeltes Mauerwerk entstanden, sondern absichtlich erschaffen worden. Ich nehme mir vor, in den nächsten Tagen darauf zu achten, ob das Loch weiter wächst.
Bis ich den Bahnhof erreiche, eintausendeinhundertsechsundfünfzig Schritte später, geht mir das Gebäude nicht aus dem Kopf. Ich muss an Recyclingpapier denken. Egal, wie sehr man sich anstrengt, seine Qualität zu verbessern, es wird nie wieder so weiß und perfekt sein wie das Original. Ist es mit Gebäuden ähnlich? Kann ein renoviertes Haus, dessen alte Wände eingerissen und durch neue ersetzt werden, je wieder dasselbe sein? Verkommt es nicht nach und nach lediglich zu einem Abbild seiner selbst, einer Erinnerung, vollgestopft mit Ersatzteilen, die nach außen den Anschein erwecken sollen, dass sich nichts geändert hätte? Vielleicht ist Verfall das Einzige, was von Bestand ist.
Das gleichmäßige Rütteln der Metro lässt mich einnicken. Obgleich ich nur ungern inmitten fremder Menschen schlafe, lässt sich mein Körper partout nicht dazu animieren, im Wachzustand zu bleiben. Ein ums andere Mal fallen mir die Augen zu und nur der Augenblick des Stillstands beim Erreichen einer Station lässt mich wieder aufwachen. So geht das mehr als eine Stunde lang. Gesprächsfetzen dringen an mein Ohr, wirres Geschwätz, Lachen, das eine oder andere undefinierbare Geräusch, dazwischen das vertraute Summen beim Schließen der Türen. Zusammengenommen ist das so etwas wie der Klang der Stadt, zumindest was ihre unterirdische Seite angeht, laut und hektisch, aber dennoch irgendwie angenehm. Etwas später, kurz bevor ich meine Station erreiche, hat mein Körper durch den Sekundenschlaf offenbar ausreichend Energie getankt, um wach bleiben zu können.
Ich frage mich, ob meine Müdigkeit daher rührt, dass mein Schlafrhythmus unregelmäßig ist, oder ob es irgendeine Art von Hypnose ist, die in der Metro auf mich wirkt. Regelmäßige Geräusche, gleichförmige Bewegungen, als säße man vor einem Metronom und starrte auf dessen Pendel, während der eigene Herzschlag sich dem Takt des Klickens anpasst.
Mir gegenüber sitzt ein Mann, sein Körper ist gegen die Seitenscheibe gesunken, er hat die Augen geschlossen. Vielleicht geht es ihm so wie mir wenige Minuten zuvor. Ich schaue ihn eine Weile lang an, studiere jede Einzelheit seines Gesichts genau, als hätte ich vor, später ein Porträt von ihm zu zeichnen. Plötzlich spüre ich wieder dieses flaue Gefühl im Magen, so wie auf dem Balkon.
»Sind Sie sicher, dass Sie das riskieren wollen?«, fragt jemand von links neben mir. Ich nehme die Worte wahr, beziehe sie aber nicht auf mich, sondern starre weiterhin den Mann gegenüber an. Seine Haut schimmert im künstlichen Licht der Metro wie Wachs. »Überlegen Sie es sich«, fährt die Stimme fort. »Wenn Sie diesen Schritt einmal getan haben, gibt es kein Zurück mehr. Insekten an einer Laterne sind das eine, aber das hier ist ein völlig anderes Niveau.« Irritiert wende ich die Augen von meinem Studienobjekt ab und schaue nach links. Die Bank ist leer. Auch auf der anderen Seite ist niemand zu sehen. Halluziniere ich?
Ein Klackern weckt mich aus meinem Dämmerschlaf. Ich schrecke aus dem Sessel hoch und schaue mich im Zimmer um. Habe ich ein Glas umgestoßen? Nichts zu sehen. Wieder klackert es. Das Geräusch kommt von draußen. Ich erhebe mich und trete hinaus auf den Balkon.
Ein nebliger Dunst liegt über der Stadt, so dicht und alles bedeckend, dass ich nur mit Mühe die Straße vor dem Haus erkennen kann. Irgendetwas bewegt sich da unten. Kleine Wesen huschen hin und her, dabei verursachen sie die seltsamen Geräusche, die klingen wie Metall, das auf Beton trifft. Ratten. Dutzende. Hunderte. Sie kommen aus allen Richtungen herbei, fließen wie ein Strom aus Fell und Fleisch in Richtung des Hochhauses auf der anderen Seite des Flusses. Der Nebel ist zu dicht, als dass ich irgendetwas Konkretes erkennen könnte. Erst jetzt fällt mir auf, dass nirgends Licht brennt, weder in den Gebäuden gegenüber noch irgendwo in meinem Haus.
Ich gehe wieder hinein und schalte eine der Lampen an. Ihr Lichtschein schneidet wie der gerichtete Strahl eines Leuchtturms durch den Dunst. Dort, wo gestern noch das Hochhaus stand, wuchert etwas aus dem Boden, einem gewaltigen Turm aus Fleisch gleichend, organisch, wabernd, lebendig. Tausende und Abertausende von kleinen, pelzigen Körpern winden sich auf seiner Oberfläche, verschlingen einander, bringen sich neu hervor und bilden Formen, die sofort wieder zerfallen. Das muss ein Traum sein, anders ist es nicht zu erklären. Der Nebel oder das, was ich dafür halte, kondensiert auf meiner Haut, bildet einen Film aus durchsichtigem Schleim.
Die Schnauze einer Ratte schiebt sich über die Brüstung des Balkons. Das Tier schaut mich an, fiept einmal und huscht an mir vorbei, bevor es verschwindet. Weitere folgen, sie klettern von unten hoch, laufen auf der Brüstung zu den Seiten und setzen ihren Weg nach oben fort. Wohin wollen sie? Auf das Dach? Ich schaue hinauf und sehe voller Entsetzen, dass die Ratten begonnen haben, die Substanz des Hauses abzutragen. Im gleichen Maße, wie sie nach oben strömen, fließt ein Strom von ihnen nach unten, und wie auch immer sie es bewerkstelligen, verschwindet über mir binnen Sekunden eine ganze Etage. Was wird geschehen, wenn sie mich erreichen?
Panisch haste ich zurück ins Zimmer, schlage die Tür zu, verriegle sie und schalte das Licht aus. Schon höre ich es von oben rascheln und knistern. Oh verdammt, sie fressen sich einfach durch das Mauerwerk! Das, was ich zuvor für eine Art kondensierten Dunst gehalten hatte, hat eine gummiartige Beschaffenheit angenommen. Ich stürze ins Bad, schließe die Tür und schalte das Licht über dem Waschbecken ein. Um Gottes Willen! Es ist neue Haut! Sie wächst über meinen Körper, wuchert, und breitet sich unter meiner Kleidung weiter aus. Ich sehe Poren, feine Härchen, Leberflecken. Vollkommen außer mir reiße ich daran, doch sengender Schmerz hält mich davon ab, mich dieses neuen Fleisches einfach wieder zu entledigen.
Nur Augenblicke später bin ich komplett von der neuen Haut umschlossen. Meine Fingernägel werden nach vorn geschoben, fallen ab, doch schon im nächsten Moment bilden sich neue und nehmen ihren Platz ein.
Währenddessen sind die Ratten durchgebrochen. Ich höre sie im Wohnzimmer, höre das Tippeln ihrer Füße und das Knirschen, als sie das fressen, was Minuten zuvor noch die Wirklichkeit war, während ich mich in die hinterste Ecke des Badezimmers zurückziehe. Kaum einen Atemzug später fliegt die Tür aus den Angeln. Ein Schwall von Ratten flutet mir entgegen, Hunderte pelzige Leiber ringen mich zu Boden. Mein Kopf schlägt gegen die Wand und alles wird dunkel.
Als ich wieder zu mir komme, spüre ich Zähne und Klauen, fühle, dass einige der Tiere sich in meinen Körper gegraben haben und darin herumkriechen. In meiner Brust bewegt sich etwas, im linken Arm schiebt sich unter der Haut ein Körper nach oben. Vor Entsetzen vergesse ich sogar zu schreien. Wer sollte mich auch hören? Ich schleudere die Tiere davon, setze mich, so gut ich kann, zur Wehr, doch es sind einfach zu viele. Dann, nach Augenblicken blanker Todesangst, dämmert mir, was hier geschieht. Eine Ratte schlüpft aus einem Loch in meinem Unterschenkel, ihr Fell ist blutverschmiert, und sie hat einen Klumpen Fleisch im Maul. Es sieht verdorben aus, schwarz und wuchernd. Ist das aus mir herausgekommen? Sieht es so in mir aus? Eine andere Ratte hüpft mir entgegen. Auch sie hat ihre Zähne in etwas geschlagen, doch es sieht bedeutend frischer aus. Sie verschwindet in derselben Öffnung und kehrt wenige Augenblicke später mit einem weiteren Klumpen verrotteten Materials zurück. Kann das wirklich sein? Erschaffen sie mich gerade neu? Tragen sie das faulige Fleisch hinfort und füllen mich stattdessen mit neuem? Bin ich wie ein Gebäude, dessen brüchige Wände ausgebessert werden?
Einen Atemzug später ist es vorüber. Ich stehe vor dem Spiegel im Badezimmer und betrachte mein Gesicht. Keine Spur von Ratten oder irgendwelchen Wunden an meinem Körper. Vorsichtig taste ich über meine Haut, suche nach Anzeichen dafür, dass irgendetwas daran neu oder anders ist, doch ich finde nichts. Auch das Wohnzimmer sieht unberührt aus. Ich trete ans Fenster und schaue über den Fluss zu dem Bürogebäude und den winzigen Quadraten, in denen Licht brennt, weil irgendjemand Überstunden macht.
Die Metro hält an meiner Station und ich verlasse den Waggon. Wie jeden Morgen ist der Bahnsteig leer, bis auf ein paar aufgewirbelte Papierfetzen bewegt sich nichts. Offenbar bin ich um diese Uhrzeit der Einzige, der hier aussteigt. Mir kam das nie seltsam vor, bis heute.
Mein Blick bleibt an einem der Stützpfeiler hängen. In ihm klafft ein Loch, dessen Durchmesser und Beschaffenheit mir bekannt vorkommen. Ich trete näher und schaue hinein. Auch wenn es völlig unmöglich sein mag, bin ich sicher, dass dies nicht nur ein ähnliches, sondern dasselbe Loch ist, das im Mauerwerk des Gebäudes klafft, an dem ich jeden Morgen vorbeilaufe. Die Schnauze einer Ratte schiebt sich mir entgegen. Ich strecke den Arm aus und lege meine Fingerspitzen auf die ungleichmäßig geformte Kante des Lochs. Die Ratte schnüffelt kurz, bevor sie die von mir gebaute Brücke nutzt, mit Geschick auf meinem Arm balanciert und schließlich auf meiner Schulter Platz nimmt.
»Es ist faszinierend, nicht wahr?«, sagt die Stimme hinter mir. »Wie sich die Realität verändert, wenn man sich nur die Zeit nimmt, sie als das zu sehen, was sie wirklich ist.«
»Wie kann dieses Loch hier sein und gleichzeitig an einem anderen Ort?«, frage ich ins Nichts. Meine Stimme hallt über den Bahnsteig. Erst jetzt fällt mir auf, dass die Worte der unsichtbaren Präsenz zuvor keine solche Wirkung entfalteten.
»Vielleicht ist es kein Loch«, erhalte ich zur Antwort. »Und vielleicht sind Sie die Ratte.«
Ich drehe mich um, doch natürlich steht dort niemand. Bis auf das pelzige Tier auf meiner Schulter und mich ist der Bahnsteig nach wie vor leer. Ich schaue die Ratte an und könnte schwören, dass sie meinen Blick erwidert und einmal mit den Schultern zuckt. Ein Gedanke geht mir durch den Kopf. Haben Ratten überhaupt Schultern?
Ein Quietschen, gefolgt von einem dumpfen Schlag und metallischem Scheppern lässt mich aufschrecken. Schreie von Menschen folgen. Vom Balkon schaue ich hinunter auf die Straße. Ein lebloser Körper, grotesk verdreht, liegt auf dem Gehweg, der bis zur Unkenntlichkeit deformierte Klumpen Metall ein paar Meter weiter, der Sekunden zuvor wohl noch ein Fahrrad war, zeugt von der Wucht des Aufpralls. Am Ende der schwarzen Bremsspur steht ein Auto, dessen Motorhaube und Windschutzscheibe demoliert sind. Ich glaube, Blut auf dem gesplitterten Glas zu erkennen. Selbst mit einem Fahrradhelm hätte dieser Unfall wohl kein anderes Ende genommen.
Passanten laufen herbei, einige zücken Telefone. Sicher ruft einer von ihnen die Polizei, denke ich, sodass ich es nicht tun muss. Erst jetzt sehe ich, dass dem Radfahrer offenbar eine Hand abgerissen wurde, an seinem linken Arm ist nur noch ein blutiger Stumpf zu erkennen, aus dem ein Stück Knochen ragt. Eine kleine dunkle Pfütze hat sich darunter gebildet. Auch sein Schädel scheint stark in Mitleidenschaft gezogen. Er ist deformiert, verschoben und wahrscheinlich an irgendeiner Stelle aufgebrochen. Wahrlich kein schöner Anblick.
Minuten später trifft unter lautem Sirenengeheul und Blaulicht die Polizei ein, sorgt dafür, dass der Verkehr umgeleitet und allzu aufdringliche Gaffer zurückgedrängt werden, sichert die Unfallstelle und befragt Augenzeugen. Der Notarztwagen parkt direkt unter meinem Balkon, Rettungssanitäter springen heraus und machen sich daran, den Körper des Unfallopfers zu bergen. Einer der Umstehenden auf der gegenüberliegenden Straßenseite stößt einen spitzen Schrei aus, deutet panisch auf etwas zu seinen Füßen und taumelt rückwärts. Wahrscheinlich hat er die Hand gefunden. Ein paar Augenblicke später wendet sich einer der Sanitäter ihm zu und verstaut etwas in einem Plastikbeutel, sucht noch eine Weile in der näheren Umgebung und bringt seine Beute dann zum Krankenwagen.
Nach etwa einer Stunde ist alles halbwegs zur Normalität zurückgekehrt. Die Spuren des Unfalls sind weitgehend beseitigt, die Grüppchen von Schaulustigen haben sich in alle Winde verstreut und für den Augenblick kehrt wieder Ruhe ein.
Mit einem Dröhnen kündigt sich der nächste Zug an. Komprimierte Luft lässt ein weiteres Mal Überreste von Zeitungen umherwirbeln. Dann hält die Bahn. Sie ist menschenleer. Die Tür direkt vor mir öffnet sich.
»Steigen Sie ein«, fordert mich die Stimme auf. Ich steige ein. Die Tür schließt sich und der Zug setzt sich in Bewegung. Die Ratte springt von meiner Schulter und nimmt auf einer der Sitzbänke Platz. Das Licht flackert. Erst einmal, dann wieder und wieder, schneller und schneller, bis es einem Stroboskop gleicht. Plötzlich hält es an, bleibt wie eingefroren in genau dem Augenblick stehen, als ein neuer Lichtimpuls aufblitzt, doch bevor sein Strahlen den Waggon zur Gänze fluten könnte. Wie in aller Welt kann es möglich sein, Licht anzuhalten?
»Vielleicht habe ich nicht das Licht angehalten«, sagt die Stimme. »Vielleicht habe ich Sie angehalten.« Aus den Schatten am Ende des Wagens tritt eine Gestalt hervor, deren Körper pulsiert, als würden sich Gliedmaßen in jedem Augenblick neu formen.
Ich weiche zurück. Die Ratte schaut indes interessiert zu der unförmigen Kreatur, die langsam näher kommt. »Was … passiert … hier?«, stammele ich. »Was wollen Sie von mir?« Währenddessen rauscht der Zug unentwegt weiter durch den Tunnel.
»Ich werde Ihre Fragen beantworten«, entgegnet die Stimme. »Zur Realität und all dem, was uns umgibt.« Die Gestalt nimmt neben der Ratte Platz. »Setzen Sie sich«, sagt sie und deutet auf die Sitzbank auf der gegenüberliegenden Seite. Ich setze mich.
»Wissen Sie, wie ein Filmprojektor funktioniert?«, fragt die Gestalt, deren Erscheinung die ganze Zeit über wie im Fluss scheint, ohne dass ich genaue Formen, Gesichtszüge oder dergleichen ausmachen könnte. Filmprojektor? Warum zur Hölle fragt dieses Ding mich so etwas?
»Ja«, erwidere ich, »Einzelbilder auf einem Filmstreifen werden schnell nacheinander abgespielt, sodass eine Bewegung entsteht.«
Die Gestalt nickt. »Und so ist es auch mit der Wirklichkeit«, entgegnet sie. »Die Einzelbilder, wie Sie es nennen, sind das, was uns umgibt, was die Menschen Realität nennen. Doch in Wahrheit ist all das nichts weiter als ein Trick, eine optische Täuschung, wenn Sie so wollen. In schneller Frequenz nacheinander abgespielt, ergeben einzelne Bilder eine Bewegung, ein Ganzes, wie bei einem Kinofilm, der zuvor als einzelne Momentaufnahmen auf einen Streifen Zelluloid gebannt wurde.«
Ich verstehe die Worte, doch mein Verstand weigert sich, ihre Bedeutung zu begreifen.
»Könnten Sie einen Film zwischen zwei Bildern anhalten, ohne die Beschränkungen der menschlichen Existenz, ohne Bewegungsunschärfe«, fragt die Gestalt, »was würden Sie sehen?« Ohne mir Zeit für eine etwaige Antwort zu lassen, fährt sie fort. »Sie würden das Verblassen des ersten Bildes sehen, seine Auflösung, sein Verschwinden, bevor das nächste Bild die Realität erneut erwachen lässt. Mit jedem Bild endet sie, nur um mit dem nächsten neu zu beginnen. Die menschliche Wahrnehmung ist leicht zu täuschen. Vierundzwanzig oder sechzig Bilder pro Sekunde, im Falle des Universums natürlich deutlich mehr, doch es bleibt dabei: Die Wirklichkeit besteht aus einzelnen, nacheinander aufblitzenden Sequenzen von Realität.«
»Was hat das mit dem zu tun, was hier passiert?«, frage ich und deute auf das noch immer eingefrorene Licht.
»Dazu komme ich gleich«, stellt die Gestalt zufrieden fest. »Wissen Sie, wie Videotext funktioniert?«
Mit Erstaunen sehe ich, dass das Baugerüst verschwunden ist. Heute Morgen noch stand es hier, der Boden war bedeckt von Schutt, doch auch davon ist keine Spur mehr zu sehen. Die akkurat in den Boden gehämmerten Steine des Weges heben sich in keiner Weise vom Rest ab, keine weißliche Färbung von Baustaub, keine Feuchtigkeit, gar nichts. Es ist, als hätten hier niemals Arbeiten stattgefunden.
Einzig das Loch in der Mauer ist noch da. Ich kauere davor und versuche, mich daran zu erinnern, wie groß es heute früh war. Ist es gewachsen? Schwer zu sagen, mit dem makellosen Anstrich ringsumher erscheint es kleiner, doch ich glaube, dass seine Größe konstant geblieben ist. Ich bin fast ein wenig enttäuscht davon, dass sich keine Ratte blicken lässt. War ich zuvor noch verwirrt darüber, dass der Rückweg vom Bahnhof heute über einhundert Schritte länger war als gewöhnlich, so taucht jetzt das Bild einer Ratte vor meinem inneren Auge auf und lässt mich schmunzeln.
Als ich um die Ecke biege, denke ich wieder an den Unfall von gestern Abend. Die Straßenreinigung hat in aller Frühe die noch herumliegenden Glassplitter aufgesaugt und mit sich davon getragen. Vielleicht sollte ich meine Überlegungen zum Schmutztransfer hinsichtlich menschlicher Biomasse erweitern?
Plötzlich fällt mein Blick auf eine der kleinen Grasflächen, die rings um die Bäume längsseits der Straße angelegt sind. Normalerweise findet sich dort nicht viel außer Hundekot und Zigarettenstummeln, doch das, was gerade meine Aufmerksamkeit auf sich zieht, fällt in keine dieser beiden Kategorien. Ich trete näher und traue im ersten Moment meinen Augen nicht. Doch wirklich, dort liegt ein menschlicher Finger im Gras, offensichtlich wurde er mit großer Kraft abgerissen. Mein Verstand braucht tatsächlich mehrere Sekunden, um zu begreifen, dass vor mir ein Überbleibsel der armen Seele von gestern Abend liegt. Gerade als ich überlege, was ich damit tun soll, huscht von irgendwoher eine Ratte herbei, schnappt sich den Finger und trägt ihn im Maul davon. Ich schaue ihr hinterher, bis sie im Gully vor meinem Haus verschwindet.
»Stellen Sie sich vor«, fährt die Gestalt fort, »Sie könnten zwischen den einzelnen Bildern der Wirklichkeit existieren, könnten den Zwischenraum nicht nur sehen, sondern ihn betreten.«
Ich schaue zur Lampe an der Decke. »Ist es das, was hier passiert? Ist meine Wahrnehmung verschoben?«
»Ja, das ist ein gutes Wort«, kichert die Gestalt, »verschoben beschreibt es gut, doch es ist weit mehr als das. Sie sehen nicht das Aufblitzen des eigentlichen Bildes, sondern das schwarze Stück Zelluloid zwischen den Bildern. Schauen Sie genauer hin. Da ist nicht einfach nur eine Lampe, die im richtigen Bruchteil eines Augenblicks eingefroren wurde.«
Ich sehe die Lampe an, konzentriere mich und versuche zu sehen, was da noch sein soll. Die Plastikverkleidung wird transparent, gibt den Blick auf die Glühlampe darunter frei, auch diese verschwindet. Dann beginnen beide zu flackern, schneller und schneller, bis sie zu einem Wabern werden, das weder Verkleidung noch Lampe ist, sondern … jede mögliche Kombination beider Elemente in allen erdenklichen Zuständen. Jede Lampe, jede Abdeckung. Funktionierend, beschädigt, zerstört, angeschaltet und erloschen. Zur selben Zeit, in einer Art undefiniertem Zustand.
»Sie denken gerade an die Katze, nicht wahr?«, flüstert die Gestalt. »Die von Schrödinger. Sie denken daran, dass beim Beobachten die Wellenform kollabieren müsste, dass das, was Sie ansehen, eine konkrete Ausprägung annehmen sollte.«
Ich nicke, sage aber kein Wort.
»So funktioniert Realität«, fährt die Gestalt fort. »Menschen sind biologisch dazu konditioniert, die Wirklichkeit begreifen zu können. Sie leben in der kollektiven Halluzination, die sie als echt, als wirklich anerkennen. Die anderen können die Dinge nicht auf die Weise sehen, wie Sie es gerade tun. Denen ist nicht klar, dass es keineswegs vorherbestimmt ist, was auf dem nächsten Bild folgt.«
»Die anderen?«, frage ich irritiert. Ich löse den Blick von der Lampe, nehme dabei unwillkürlich an, dass sie in ihren früheren Zustand zurückkehren wird, und sehe die Gestalt an. »Was meinen Sie damit? Wieso kann ich es sehen?«
»Dazu kommen wir gleich.« Die Gestalt erhebt sich. »Doch vorher will ich Ihnen etwas zeigen.« In diesem Augenblick verlässt der Zug den Tunnel, bricht aus der Finsternis hervor ins Tageslicht. Wir rauschen durch die Stadt, doch sie sieht nicht aus wie zuvor. In Abständen, die mir zufällig und willkürlich erscheinen, verändern sich winzige Details an Gebäuden und Werbetafeln, selbst am von Scheinwerfern und den Lichtern von Helikoptern illuminierten Nachthimmel. »Wir sind es, die jedes Mal, wenn eine Momentaufnahme der Wirklichkeit verblasst, die Welt und alles in ihr neu erschaffen«, sagt die Gestalt. »Wir sorgen dafür, dass die Realität weiter existiert. Vergessen Sie die Planck-Zeit oder ähnliche vergebliche Versuche, das Intervall zu messen, in dem es geschieht …«
»Wir?«, unterbreche ich den Vortrag.
Die Gestalt nickt. »Ich bin nicht der Einzige«, erwidert sie. »Das Aufrechterhalten der Realität ist eine Gemeinschaftsarbeit. Doch wir stehen vor einer Herausforderung, der wir nicht gewachsen sind. Von daher bin ich sehr froh, Sie gefunden zu haben.«
Ich verstehe nicht. »Soll das heißen …?«
»Ja«, antwortet der dunkle Klumpen Materie. »Das heißt es. Sie sind einer von uns geworden.«
»Aber wie …?«, presse ich hervor. »Ich bin doch nur …«
»Ein Mensch?«, entgegnet die Gestalt. »Nicht mehr, fürchte ich.« Er erhebt sich, kommt näher und steht jetzt unmittelbar vor mir. »Wir brauchen Ihre Hilfe. Es geht um alles, um einfach alles.«
Ich bin gerade im Badezimmer, als ich von der Wohnungstür ein kratzendes Geräusch vernehme. Zuerst denke ich mir nichts dabei, vielleicht knarrt das Gebälk oder ein Nachbar geht gerade an meiner Tür vorbei. Doch einige Sekunden später kratzt es erneut. Dann noch einmal. Ich werde neugierig und sehe durch den Spion. Nichts. Wieder kratzt es. Ich öffne die Tür und schaue in den Flur. Zu meinen Füßen bewegt sich etwas. Eine Ratte steht auf ihren Hinterbeinen und schaut mich an. Im Maul trägt sie einen menschlichen Finger. Vorsichtig legt sie ihn auf die Fußmatte, wirft mir noch einen Blick zu und verschwindet dann in einem Spalt in der Wand auf der rechten Seite, von dem ich nicht sicher bin, ob er gestern schon da war.
Später sitze ich am Schreibtisch und betrachte den Finger, der auf einem kleinen Teller liegt. Der Zeigefinger einer rechten Hand, schätze ich. Mit jeder Sekunde, die verstreicht, wächst in mir sowohl das schon bekannte Unbehagen als auch ein bizarres Gefühl der Vertrautheit. Das Licht der Schreibtischlampe scheint dicker zu werden, als gewönne es greifbare Substanz, während das von geschlossenen Fenstern gedämpfte Dröhnen der Großstadt zu einem einzigen langgezogenen Brummen erstarrt. Unwillkürlich strecke ich die Hand aus, nähere mich dem toten Stück Fleisch, das vor mir liegt. Übelkeit brandet in mir auf, doch ich bleibe standhaft. Rascheln und Knacken dringt an meine Ohren, wie das Tapsen Tausender winziger Füße. Ich greife nach dem Finger und hebe ihn vorsichtig hoch. Hatte ich zuvor noch einen dieser Küchenhandschuhe übergestreift, um das Geschenk der Ratte in die Wohnung zu tragen, so habe ich die Furcht vor dem toten Stück Fleisch mittlerweile hinter mir gelassen.
Eine Erkenntnis schleicht sich aus dem Hinterhalt an, pirscht sich durch das Chaos anderer Gedanken, die wie ein Insektenschwarm in meinem Kopf umherschwirren, und schafft es, meine Aufmerksamkeit zu erringen. So absurd es klingen mag, so wenig ich meiner Intuition im ersten Moment Glauben schenken möchte, so unwiderlegbar ist dieser Finger eines Toten absolut identisch zu meinem. Die kleinste Furche in der Haut, jeder einzelne gewundene Ring des Fingerabdrucks, sie stimmen überein. Das ist mein Finger.
Irgendjemand rüttelt an meiner Schulter. »Hey, aufwachen«, raunzt mich eine unbekannte Stimme an. »Endstation.«
Verwirrt schaue ich mich um. Der dickliche Mann in der Uniform eines Bahnangestellten trottet davon und ich stelle fest, dass ich als Letzter im Waggon sitze, wahrscheinlich Minuten, nach dem alle anderen den Zug verlassen haben. Ich erhebe mich und trete hinaus auf den Bahnsteig. Tatsächlich, das ist die Endstation dieser Linie. Sekundenlang betrachte ich das metallene Schild, auf dem in großen Buchstaben der Name der Haltestelle steht. Ich könnte auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnsteigs in den dort wartenden Zug steigen und einfach zurückfahren.
Irgendetwas berührt mein Bein. Eine Ratte klettert an meiner Hose empor. Ich lasse sie gewähren und wenige Augenblicke später sitzt sie auf meiner Schulter. Von all den Bewohnern der Stadt sind mir Ratten mit Abstand am sympathischsten.
Der Zug hinter mir verschwindet in der Dunkelheit des Tunnels. Sein Luftzug wirbelt Papierfetzen durch die Gegend, lässt sie in der Luft tanzen und Formen bilden. Ich entschließe mich, den Zug zurück zu nehmen, und trete durch eine der geöffneten Türen ein. Kurz nachdem ich Platz genommen habe, betreten weitere Menschen den Waggon, die Gruppe aus mehreren Männern und Frauen mittleren Alters unterhält sich lautstark über irgendwelche Nebensächlichkeiten. Irgendwann bemerkt einer von ihnen meine Begleiterin, die noch immer auf meiner Schulter ruht und sich an meinen Hals schmiegt.
»Wissen Sie nicht, dass die Krankheiten verbreiten?«, fragt eine der Frauen und verzieht angewidert das Gesicht. »Das ist ekelhaft.«
Ich drehe den Kopf und sehe die Ratte an. »Ist das wahr?«, frage ich. »Das mit den Krankheiten, meine ich.« Die Ratte schüttelt den Kopf. Ich wende mich wieder der Frau und ihrer Begleitung zu. »Sie haben die Wahl, einfach in einen anderen Waggon einzusteigen.«
Das Gesicht der Frau verfinstert sich. Auch die anderen schauen mich an, als wäre mit mir irgendetwas nicht in Ordnung. Dabei sitze ich einfach nur friedlich da. Kann es sein, dass allein die Anwesenheit einer Ratte die Menschen dazu bringt, sich unwohl oder gar bedroht zu fühlen? Sollten sie nicht vor ihren eigenen Artgenossen viel mehr Angst haben? Ich möchte gar nicht wissen, welche übertragbaren Krankheiten jeder von denen mit sich herumträgt.
»Ich informiere den Sicherheitsdienst«, sagt sie drohend, und die anderen nicken zustimmend.
»Nur zu«, antworte ich. »Ich bin gespannt, was der dazu zu sagen hat.« Ich frage mich, ob sie auch soviel Aufhebens machen würde, säße ich hier mit einem Hund, der zuvor Gott weiß was gefressen hat und dessen Speichel ein wahrer Hort für allerlei Krankheitserreger ist. Gespannt warte ich darauf, dass irgendjemand aus der Gruppe den Wagen verlässt, um wie angekündigt den Sicherheitsdienst zu rufen. Nichts dergleichen geschieht. Stattdessen verzieht sich die kleine Menschentraube in einen entfernten Bereich des Waggons, nicht ohne sich nach wie vor hörbar darüber auszulassen, wie schrecklich unhygienisch das alles sei.
»Wann ist eine Ratte keine Ratte?«, fragt eine Stimme in meinem Kopf.
»Wenn sie alle Ratten ist«, antworte ich, ohne darüber nachzudenken. Ein zustimmendes Quietschen kommt von meiner Schulter. Ich schaue zur Seite.
Die Ratte balanciert auf ihren Hinterbeinen und hat die Pfoten vor dem Körper gefaltet, als wollte sie eine Ansprache halten. »Wir sind da«, flüstert sie. Ich sehe, wie sich ihre Schnauze bewegt, während sie die Worte artikuliert.
»Ratten können nicht sprechen«, entgegne ich. Wie zur Antwort hüpft sie von meiner Schulter auf den Boden, huscht zur Tür, springt über den Spalt und schaut mich vom Bahnsteig aus erwartungsvoll an. Ich folge und stelle erstaunt fest, dass das Schild in der Tat den Namen meiner Station zeigt. Nun, im Grunde sollte mich das nicht überraschen, immerhin saß ich im richtigen Zug und war diesmal ausreichend wach. Dass der Waggon sich nicht einen Zentimeter bewegt hat, erscheint eher als unwichtiges Detail. Ich gehe in die Hocke, greife vorsichtige nach der Ratte und setze sie auf meine linke Schulter, bevor ich den Weg zur Arbeit fortsetze.
»Schauen Sie«, sagt die Gestalt und deutet mit einem Arm aus wabernder Schwärze auf eines der Gebäude, an denen der Zug vorbei rauscht. Im nächsten Moment friert alles ein, erstarrt zu einem perfekten Standbild. »Sehen Sie die Degeneration?«
Ich trete näher an die Scheibe und betrachte die Fassade des Gebäudes. An einigen Stellen, für andere Menschen wahrscheinlich nicht wahrnehmbar, blättert die Substanz ab. Nicht das Material, nicht Beton, Kunststoff oder Glas, sondern das, was ihnen Existenz verleiht. Kann sich Realität abnutzen? Wird sie dünner, droht sie gar zu reißen, wenn man sie zu sehr strapaziert? »Wie schlimm ist es?«, frage ich flüsternd.
»Bei der derzeitigen Geschwindigkeit des Verfalls bleiben nur noch wenige Jahre, bis die Realität kollabiert«, sagt die Gestalt. »Die Weigerung der Menschen, die Wirklichkeit als solche anzuerkennen, hat ein nie dagewesenes Ausmaß angenommen. Sie haben eine Gegenrealität erschaffen, und beide driften mehr und mehr auseinander.«
Ich erinnere mich an den Turm aus Fleisch und Knochen. »Vielleicht soll es so enden. Ich hänge nicht besonders an dieser Welt, wissen Sie?«
Heiseres Lachen ertönt und lässt mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen. »Der Prozess der Degeneration läuft schon seit sehr, sehr langer Zeit«, erklärt die Gestalt hinter mir. »Jede Neuerschaffung bedeutet Verlust, aber das ist der Lauf der Dinge. Bisher hatten wir es unter Kontrolle. Doch seit einigen Jahren beschleunigt sich die Degeneration mehr und mehr, und wir verstehen nicht warum. Sie können uns dabei helfen.«
Ich drehe mich um und sehe das Ding vor mir an. »Ist es nicht normal, dass alles irgendwann stirbt?«, frage ich. »Warum sollte es mit der Wirklichkeit anders sein? Und warum sollte gerade ich etwas daran ändern wollen?«
»Weil die Wirklichkeit mit Ihrer Hilfe werden könnte, wie sie früher war«, haucht die Kreatur, von der ich noch immer nicht mehr weiß, als dass sie offensichtlich existiert. »Sie war wundervoll, unvorstellbar schön, elegant, perfekt. Und sie könnte es wieder sein.«
Von einem Augenblick zum anderen läuft draußen die Welt weiter.
»Sie waren ein Mensch«, fährt die Gestalt fort. »Sie verstehen, wie Menschen denken, wahrnehmen und fühlen. Zusammen mit Ihrer neuen Fähigkeit, die Realität aus unserer Perspektive zu betrachten, könnten wir gemeinsam den Schaden reparieren und der Wirklichkeit zu neuem Glanz verhelfen.«
Einige Augenblicke lang denke ich darüber nach.
Ein Loch in einer Mauer.
Ein Turm aus Fleisch und Knochen.
Vielleicht wäre es das Beste für die Welt, wenn sie von Ratten beherrscht würde.
Risse
Das feuchte Tuch vor meinem Mund vermag kaum den beißenden Geruch fernzuhalten, der durch das Gebäude zieht wie der Hauch des Todes. Irgendwo im Erdgeschoss hat es gebrannt, und auch wenn die Flammen mittlerweile erstickt sind, liegt doch überall brenzliger Dunst in der Luft, der in den Lungen brennt. Die Beleuchtung ist weitgehend ausgefallen, nur hier und da kündet noch ein flackerndes Licht davon, dass hier bis vor Kurzem Menschen gearbeitet, miteinander geredet und gelacht haben. Es grenzt fast an ein Wunder, überhaupt noch Reste von Elektrizität zu finden.
Nach dem Kollaps der öffentlichen Ordnung ist es nahezu unmöglich geworden, sich anders als zu Fuß durch die Stadt zu bewegen. Die Hauptverkehrsstraßen sind blockiert mit unbrauchbaren Autos und es dauert länger als je zuvor, über Schleichwege und Nebenstraßen von einem Ende der Stadt ans andere zu gelangen.
Nicht, dass es vorher ein entspannendes Vergnügen gewesen wäre, sich durch diesen Schmelztiegel aus wütenden Idioten und rücksichtslosen Arschlöchern zu kämpfen, doch jetzt ist es weitaus schlimmer. Die Straßen sind voll von Menschen in Panik, Familien auf der Flucht, die allesamt versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Fast sind sie zu beneiden, die Hoffnungsvollen, die noch immer glauben, dass in ein paar Wochen alles wieder beim Alten sein wird. Doch es gibt keine Erlösung, keine göttliche Intervention in letzter Sekunde.
Sechs Tage, so heißt es, hat Gott gebraucht, um die Welt zu erschaffen. Drei Tage sind vergangen, seit sich der erste Riss geöffnet hat. Es wird kaum weitere drei dauern, bis nichts mehr von uns übrig ist.
Ich erreiche Jacobsons Büro im fünften Stock. Die Tür steht offen und durch die Fenster fällt der Feuerschein brennender Gebäude hinein, lässt Schatten an den Wänden hin und her zucken, Abbilder des Untergangs, der die einstige Metropole mehr und mehr in eine Geisterstadt verwandelt. Aus der Manteltasche fördere ich die kleine Taschenlampe zutage, die ich seit dem ersten Stromausfall im Labor stets bei mir habe. Unmengen von Papieren sind auf dem Boden verstreut, wissenschaftliche Arbeiten, Ausdrucke, Kopien.
Bei unserem letzten Gespräch hatte Jacobson noch Hoffnung, dass es eine Möglichkeit gäbe, den Untergang aufzuhalten. Ich hingegen habe mich mit der Wirklichkeit abgefunden. Das ist das Ende, nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, dass ich es verdient habe, doch ich will es wenigstens verstehen. Nur aus diesem einen Grund bin ich hier. Es mag zynisch klingen, aber ich bin dankbar dafür, dass Mitsuko und Katie das hier nicht mehr erleben müssen.
Die Luft knistert, schwach nur, doch ich bemerke es. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ich schalte die Taschenlampe an, stecke sie zwischen meine Zähne und hole das Brecheisen hervor. Zielstrebig gehe ich zum Schreibtisch, hebele die Schubladen auf und hoffe, darin Jacobsons Aufzeichnungen zu finden. Typisch für ihn hat er alles aufgeschrieben, ganz altmodisch mit Stift und Papier, statt es nur digital zu erfassen. Es sind die einzigen Dokumente, die uns geblieben sind, nachdem fast sämtliche Technologie unbenutzbar wurde.
Hastig greife ich alles, was irgendwie brauchbar aussieht und lege es auf den Tisch. Am Boden der ersten Schublade finde ich etwas, mit dem ich an diesem Ort am allerwenigsten gerechnet hätte. Ohne lange nachzudenken, stecke ich die kleine Pistole ein, es schadet sicher nicht, sich im Notfall zur Wehr setzen zu können. Die Risse sind nicht die einzige Bedrohung da draußen, Horden von Plünderern tun, was sie können, um den Niedergang der Stadt zu beschleunigen. In den anderen Schubladen kommen mehr Papier, ein paar Datenträger, ein Diktiergerät und dazu passende Tonbandkassetten zum Vorschein. Ich klaube alles zusammen und fülle es in einen herumstehenden Karton. Bevor ich mich davonmache, nehme ich das Foto unserer Forschungsgruppe vom Schreibtisch mit. Vielleicht ist es das Einzige, was von uns bleiben wird.
Ich muss verschwinden, bevor sich ein Riss manifestiert, sonst ergeht es mir wie Willard und Jack. Sie dachten, sie hätten eine Möglichkeit gefunden, das alles zu beenden. Ich habe beide sterben sehen, unten im Labor. Wir können nur laufen, uns verstecken und dafür sorgen, dass sie uns nicht finden. Ein Rennen gegen die Zeit, das wir verlieren werden.
Es ist auf eine grausame Weise erstaunlich, wie unwichtig all die Errungenschaften der modernen Zivilisation, all unsere geliebte Technologie, all unser Fortschritt werden, wenn es um das nackte Überleben geht. Nachdem sich die ersten Risse draußen geöffnet hatten, dauerte es nur wenige Stunden, bis Stromversorgung und Kommunikation zusammenbrachen. Unsere Kraftwerke müssen auf diese Dinger wie ein All-you-can-eat-Buffet gewirkt haben. War es anfangs noch möglich, im Radio Informationen über die Ausbreitung des Phänomens zu erhalten, brachten die elektromagnetischen Störungen der Risse schnell jegliche Übertragung zum Erliegen. Polizei und Militär stellten schmerzhaft fest, dass das, was aus den Rissen kommt, sich nicht mit Waffen bekämpfen lässt. Wie soll man töten, was nicht lebendig ist?
Auf dem Weg nach unten denke ich unentwegt an Cassie und frage mich, ob ich sie je wiedersehen werde.
Elektronische Musik schallt durch das Labor. Felicias Playlist ist wirklich gut und lässt mich konzentriert arbeiten. Ein weiteres Mal gehe ich die Aufzeichnungen der Testläufe durch, kalibriere die Instrumente, gleiche Informationen und Messwerte ab. Auch wenn bisher alles glatt lief, so bin ich doch skeptisch, ob wir damit nicht zu weit gehen. Ich war nie ein religiöser Mensch, doch selbst mir kamen Jacobsons Worte blasphemisch vor, als er davon sprach, dass wir an Gottes Stelle über das Leben gebieten könnten, wenn wir nur entschlossen genug wären.
Das rote Licht blinkt auf und ich schaue zur Eingangstür des Labors. Eine junge Frau mit dunklem Haar, einem geradegeschnittenen Pony und einer Brille auf der Nase winkt mir zu. Sie hält ein Schriftstück in die Höhe und deutet darauf. Ah, richtig, Jacobson hatte davon erzählt, dass er mir eine Assistentin besorgen wollte. Ich drehe die Musik leiser, gehe zur Tür und öffne sie.
»Guten Abend«, sage ich freundlich. »Du bist Cassandra, nehme ich an.«
»Cassie«, erwidert sie lächelnd und streckt mir die Hand entgegen. »Dr. Jacobson sagte, ich solle mich so bald wie möglich vorstellen.«
»Komm rein.« Ich trete beiseite. Cassie gleitet an mir vorbei, einen Hauch dezenten Parfüms mit sich bringend. Ich schließe die Tür und betrachte die Frau, die sich gerade im Labor umschaut. Sie trägt schwarze Schuhe und einen knielangen Rock, darüber eine weiße Bluse, schlicht und elegant. War ich bisher wenig begeistert von der Idee, jemanden zur Seite gestellt zu bekommen, so verfliegt meine Ablehnung zusehends.
Plötzlich fährt Cassie herum. »Flesh Field?«, fragt sie erstaunt und bewegt sich im Rhythmus der Musik.
Ich nicke. »Epiphany, uralt, aber immer noch einer meiner liebsten.«
»Das läuft oft im Arcane«, grinst sie. »Ich liebe diesen Song. Der Text ist phantastisch.«
»Gleich morgen früh stelle ich dir Felicia vor. Ich bin sicher, ihr werdet euch sehr gut verstehen.«
Das Dröhnen der Stadt übertönt alles. Nur hier und da kann ich einzelne Geräusche identifizieren, wie das Aufheulen eines Motors, das Rumpeln einer vorbeifahrenden Bahn oder das Piepsen der Ampelanlagen, die wie Schleusen den niemals versiegenden Strom von Menschen separieren. Eine kleine Gruppe huscht über die Straße, bevor rotes Licht den Nachfolgenden Einhalt gebietet. Ich erreiche die Wartenden, reihe mich ein und richte den Blick auf die Straße vor mir, auf die diffuse Masse aus Fahrzeugen, die in der flirrenden Hitze dieses Tages verflüssigtem Metall gleich dahinfließt wie Quecksilber.
Unvermittelt krampfen meine Muskeln und die Haare auf meinen Armen stellen sich auf. Was zum …? Den Menschen in meiner Nähe scheint es ähnlich zu ergehen, ich sehe verwirrte Blicke und höre Tuscheln ringsum. Auf der Straße kracht es. Erst einmal, dann erneut, bis es klingt, als spielte jemand auf einem Schlagzeug einen kruden Rhythmus. Auf Scheppern und Quietschen folgt ein ekstatisches Hupkonzert, Autotüren werden aufgerissen, laute Worte gewechselt, hier und da kommt es zu Handgreiflichkeiten.
Mein Magen zieht sich zusammen. Etwas bedrohliches ist hier gerade geschehen und es ist noch nicht vorbei. Aus irgendeinem Grund denke ich die Worte, die Jeanette rief, kurz bevor wir sie aus der Kammer holten.
Dann geht alles ganz schnell. Die Luft auf der Kreuzung flimmert stärker und stärker, elektrisches Knistern gesellt sich hinzu. Ein Bus, vollbesetzt mit Fahrgästen, steht im Zentrum der Anomalie. Nur Augenblicke später reißt die Wirklichkeit von oben nach unten auf, aus etwa fünf Metern Höhe bis zum Boden herab bildet sich in Sekundenschnelle ein Spalt und durchtrennt den Bus fast genau in der Mitte. Metall knirscht, Glassplitter fliegen durch die Gegend, als Scheiben bersten. Menschen drängen in Panik zu den Türen, doch diese lassen sich nicht aufschieben, zu stark deformiert ist der metallene Rumpf des Fahrzeugs bereits. Die ersten Fahrgäste beginnen, aus den geborstenen Fenstern zu klettern, Schreie dringen hinüber zu uns. War die Kreuzung Minuten zuvor noch von Motorenlärm erfüllt, so sind es jetzt die ängstlichen Laute der Eingeschlossenen, die über den bis zum Bersten mit Fahrzeugen vollgestopften Platz hallen. Etliche Fahrer umstehender Autos verlassen ihre Fahrzeuge und machen sich daran, den Passagieren des Busses zu helfen, während der Riss sich manifestiert. War er bisher nur eine Art optische Verzerrung, so gewinnt er zunehmend Substanz und nimmt dunkelgraue Farbe an.
Ich bin erstarrt, weiß nicht, was ich tun soll. Der Wissenschaftler in mir will das Phänomen studieren, doch irgendwo tief im Innern weiß ich, dass ich fliehen sollte, auf der Stelle.
»Ich würde viel lieber über etwas anderes reden«, unterbricht Cassie meine Ausführungen zur Tragweite unserer Forschung. Ich halte inne und schaue in ihre funkelnden Augen. Sie kommt näher und keine Sekunde später berühren sich unsere Lippen in einem zarten Kuss. »Ist das nicht spannender als die Experimente?«
»Allerdings«, gebe ich lächelnd zurück und kann kaum glauben, was geschehen ist. Neben uns kichert es. Simultan drehen wir die Köpfe und sehen Felicia, die mit einem großen Joint in der Hand vor uns steht.
»Oh, lasst euch nicht stören«, grinst sie und wirft uns einen auffordernden Blick zu. »Es geht doch nichts über ein gutes Arbeitsklima.« Wieder kichert sie wie ein kleines Mädchen.
Cassie löst sich von mir, legt sanft ihre Hände auf Felicias Wangen und gibt ihr einen tiefen, leidenschaftlichen Kuss. Die beiden versinken förmlich ineinander, und ich sehe deutlich, dass Felicias anfängliche Überraschung gleich darauf purem Genuss weicht. Sie hat die Augen geschlossen und steht noch immer so da, als Cassie längst meine Hand genommen und mich wieder auf die Tanzfläche gezogen hat. »Teambuilding ist wichtig, nicht wahr, Doc?«, ruft sie lachend, während wir uns unter die Tanzenden mischen.
Später irgendwann hält Jacobson eine Rede vor den mehr als hundert Gästen, illustriert in blumigen Worten seine Vision von einem wissenschaftlichen Durchbruch, doch die Tatsache, dass Cassie die ganze Zeit über meine Hand hält, reduziert meine Aufmerksamkeit erheblich. Als Jacobson schließlich einen Scheck aus der Tasche zieht, brandet Jubel auf. Dunham hat endlich der Finanzierung zugestimmt und den Fortbestand des Projekts für die nächsten Jahre gesichert.
»Hier«, sagt Cassie und reicht mir das Datenpad. »Ich habe die Feinjustierung vorgenommen. Nur minimale Anpassungen, aber sie werden den Übertritt deutlich vereinfachen.« Ich nicke ihr zu und gebe die Informationen in das System ein. Seit Jacobson die neue Hardware beschafft hat, können wir um den Faktor eintausend präziser arbeiten. Für das, was wir vorhaben, gerade gut genug.
»Konfiguration abgeschlossen«, meldet Willard, »alle Verbindungen sind stabil.«
»Vitalzeichen normal, leicht erhöhtes Stresslevel«, schaltet sich Felicia dazu. »Das ist nur verständlich. Alles im grünen Bereich. Aufzeichnung läuft.«
Ich starte den Ladezyklus und erhebe mich, um ein letztes Mal nach Jeanette zu sehen, bevor wir beginnen. Sie sitzt aufrecht in der Versuchskammer, schaut durch die offene Tür zu uns herüber und beobachtet die Vorbereitungen. Auch wenn sie es nie zugeben würde, sehe ich ihr die Aufregung deutlich an.
»Alles in Ordnung bei dir?«, frage ich.
Sie nickt. »Ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe«, flüstert sie, »davor, dass etwas schiefgeht, oder davor, dass wir Erfolg haben.« Das klingt so gar nicht nach Jeanette.
»Hey, wenn du dich nicht bereit fühlst …«
»Nein, das ist es nicht. Ich habe nur irgendwie ein komisches Gefühl bei der Sache.« Sie ringt sich ein Lächeln ab. »Ist sicher nur die Aufregung.«
Ich lege die Kassette in das Diktiergerät ein und drücke den Wiedergabeknopf. Jacobsons Stimme ertönt, während ich den Wagen starte und mich auf den Weg zu Jeanettes Haus mache. Ein glücklicher Zufall ist es, dass das Auto noch eines der alten Generation ist, das weitgehend ohne elektronische Bauteile auskommt. Anderenfalls wäre es ebenso unbrauchbar wie der gesamte Rest unserer technologischen Errungenschaften.
»Auch wenn es dafür zu spät ist«, sagt Jacobson mit müder Stimme, »so bereue ich meinen Hochmut, bereue meine Arroganz, mit der ich die anderen dazu trieb, etwas zu konstruieren, das nun den Untergang der Welt bewirkt.« Er schluchzt, einige Sekunden lang höre ich nur Rauschen und angestrengtes Atmen. »Wir dachten, wir könnten einen Blick hinter die Kulissen der Welt werfen, dachten, wir hätten den Schlüssel gebaut, mit dem sich die Tür zu Gottes geheimem Garten hinter dem Haus öffnen ließe.«
Während seiner Ausführungen durchquere ich auf irgendwelchen Schleichwegen eine zerstörte Stadt und kann ein ums andere Mal nicht glauben, dass hier vor Kurzem noch das pulsierende Leben tobte. Bereits am ersten Tag, nur wenige Stunden, nachdem ich Zeuge wurde, welch unerbittliche Gewalt die Risse mit sich bringen, brach das Chaos aus. Seitdem habe ich kaum eine Minute geschlafen.
»Spätestens nach der Sache mit Jeanette hätten wir das Experiment abbrechen müssen«, fährt Jacobson fort, »vielleicht hätten wir dann eine Chance gehabt, das alles aufzuhalten. Doch ich war starrsinnig, wollte nicht begreifen, dass wir Mächte entfesselt hatten, die wir unmöglich kontrollieren konnten.« Er lacht gequält. »Was für Narren wir doch waren. Statt des Schlüssels haben wir die verdammte Tür gebaut«, sagt er mit bebender Stimme, »und irgendetwas von der anderen Seite hat sie aufgestoßen. Als hätte es nur darauf gewartet, fiel es über unsere Welt her.« Eine weitere Pause, diesmal dauert sie beinahe eine Minute. »Willard, Jack, Felicia, ich habe euch in den Tod geschickt. So wie all die anderen, die meine Hybris nun zu einem furchtbaren Ende verdammt. Es gibt keine Hoffnung und keine Vergebung für mich, nichts, womit ich diese Schuld wieder gutmachen könnte. Ich werde all meine Aufzeichnungen vernichten, vielleicht vermögen es die Flammen, auch mir Erlösung zu bringen.«
Die Sonne sinkt langsam hinter den Horizont, als ich in etwa einer Meile Entfernung Jeanettes Haus erkenne. Endlich. Ich drossele das Tempo und nähere mich so leise wie möglich. Ein Wagen steht in der Einfahrt. Jeanette scheint noch da zu sein. Bleibt zu hoffen, dass das Haus abgeschieden genug liegt, um uns zumindest für eine Weile Schutz vor den Rissen zu bieten.
Ich halte an, schalte den Motor aus und lausche für einen Moment in die Dunkelheit. Dann nehme ich die Waffe aus dem Handschuhfach, auch wenn ich weiß, dass sie gegen diese Kreaturen nutzlos ist. Darauf bedacht, möglichst keine Geräusche zu machen, schleiche ich einmal um das Haus herum und versuche, durch eines der Fenster einen Blick hinein zu erhaschen. Irgendjemand hat sich Mühe gegeben, jeden noch so kleinen Spalt blickdicht zu machen. Als ich wieder die Eingangstür erreiche, umklammert meine rechte Hand den Griff der Pistole, während ich mit links klopfe. Zaghaft zuerst, dann stärker. Nichts. Ich klopfe erneut. Drinnen regt sich etwas. Ich höre Schritte, gedämpft und langsam. Die Tür öffnet sich ein paar Zentimeter weit, ein schwacher Lichtschein fällt nach draußen und Jeanettes erleichtertes Gesicht kommt zum Vorschein. Ich glaube sogar, den Anflug eines Lächelns erkannt zu haben.
»Komm rein«, sagt sie leise. »Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt.«
»So leicht kriegen die mich nicht«, gebe ich zurück und versuche, unbeschwert zu klingen, doch wir beide wissen, dass das nichts als Scharade ist. Ich stecke die Waffe hinten in den Hosenbund und trete ein.
Der kleine Raum ist von Kerzen erleuchtet, flackernde Schatten tanzen an den Wänden. Wäre dies nicht das Ende der Welt, könnte man meinen, Jeanette hätte einen romantischen Abend für uns beide geplant.
»Gib mir dein Telefon«, sagt sie und streckt die Hand aus. Ich bin unsicher, was sie damit will. Zögernd reiche ich es ihr. Telefonieren ist seit ein paar Tagen ohnehin unmöglich, was habe ich also zu verlieren. Jeanette legt das Gerät in eine der isolierten Boxen, wie wir sie auch im Labor verwenden.