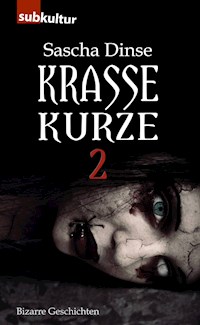7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition subkultur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von den Abgründen des Großstadtlebens über Auswüchse moderner Technik bis hin zu unheimlichen Erscheinungen und finsteren Zukunftsszenarien erstrecken sich die 31 brillant erzählten Geschichten von Sascha Dinse. Manchmal blutig und verstörend, dann wieder voller nachdenklicher Melancholie, haben sie eines gemeinsam: Sie sind kurz und krass.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sascha Dinse, Jahrgang 1978, ist freischaffender Schriftsteller, Vorleser und Mediensoziologe. Er lebt und arbeitet in Berlin.
Als Autor tritt er zunächst in zahlreichen Horror-, Dark Fantasy- und SciFi- Anthologien in Erscheinung, was dann auch in etwa die Genres benennt, in die man seine Geschichten einsortieren kann, wobei diese meistens fulminant dazwischen passen.
Seine erste eigene Geschichtensammlung „Aus finstrem Traum“ erschien bei p.machinery. Die Erstauflage der „Krassen Kurzen“ brachte Sascha Dinse selbst heraus.
Zudem unterhält er mit TARTAROS seinen eigenen Podcast, in dem er vorwiegend seine Geschichten vorliest und einen Blick hinter die Kulissen gestattet.
Sascha Dinse
Krasse
Kurze
Bizarre Geschichten
www.edition.subkultur.de
SASCHA DINSE: »Krasse Kurze« 2. Auflage, Juli 2020, Edition Subkultur Berlin
© 2020 Periplaneta - Verlag und Mediengruppe / Edition Subkultur Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin
www.subkultur.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig.
Korrektorat: Laura Alt Covermotiv: www.farina-froede.com
Satz & Layout: Thomas Manegold
print ISBN: 978-3-943412-98-7
epub ISBN: 978-3-943412-99-4
Erdbeermädchen
Das Erste, was mir bereits von weitem ins Auge fällt, ist ihr Haar. Es schimmert beinahe so feuerrot wie die Erdbeeren, die in unzähligen kleinen Schalen vor ihr stehen. Ich sehe sie jeden Tag, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, und dann noch einmal, wenn ich zurückkehre. Es ist, als wäre ich der Einzige, der sich die Zeit nimmt, das Erdbeermädchen anzuschauen. Alle anderen hasten Treppen hinauf oder hinunter, rempeln einander an und halten keinen Moment inne auf ihrer Jagd nach dem, was sie Erfolg oder Karriere nennen. Ich stattdessen bleibe stehen, so wie ich es seit einer Woche jeden Morgen tue, lächle das Mädchen an und kaufe eine Schale. Sie erwidert mein Lächeln und überreicht mir einen kleinen Plastikbeutel, in dem mein heutiges Frühstück baumelt. Bestimmt erinnert sie sich an mich.
Später, als ich im Büro sitze, steht der Teller mit Erdbeeren neben mir. Jedes Mal, wenn mein Blick darauf fällt, schweifen meine Gedanken wieder zu ihr. Ist es komisch, dass ich mich den ganzen Tag darauf freue, sie auf dem Nachhauseweg wiederzusehen? Sie ist bestimmt höchstens halb so alt wie ich und ich komme mir seltsam dabei vor, in jedem Sonnenstrahl, der durch das Fenster fällt, den kupfergoldenen Glanz ihrer Haare zu sehen.
Nur mit Mühe schaffe ich es, mich auf etwas anderes zu fokussieren, suche mehr als üblich das Gespräch mit Kollegen und nehme jede Möglichkeit zur Ablenkung wahr. Während ich im Zug nach Hause sitze, leicht müde vor mich hin dösend, ist sie plötzlich wieder in meinem Kopf. An meiner Station angekommen, verlasse ich den Zug und dränge mich an all den anderen Menschen vorbei, die den Bahnsteig bevölkern. Dann endlich, nachdem ich die Treppe hinabgeeilt bin, sehe ich sie. Mein Herz schlägt schneller und ich spüre, dass mein Magen kribbelt. Komm schon, reiß dich zusammen, sie verkauft dir einfach nur Erdbeeren. Sie ist nur nett zu dir, weil du dafür sorgst, dass sie bezahlt wird. Ich atme einmal tief durch und bestelle drei Schälchen.
»Wir haben gerade neue bekommen«, sagt sie und greift hinter sich. Dann fördert sie drei Plastikschalen zutage, in denen die Erdbeeren noch köstlicher erscheinen als gewöhnlich. »Schauen Sie mal, die sind so frisch, die eignen sich sogar zum Einfrieren«, strahlt sie mich an. »Das geht nur, wenn sie wirklich noch völlig unversehrt sind.« Sie grinst. »Tiefgefroren ist zwar nicht genau dasselbe vom Geschmack her, aber so haben Sie vielleicht länger was davon. Immerhin ist die Erdbeersaison bald vorbei.«
Ich bedanke mich herzlich und wünsche ihr noch einen schönen Abend, bevor ich meinen Heimweg fortsetze.
Als ich am nächsten Morgen zum Erdbeerstand komme, ist sie nicht da. Statt des Mädchens mit den flammend roten Haaren steht jemand anderes dort. Schlagartig fühle ich mich leer und kann nicht einmal sagen, wieso. Die Freude, die ich jedes Mal empfand, wenn ich sie dort stehen sah, ist wie weggewischt. Trotzdem kaufe ich eine Schale Erdbeeren, aus purer Gewohnheit. Den ganzen Tag über frage ich mich, warum es sich so merkwürdig anfühlt, dass heute nicht sie die Erdbeeren verkauft.
Die restlichen Stunden im Büro bin ich unkonzentriert und kaum fähig, irgendeinen Gedanken festzuhalten. Vermisse ich das Erdbeermädchen? Ist es das, was mich so ruhelos werden lässt? Oder stimmt irgendwas nicht mit mir? Ich mache mir einen starken Kaffee, bevor ich mich wieder an den Schreibtisch setze. Die Erdbeeren lasse ich in der Küche stehen, vielleicht bedienen sich die Kollegen daran. Mich würden sie nur ablenken.
Erst als ich abends erneut am Erdbeerstand vorbeigehe, denke ich wieder an sie, an ihr Lächeln, ihr kupferfarbenes Haar und an die wenigen Worte, die wir miteinander wechselten. Daheim werfe ich meine Tasche in die Ecke, setze mich in den Sessel und schließe die Augen. Da, da ist sie wieder. In der Erinnerung kann ich sie zurückholen, wann immer ich will. Ich schenke mir ein Glas des guten Rotweins ein, den ich auf dem Nachhauseweg gekauft habe. Seine Farbe erinnert mich an Erdbeersaft. Durch die geschlossenen Fenster dringt dumpf der Klang der Stadt, die trotz vorangeschrittener Stunde rastlos scheint, so wie die Menschen in ihr, die einfach nie zur Ruhe kommen. Irgendwann entscheide ich mich, Musik zu spielen. Nichts Modernes, eher etwas aus vergangenen Zeiten. Nach einer Weile finde ich, wonach ich gesucht habe. Ruth Ettings »After you’ve gone« erscheint passend. Die Melodie mitsummend, genieße ich den Wein und schließe die Augen. Ob ich mich daran gewöhnen werde, sie nicht mehr jeden Tag dort stehen zu sehen? Ich werde schon darüber hinwegkommen, denke ich. Einige Gläser Wein und etliche Songs später fällt mir ein, dass ich morgen früh einen anderen Weg fahren muss. Keine frischen Erdbeeren also. Ich erinnere mich daran, dass ich noch welche übrig habe. Ich habe sie eingefroren, für schlechte Zeiten, ganz so, wie das Erdbeermädchen gesagt hat. Wenn ich sie jetzt zum Auftauen rauslege, sind sie vielleicht morgen früh essbar.
Ich schalte das Licht an und steige die Treppe hinab in den Keller. Das Brummen der Tiefkühltruhe wirkt bedrohlich, wie ein unheimlicher Eindringling in der Stille des Gewölbes. Doch ich weiß, dass mir keine Gefahr droht. Als ich den Deckel öffne, fällt mein Blick auf die Plastikschale mit dem stabilen Deckel, in der sich bestimmt drei Dutzend Erdbeeren befinden. Meine eiserne Reserve. Ich greife nach der Schale und denke daran, was das Erdbeermädchen sagte. Sanft streiche ich den Frost von ihren Lippen, während sie mich aus toten Augen anstarrt. Ihr Körper ist von einem Eisfilm bedeckt, der das einst prachtvolle Rot ihrer Haare kaum mehr zur Geltung kommen lässt. Sie hatte recht, denke ich. Tiefgefroren ist wirklich nicht dasselbe, aber man hat länger was davon.
Marla
Marlas Nachricht hat mir richtig Angst gemacht. Wir stehen uns nicht sonderlich nah, waren nie wirklich enge Freunde, dennoch mache ich mir Sorgen um sie.
Der Zug rauscht durch endlose Tunnelschächte, hält, fährt weiter, hält erneut. Immer wieder schaue ich auf mein Telefon. »Hilf mir, bitte. Ich muss es tun. Ich kann nicht aufhören. Hilf mir, solange ich noch da bin.«
Ich weiß nicht mehr, wie oft ich versucht habe, sie anzurufen. Ohne Erfolg. Vielleicht kann sie nicht rangehen. Vielleicht will sie nicht. Vielleicht spielt sie mir hier auch einfach nur einen makaberen Streich. Doch irgendwie spüre ich, dass mehr dahintersteckt als Marlas schräger Sinn für Humor.
Ich verlasse den Zug, stürme die Treppen hinauf, überquere im Laufschritt die Straße und stehe schließlich unten vor ihrem Haus. Ich drücke den Klingelknopf. Nichts geschieht. Komme ich zu spät? Wahllos hämmere ich auf einige der anderen Knöpfe, irgendwer wird mir schon öffnen. Tatsächlich, nach einer halben Minute schnarrt es und ich trete ein. Mit dem Aufzug fahre ich nach oben.
Die Tür zu Marlas Wohnung steht einen Spaltbreit offen, drinnen brennt Licht.
»Marla, bist du da?«, frage ich. Keine Antwort. Ich schiebe die Tür auf und metallischer Geruch dringt an meine Nase. Durch den Flur schaue ich ins Wohnzimmer, dann nach rechts in die Küche. »Marla?«, frage ich erneut. Nichts. Bis auf das Ticken der Küchenuhr ist es totenstill.
Auf dem Glastisch im Wohnzimmer finde ich ihr Telefon. Das Display ist blutverschmiert. Daneben liegen einige herausgerissene Blätter, als hätte Marla einen Zettelblock in seine Einzelteile zerlegt. Ich trete näher. Was sind das für verschlungene Formen auf dem Papier? Sind die etwa … mit Blut gemalt? Oh Scheiße, Marla, was ist mit dir passiert? Und wo zur Hölle bist du?
Aus dem Augenwinkel nehme ich etwas wahr. Draußen vor dem Fenster bewegt sich irgendwas. Ich trete näher und schaue durch die Scheiben. Kleine Papierstücke flattern durch die Nachtluft. Sie scheinen vom Dach zu kommen. Das Dach! Sie ist auf dem verdammten Dach! Ich öffne die Balkontür und trete hinaus. »Marla!«, schreie ich aus Leibeskräften. »Bist du da oben?« Einer der Papierschnipsel landet unmittelbar vor mir. Ich betrachte ihn näher. Ein seltsames Zeichen ist darauf gemalt, so eines wie auf den Blättern im Wohnzimmer.
Ich stürze in den Flur, haste die Treppe empor und bin vollkommen außer Atem, als ich die Tür zum Dach öffne. Da ist sie! Marla steht im Dunkeln an der Brüstung und hat mir den Rücken zugewandt. Rings um sie liegen zahllose weitere Papierschnipsel verteilt. Ist sie übergeschnappt? Was um alles in der Welt …?
»Was machst du hier oben?«, rufe ich ihr zu. Marla regt sich nicht, sie steht einfach nur da. Eine blutige Spur auf dem Boden führt zu ihr. Ist sie verletzt? »Was ist los mit dir?«, fahre ich fort. »Lass mich dir helfen.« Ich nähere mich ihr und spüre, dass eine Gänsehaut meinen Rücken hinabkriecht. Dann stehe ich direkt hinter ihr und strecke den Arm aus, um sie zu berühren.
»Du musst widerstehen, hörst du?«, flüstert sie. »Du musst stärker sein als ich.« Marla macht einen Schritt nach vorn und steigt auf die Brüstung.
»Was tust du da?«, rufe ich. Ich will nach ihrer Hand greifen, doch es gelingt mir nicht.
Marla fährt herum und sieht mich an. Trotz der Dunkelheit hier oben erkenne ich, dass ihr Gesicht über und über von Blut bedeckt ist.
»Gib dem Verlangen nicht nach«, flüstert sie.
Dann hebt sie die Arme. Übelkeit überkommt mich, ich taumle einen Schritt zurück. Dort, wo ihre Hände sein sollten, sind nur noch abgenagte Stümpfe, Reste von Knochen, die aus den blutbefleckten Ärmeln ihres Mantels ragen. Es sieht aus, als wäre sie von wilden Tieren angefallen worden.
»Sei stärker«, sagt Marla, und bevor ich reagieren kann, lässt sie sich rückwärts fallen.
Ich bin zu schockiert, um zu schreien, zu gelähmt, um irgendetwas zu tun. Dann höre ich einen Knall von unten, Menschen, die panisch nach Hilfe rufen. Endlos scheinende Augenblicke später kann ich mich wieder bewegen und hebe wie in Trance einen der Zettel vom Boden auf. Er zeigt ein seltsames Symbol, ähnlich den anderen, die ich schon gesehen habe. Was haben diese Zeichen mit dem zu tun, was Marla widerfahren ist? Sind sie der Grund oder ein Symptom ihres Wahnsinns? Ich stecke das Stück Papier ein und schleppe mich zurück ins Treppenhaus. Vielleicht kann ich irgendwie herausfinden, was das alles zu bedeuten hat.
Blaulicht flackert durch die Nacht, Dutzende Menschen stehen herum und gaffen. Ich bringe es nicht fertig, einen Blick auf Marlas zerschmetterten Körper zu werfen.
Im Zug sitzend, hole ich das Stück Papier hervor und betrachte es minutenlang. Um mich her geht das Leben weiter, unberührt von dem, was passiert ist.
Mir gegenüber nimmt eine Mutter mit ihrer Tochter Platz. Nur Augenblicke später beginnt das Kind zu weinen. Ich schaue hinüber, lächle und bemerke, dass seine Mutter mich aus großen Augen anstarrt, als hätte sie einen Geist gesehen. Hastig nimmt sie ihr Kind auf den Arm und läuft davon.
Was ist nur los mit den Menschen heute?
»Ey Mann, das sieht ja voll echt aus«, raunzt mir der abgerissene Typ zu, der gerade auf der anderen Seite der Sitzreihe Platz nimmt. »Coole Maske, Mann.«
Was meint er? Ich schaue ihn an. Erst jetzt fällt mir der süßliche Geschmack auf, der meinen Mund erfüllt, lieblich wie der Duft eines Frühlingsmorgens. Unwillkürlich führe ich die linke Hand zum Mund, dann dämmert es mir. Ich halte inne und betrachte meinen Zeigefinger, der bis zum zweiten Glied vollständig abgenagt ist. Der Knochen liegt frei, meine Hand ist blutüberströmt.
»Danke«, erwidere ich. »Ich glaube, das wäre auch was für Sie.« Der Zug hält an meiner Station und ich steige aus, doch nicht, ohne meinem Gegenüber vorher den Zettel zuzustecken.