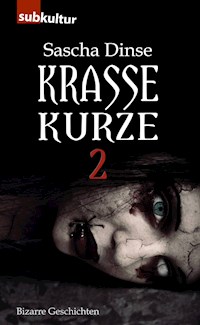
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition subkultur
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sascha Dinse erzählt von den Schrecken, die hinter der Fassade der Wirklichkeit lauern, von finsteren Träumen und vom Abseitigen, das uns schaudern lässt. Seien es dystopische Ausblicke in die Zukunft, verhängnisvolle Obsessionen oder ganz alltägliche Dinge, die urplötzlich ihre grauenhafte Fratze zeigen, sobald die Maske des Normalen fällt – die 29 Kurzgeschichten stellen unter Beweis, dass es nicht vieler Worte bedarf, um Gänsehaut zu erzeugen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sascha Dinse
Sascha Dinse, Jahrgang 1978, ist freischaffender Schriftsteller, Vorleser und Mediensoziologe. Er lebt und arbeitet in Berlin.
Als Autor tritt er zunächst in zahlreichen Horror-, Dark Fantasy- und SciFi- Anthologien in Erscheinung, was dann auch in etwa die Genres benennt, in die man seine Geschichten einsortieren kann, wobei diese meistens fulminant dazwischen passen.
Seine erste eigene Geschichtensammlung »Aus finstrem Traum« erschien bei p.machinery. Die Erstausgabe der »Krassen Kurzen« brachte Sascha Dinse selbst heraus. Nach deren Neuauflage folgt nun bei Subkultur der zweite Teil.
Zudem unterhält Sascha Dinse mit TARTAROS seinen eigenen Podcast, in dem er vorwiegend seine Geschichten vorliest und einen Blick hinter die Kulissen seines Schaffens gestattet.
edition.subkultur.de
Sascha Dinse
KRASSE KURZE 2
Bizarre Geschichten
edition.subkultur.de
SASCHA DINSE: »Krasse Kurze 2« 1. Auflage, Dezember 2020, Edition Subkultur Berlin
© 2020 Periplaneta - Verlag und Mediengruppe / Edition Subkultur Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlinedition.subkultur.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig.
Korrektorat: Laura Alt Covermotiv: wallpapersafari.com (CC-Free Culture License), modified by ToM
Satz & Layout: Thomas Manegold
print ISBN: 978-3-943412-91-8
epub ISBN: 978-3-943412-92-5
Jane Doe
Bethanys Freundin ist ja echt ziemlich spooky«, sagt Vince, muss es fast schreien, »aber, Gott verdammt, auflegen kann sie.«
Vollkommen durchgeschwitzt stehen wir an der Bar, während hinter uns die tanzende Masse mit jedem Titel mehr und mehr in Ekstase gerät. Dominierten zuvor rockige Klänge, so hämmern nun elektronische Beats und entfachen ein wahres Feuerwerk tanzbarer Aggression. Stroboskoplampen und Videoprojektionen tun ihr Übriges, um die Stimmung anzuheizen.
»Liv ist eigentlich ganz nett«, entgegne ich grinsend, »und mal ehrlich, die beiden sind schon ein echt heißes Pärchen, nicht wahr?«
Die Bardame schiebt uns die bestellten Drinks rüber und wir prosten einander bestätigend zu. Während der Gin Tonic meine trockene Kehle hinabrinnt, lasse ich im Takt wippend den Blick über die Menge schweifen. Kaum vorstellbar, dass die ausgelassen Tanzenden dieselben Menschen sind, die ansonsten strebsam und pflichtbewusst Hörsäle bevölkern und buchstäblich alles tun, um einen guten Eindruck bei den Lehrkräften zu hinterlassen. Schön zu sehen, dass unter den perfekten Fassaden doch Menschen stecken.
Irgendwann wurde es einfach Tradition, dass Beth und Robert ihre Geburtstage gemeinsam feiern. Die beiden haben nicht nur wie sonst den medizinischen Fachbereich, sondern noch etliche andere eingeladen und so platzt das Arcane aus allen Nähten.
»Hey.« Ich stupse Vince mit dem Arm an. »Weißt du, wer das da ist?« Ich deute auf eine junge Frau am Rand der Tanzfläche, nur ein paar Meter entfernt. Die meisten der anderen Anwesenden kenne ich oder habe ich zumindest irgendwo auf dem Campus schon mal gesehen. Sie jedoch kommt mir nicht bekannt vor. Und ich bin sicher, dass ich es mir gemerkt hätte, wenn ich ihr zuvor schon einmal über den Weg gelaufen wäre.
»Keine Ahnung«, gibt Vince zurück und zuckt mit den Schultern. »Kann sein, dass ich sie schon mal gesehen habe, aber ich kenne sie nicht. Vielleicht eine von den Erstsemestern.«
In den Minuten darauf ertappe ich mich mehr als einmal dabei, zu ihr rüber zu schauen. Irgendwann treffen sich unsere Blicke und ich sehe ein scheues Lächeln über ihr Gesicht huschen.
»Nun mach schon«, raunt Vince von der Seite. »Geh hin und sprich sie an. So, wie sie dich angelächelt hat, wird sie dir schon nicht den Kopf abreißen.«
Es dauert die Hälfte meines zweiten Drinks, bis ich mich endlich durchringen kann. Ich bin nicht gut in so was und das Herz schlägt mir bis zum Hals.
»Hallo«, sage ich und versuche, deutlich weniger aufgeregt zu wirken, als ich in Wahrheit bin. Irgendwie gelingt es mir sogar, meinen Namen fehlerfrei hervorzubringen.
»Ich bin Jane«, entgegnet sie. »Schön, dich kennenzulernen.«
Verdammt, sie ist hinreißend.
»Gehörst du zu den Medizinern?« Ich deute auf den Pulk tanzender Menschen zu unserer Linken.
»Schätze ja«, entgegnet sie lächelnd, »aber eigentlich bin ich nur zu Besuch. Ich studiere nicht mehr.«
Um nicht allzu aufdringlich zu werden, frage ich nicht weiter nach. Stattdessen gebe ich ihr einen Drink aus, wir unterhalten uns, tanzen, reden, lachen. Die Zeit verfliegt geradezu. Irgendwann berührt ihre Hand die meine, ganz beiläufig, und es dauert keine fünf Minuten, bis daraus der erste vorsichtige Kuss wird.
»Vielleicht sollten wir das woanders fortsetzen«, flüstert Jane mir ins Ohr.
»Ich bin ganz deiner Meinung«, gebe ich zurück. »Meine Bude ist nicht weit von hier.«
Wir stehen auf und mein Blick fällt auf Vince, der den Daumen hebt und mir zunickt. Jane greift nach meiner Hand und wir schlängeln uns durch die Menge zum Ausgang.
»Ich geh schnell unter die Dusche. Schau dich gern um, wenn du magst.«
Jane nickt und ich verschwinde im Badezimmer. Als ich zurückkehre, in frische Unterwäsche gekleidet, steht Jane am Bücherregal und mustert meine Sammlung. Dunkles Haar, das sie zuvor hinter dem Kopf zusammengebunden trug, fällt über ihre Schultern.
»Ich mach mich auch noch mal frisch«, sagt sie und wendet sich mir zu. »Bin gleich wieder da.«
Fünf Minuten später tritt Jane ins Zimmer, nur mit einem um ihren Körper geschlungenen Handtuch bekleidet. Sie setzt sich neben mich aufs Bett.
»Weißt du, es gibt da diese Sache, die ich gern tun würde«, hebt sie an und wirft mir einen Blick zu, in dem Unsicherheit liegt. »Wenn dir das zu schräg ist, sag es, in Ordnung?«
Ich nicke.
»Ich möchte tot sein, kalt und reglos«, flüstert sie. »Und du machst mit mir, was immer du willst.« Sie schaut mich fragend an. »Wär das okay?«
»Klingt gut«, gebe ich zurück. »Woran bist du gestorben?«
»Egal«, erwidert Jane, »ich bin einfach nur eine sehr, sehr hübsche Leiche.« Sie löst den Knoten des Handtuchs und gibt den Blick auf ihren nackten Körper frei. »Hier, siehst du?« Dann nimmt sie meine Hand und legt sie auf ihre linke Brust. Instinktiv zucke ich zurück, ihre Haut fühlt sich an wie Eis. »Kalte Dusche«, grinst sie. »Es soll doch authentisch sein.«
Jane liegt vor mir, die Augen geöffnet und starrt an die Decke. Ich lasse zuerst die Hände über ihre Haut gleiten, dann Lippen und Zunge. Sie ist gut darin, sich nichts anmerken zu lassen, doch als ich mich intensiver um ihre sensibelsten Stellen kümmere, kann auch die blasse Leiche auf meinem Bett ein leises Stöhnen nicht länger unterdrücken. Langsam schiebe ich meine Hand über ihren Bauch und zwischen den Brüsten hindurch nach oben, lege sie auf ihren Mund und drücke sanft zu.
»Du bist tot, schon vergessen?«, flüstere ich. »Die Toten sind still.«
Jane zuckt und windet sich unter mir, doch kein Laut ist mehr zu vernehmen.
»Als du wach wurdest, war sie schon weg?«, fragt Vince überrascht. »Werdet ihr euch wiedersehen? Hat sie vorher irgendwas gesagt?«
»Keine Ahnung«, erwidere ich. »Ich hoffe es. Zumindest weiß sie ja, wo ich wohne.«
»Dafür, dass du so was sonst nicht machst, war das ja mal eine richtig wilde Nummer«, lacht er und haut mir spielerisch auf die Schulter.
In diesem Augenblick betritt Professor Wolfson den Hörsaal, gefolgt von einem Polizeibeamten.
»Meine Damen und Herren, bevor wir mit der heutigen Vorlesung starten«, beginnt Wolfson, »möchte ein Vertreter der Polizei Sie zu einem etwas pikanten Sachverhalt befragen.« Er bedeutet dem Beamten, ans Pult zu treten, und macht sich derweil daran, einen Datenstick in den Präsentationsrechner zu stecken.
»Gestern im Laufe des Tages wurde etwas mit Relevanz für eine aktuelle polizeiliche Ermittlung aus dem Bereich der medizinischen Fakultät entwendet«, kommt der Mann ohne Umschweife zum Punkt. »Die unidentifizierte Leiche einer jungen Frau«, er gibt Professor Wolfson ein Zeichen, der daraufhin ein Foto eines toten, nackten Körpers an die Wand projiziert, »ist vor zwei Tagen der pathologischen Abteilung des Universitätsklinikums überstellt worden, um eine Autopsie durchzuführen. Der örtliche Leichenbeschauer hatte Schwierigkeiten, den Todeszeitpunkt und die Todesursache festzustellen, und wollte daher eine zweite Meinung einholen. Sollten Sie Kenntnis vom Verbleib der Leiche haben, melden Sie sich bitte bei der örtlichen Polizei.«
Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Das Bild auf der Leinwand zeigt zweifellos Jane.
»Verdammt, jetzt erinnere ich mich, wo ich sie schon mal gesehen habe«, zischt Vince neben mir. »Ich war dabei, als sie eingeliefert wurde. Das ist ja total schräg.«
Mein Telefon vibriert. Eine Nachricht von einer äußerst bizarr anmutenden Nummer mit seltsamen Zeichen darin.
»Sehen wir uns heute Abend? Würde mich freuen. J.«
Mein Blick springt einige Male zwischen dem Bild auf der Leinwand und dem Telefon hin und her.
Einen Moment lang bin ich nicht sicher, was ich antworten soll, und ringe mich schließlich dazu durch, das einzig Richtige zu tun.
»Acht Uhr. Ich koche, du bringst den Wein. Bis dann.«
Escape Room
Irritiert lese ich die Nachricht erneut.
»Drei Blumen in einer Vase. Die dritte Blume ist blau.«
Unbekannte Nummer. Was zum …? Ich stecke das Telefon weg. Sicher hat sich jemand vertan. Von meinem Nacken ausgehend, zieht ein stechender Schmerz in meinen Kopf, nur kurz, dann ist es vorüber. Ich stelle die Musik lauter und schließe die Augen. Erneut vibriert das Telefon in meiner Tasche. Reflexartig greife ich danach.
»Schau genauer hin.«
Unbekannte Nummer. Das ist unheimlich. Ich lasse den Blick durch den Metrowaggon schweifen, mustere die anderen Fahrgäste. Erlaubt sich hier irgendwer einen Scherz? Doch woher sollte er oder sie meine Nummer kennen? So unauffällig wie möglich prüfe ich die Sicherheitseinstellungen meines Telefons und aktiviere den Flugmodus. Für den Moment brauche ich keine weiteren komischen Nachrichten.
Der Rest des Weges nach Hause verläuft ereignislos. Ich bin umgeben von müden Gesichtern, die wie Masken erscheinen, abgenutzt und unecht. Mit routiniertem Griff leere ich den Briefkasten und schlurfe die Treppe hinauf.
Später sitze ich am Schreibtisch und sortiere die heutige Ausbeute an postalischen Nichtigkeiten. Werbung, ein Katalog für Inneneinrichtung, eine Einladung zur Eröffnung des nächsten überflüssigen Einkaufszentrums, das Übliche. Einzig ein Brief erregt meine Aufmerksamkeit. Handschriftlich adressiert an mich, doch ohne Absender. Ich öffne ihn und nehme eine Postkarte heraus. Ihre Frontseite zeigt das Foto einer Vase mit drei gelben Blumen darin. Sekundenlang starre ich das Bild an und spüre Unbehagen in mir aufsteigen, das mit jedem Atemzug weiter anschwillt. Der stechende Schmerz kehrt zurück, schneidet vom Nacken her in meinen Kopf und breitet sich bis über die Stirn aus. Ich erhebe mich mühsam, schleppe mich ins Bad und schaffe es gerade noch, den Toilettendeckel hochzuklappen, bevor ich mich übergebe.
Das Mundwasser hat seine liebe Mühe, den Geschmack zu vertreiben, doch kurze Zeit später kehre ich zurück ins Wohnzimmer. Was ist nur los mit mir? Habe ich mir irgendeinen Infekt eingefangen? Mein Blick bleibt an der Postkarte hängen, die noch immer auf dem Schreibtisch liegt. Irgendwas ist anders. Ich trete näher und kann es zuerst nicht glauben. Doch ich täusche mich nicht. Eine der Blumen ist blau. Hinter mir quietscht es. Ich fahre herum und sehe erschrocken, dass meine Wohnungstür einen Spaltbreit offen steht. Mit vorsichtigen Schritten nähere ich mich, lausche, doch bis auf mein aufgeregtes Atmen ist es still. Habe ich die Tür nicht richtig ins Schloss fallen lassen? Für gewöhnlich schließe ich immer ab, sobald ich die Wohnung betrete. Ich spähe durch den Spalt auf den Flur, doch da ist niemand. Langsam schließe ich die Tür, drehe den Schlüssel und frage mich, ob es die seltsamen Ereignisse des heutigen Tages sind, die ihren Tribut zollen. In Gedanken versunken drehe ich mich um. Eine von Kopf bis Fuß in glänzendes Schwarz gekleidete Gestalt steht vor mir. Adrenalin schießt durch meinen Körper, mit einem Mal bin ich hellwach, doch bevor ich irgendetwas tun kann, versetzt mir der Eindringling einen Schlag ins Gesicht, der mich rückwärts gegen die Wohnungstür taumeln lässt. Ich schmecke Blut, das mit dem noch immer nachwirkenden Aroma des Mundwassers eine widerliche Kombination bildet.
»Wer zur Hölle sind Sie?«, brülle ich die Person an, die offenbar komplett in Latex gekleidet ist, selbst Augen und Mund sind bedeckt. Der Statur nach zu urteilen, ist es ein Mann. Verdammt, wie kann er mich überhaupt sehen? Die Gestalt antwortet nicht, sondern stürzt sich auf mich. Ich pralle gegen die Tür, wir wälzen uns keuchend auf dem Boden des Flurs, ringen, meine Fingernägel graben sich in das Material, das sich wie Haut anfühlt. Irgendwann schaffe ich es, die Oberhand zu gewinnen, schlage den Kopf des Angreifers gegen die Tür, drücke den Kerl zu Boden und zerre an der Maske, die sein Gesicht bedeckt. Ich will sehen, mit wem ich es zu tun habe. Entschlossen reiße ich ein großes Stück des schwarzen Stoffs beiseite und halte entsetzt inne. Nichts als blutiges Gewebe kommt zum Vorschein, kein Gesicht, nur Fleisch. Die Gegenwehr des Eindringlings ist erloschen, er liegt jetzt ruhig vor mir und wären da Augen, so sähen sie mich wohl an. Doch da ist nichts. Ich erhebe mich, bebend vor Furcht, und lasse angewidert den blutigen Fetzen fallen, den ich in der Hand halte. Wie in Trance mache ich einige Schritte rückwärts, um etwas Abstand zwischen mich und den Kerl ohne Gesicht zu bringen. Langsam erhebt er sich, greift mit einer Hand nach hinten und schließt die Tür auf. Im nächsten Augenblick ist er verschwunden und mir bleibt nicht mehr übrig, als am ganzen Leib zitternd und fassungslos durch die offene Tür in den Hausflur zu starren. Ich atme einmal tief durch und trete nach draußen. Keine Spur von ihm.
»Alles in Ordnung?«, schallt es gedämpft aus der Wohnung neben meiner. »Soll ich die Polizei rufen?« Ich erkenne die Stimme meines Nachbarn.
»Nein«, erwidere ich, »ist schon gut, danke.«
Während ich mich anschicke, wieder in meine Wohnung zu gehen, klirren hinter mir Schlüssel und die Tür wird geöffnet. Unwillkürlich drehe ich den Kopf und schaue den älteren Herrn an, neben dem ich seit Jahren wohne, ohne mir je seinen Namen gemerkt zu haben. Unter der Maske, die vorgibt, sein Gesicht zu sein, erahne ich zum ersten Mal nichts als einen Klumpen blutigen Fleisches. Ich nicke und lächle, dann betrete ich meine Wohnung und ziehe die Tür hinter mir zu. Erfüllt von einem Gefühl der Erleuchtung trete ich an den Schreibtisch und greife nach der Postkarte. Sie zeigt drei Blumen in einer Vase, die dritte Blume ist grün. Ich drehe die Karte um und lese, was auf der Rückseite geschrieben steht.
»Das beste Gefängnis braucht keine Mauern.«
Mein Blick wandert zum Sessel, der vor dem Fenster steht. Über seine Lehne ist ein glänzender schwarzer Latexanzug gebreitet worden, die dazu passende Maske liegt auf der Sitzfläche. Ich gehe zurück zur Wohnungstür, vergewissere mich, dass sie verschlossen ist, und breche den Schlüssel ab.
Im Badezimmer entkleide ich mich und sehe die Nähte. Sie sind überall. Voller Verachtung betrachte ich das, was ich ein Leben lang für mein Gesicht hielt, bevor ich wutentbrannt beginne, Stück für Stück die faulige Haut herunterzureißen.
Prototyp
Die haben auf uns geschossen!«, presst Saki hervor.
»Hab ich gemerkt«, rufe ich gegen den Lärm, der in das Fahrzeug dringt. Was Sekunden zuvor noch die Scheibe der Fahrertür war, bedeckt jetzt in Form Dutzender Glasscherben meinen Schoß. Mit Vollgas halte ich auf die große bogenförmige Tunneleinfahrt vor uns zu. »Halt das Lenkrad!«, presse ich durch zusammengebissene Zähne hervor.
»Ich kann das nicht!«, erwidert Saki und schaut mich entgeistert an. »Ich bin noch nie gefahren.«
»Guter Zeitpunkt, es zu lernen«, antworte ich und lasse das Fahrzeug führerlos dahingleiten, während ich die rechte Hand auf die blutende Wunde an meiner Schulter drücke und mit der linken die Beintasche zu öffnen versuche. Saki greift nach dem Lenkrad, unbeholfen zunächst, doch kurze Zeit später hat sie den Dreh raus. Ich injiziere mir etwas von dem Serum, das ich für Notfälle immer dabeihabe. Augenblicklich schwindet der stechende Schmerz, meine Sinne werden klarer. »Wer zum Teufel sind die Typen und was wollen sie von dir?«, frage ich und übernehme wieder das Steuer.
»Keine Ahnung«, gibt Saki zurück. Dann schaut sie mich an. »Was meinst du damit, was sie von mir wollen? Ich dachte …«
»Das Ganze sollte ein einfacher Job sein«, erwidere ich und sehe in den Rückspiegel. Wie es aussieht, werden wir nicht verfolgt. »Bring das Mädchen aus der Stadt, keine Fragen, keine Probleme.« Ich fürchte jedoch, dass wir spätestens am Tunnelausgang welche bekommen werden. »Normalerweise ist es nicht meine Art, Fragen zu stellen«, sage ich und schaue Saki an. »Aber für gewöhnlich verfolgt mich bei so einer Sache auch keine Horde bewaffneter Attentäter. Also, warum wollen dir diese Typen ans Leder?«
»Ich weiß es nicht«, antwortet Saki und klingt erschüttert, »im Moment weiß ich gar nichts mehr.« Sie scheint den Tränen nah und ich kann es ihr nicht verdenken. Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass auf mich geschossen wird, doch sie wirkt, als wäre es für sie eine neue Erfahrung. Hinter der Biegung des Tunnels kommt der Ausgang in Sicht. Dann geht alles ganz schnell. Wir jagen aus dem dunklen Schlauch ins Freie und ich sehe gerade noch, was vor uns quer über die Straße gespannt liegt, doch es ist bereits zu spät. Der Wagen gerät ins Schlingern, überschlägt sich, Glassplitter fliegen umher, Saki schreit in Panik, dann prallen wir auf.
Es dauert einige Sekunden, bis ich begreife, dass das Fahrzeug auf dem Dach liegt. Ich schaue neben mich, doch der Beifahrersitz ist leer. Als das Klingeln in meinen Ohren nachlässt, höre ich von irgendwoher einen Schrei, dann noch mal. Saki! Mit aller Kraft schiebe ich mich nach draußen und spüre, wie messerscharfe Glassplitter Wunden in meine Haut schneiden, doch das spielt jetzt keine Rolle. Ein paar Meter weiter sehe ich das Mädchen, das von zwei Männern festgehalten wird und sich nach Leibeskräften wehrt. Ich stemme mich hoch, mache ein paar stolpernde Schritte in ihre Richtung und hoffe, dass ich unbemerkt bleibe. Aus dem rechten Stiefel fördere ich ein Messer zutage, stürze mich wild entschlossen auf einen der Kerle und ramme ihm die Klinge in den Hals. Saki schaut zur Seite, unsere Blicke treffen sich. Mit aller Kraft versetzt sie dem Kerl neben ihr einen Schlag zwischen die Beine und ich nutze die Gelegenheit, ihn mit einem Tritt gegen den Kopf zu Boden zu schicken.
»Bist du verletzt?«, frage ich.
Saki lächelt erleichtert und will antworten, doch mit einem Mal erstarren ihre Gesichtszüge. Ein Zucken durchfährt ihren Körper, lässt sie erzittern wie bei einem Stromschlag. Bevor ich irgendetwas tun kann, sinkt sie zu Boden.
»Saki!«, entfährt es mir und ich knie mich neben sie. »Was ist mit dir?«
Sie atmet nicht, auch ein Puls ist nicht zu fühlen. Fieberhaft suche ich nach einer Verletzung und finde schließlich eine breite Wunde im Nacken, offenbar hervorgerufen durch einen der umherfliegenden Splitter. Funken stieben daraus hervor, ich sehe metallene Bauteile, Drähte und Leitungen unter ihrer aufgerissenen Haut. Oh mein Gott! Sie ist eine … Maschine? Wie ist das möglich? »Schätze, jetzt wissen wir, warum sie hinter dir her sind«, sage ich mit gequältem Lächeln, während ich überlege, wohin ich Saki bringen könnte, um ihr Leben zu retten.
Plötzlich, von einem Augenblick zum nächsten, verblasst alles um uns herum. Die leblosen Körper unserer Angreifer, das zerstörte Auto, die staubige Straße, alles verschwindet und wird ersetzt von schwarzem Nichts. Einzig uns beide umgibt noch schwacher Lichtschein. »Was ist hier los?«, frage ich angsterfüllt.
»Ich weiß nicht mehr, was danach geschah«, flüstert Saki.
»Interpolation der Erinnerungsfragmente vollständig.«- »Transfer eingeleitet.«
Die Stimmen kommen von allen Seiten, als wären sie direkt in meinem Kopf. Meine Augen schmerzen, doch ich kann erkennen, dass eine gläserne Wand mich umgibt. Ich stehe in einer Art Zylinder, der kaum mehr als einen Meter breit scheint.
»Wo …?«, bringe ich krächzend hervor. Eine kleine Maschine schwebt auf mich zu und verharrt auf der anderen Seite des Glases. »Wo ist Saki?«





























