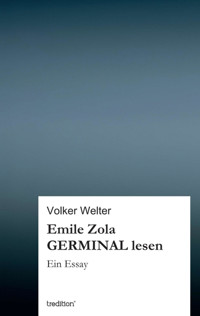
5,49 €
Mehr erfahren.
Zolas Roman GERMINAL übt offensichtlich auch auf heutige Leser noch immer eine große, wenngleich ambivalente Faszination aus. Die Problematik unmenschlicher Arbeitsbedingungen in einer früheren Zeitphase des Kapitalismus, die nach einer bestimmten Lesart im Mittelpunkt des Romans steht, scheint zumindest in den wirtschaftlich fortgeschrittenen Ländern des Westens nicht mehr aktuell und eher von historischem Belang zu sein. Was also erklärt das weiter anhaltende Interesse an diesem Werk? Dieser Frage geht Autor Volker Welter in seinem Essay nach und weist auf den kulturellen Konservatismus der Linken und Elemente der Trivialliteratur in dem Werk als mögliche Erklärungsmuster hin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 41
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Volker Welter
Émile Zola
GERMINAL lesen
Ein Essay
© 2013 Volker Welter
Lektorat: Kay Zeisberg
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-4491-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Einleitung
Zolas Roman Germinal übt offensichtlich auch auf heutige Leser noch immer eine große, wenngleich ambivalente Faszination aus. Die Problematik unmenschlicher Arbeitsbedingungen in einer früheren Zeitphase des Kapitalismus, die nach einer bestimmten Lesart im Mittelpunkt des Romans steht, scheint zumindest in den wirtschaftlich fortgeschrittenen Ländern des Westens nicht mehr aktuell und eher von historischem Belang zu sein. Was also erklärt das weiter anhaltende Interesse an diesem Werk?
Wenn man sich auch auf eine politische Interpretation des Werkes beschränkt, erstaunt doch die Bandbreite der Deutungen Émile Zolas, die vom engagierten Verteidiger der Arbeiterklasse bis zu deren offenen Verächter reicht. Die politische Deutung von Germinal ist jedoch nur eine mögliche Lesart oder Interpretation des Werkes. Die verblüffend vielfältigen Deutungen bewegen sich in einer Zone, die ökologische, feministische, antifeministische, mythologische, psychologische Lesarten zulassen und selbst die Klassifikation als Trivialliteratur nicht vollkommen ausschließen. Sollte sich am Ende die Wirklichkeit, als deren wissenschaftlicher Dokumentar und Ethnograph sich der Schriftsteller Zola (zumindest in seinem Selbstanspruch) sah, als wesentlich ambivalenter und doppelbödiger präsentieren als es in den Intentionen des Autors lag? Ist es nicht vielleicht auch gerade ein Merkmal großer Literatur so viele Bedeutungs- und Interpretationsebenen zuzulassen? Oder sagt die Vielfalt der Lesarten vielleicht mehr aus über die Pluralität und Differenziertheit der heutigen Literaturkritik? Mit anderen Worten: So unwahrscheinlich oder ketzerisch das für manche klingen mag - vielleicht gibt es auch wissenschaftlichen Fortschritt in der Literaturkritik.
Germinal zeichnet sich durch gänzliche Abwesenheit von Humor und Ironie aus. Er ist kein Roman der Moderne. Das gilt in einem technischen Sinne: Es gibt keine inneren Monologe. Es gilt aber auch in einem weiteren Sinne, in dem Moderne verstanden werden kann, nämlich als die Botschaft, dass das Leben, das wir leben, nicht das eigentliche ist und dass unsere Wirklichkeitsvorstellung nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Wirklichkeit umgreift (Engel 1997:333). Existenzielle Grunderfahrungen wie Liebe und Tod machen viele Personen in Germinal, aber diese Personen bleiben eigenartig flach und eindimensional (siehe auch Kommentare heutiger Leser: Roof Beam Reader Juli 2012: 3, 6). Sie sprechen durch zum Teil dramatische Handlungen, aber sie bleiben leer, als ob sie keine Seele hätten. Und irgendwie wäre das dann auch wieder nur konsequent, da die Philosophie der naturalistischen Literatur zumindest in ihrer Verkörperung durch Zola Menschen eindeutig als durch Vererbung und Milieu bestimmt sieht. Aber ist es große Literatur, die da entstanden ist?
Politische und soziale Sichtweise
Im Vordergrund der meisten Interpretationen von Germinal steht der politische und soziale Inhalt, und es wäre in der Tat überraschend, wenn die Geschichte eines Minenarbeiterstreiks, die explizite und detaillierte Beschreibung der schockierenden Arbeits- und Lebensbedingungen der Minenarbeiter und die politischen Debatten und Diskussionen, die im Roman geführt werden, nicht als ein Hauptthema verstanden würden.
Émile Zolas Beschreibung der Arbeits-und Lebensbedingungen stützte sich auf eigene Recherchen. Der zu dieser Zeit bereits berühmte Pariser Literat reiste im Februar 1884 nach Anzin in Nordfrankreich, unterhielt sich mit Minenarbeitern und deren Frauen, besuchte ihre Häuser, nahm an gewerkschaftlichen Veranstaltungen teil und ging selber unter Tage. Der Streik, wie er in seinem Roman beschrieben wird, hat offensichtliche Ähnlichkeiten mit dem Minenstreik in Anzin im Jahre 1866 (Mitterand 2002), und selbst der Einsturz der Grube bezieht sich auf eine reale Katastrophe (Mitterand 2002). Der Bezug auf den Streik in Anzin wird auch dadurch glaubhaft, dass Germinal sich im Jahre 1866 abspielen muss, da der Roman erwähnt, dass die Minengesellschaft vor 106 Jahren etabliert wurde und das Gründungsdatum mit 1760 angegeben wird; wir befinden wir uns also im Jahre 1866 (Ahlberg 2008:6).
Wie stellen sich diese schockierenden Arbeitsbedingungen im Roman dar und in wieweit entsprechen sie der Wirklichkeit jener Zeit? Frauen und Kinder arbeiten in den Minen. Die Arbeit ist noch nicht mechanisiert. Einige Minenarbeiter müssen unter Tage bis zu zwei Kilometer gehen, um an ihre Arbeitsstätte zu gelangen. Die Kohle wird mit reiner physischer Muskelkraft gewonnen. Es gibt kaum Luftzirkulation, die Temperaturen können bis zu 50 Grad erreichen, sodass die Arbeiter und Arbeiterinnen manchmal fast unbekleidet arbeiten (Hallaran 1971:53):
Zola (1974: 353): An der Stelle, wo man hingelangt war, hatten die Schläge eine Durchschnittstemperatur von fünfundvierzig Grad.
Zola (1974: 356): In diesem abgelegenen Gange gab es keine Lüftung. Man sah hier alle Arten von Dämpfen, die mit dem leisen Brodeln einer Quelle aus der Kohle aufstiegen, manchmal so reichlich, dass die Lampen zu erlöschen drohten… diese schlechte Luft …diese tote Luft … unten erstickende schwere Gase, oben leichtes Gas, die sich entzünden und in einem einzigen Donnerschlage alle Werkplätze einer Grube, Hunderte von Menschen vernichten.
Zola (1974:357):





























