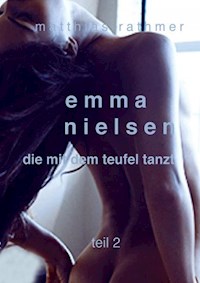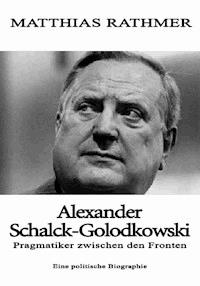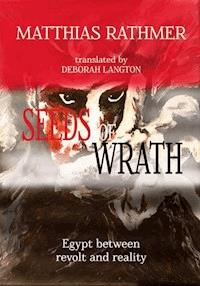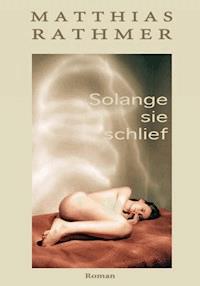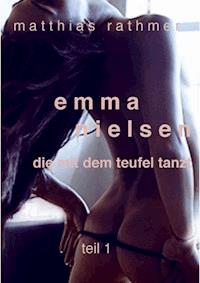
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
sie dachte, sie würde ihr leben schon meistern. irgendwie und irgendwann. so wie eben jeder denkt. und sie dachte, dass die liebe sie einmal für das entschädigen konnte, mit die anderen um sie herum sie immerzu bestraften. wie eben alle so dachten. sie hätte einfach nicht denken sollen. als emma nach einer sonderbaren Begegnung zu entdecken beginnt, dass nichts um sie herum so ist, wie es scheint, sieht sie sich einer herausforderung gegenüber, die genauso überraschend wie wahnsinnig ist. denn wenn ausgerechnet der teufel mit dir tanzen will, solltest du wissen, auf welcher seite du stehst...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Rathmer
Emma Nielsen×Die mit dem Teufel tanzt
Teil I
Informationen und die Möglichkeit für
Reaktionen auf diesen Roman unter
www.emma-nielsen.de
Matthias Rathmer
Emma Nielsen
×
DIE
MIT
DEM
TEUFEL
TANZT
Danken möchte ich vor allem Dir, meine liebe Stephanie, für Deine grenzenlose Geduld mit mir und der deutschen Rechtschreibung, für Deine große Unterstützung und all die Zeit und Mühen, die Du Dir genommen und diesem Projekt so einmalig wohltuend geschenkt hast.
Emma Nielsen – Die mit dem Teufel tanzt – Teil1
Matthias Rathmer
Published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
© Matthias Rathmer, Hamburg
Coverfoto by Joseph N. Tran
ISBN 978-3-8442-3146-5
MEINEN
LIEBEN
ELTERN
und im Besonderen
MEINER
WUNDERBAREN
1
Solange sie nicht sicher war, absolut gewiss, überzeugter als es eindeutiger nicht mehr ging, dachte sie, könnte sie genauso gut eine Bank überfallen, sich dank der Künste des besten Gesichtschirurgen seiner Zunft eine neue Identität zulegen und irgendwo auf der Welt ein neues Leben beginnen. Das Absurde war unwiderruflich zur Wahrheit und damit noch unfassbarer geworden. Sie wusste immer noch nicht, ob sie bleiben oder augenblicklich fliehen sollte. Ihr Leben war in Gefahr. Doch statt nach allgemein gängiger menschlicher Vernunft geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, saß sie in einer Höllenbar im Jenseits, lauschte der wie frisch geölten Stimme von Elvis Presley und trank Cognac.
Der Schmusebarde, zu dessen Lebzeiten ihre Großmutter vermutlich schon in Ekstase gefallen war, hielt alle in seinen Bann. Er hatte eindeutig abgenommen, wie Emma befand. Von alten Fotos kannte sie den King of Rock’n Roll als reichlich abgehalfterte Existenz mit Drogen-, Fress- und Alkoholproblemen. Im Hier und Jetzt machte er einen sehr glücklichen und gesunden Eindruck. Michael Jackson indes hockte allein ein paar Meter vor ihr wie ein Häufchen Elend am Tisch und nippte übertrieben lange an einem Glas Diätcola. Sie überlegte, ihn aufzuheitern, so deprimiert, wie er da saß. Ob er wohl wusste,wie sehr die Menschen ihn auf der Erde immer noch schätzten, und wie viele Millionen Papa mit seinem Tod gescheffelt hatte?
Amy Winehouse, die mit ihrem bürgerlichen Namen gewiss weit weniger Aufmerksamkeit erreicht hätte, wie Emma vermutete, ohne dass sie über diesen Bescheid wusste aber doch annahm, dass kein Mädchen mit diesem Namen wirklich glücklich geworden wäre, schunkelte nur ein paar Meter von ihr entfernt vor der Bühne zur Musik des schmalzigen Schnullis aus den Fünfzigern. Dann und wann versuchte sie sich an einem seiner legendären Hüftschwünge. Dass sie dabei so wenig taktvoll den Inhalt ihres Whiskyglases auf die umsitzenden Gäste vergoss, quittierte sie permanent mit ihrem genauso typischen wie albernen britischen Popgehabe. Jedem Protest der anderen Gäste folgte das wilde Zungenspiel ihres beringten Mundlappens. Regelmäßig glitt sie mit dem gestreckten Zeigefinger ihrer Rechten ihren Schoss entlang. Sie sah abgehalftert aus. Sie war wieder einmal so voll wie die dauerhaft pubertierenden Jungs, die daheim regelmäßig das freie Wochenende begossen. Die arme Amy, dachte Emma. Sie gab sich so, wie sie die Sängerin aus dem Fernsehen kannte. Über jede Peinlichkeit war sie deshalb erhaben, weil der Ruhm ihr Talent gefressen und ihre Scham ertränkt hatte. Sie hatte sich zu Tode gelebt. Sie hatte sich, durfte sie der englischen Klatschpresse trauen, aus dem Leben geschluckt, gespritzt und geliebt. Und zwar geradewegs und unaufhaltsam hierher. In die Hölle. Wo sich augenscheinlich alle trafen, die sich auf der Erde einen einigermaßen tauglichen Starstatus erworben hatten. Wer immer diese Party organisiert hatte – er legte Wert auf eine exklusive Gesellschaft. Normalos mussten draußen bleiben.
Einen Tisch weiter saß Romy Schneider. Püppchengleich starrte sie mit blassem Puderteint wie paralysiert auf den italienischen Welttenor Luciano Pavarotti und die Zwillingsbrüder Robin und Maurice Gibb, die abseits vor der Bühne standen. Die so unterschiedlichen Stimmgewalten bereiteten sich offensichtlich auf den gemeinsamen Vortrag des Songs „Staying Alive“ vor, wenn sie die leisen Gesangsproben der drei richtig vernahm. Als der südländische Teddybär den Mastermind der Bee Gees und dessen kleinen Bruder ob ihrer unverwechselbaren Fähigkeiten der hohen Tonlagen temperamentvoll herzte, drohten beide an seiner breiten Brust zu ersticken. Wie zwei Jünglinge, die sich der Umarmung eines ungeliebten Onkels entziehen wollten, zappelten die schmächtigen Leiber in den Pranken und an den Flanken des wuchtigen Brummers.
Was und wen sie sah, hatte jedes menschliche Maß an Verwunderung und der schleichenden Ohnmacht darüber längst schon überstiegen. Emma war es noch immer nicht möglich, eine Bezeichnung für ihre Verfassung zu finden. In der Hölle war die Seele verloren. Wenigstens darauf konnte sie sich mit ihrem Gemüt verständigen. Mehr und mehr wurde ihr klar, dass es etwas gab, das sich die meisten Menschen zwar erhofften, doch darauf zu setzen nach irdischer Intelligenz reichlich dumm und lächerlich war. Es gab ein Leben nach dem Tod. Ein Teil der ehemals so weltlichen Stars und Sternchen tummelte sich putzmunter und unbesorgt an diesem Ort. Wo wohl all die anderen waren, die sie dazu gemacht hatten, fragte sie sich und wünschte sogleich aus tiefsten Herzen allen Promis der vierten und fünften Kategorie, die seit geraumer Zeit mit ihrem Stumpfsinn nicht unwesentlich für die allgemeine Volksverdummung weiter Teile der Republik verantwortlich zeichneten, ein schönes und vor allem langes Leben. Das fehlte noch, wenn jetzt der Schweiger und die Katzenberger in ihrem Rücken um die Wette quakten.
Sie war tatsächlich in der Hölle. Sie war ohne jeden Zweifel in einem Teil der jenseitigen Welt, die es nach artgerechter Vernunft nicht geben durfte. Ein Agent des Teufels saß an ihrer Seite. Er hatte sie an diesen so außergewöhnlichen Ort geführt. Sie stand auf der Todesliste Luzifers, seines obersten Herrn. Nur, wenn sie durch das ewige Licht flog, in das die Himmlischen einen schickten, wenn man die Abschlussprüfung im Garten Eden bestanden hatte, war sie gerettet. Emmas Sinne und ihre Auffassungsgabe schrien seit zwei Tagen dauergereizt nach einer Ordnung. Ruhe bewahren. Nachdenken. Sehen, sorgfältig darüber urteilen und dann erst handeln. Die eindringlichen Appelle an ihr Bewusstsein bedurften übermenschliche Kräfte.
Jeder, der einigermaßen bei Verstand war, würde in dieser höchst bedrohlichen Situation die Beine in die Hand nehmen und, so schnell er noch konnte, zur nächsten Polizeistation laufen. Die Beamten aber würden sie unverzüglich aus jedem Revier jagen. Um bestenfalls annähernd auch nur den Hauch einer Chance zu bekommen, sich einigermaßen glaubhaft erklären zu können, müsste sie einem der Ordnungshüter ins Gesicht springen, ihn überwältigen, seine Waffe entsichern, wild herumballern und ihn als Geisel halten. Eine Eliteeinheit würde gerufen, ein Mitarbeiter des polizeipsychologischen Dienstes angefordert. Der wäre in der Pflicht, ihr zuzuhören. Danach würde sie sich ergeben, mit dem Ergebnis, für Jahre im Gefängnis oder gleich in einer geschlossenen Anstalt zu landen. Ihre Lage war hoffnungslos, ausweglos wie ein Missstand aussichtloser nicht sein konnte. Abgesehen davon kannte sie nicht einmal den Weg zurück auf die Erde.
Es gab Stunden, die zu erleben so schräg war, dass die, die von ihr darüber hörten, nur müde lächelten und sie für hoffnungslos durchgeknallt hielten. Es gab Momente, die zu erleben so verrückt war, dass einem keiner auch nur ein Wort glaubte, obgleich sie wahr gewesen waren. Und es gab Augenblicke, die zu erleben so unvorstellbar war, dass sie darüber eisern schwieg. Alle diese Erlebnisse kannte sie. Was jedoch gerade geschah, machte es ihr unmöglich, eine Bezeichnung dafür zu finden geschweige denn eine Erklärung. Trotzdem. Sie musste glauben, was ihre Augen sahen.
John Wayne hatte Adolf Hitler soeben ein weiteres Mal ein Bein gestellt. Der Schlächter von einst war zur Sicherheit an einen Windhund angeleint. Das Tier zog ihn quer durch den Saal. Mehrere Gäste beschwerten sich über den Störfall. Zwei Kellner eilten herbei und sperrten den Barbaren vorsorglich zur allgemeinen Sicherheit in den Vorratsraum der Bar, worauf unverzüglich zackige und wütende Proteste aus der Butze dröhnten.
Am Nebentisch hatte Lady Di Platz genommen. Auch sie war real. Leibhaftig saß sie keine drei Meter von ihr entfernt. Auch daran gab es nichts zu zweifeln. Ihre feine Würde in ihrem Gesicht versprühte einen besonderen Glanz. Ihre Schönheit strahlte einem jeden, der an ihr vorbeikam und sie freundlich grüßte, entgegen. Ein englischer Offizier in Paradeuniform begleitete sie. Während die Prinzessin der Herzen einen Manhattan trank, spielte er, smart lächelnd, mit einem Whiskyglas in seinen Händen. Seine Schleimspur war gelegt, dachte Emma und fragte sich, wie sich eine Frau dieses Formats nur von einem solch stocksteifen Feuerkopf ausführen lassen konnte.
Mutter Theresa hatte es sich direkt hinter Diana am Tresen der Bar bequem gemacht. Die Wohltäterin aus Kalkutta hatte lange gebraucht, bevor sie ihre alten Glieder auf einen der Barhocker geschoben hatte. Sie bestellte einen Kamillentee und nahm ihre Hände zu einer Gebetshaltung zusammen, die ihrer Erscheinung etwas Erhabenes verlieh. Patrick Swayze schritt vergnügt an Emmas Tisch vorbei und zwinkerte ihr wie selbstverständlich ein Auge zu, als waren sie gute Bekannte. Ihm folgten eine Hand voll amerikanischer Präsidenten, die sich sogleich beim Oberkellner lautstark darüber beklagten, dass für sie kein Tisch mehr frei war, während Elvis auf der Bühne stand und einen Auftritt hinlegte, für den ihm die halbe Welt zu Füßen liegen würde.
Wohin Emma auch schaute, überall sah sie auf unzählige große und kleine Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die allesamt irgendwann einmal das Zeitliche gesegnet hatten und nun in einem Lokal in der Hölle ihrem Vergnügen nachgingen. Lady Di erhob sich plötzlich ungeduldig. Das Servicepersonal kam wegen der zahlreichen Gäste mit den Bestellungen einfach nicht nach. Entnervt trat die ehemalige Prinzessin an die Theke und orderte zwei neue Drinks. Das war sie, dachte Emma. Das war die Gelegenheit, auf die sie so geduldig gewartet hatte. Sie nahm all ihren Mut zusammen und gesellte sich zu ihr.
„Kein schöner Abend, was? Wissen Sie! Bei Elvis werde ich immer so melancholisch.” Mit Blick auf den Offizier schob sie leiser nach. „Er langweilt Sie, nicht wahr? Es macht jedenfalls den Eindruck.”
„What?” patzte Lady Di sogleich reichlich unzart zurück.
„Ich habe nur gesagt, dass Ihr Begleiter Sie bestimmt langweilt. Es geht mich nichts an, ich weiß. Aber Sie sehen so aus, als wurden Sie zu diesem Date verpflichtet.” Emma hatte sich ihr bestes Schulenglisch aus den Lippen gequetscht.
„I did’nt ask you anything!Let me live my life!” gab sie ihr noch schroffer zurück und gestikulierte ein weiteres Mal ungehalten nach dem Barkeeper.
Ihre flegelhafte Art überraschte Emma. Was für ein eingebildetes Luxusweibchen, dachte sie. Nur, weil nicht sofort alle nach ihrer Nase tanzten, musste sie hier die Oberzicke geben. Die amerikanischen Präsidenten kehrten im Gänsemarsch empört von ihrer gescheiterten Platzsuche im hinteren Teil des Lokals zurück. Van Gogh lief wie angestochen vorbei und fragte jeden nach seinem Ohr, während Rex Gildo freudetrunken in die Arme Max Schmelings fiel.
Im üblichen Gedränge riss Emma plötzlich affektähnlich die Prinzessin mit sich. Noch während beide zu Boden stürzten, hatte sie Lady Di in die linke Brust gekniffen. Auf ihr liegend griff Emma in die hochgesteckten Haare der einst so unbeschwerten Queen in spe und zog kräftig an ihrer frisch gemachten Frisurenpracht. Sie drückte sich mit beiden Händen auf dem königlichen Hintern ab, erhob sich wieder, half auch der Lady auf und bat um Entschuldigung. Im Gegensatz zu vielen anderen wusste Emma um die grundsätzliche Qualität ihrer Reue. Man konnte allenfalls um Entschuldigung bitten. Ob sie erhört wurde, war eine ganz andere Frage. Ron, ihr Begleiter, war aufgesprungen, um zu helfen. Der Offizier eilte zu Diana, die hysterisch herumzukeifen begonnen hatte. Noch einmal entschuldigte sich Emma mit tiefer Verbeugung, bevor der kleine Tumult beendet war.
„Was war das denn?” wollte Ron wissen, der den giftigen Blick des Offiziers nur schwerlich besänftigen konnte.
„Was soll schon gewesen sein? Nichts war. Bin nur gestolpert. Hab mich auch brav entschuldigt, aber Prinzesschen macht gleich ein Attentatsversuch daraus.”
„Lass sie einfach! Sie strahlt zwar unentwegt in die Unterwelt, aber es heißt, dass sie immer noch unter ihrer Depression leidet, ob es je ein Mann ernst mit ihr gemeint hat. Aber pst!” flüsterte Ron ihr zu und führte Emma zurück an ihren Platz.
„Und ich hab nie verstanden, warum sie ihren Charles an diese Camilla verloren hat.” Prüfenden Blickes legte sie nach. „Was die wohl besser konnte, hä?”
„Das willst Du nicht wirklich wissen, glaube ich.”
„Oh doch, Ron Gallagher! Das will ich sehr wohl. Die Zeit ist reif. Für alle Wahrheiten, meine ich. Für restlos alle, um genau zu sein.”
„Böse Zungen,” hauchte er ihr ins Ohr. „Böse Zungen behaupten, dass er... Na ja! Was meinst Du? Woher hat er wohl so große Ohren bekommen?” Ron riss die Augen auf, um seinen Ulk betonen zu wollen.
Emma entließ ihn mit abfälligem Blick. Sie würde lange brauchen, um aus ihm einen einigermaßen tauglichen Lebenspartner zu machen. Sehr lange, und das sollte er auch wissen. Als sie sich wieder gesetzt hatten, schob sie ihren Kopf dicht an sein Ohr. „Versuch es doch mal mit Liebe! Mit tiefer und aufrichtiger Liebe. Das hat sie von ihm gekriegt. Das braucht es, wenn Frauen glänzen können.” Es war weder die Zeit noch die Stätte, wie Emma befand, ihrem Auserwählten ein paar weitere tiefere Einsichten in Sachen wahrhaftiger Emotionen für die dauerhafte Zukunft einer gelungenen Zweisamkeit zukommen zu lassen. Also schwieg sie fortan.
Alle Gemüter hatten sich auch dank Elvis wieder beruhigt. Emma saß auf ihrem Stuhl und blickte eine Nuance gelassener durch den Saal. Wenigstens eine Zufriedenheit hatte sich in ihr eingestellt, resümierte sie ihre kleine Attacke auf die Echtheit all der Existenzen um sie herum. Der Beweisdrang in ihr hatte über jede Lähmung gesiegt. Es wäre völlig gleichgültig gewesen, wen es aus dieser so einmaligen Prominentendichte an diesem Ort erwischt hätte. Sie hätte jeden zu Boden gerissen. Sie hatte wissen wollen, ob sie nicht doch träumte. Sie hatte wissen wollen, ob all die Persönlichkeiten, ob nun wirklich wichtig oder nicht, tatsächlich echt waren. Sie waren es. Sie waren weder aus Wachs, noch irgendwelche Doppelgänger, noch sonst wie geklont. Lady Di hatte sich angefühlt, wie sich menschliche Wesen mit Haut und Haaren nun mal anfühlten. Und wie zur letzten Beweisinstanz gerufen stieß Mutter Theresa sie an die Schulter und reichte ihr ein weiteres Glas Cognac, auf das sie Emma einlud. Auch die berühmte Nonne aus den indischen Elendsvierteln war unbestreitbar wahrhaftig, sah Emma von dem nicht unwesentlichen Umstand ab, dass die tattrige Ordensschwester, wie alle Anwesenden hier, ein munteres Leben nach dem Tod führte.
Emma musterte Ron eindringlich. Er hatte tatsächlich die Wahrheit gesagt. Nichts mehr als die reine Wahrheit. Ihr Leben stand auf dem Spiel. Sie würde tun müssen, was er vorgeschlagen hatte. Sie musste einmal durchs Jenseits laufen, die Hölle hinab, am Inferno vorbei, dem Amtssitz Luzifers, den Berg des Fegefeuers hinauflaufen, bis sie das ewige Licht erreicht hatte. Dann erst war sie den Höllenfürst samt seiner Bande von Riesenschnauzern los. Emma erinnerte sich. Sie war ihm gefolgt. Eine Untergrundbahn hätte sie zermalmt, wenn er nicht gewesen wäre. Mit diesem Tag hatte alles angefangen. In diesen Stunden hatte sie eine Entscheidung getroffen, über deren Konsequenzen sie nicht die geringste Ahnung besessen hatte. Ihre Reise durchs Jenseits, das es entgegen vieler Bekundungen und Lehren also doch gab, sollte eine dramatische Enthüllung werden, die nie zuvor ein Mensch gemacht hatte. Und hätte Emma zu diesem Zeitpunkt bereits gewusst, wer im Hintergrund tatsächlich an den Fäden ihres Schicksals zog, hätte sie sich freiwillig für den Rest ihres Lebens in eine kleine, gemütliche Irrenanstalt eingewiesen.
2
Seit der Zeit, in der sie denken zu können in der Lage war, hatte sich Emma nie rundum wohl gefühlt. Irgendetwas war immer. Noch schlimmer als diese Gewissheit war der Umstand, dass sie, dachte sie über sich und die Welt um sie herum nach, für ihre ständigen Zweifel und seelischen Verkrümmungen nur bedingt selbst verantwortlich war. Emma war es gewohnt, mit ihren vielen Fragen allein und ohne Antworten zu bleiben. Was sie allerdings an diesem Tag im Spätsommer erlebt hatte, überstieg ihre Zweifel und Zerrissenheit um ein überirdisches Maß. Ihr Unterbewusstsein hatte seinen Dienst gleich schon mit Beginn der Ereignisse völlig versagt. Menschliche Vernunft und Phantasie, die Säulen jeder schlüssigen Erklärung, waren erstmals tatsächlich unmöglich geworden. Dabei war der Grund für diesen niemals zuvor so empfundenen Ausnahmezustand ihres aktuellen Ungleichgewichts durch und durch real. Er besaß zwei Beine, zwei Arme, zwei Hände, einen Kopf und zwei herrlich glänzende Mokkaaugen. Dazwischen lagen die verlockenden Merkmale eines Mannes, die, genauso simpel, ihre Hormone in Wallung gebracht hatten. Ein Unbekannter hatte es fürwahr geschafft, ihre Sinne zu reizen und mit seinem Auftreten für die genauso ungewohnten wie prickelnden Schwankungen in ihrem chemischen Haushalt gesorgt.
„Emma! Da bist Du ganz alleine selbst Schuld!” Sie griff eines der Kissen vom Kopfende ihres Bettes und vergrub genauso ratlos wie enttäuscht ihr Haupt. Am Morgen dieses Tages, der ihre Erlösung bringen sollte, hätte sie wie gewöhnlich die Hälfte von sich in ihrer Matratzengruft liegen lassen sollen. Das Leben war einfach nicht fair mit ihr. Wieder einmal.
Der Sommer ihres Lebens, wie sie den Abschnitt von Einsicht und Umkehr bezeichnet hatte, lag in den letzten Zügen. Die Ferien waren vorbei, das letzte Schuljahr hatte begonnen. Der Ernst des Daseins hatte sie wieder voll im Würgegriff. Alles war so, wie sie es kannte, wenn sie von der Befürchtung absah, dass sich ihr Hamsterrad fortan noch ein kleines bisschen schneller zu drehen drohte. Es ging aufs Abitur zu. Für die Zeit, die ihr bevorstand und die andere Leben nannten, hatte sie deshalb für sich selbst ein neues Konzept verfügt, das konsequent allen bisher gemachten Erfahrungen folgte.
„Ich habe mich entschieden. Weil es ganz offensichtlich nichts bringt, nach einem Sinn des Lebens zu suchen, werde ich mir fortan alle Mühe geben, ein Gefühl des Lebens zu entwickeln.”
Oskar hatte an einem der so sehnlich erwarteten leeranstaltsfreien Tage, an dem Emma ihm bei Bier und portugiesischen Tapas im Schanzenpark ihren neuen Kurs offenbart hatte, zunächst verwirrt wie nie drein geschaut, sich dann verschluckt und danach laut gerülpst. Später erst meinte er, dass es zwischen den Menschen immer schon hätte mehr geben müssen als Sex und eine gemeinsame Sprache.
Emma schlug ihre Fäuste in die Kissen. Dieser Tag, der zur Kür in der Zeit ihres Erwachens hatte werden sollen, war gründlich verlebt. Sie griff nach einem von Kaffeesatz verdreckten Handzettel, der an der Pinnwand hing und auf den sie zu schielen begonnen hatte, weil ihrer Lunge nach mehr Luft war. Ihr Urteil war gefällt. Er kam zu kitschig daher, dieser Engel. Er saß auf einer Wolke und lächelte einem so freundlich entgegen, wie es sich wohl die meisten Himmelsfahrer wünschten, wenn sie gestorben und von Gottes Personal in Empfang genommen worden waren.
„Der Mensch ist nur ein Mensch. Weil er liebt. Weil er vergibt,” las sie sich selbst zum wiederholten Male laut vor, als ginge es ihr darum, mit dem Klang dieser Buchstabenreihen ihre Bedeutung besser verinnerlichen zu können.
„Wie soll ich jemandem vergeben, von dem ich gar nicht weiß, ob es sich effektiv lohnt, ihm derart große Geschenke zu machen. Das gehört sich einfach nicht.”
Emma blinzelte angestrengt zurück auf den Diener Gottes. Die Worte des Engels standen auf einem Flyer, den sie vor dem vernichtenden Zugriff der Mutter hatte bewahren können, weil er sonst, ohne ihr Interesse, auf dem Altpapierstapel neben den Bioabfällen gelandet wäre. Immerhin hatte jemand eine Meinung und traute sich ihren öffentlichen Vortrag. Das war selten genug. Der Botschaft dieser klerikalen Hauswurfsendung allerdings konnte sie nur sehr bedingt folgen. Eitel oder narzisstisch wie die meisten im Allgemeinen um sie herum waren, hatte Emma längst aufgehört, anderen vorzugaukeln, dass es bereichernd sein könnte, sie auf ihren Irrfahrten durchs Leben zu begleiten, um entweder zu zweit oder in Ansammlungen ihrer Art doch nur wieder allein zu sein. Emma wollte nicht ungerecht sein. Doch seit langem schon bemäkelte sie den allgegenwärtigen Unsinn menschlichen Handelns. Wider jede Einsicht lebte sich die Mehrzahl scham- und skrupellos aus. Sie taten so, als ginge sie Verantwortung höchstens dann etwas an, wenn sie bezahlt wurde. Dabei kam niemand lebend davon.
„Wer sich für die Warums dieser Welt interessiert, wäre besser dumm geblieben.” Es gab Tage, da reduzierte Emma, hatte sie über die bedeutendsten weltweiten Krisenherde gelesen oder gehört, die Funktion und Daseinsberechtigung der Menschheit allein auf die Umwandlung von Sauerstoff in Kohlenstoff. Über alle anderen Ungerechtigkeiten, über den massenhaften Lug und Betrug in den unzähligen anderen Winkeln dieses Planeten wurde, wie sie mittlerweile begriffen hatte, deswegen nichts gesagt, weil die Berichterstattung darüber entweder manipuliert war, oder Spalten wie Sendeminuten für verblödende Werbung vorgesehen war.
Eine ganze Woche hatte sie in den letzten Frühjahrsferien damit verbracht, Kriege, Katastrophen, Korruption und andere Untaten aus zehn bedeutsamen Illustrierten zusammen zu tragen. Nicht weniger als einhundertzweiunddreißig Ereignisse von Belang hingen schließlich an ihrer Wand, von der einst Robbie Williams seinen Charme als lebensgroße Puzzlegestalt versprüht hatte. Das Leben machte einfach keinen Sinn. Die Menschen machten einfach keinen Sinn. Emma wusste, dass allgemeine Verurteilungen nicht wirklich etwas taugten. Sie veränderten nichts. Sie veränderte mit ihnen nichts. Weil die Defizite vieler einzelner aber in der Regel überwogen, und es keinen gab, zu dem sie hätte aufsehen können, stellte sie die Menschheit als Einheit immer häufiger in Frage. Gute Musik als Ausflug in eine kleine, heile Welt fegte diese Missstände schon lange nicht mehr aus ihrem Hirn.
„Was denkst Du gerade?” hatte sie Oskar gefragt, als sie damals, im nasskalten April, eine ganze Weile schweigend, gelangweilt und genervt nebeneinander im Auto gesessen hatten, weil sich auf der Rückfahrt der Straßenverkehr gestaut hatte. Sie waren ein ganzes Wochenende über auf einem Raverfestival im Brandenburgischen gewesen. Emma hatte diesen Trip deswegen noch so genau im Kopf, weil sie nie zuvor heftigere Ohrenschmerzen und Herzrhythmusstörungen bekommen hatte als während und nach dieser zweitägigen Dauerbeleidigung für ihre Ohren.
Beide hatten bereits in einem der ersten Gespräche, die sie geführt hatten, nachdem sie sich kennen gelernt hatten, vereinbart, dass der jeweils andere zügig und ehrlich zu antworten hatte, wenn einer von beiden diese Frage gestellt hatte. Kein Mensch dachte tatsächlich an nichts.
„Dass neunzig Prozent der Menschen dumm und blöd sind,” war Oskars Antwort gewesen.
„Mehr!” hatte sie sofort ergänzt. „Wenn ich einen schlechten Tag habe, denke ich, dass es weit mehr sind.”
„Das darf man aber um Himmelswillen bloß nicht laut sagen, um nicht ans Kamener Kreuz genagelt und öffentlich mit Katzenkot beworfen zu werden.”
„Kamener Kreuz?”
„Ist da, wo sich die erste und die zweite Autobahn unserer Republik kreuzen. Die, die Hitler einst bauen ließ. Mit all den Dummen und Blöden.”
„Es ist heute genau so,“ seufzte Emma auf. „Neunzig Prozent der Menschen sind wie Knete in den Klauen ein paar weniger. Zerquetscht von Macht und Ohnmacht. Sie sind dumm, ehrerbietig, namenlos, habgierig, zivilfeige und konsumsüchtig. Keine Revolution, kein Krieg, keine Regierung und kein Herrschaftssystem hat daran in den letzten dreitausend Jahren etwas ändern können, nicht einmal die Philosophen, die Künstler, die Denker oder die anderen Großen ihrer Zeit.”
„Stimmt! Mit ihren Büchern und Schriften könnte man im Mittelmeer eine ganze Insel aufschütten lassen, die aber niemand besuchen würde, weil sich dort auszuruhen hart und unbequem wäre.”
„Ja! Es ist zum Beispiel total sinnlos, in dieser Blechlawine nach Hause zu schleichen. Alle wissen es, aber alle tun es trotzdem. Wir gehören ganz eindeutig auch zu den neunzig Prozent. Ich hab es vorher gesagt. Und was war? Nichts war. Wir sind trotzdem gefahren.”
„Schatz! Das nächste Mal hast Du Recht. Ganz gleich, was es ist, ok?” Oskar konnte so herrlich einfach sein. Von allen Sinnlosigkeiten des Lebens, erinnerte sich Emma an dieses Ereignis zurück, war die damalige Schleichfahrt mit ihm noch einigermaßen erträglich gewesen. Sie waren wenigstens vorangekommen, im Straßenverkehr und in ihrer Freundschaft.
Seit Jahren hatte sich Emma stets ein bisschen mehr zurückgezogen. Sie war da. Sie war präsent. Sie atmete. Sie aß. Sie trank. Aber sie war dabei, nicht mehr mit den Menschen zu sein. Solange sie allein war, wurde sie nicht enttäuscht und enttäuschte andere nicht.
„Manchmal ist mir danach, alle meine Habseligkeiten samt Ausweise und Schulbücher öffentlich zu verbrennen, um im Amazonas nach den letzten verbliebenen Exemplaren der Spix-Aras zu suchen.”
„Spix-Aras? Amazonas? Mach lieber erst mal Dein Abitur! Dann sehen wir weiter.” Die Mutter war in existenziellen Angelegenheiten wie dieser ein Totalausfall.
„Spix-Aras, mein liebes Mütterchen, sind die seltenste Papageienart, die es hoffentlich außerhalb der Zivilisation noch gibt. Die Menschen haben sie in ihrem Wahn aber vermutlich schon längst vernichtet, weil sie früher oder später auf alles Schöne erbarmungslos einschlagen.”
Gerne hätte Emma etwas erlebt, was ihrem Wagemut und ihrer Neugierde entsprach, statt sich ständig einer Wirklichkeit stellen zu müssen, die, da war sie sich sicher, oft nicht mehr war als eine Maskerade aus Ängsten und Gewohnheit. Jeder Tag brachte neue Probleme, von denen sie drei bis fünf dieser Unstimmigkeiten mitunter bereits vor dem Aufstehen ereilten. Das Leben war einfach zu kompliziert. Die Welt, in der sie lebte und vermutlich auch die, in der sie leben wollen würde, gab sich jeden Tag mehr Mühe, Realitäten zu verdrängen. Im Verkennen von Wahrheiten waren die Menschen wahrhaft meisterlich.
Auf ihrem schier endlosen Leidensweg musste sie immer wieder an den Rat denken, den ihr Oskar, der mittlerweile zum einzigen wahren Vertrauten in ihrem Leben aufgestiegen war, gegeben hatte. „Tu einfach so, als wärest Du glücklich. Das machen alle so.”
Doch Emma konnte, wenn es um eine gesunde Selbstreflexion ging, weder heucheln noch lügen. Ihr fehlten ganz eindeutig ein paar nützliche Eigenschaften, die ein Mensch scheinbar entwickeln musste, um nicht als sozialer Unrat der Gesellschaft verstoßen zu werden. Wenn Oskar so auf sie einredete, hatte er vorher meistens gekifft. Emma mochte es nicht, wenn er seine Sinne deswegen benebelte, weil er sich selbst für das entschädigen wollte, womit ihn sonst das Leben bestrafte. Abgesehen davon hatte er Recht.
Tagaus, tagein umgab sie eine Wolke der Unzufriedenheit. Sie kannte sich selbst so wenig. Ihre Bedürfnisse blieben ihr meistens ein Rätsel. Deswegen, so mutmaßte sie, war sie auch so leicht zu kränken. Sie war einfach noch nicht bei sich angekommen. „Aber Pst! Das ist ein heiliges Geheimnis. Im Grunde habe ich keine Ahnung, was wir wollen.”
„Wir?” hatte Oskar während einer ihrer unzähligen Unterredungen über Emmas Zustand wissen wollen.
„Na! Ich, so wie Du mich siehst und erlebst, und ich, so wie ich wirklich bin.”
Emma war ehrlich. Vor allem zu sich selbst. Sie besaß mitunter das Selbstwertgefühl eines kleinen Mädchens, aber das durfte niemand wissen. Sie gehörte zur Generation der Verlorenen und Beschwiegenen und war ein Opfer der Revolution, mit der die Frau, die sie geboren hatte, zwar einst die eigene Befreiung gefeiert hatte, als sie sich entschloss, Emmas Erzeuger den Laufpass zu geben. Doch in Wahrheit beklagte die Mutter fortan, so wie sie selbst, den permanenten Verlust von Sicherheit. Mamas ständige Lover schafften auch bei Emma so wenig Vertrauen.
Immer häufiger prägte Müdigkeit Emmas Dasein, ähnlich dem Gefühl, das sie kannte, wenn sie vom Schwimmen kam, alle Glieder schwer wie Blei wogen, weil sie zu lange durchs Wasser geglitten war, um leichter zu sein, als sie tatsächlich war. Die ganze Welt wartete auf den nächsten Hüftschwung. Alle wollten in ihren Spaß- und Spießgesellschaften gleichzeitig ständig etwas erleben und verdrängen. Emma aber hatte lieber ihre Ruhe. Konnte sie träumen, war sie bei sich angekommen. Sie erkundete fremde Landschaften und erlebte aufregende Geschichten, von denen einzig zu beklagen war, dass sie Verlauf und Ausgang stets viel zu schnell wieder vergaß. Hatte sie derart phantasiert, fühlte sie sich anschließend meistens als Heldin, der etwas anzuhaben unmöglich gewesen war. Sie erlebte Momente der Angst, der Qualen aber auch des Glücks und der Stärke.
Schlafforscher hatten keine Erklärung dafür, wenn ihre Hirnzellen im Traum derart verwirrend Informationen austauschten, neue Verknüpfungen eingingen und Reize umwandelten. Ihr Körper entspannte zwar, und ihre Muskeln erschlafften. Ihr Gehirn aber fuhr alle seine Windungen entlang Achterbahn. Schlief Emma, war dieser Zustand allemal erträglicher als die Sinnlosigkeiten um sie herum. Was auch immer elektrische Impulse in ihrem Kopf anstellten, Emma konnte der Welt, wie sie wirklich war, beruhigt den Rücken kehren. Nichts ging sie dann mehr etwas an.
„Möchtest Du vielleicht lieber beten?” hatte Oskar sie einmal gefragt, als sie ihm ihre ständigen Zweifel über das Leben und die Menschen offenbart hatte.
„Beten? Ich habe nicht einmal leidenschaftlich geliebt!”
Mittlerweile war Einsamkeit für Emma ein normales Gefühl geworden. Einzig ihr unerwartetes Eintreten war eine Klage wert. Sie hatte aufgehört, jammrig in ihrem Selbstmitleid zu zergehen. Ihr leichtes Übergewicht hatte Emma in den Griff bekommen. Jede Frau wog zu schwer, hatte Conny ihr, der Erzeuger, wiederholt mit auf dem Weg gegeben. Dafür, dass er sie zusammen mit der Mutter, die nicht wirklich eine war, in die Welt gesetzt hatte, zahlte er Schmerzensgeld. Wenigstens stellte er keine dummen Fragen, die, gleich von wem der beiden Akteure ihrer Zellteilung geäußert, zu beantworten Emma grundsätzlich seit Jahren schon verweigert hatte. Die meiste Zeit verbrachte Emma auf dem Bett und las. Oder sie schlief und träumte in den Tag. Oft döste sie auch nur so vor sich hin und dachte darüber nach, was die Welt brauchte, damit es sich lohnen könnte, ein anständiger Mensch zu sein. Dann hegte Emma einen Verdacht. In ihren Träumen schrie das um Hilfe, was sie im Leben verdrängte.
Emma hätte vermutlich ihr ganzes Leben so langweilig und unerfüllt verbringen können, bis zu jenem Tag im Sommer, der verrückter kaum geraten konnte. Eine Leidenschaft namens Begierde machte gerade das Leben noch komplizierter. Ein außergewöhnlicher Mann war in ihr Leben getreten. Reichlich verwirrt, was ein männlicher Schwellkörper mit ihr anstellen konnte, starrte sie immer noch auf das Antlitz dieses Engels, der auf dem Gemeindebrief in ihre Wohnung geflattert war und zwischen den dicken, weißen Kumuluswolken einer billigen Fotomontage auf sie herunterschaute. Im Himmel war seit geraumer Zeit die Hölle los, schien er ihr sagen zu wollen, je intensiver Emma visionierte, wie es so weit weg von allen Ungereimtheiten auf der Welt bei ihm auf seinem puscheligen Ruhekissen wohl wäre.
Hals über Kopf hatte sie sich in einen Jüngling verknallt, von dem sie wenig bis gar nichts wusste. Sie fühlte sich verflucht. Selbst wenn sie sich eine solche Begegnung immer gewünscht hatte, die sie aus ihrem Muff herausziehen konnte, waren die Ereignisse des Tages so wenig geeignet, sich vertrauensvoll in seine Hände zu begeben. Die Liebe durfte sie einfach nicht blind machen. Nicht, weil etwas schwierig war, wagten viele Menschen es nicht. Weil sie es nicht wagten, geriet es schwierig. Deswegen war sie ihm gefolgt, deshalb hatte sie an diesem Tag die Initiative ergriffen. Wer sich nicht bewegte, bewegte nichts. Und doch waren die vergangenen Stunden völlig ganz anders verlaufen, als sie es sich in ihren Wünschen ersehnt und in ihrem Engagement vorgenommen hatte. So waren sie eben. Die Menschen. Uneinsichtig und unberechenbar.
„Na, was denn? Komm jetzt bloß nicht auf dumme Gedanken!” Weil sie eine für sie unvorteilhafte Reaktion in Betracht ziehen musste, schob Emma mit vorgespielter Souveränität rasch nach. „Ich kratze, beiße und spucke. Außerdem. Ich bin bereits vergeben.” Sie schätzte ihr Gegenüber kritisch ab.
Ron stand regungslos, das rechte Ohr an das Türblatt gedrückt, ein paar Schritte entfernt. Nur kurz hatte er ihre Worte mit abstrafendem Blick als unangebrachtes Geplapper gewürdigt. Etwas anderes interessierte ihn weitaus mehr.
Emmas Irritation wuchs. Sie wusste weder genau, was geschehen war, noch besaß sie eine Vorstellung, wo sie war. Sie hatte zwar keine Angst, dafür hatte sie Ron in den letzten Wochen zu lange beobachtet, als dass zu befürchten war, ein wie auch immer geartetes Unheil fiel nun mit angehend mannhafter Statur über sie her. Die größten Zweifel an der Behaglichkeit ihrer augenblicklichen Situation hegte Emma eigentlich nur, weil sie sich an einem durch und durch ungemütlichen Ort befand, in einem echten Drecksloch nämlich, das Ekel in ihr aufkommen ließ, je länger sie sich mit kurzen Blicken umschaute.
Das Zimmer besaß die Größe einer Hundehütte, wie sie die beklemmende Enge empfand. Alle Wände waren mehrfach laienhaft mit schwarzer Farbe gestrichen. Statt eines Fensters war ein Ventilator in einer der Wände eingelassen worden, der aber schon seit längerem den Betrieb versagte, wie ein gebrochenes Rotorblatt verriet. Eine Glühbirne hing an ihrem Stromkabel von der Decke. Mottenmuff drang widerlich miefend in ihre Nasenlöcher. Staubwolken glitten an den Stuhlbeinen bei jeder Bewegung tänzelnd auf dem Boden hin und her. Auf dem Bett lag nur eine Decke, und die Matratze wies ekelige Flecken unbekannter Art und Herkunft auf. Dazu war es ungenehm heiß. Emma kannte diese gestaute Wärme von der alten Frau Winkler, die in ihrem Haus wohnte. Öffnete sie ihre Wohnungstür, gleichgültig, zu welcher Jahres- oder Tageszeit, wurde man, ging man gerade daran vorbei, von jenen Hitzewallungen förmlich erschlagen. Emma blickte auf ein paar Zeichnungen und das einzige Regalbrett an der Wand gegenüber. Neben ein paar arg verschlissen, uralten Schulheften standen genau drei Bücher standen nebeneinander: das Satanische Manifest, eine Biographie über Karl Marx und ein Lehrbuch der großen Philosophen aus der Antike.
Als sie Ron an diesem Tag gefolgt war, bestand ihre größte Sorge darin, dass er möglicherweise aus dem Osten der Republik stammen könnte, so wie er gesächselt hatte, als sie ihm und einem seiner eigenartigen Kameraden einmal heimlich gefolgt war. Hatte Oskar Recht, drohte genau jetzt dieses Unheil, befürchtete Emma.
Oskar nämlich maß seine Beurteilung über Menschen an dem Besitz ihrer Bücher. „Zeig mir Deine Bücher, und ich sage Dir, wer Du bist.”
Emma wollte sich ihre Bedenken nicht anmerken lassen, und so tat sie, was sie in Situationen wie dieser immer tat, wenn sich Dinge für sie nachteilig gestalten konnten. Sie ging in die Offensive. Immer noch wartete sie auf eine Reaktion, die sie beruhigen konnte.
„Ich habe lediglich bemerkt, dass Du in einem Alter sein dürftest, in dem Du alles für möglich halten solltest,” bemerkte Ron, schloss die Tür und zog sein Shirt aus. Während ihrer Beobachtungen hatte er mehrfach links wie rechts auf den Flur gelinst, zu seiner Beruhigung aber nichts Auffälliges feststellen können. Noch blieben sie unter sich.
„Was ist? Damenbesuche sind hier verboten, wie?”
Ron ignorierte ihre Provokation abermals.
Emma nahm ihn weiter argwöhnisch in den Blick. „Wenn Du glaubst, dass ich auf Entführung, Höhle und Urmensch stehe, muss ich Dich enttäuschen. Außerdem. Ich sagte doch. Ich bin bereits vergeben!”
„Vorsicht! Je höher der Affe klettert, desto mehr sieht man von seinem Hintern!” Ron ging zum Schrank und griff ein neues Shirt. Der eigentlich einfache Vorgang kam einem Jonglier- und Kraftakt gleich, denn der klapprige Holzspint kippte zunächst sowohl nach vorne wie auch zu beiden Seiten bedrohlich zunächst von links nach rechts, dann auf und ab und obendrein noch ein weiteres Mal zurück von der rechten auf die linke Seite.
Emma war abermals verblüfft, aber nicht etwa, weil sich ein Junge vor ihr entblößte. Da hatte sie schon ganz anderes gesehen. Peinlich sorgfältig und geglättet lagen dutzende identische Shirts übereinander gelegt. Alle waren noch neu verpackt. Genauso viele Jeans stapelten in gleichem Zustand daneben. Unzählige Paare schwarzer Socken lagen auf dem Schrankboden griffbereit.
„Jeden Tag trägst Du diese Klamotten. Immer die gleichen. Aber hip ist ganz eindeutig etwas anderes.”
Ron ließ sich nicht stören. „Hip?”
„Ja! Hip!”
„Was bitte meint hip?”
„Wie, was meint hip?”
„Wie, wie, was hip meint?”
Eine neue Irritation machte sich in ihr breit. Wollte er sie allen Ernstes mit seiner vorgeschobenen Unwissenheit necken? Jeder Mensch jenseits des Kindergartens wusste, was dieser Ausdruck bedeutete. Ron aber schaute sie derart glaubhaft tief fragend an, dass zumindest der begründete Verdacht bestand, ihm zuzugestehen, tatsächlich nicht zu wissen, was hip meinte. Außerdem war es weise und vorausschauend, etwaigen Handgreiflichkeiten gegen Leib und Seele dialogreich zuvorzukommen. „Angesagt. In. Hip eben.”
Er schüttelte verständnislos den Kopf. „Mit diesen Klamotten, wie Du sie nennst, bin ich in der Lage, mich zu entmaterialisieren. Mich aufzulösen.”
„Sicher! Geht klar. Das verstehe ich! Was sonst?” Emma inspizierte noch einmal das Zimmer mit seiner kargen Einrichtung, ohne dabei Ron auch nur für eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Ihr Blick fiel auf die Graphiken, die alte Damen im englischen Ambiente zeigten und wenigstens einen Hauch Wertschätzung für persönlichen Besitz vermittelten, auch wenn geschmackvoll etwas anderes war.
Ron hatte ihr Interesse an der Kreidezeichnung vernommen. „Das einzige, was mir geblieben ist. Von meiner Mutter. England, achtzehntes Jahrhundert. Siebzehnhundertneunundfünfzig, um genau zu sein.”
Emma pflichtete ihm bei, so, als war seine Erklärung das Selbstverständlichste auf der Welt.
Immer mal wieder beobachtete auch Ron sie aus den Augenwinkeln heraus, was Emma ihrerseits genau registrierte. „Nichts ist, wie es scheint. Wenn Du das erkannt hast, hast Du keine Probleme mehr.” Er genoss seine Überlegenheit, wie Emma vermutete, verharrte aber wieder für einen kurzen Moment aufs Neue, um zu hören, ob sich hinter der Zimmertür nicht doch etwas tat.
„Moment! Ich habe kein Problem. Aber sollte ich eins bekommen, hast Du auch eins.” Sie bespitzelte ihn weiter eindringlich. „Und jetzt mal das Schnitzel aufs Brötchen. Wo sind wir hier wirklich?”
Ron verharrte plötzlich, lauschte angestrengt ins Nichts und entzog seinem Körper erneut jede Anspannung. „Wie ich schon sagte. Du befindest Dich im sechsten Agententrakt der Unterwelt. Und ich sagte, dass Du leise sein sollst!” Er stand vor ihr und taxierte sie derart von unten nach oben und wieder zurück, als suchte er nach einem Makel an ihr.
Emma rutschte nervös zurück. Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Wand. „Richtig! Ich vergaß,” entgegnete sie im Flüsterton und legte mit leichter Ironie nach. „Die Schwellenwächter dürfen ja nicht wissen, dass ich hier bin.”
„So ist es! Aber bitte! Nimm es nicht persönlich!”
Sie verfolgte, wie er Hose, Socken und Schuhe wechselte. Sie blickte auf einen tätowierten Dreizack, der Rons Oberarm zierte. Als er sich zu ihr setzte, verspürte sie eine ungewöhnlich starke Körperwärme, die von ihm ausging. Emma wurde noch unbehaglicher. Dieser Typ würde sich nicht wirklich an ihr vergehen, oder doch? Hatte sie sich derart getäuscht? Ron legte den Zeigefinger auf seinen Mund. Von draußen waren Schritte zu hören, die sich aber zu seiner Beruhigung wieder von dem Zimmer entfernten.
Um die Stille zu durchbrechen, mehr aber, um ihren vermeintlichen Mister Right von möglichen Übergriffen abzuhalten, fasste Emma in bestem Oberlehrerton zusammen. „Ok! Du erzählst mir die Geschichte, dass ich in der Hölle bin. Dass wir durch ein Zeitfenster hierher sind. Und weil niemand wissen darf, dass ich hier bin, hast Du mir, galant wie Du bist, eine Decke über den Kopf gezogen und mich in dieses zauberhafte Gemach überführt.”
Ron wusste, wie unwahrscheinlich es war, dass sie ihm auch nur einen Hauch Glauben schenkte. „So ist es!”
„Ups! Ein Heiratsantrag geht irgendwie anders.”
„Es war schon dumm genug von Dir, mir bis in den Tunnel zu folgen,” bemerkte er beiläufig. „Glaub nicht, ich hätte nicht gemerkt, dass Du schon seit Längerem wie eine Schlange um mich herumschleichst.”
„Ach ja? Wer hat denn mit diesem blöden Versteckspiel angefangen? Oder glaubst Du wirklich, ich wollte meinem Leben tatsächlich in einem schäbigen Bahnschacht ein Ende setzen? Allein und ohne jedes Publikum. Auch noch Deinetwegen?” Emma stieß salopper nach. „Nicht mein Stil.”
„Du glaubst mir nicht. Noch eingebildeter ist, dass Du es nicht einmal versuchst.” Ron kramte einen Siegelring aus der alten Hose hervor und steckte ihn auf den Ringfinger seiner rechten Hand. Das Abbild einer umgekehrten Pyramide blitzte Emma für einen Moment funkelnd entgegen.
„Mal ehrlich! Wie würdest Du reagieren, wenn Dir jemand erzählt, er ist ein Agent des Teufels, der sich und den Körper anderer auflösen kann, der auf der Erde ist, um Böses zu stiften, weil das seine unliebsame Mission ist, miese Filme verleiht und die Kids aus Deiner Straße mit noch viel mieseren Spielen im Netz versorgt, die neben Mord und Totschlag nur Mord und Totschlag kennen?” Wieder schob sie rasch nach. „Nein! Ron Gallagher. Ich glaube Dir in der Tat kein Wort.”
„Solltest Du aber,” antwortete Ron gelassen in einer Sprache, die für Emma wie Englisch klang.
Plötzlich drang ein lautes Schnauben vom Flur ins Zimmer. Ein Fauchen folgte.
Emma blickte zunächst fragend auf die Tür, dann auf Ron, der angespannt verharrte.
Er sah auf seine Uhr. Rasch umgriff er ihre Hüfte und zeigte ihr energisch ein zweites Mal an, still zu sein.
Momente später, als Emma erneut seine ungewöhnlichen Hitzewallungen verspürte und einen endgültigen Versuch befürchtete, sich ihr doch noch unangenehm zu nähern, lag sie allein daheim in ihrem Zimmer auf ihrem Bett. Sie war ohnmächtig geworden, kam nur langsam wieder zu sich und schreckte schließlich verstört hoch.
Der ersten Erleichterung, unversehrt an einem ihr bekannten Ort zu sein, folgte zunehmende Verwunderung. Was um Himmelswillen war geschehen? Von Ron war weit und breit weder zu sehen noch zu hören, unter dem Bett nicht, im Kleiderschrank nicht. Nirgendwo.
„Und? Wie war Dein Tag so?” Die Mutter schob ihren Kopf durch die Zimmertür, als sie von der Arbeit gekommen war, erst nach Emma gerufen hatte und dann, ohne anzuklopfen, wie sie das immer tat, unverschämt gedankenlos in Emmas Privatsphäre eindrang.
Emma lag auf ihrem Bett und starrte an die Decke. „Ging so! Und Deiner?”
„Ging so.” Die Mutter schritt ins Bad.
Emma vernahm neben der belanglosen Frage nach der Schule, wie ihre Mutter kundtat, dass sie nach dem Yogakurs ihre Freundin Betty treffen werde. Ihr war klar, dass ihre verbliebene Erziehungsberechtigte in Wahrheit einen neuen Lover daten würde. Die arme Betty, eine angeblich alte Freundin, die Emma aber schon seit Monaten nicht mehr gesehen hatte, musste für derlei Vertuschungen der mütterlichen Bedürfnisse schon seit geraumer Zeit herhalten.
Ihre Mutter war einfach nur Mutter, ohne Namen also. Emma selbst bemäkelte innerlich diese so unpersönliche Bezeichnung ihrer hauptsächlichen Erziehungsberechtigten. Sie tröstete sich damit, dass es allgemein üblich war. Wurden Kinder älter, benannten die meisten ihre Eltern in der Regel nach ihrer biologischen und sozialen Funktion. Das Recht auf einen Vornamen war ihnen damit ein Leben lang genommen. Emma kam es so vor, als führte ihre Mutter als Christiane ein zweites, ihr völlig fremdes Leben.
Wie vieles andere auch, hatte es Emma am Ende ihrer Auseinandersetzungen irgendwann einmal unbewegt gelassen. Heute erst recht. Nachdenklich schritt sie durch das Zimmer. Sie hatte die Überlegungen verworfen, dass Ron ihr vielleicht etwas verabreicht hatte, ein Medikament oder eine Droge sogar. Sie konnte sich nicht daran erinnern, also musste es etwas anderes gewesen sein. Emma schmiss sich zurück auf das Bett und konnte immer noch nicht begreifen, was geschehen war. Hatte sie einen dieser hässlichen Tagträume gehabt? Hatte sie Halluzinationen? War sie auf dem besten Weg, endgültig verrückt zu werden? Ein Typ namens Ron Gallagher hatte sie vor einer einfahrenden Untergrundbahn gerettet. Ein Typ namens Ron Gallagher hatte sie anschließend in eine Art Verlies verschleppt, und der gleiche Typ hatte ihr diese wirre Geschichte erzählt, er sei seit Jahrhunderten schon ein Agent des Teufels samt dieses ganzen anderen Klamauks zwischen Witz und Wahnsinn.
Emma schloss die Augen. Sie rang mit ihrer Konzentration, sich in ihren Erinnerungen sorgsam genau den Ereignissen des Tages zu nähern, denn dass etwas Außergewöhnliches geschehen war, lag genauso auf der Hand wie nicht einschätzen zu können, wer dieser Bursche namens Ron Gallagher wirklich war. Ernüchterung stellte sich sogleich ein, denn würde sie, wem auch immer, von dieser Begegnung erzählen, hätte sich ihre kleine Liebelei vermutlich rasch erledigt. Jede Frau, gleichgültig welche Stärken und Schwächen sie selbst besaß, schätzte die Kunst des Verführens, die charmante Eroberung, den Kniefall von Stärke. Von allem war ihr Auserwählter jedoch noch weiter entfernt, als es das Leben bislang gut mit ihr gemeint hatte. Das passte, dachte Emma. Für ihr kleines Glück musste sie wieder einmal hart und ausgiebig kämpfen.
Am weitesten war Emma de facto von der Wahrheit entfernt. Und hätte sie auch nur geahnt, welches Abenteuer für sie an diesem Tag begann, sie hätte ganz sicher einen großen Bogen um diesen Ron Gallagher samt seinem Laden gemacht. Sicher. Sie war von vielem um sie herum oft gelangweilt. Eigentlich sogar von allem und so ziemlich jedem, wobei es Emma selbst für krankhaft gestört hielt, dafür nicht einmal eine plausible Erklärung zu haben. Ihre Neugier war ihr wohl schon ins Ökobettchen gelegt worden, wobei Emma nicht klar war, von welchem Elternteil sie dieses ausgesprochen ausgeprägte Gen in sich erworben hatte. Na, und Angst. Angst hatte Emma schon lange nicht mehr gehabt. Bei allen Missständen in ihr und um sie herum hatte Emma sich selbst und ihr Leben recht passabel im Griff. Das jedenfalls dachte sie. Bis zu diesem Tag.
Wann genau dieser Ron Gallagher in ihrem Wohnviertel aufgetaucht war, wusste Emma nicht mehr. Unversehens war er plötzlich da gewesen, so überraschend wie ein nicht gewollter Pups ins Höschen in völlig unangebrachter Situation, mit dem Unterschied, dass er sich nicht gleich wieder nach wenigen Momenten verflüchtigt hatte. Die vulgäre Sprache ihrer Freundin Maike, mit der sie Rons Auftauchen damals beschrieben hatte, missfiel Emma oft genug. Doch dieser Vergleich war durchaus treffend. Das, was sie wusste, war ihr dagegen sofort klar. Sie hatte sich mit dem ersten Blick in ihn und seine dunklen Augen verknallt. Das und nur das war der Grund, warum sie diesen Burschen endlich näher kennen lernen wollte. Außerdem war Eile geboten. In der Schule und auf der Straße sprachen immer mehr ihrer geifernden Konkurrentinnen über ein Geschenk namens Ron. Fabelhafte Jungs fielen nun mal nicht jeden Tag vom Himmel.
An diesem Tag war im Grunde alles so, wie es immer gewesen war. Emma hatte verschlafen, was zur Konsequenz hatte, dass sie zu spät in der Leeranstalt war und die erste Stunde vor der von innen verschlossenen Tür des Unterrichtszimmers verbrachte, weil der Kunstlehrer diese Sanktion für pädagogisch wertvoll hielt. Vielleicht war es das, wessen Emma seit geraumer Zeit so genervt und gleichzeitig gelangweilt war. Ihr ganzes Leben war mit eben diesen Sanktionsprinzipien belegt. Was sie hingegen gut verrichtete, war selbstverständlich, wurde wenig gelobt und blieb folgenlos. Machte Emma aber auch nur einen kleinen Fehler, wurde sie dafür sofort bestraft, unabhängig ob Zuhause, in der Schule, im Straßenverkehr oder im Umgang mit den Jungs ihrer Jahrgangsstufe. Die benahmen sich ihr gegenüber bisweilen unausstehlich, auf jeden Fall stets seltsam.
Schüchterne schickten ihr diffuse Kurzmitteilungen oder verkappte Freundschaftsanfragen. Muntere luden sie zu einem Eis oder ins Kino ein. Wirrköpfe drückten ihr auch schon mal in der großen Pause einen Kuss auf die Lippen und rannten davon, und die Unverschämten bepöbelten sie, sie bereits gehabt zu haben. Allen war gemeinsam, dass sie sich Emma in mehr oder weniger peinlicher Manier nähern wollten. Stil besaß keiner von ihnen. Noch konnte sie sich standhaft erwehren. Doch Emma wusste. Es war an der Zeit, sich einen Freund anzuschaffen, schon allein, um alle diese Attacken schlagartig zu unterbinden. Zu dumm nur war, dass ihr in ihrem Umfeld noch keiner dieser Jungs so gefallen hatte, wenigstens zum Schein mit einem dieser post-pubertären Jünglinge zu gehen, um sich zusätzlich dem dämlichen Gerede ihrer angeblichen Freundinnen zu entziehen. Ohnehin hatte sie weitsichtigere Pläne. Sie wollte einen richtig coolen Kerl an ihrer Seite, einen Mann, um den alle sie bis in alle Ewigkeit beneideten, einen, der selbst dann noch zum aufregendsten Gesprächsthema geriet, wenn aus ihnen senile und schrumpelige Greisinnen geworden waren.
Vor ihrer gewohnt vormittaglichen Leere hatte die Mutter zu einem ihrer üblichen Rundumschläge gegen Emma ausgeholt, zugeschlagen und getroffen. Seit langem schon stritt sich ihre Mutter, wie Emma sich selbst zu erklären versuchte, am liebsten mit ihrer Tochter, um die eigenen Defizite im Leben diskutieren zu wollen, weil sonst niemand da war. Emma hatte ihren Widerstand auch dagegen irgendwann aufgegeben. Sie war die ständigen Vorwürfe schlichtweg leid geworden. Emma kam ihren Pflichten nicht nach, auf sie war kein Verlass. Emma half nicht im Haushalt, Emma machte keine Schulaufgaben, Emma war nie pünktlich. Emma hielt keine Ordnung, Emma träumte ständig vor sich hin. Das mütterliche Zeugnis über die alltäglichen Belange im Zusammenleben mit ihrer Tochter ergab ein ziemlich vernichtendes Urteil, seit Monaten ständig lauter und vehementer vorgetragen.
Nicht alle diese und viele andere Vorwürfe mehr nervten Emma. Sie hatten ja durchaus die eine oder andere Berechtigung, wenngleich Emma für jede Verfehlung auch immer eine wichtige Erklärung oder Entschuldigung abgeben konnte. Es waren die Beschränkungen der Mutter, also wieder jene Sanktionen, die stets dem großen Ärger der Mutter folgten und in einem krassen Missverhältnis zu ihrem Alter und Geist standen. Das Handy war plötzlich weg oder die Tastatur des Computers versteckt. Kam es ganz schlimm, strich die Mutter das Taschengeld. Kam es richtig schlimm, verbrachte sie das ganze Wochenende ohne jede Pause mit Emma und versuchte, mit laienhafter Psychologie Phänomene zwischen Gewohnheiten und Ängsten zu enttarnen, Unternehmungen, die genauso unausstehlich wie zwecklos waren, weil die Mutter zuallererst selbst an allem litt. Strengere Strafen verstärkten den Protest und Widerstand Emmas, mit der Folge, dass die Mutter ihrerseits noch aufgebrachter reagierte. Irgendwie konnte oder wollte sie nicht akzeptieren, dass Emma kein kleines Mädchen mehr war, sondern eine moderne und junge Frau, die seit geraumer Zeit ihr Leben selbst in die Hand genommen hatte.
Emma jedenfalls hatte sich schon lange damit abgefunden, der Sündenbock in der untersten Gruppe aller Kleinfamilien zu sein. Sie war unverschuldet Einzelkind und dazu das Ergebnis nicht gewollter Familienplanung, ein echtes Problemkind eben, wie sie ihrer selbsternannten Erziehungsbeauftragten ihre Sicht auf Geburt und Prägung zu erklären versucht hatte. Dass sie seit nunmehr fast achtzehn Jahren allein von ihrer Mutter auf alle Prüfungen des Lebens, also auch auf diese ständigen Vorwürfe selbst, vorbereitet worden war, und dass auch die dabei den einen oder anderen Fehler gemacht hatte, war anzumerken wiederum genauso zwecklos wie zermürbend.
„Was soll ich tun? Soll ich mich etwa umbringen?” Emma hatte wie so oft erbost die Wohnungstür hinter sich zugeknallt. Natürlich zog Emma diese letzte Konsequenz auf all die vielen Missstände, Entbehrungen und Sehnsüchte nicht wirklich in Betracht. Aber es war nun mal ihre Art, die finalen Ergebnisse ihrer vielen Dispute auch beim Namen zu nennen, was an diesem Morgen bedeutet hatte, der Mutter klar zu machen, dass es in ihrem Fall der ewigen Streitereien vermutlich keine andere Lösung gab. Zwei war einer zu viel. Emma und ihre Mutter sprachen schon lange nicht mehr eine Sprache. Das Ende ihrer einstigen Vertrautheit war längst schon erreicht.
Einmal hatte Emma ihr einen Zeitungsartikel aus dem Altpapierstapel auf den Tisch gelegt. Als die Mutter darin über eine dreizehnjährige Schülerin las, die beim Oralverkehr mit einem Mitschüler gefilmt wurde, und diese Aufnahmen im Internet zu verfolgen waren, saß sie eine Woche später ihrem Schuldirektor gegenüber. Dass Sexualdelikte und Gewalt neben dem Webphänomen Cyber Mobbing in den meisten Leeranstalten unentwegt führend an der Tagesordnung waren, wollten oder konnten beide nicht verstehen. Happy Slapping verwechselten ihre Mutter und Lehrer doch allen Ernstes mit einem Modetanz, als Emma sie danach fragte. Tatsächlich schlugen sich die Kids unter diesem Namen immer noch regelmäßig die Köpfe und mehr ein.
Sex, Drogen und Peinigung jeder Art in einer zwölften Klasse – Exzesse dieser Art waren vielen Eltern und Pädagogen genauso fremd wie die Vorstellung vieler Schüler, ihre Erziehungsberechtigten könnten sie und ihre wirklichen Probleme irgendwann einmal verstehen. In Emma reifte so mehr und mehr die Einsicht, dass in Leeranstalten wie der ihrigen all jene Probleme offen zu Tage traten, die daheim in den Wohnzimmern ihren Ursprung hatten, jedem Sinn zum Trotz an beiden, für die gelungene Sozialisierung eines jungen Menschen so wichtigen, Orten aber verschwiegen wurden. Daran war nichts zu ändern, genauso wenig, wie zu hoffen, Leeranstalten und ihr Personal könnten die familiären Defizite kurieren. Töchter und Söhne wuchsen so, auch dank der elterlichen Dummheit und Ignoranz, im sexuellen Niemandsland auf, und auch die vielen anderen Dinge des wahren Lebens färbten nicht irgendwie auf sie ab. Emma blieb, wie viele ihrer Leidensgenossen, mit den meisten ihrer Fragen allein. Dafür stritt die Mutter über Hausaufgaben, Haushaltshilfe und Unpünktlichkeit.
In der Schule war es an diesem Tag gleichfalls so gewesen, wie es jeden Tag war. Langweilig. Eigentlich war Emma eine gute Schülerin. In Mathe und Deutsch stand sie glatt auf zwei. Ihr Französisch war befriedigend. Nur Englisch machte Emma Mühe. Gehörige Mühe. Für Emma aber war klar, dass dieser Missstand, wenn er denn tatsächlich zu diesem frühen Zeitpunkt im neuen Schuljahr einer werden sollte, einzig und allein an diesem Leerkörper lag, der vor ihr gestanden und sie gefragt hatte, was Erkenntnis auf Englisch hieß. Wie peinlich, derart vorgeführt zu werden, hatte Emma gedacht und beschlossen, wie ihr ein paar Schulfreundinnen bereits erfolgreich vormachten, zum nächsten Englischunterricht ebenfalls eine Bluse zu tragen, die mit zwei oder drei Knöpfen zu weit geöffnet war. Das vermied die neuerliche Auswahl beim Abfragen der Vokabeln für mindestens zehn Schulstunden und garantierte obendrauf, eine halbe bis ganze Note höher zu klettern, je nach Brustumfang. Auch so waren sie, die Menschen. Every sex sells.
Emma hielt sich im Unterricht meistens zurück. Sie mochte es nicht, sich aufzudrängen, wenn Lehrer ihre Fragen stellten und alle, die die Antwort wussten, wie irregeworden mit ausgestrecktem Arm die Finger knipsten, oder gruppendynamischer Unterricht mit Kompetenzrastern einfach nur nervte, weil meistens Emma die ganze Arbeit erledigte. Mit Mona und Maike war sie befreundet. Kalle wollte mit ihr schon seit einem Jahr gehen und schrieb die zweihundertneunundachtzigste Kurzmitteilung, um Emma auf diese einmalige Verbindung vorzubereiten. Das nervte genau so, wie der ewige Gossip-Girl-Talk der anderen Mädchen über Lady Gaga und die Stars der Republik, die in den Verdummungsshows diverser Privatsender nicht wirklich welche waren und wegen ihres Stumpfsinnes auch niemals welche würden werden können.
Alles in allem aber, abgesehen von diesem Hohlkopf von Englischlehrer, der stets die unmöglichsten Socken zu noch unmöglicheren Billigjeans trug, genoss Emma, wie sie für sich reflektierte, bei allen anderen Leerkräften in dieser Anstalt ein ordentliches Ansehen. Sie war seit ein paar Wochen im letzten Schuljahr. Bis zum Abi war also noch Zeit, sich zu bessern. Auch für diesen Englischlehrer.
Kalles Bemühungen um sie kamen Emma im Grunde ganz recht. Länger schon zog sie in Betracht, sich das eine oder andere Mal mit ihm in aller Öffentlichkeit sehen zu lassen, dann aber sofort wieder den Rückzug anzutreten, um den ihn in eine endlose Warteschleife zu schicken. Emma hätte endlich vor den vielen anderen Kerlen ihre Ruhe. Zum Glück aber war Ron in ihr Leben getreten, hatte Emma zwischen Tucholsky und Integralrechnung beseelt geschwelgt und vor sich hingeträumt, wie es sich wohl anfühlte, in seinen Armen zu liegen. Allein der Stundengong war in der Lage gewesen, sie aus ihren süßen Träumen zu reißen.
Emma war wieder einmal pleite. Die Mutter hatte die neue Haushaltssperre verfügt, weil sich Emma am vergangenen Wochenende bis tief in die Nacht auf dem Hamburger Kiez herumgetrieben hatte, obwohl sie die Ausgaben dieses Amüsiertrips für die Anschaffung neuer Schulbücher benötigte. Deswegen und nur deswegen war es nötig gewesen, sich nach der Schule einem Nerv der besonderen Art auszusetzen, der wieder einmal ausschließlich ihre Geduld erforderte.
Conny hieß in frühren Jahren eigentlich Cornelius, und er besaß zwei ihm wichtige Dinge. Eine kleine Tischlerei in einem Hinterhof in der Nachbarschaft war ihm genauso eigen wie ein alter rehbrauner Porsche aus den Siebziger Jahren. Emma nannte dieses Vehikel Frauenstaubsauger, denn immerzu saßen andere Frauen auf dem Beifahrersitz, vornehmlich Blondinen. Wegen dieser Karre samt jener anderen kurvenreicher Schönheiten steckte er ständig knietief im Dispokredit seiner Bank. Wenigstens seinen Unterhaltungszahlungen kam er regelmäßig nach. Seinem Sperma nämlich, herausgeschleudert in einer Nacht ohne echte Liebe, verdankte Emma ihre Existenz.
„Schön, wenn man die Frau fürs Leben getroffen hat. Besser, wenn man ein paar mehr kennt.” Als Conny seine Tochter vor ein paar Monaten im Vertrauen mit dieser seiner Lebenseinstellung konfrontiert hatte, war Emma alles aus dem Gesicht gefallen. Jetzt wusste sie, dass einiges doch ganz gut war, so wie es war. Dass er irgendwann einmal nicht mehr mit ihrer Mutter klar gekommen war, konnte sie dabei durchaus nachvollziehen. Zwei- oder auch dreimal im Monat traf Emma ihren Vater, je nach dessen Auftragslage und Kontostand. Dann gingen sie meistens Einkaufen oder Essen. Längst schon hatte Emma erkannt, dass sich ihr Vater damit nicht nur ihre Gunst und gute Laune erkaufen wollte. Es war sein schlechtes Gewissen, für das er zahlte, und unter allen Umständen blechte er dafür gar nicht mal schlecht. Ab und an arbeitete sie in dem kleinen Blumenladen in der Straße, wenn die väterlichen Engpässe seinen Geldfluss beeinträchtigten. Materiell war in der Summe so meistens alles im Lot. Sie besaß ein hippes Telefon, ausreichend Paar Schuhe, eine eigene Flatrate für die Kommunikation mit der Welt, gefiel meistens in allen angesagten sozialen Netzwerken und zwängte ihren Hintern in die Jeans eines französischen Designers, die zwar neuerdings wieder zu zwacken begann, aber immer noch besser saß als bei vielen anderen Tussen.
Emma hatte sich im Laufe der Zeit abgewöhnt, darüber nachzudenken, wem sie für ihre Zeugung übler sein sollte. Der Mutter, die betrunken war, kurzzeitig an einer Schilddrüsenfehlfunktion litt, was beträchtliche Hormonschwankungen verursachte, so dass die Anti-Emma-Pille nicht richtig wirkte. Oder Conny, der an diesem Abend vermutlich nur ein paar Bier trinken wollte, weil im Fernsehen kein Fußball lief und, als er, ebenfalls betrunken, Emmas Mutter traf, einfach nur ein bisschen Spaß zur Entschädigung haben wollte. Beide jedenfalls waren in Emmas Urteil einfach nur eins, nämlich verantwortungslos. Der Begegnung verdankte sie ihr Leben, doch Emma war weder geplant noch gewünscht. Sie war das Ergebnis zweier vereinsamter Großstadtseelen, die sich gegenseitig schön trinken mussten, nur weil beide mal kurz auf den Arm wollten.
„Das zu wissen, macht das Leben erst richtig hart.”
Als Mutter und Vater ihr ihre Zeugungsgeschichte berichtet hatten, es war an einem Wochenende im letzten Sommer, verlor Emma vor beiden endgültig etwas. Respekt. Sicher. In ruhigen Momenten erlebte Emma auch so etwas wie ein harmonisches Zusammenleben. Dann aber spielte sie ein braves Mädchen. Dass Emma selbst der ständigen Auseinandersetzungen vor allem mit der Mutter müde und lustlos geworden war und deswegen immer öfter auf Widerworte und provozierende Verbalattacken verzichtete, wurde weder entdeckt noch gefördert. Die Entfremdung von Mutter und Vater hatte längst begonnen. Es war wie ein Zug, der auf Schienen gesetzt und angefahren nicht mehr aufzuhalten war. Bis zum nächsten Bahnhof. Den niemand kannte.
Der Besuch bei Conny war wie immer schnell erledigt. Emma bekam Geld, und Conny ein Lächeln samt Lob, wie bereichernd es war, einen Vater zu haben, der keine dummen Fragen stellte. Wieder daheim, war Emma einem Wutanfall nahe. Mister Smith hatte der Mutter tatsächlich, wie angedroht, einen Brief geschrieben. Mister Smith hieß eigentlich Herr Kowalinsky. Aber so hieß kein Englischlehrer, jedenfalls kein cooler Englischlehrer. Herr Kowalinsky war Pole und in so vielen Belangen so unscheinbar, dass man sich im Kurs sehr schnell auf seinen Spitznamen verständigt hatte. Zu Beginn des neuen Schuljahres hatte Mister Smith einen Test schreiben lassen, um den Leistungsstand seiner Schüler besser einschätzen zu können. Emma war mit einer satten Fünf ordentlich durchgefallen und für die Nachhilfegruppe nominiert worden. In seinem Brief nun beklagte Mister Smith, dass Emma nicht ein einziges Mal an diesem zusätzlichen Unterricht teilgenommen hatte, wo doch ihre Leistungen darauf deuteten, einen Unterkurs zu riskieren, und damit die Zulassung zum Abitur gefährdet war. Wie konnte nur ausgerechnet ein Pole zu diesem frühen Zeitpunkt des Schuljahres ein derart unverschämtes Urteil fällen?
„Gut so! Weiter!” Mit souveränem Blick hatte Emma ins Leere gesprochen, was in ihrem Kopf als Antwort auf diese Kriegserklärung gereift war. „Teile ich Ihnen also mit, dass ich die Dringlichkeit Ihres Anliegens vernommen habe und unverzüglich reagieren werde.”
Sie hatte Oskar Ortega getroffen, der, mit einer Kippe im Mundwinkel, Emmas Worte in die Tasten seines Rechners eingegeben hatte. Emma kannte Oskar seit gut einem Jahr. Könnte man Namen knutschen, hatte sie sofort gedacht, als er sich vorgestellt hatte, sie wäre augenblicklich über ihn hergefallen. Oskar Ortega wurde nur noch von der markigen Vorstellung eines Ron Gallaghers übertroffen.
Oskar war zwanzig Jahre alt und Stammgast in jener Szenebar, die ein paar Meter weiter um die Ecke ihrer Wohnung lag. Er wohnte nur drei Straßenzüge entfernt. Die Bar war tagsüber geschätzter Treffpunkt zum Abhängen. Abends trafen sich dort bevorzugt die, die dem anderen Geschlecht nachstellten. Die meisten Gäste verlegten dieses Verhalten aber auch schon auf den Tag, vor allem im Sommer, wie Emma immer wieder amüsiert bei mal mehr oder weniger gelungenen Manövern feststellte, wenn sie selbst Gast war und bei einem Cafe beobachtete, wie sich die Gäste gegenseitig beschnupperten und meistens daran scheiterten, im allgemeinen Hormonalarm die Souveränität zu behalten. Das Lokal war ein tauglicher Ort, um aus dem Paarungs- und Balzverhalten vieler Großstadtzombies zu lernen.