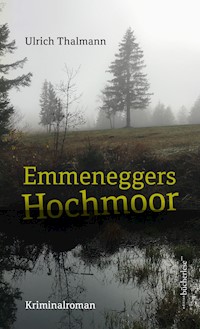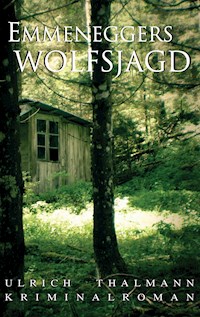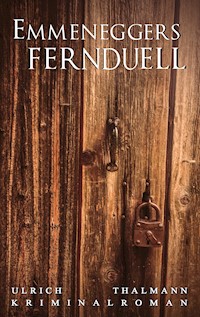
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Saint-Malo, Bretagne - der Urlaub im Westen Frankreichs scheint Bruno Emmenegger, Kommissar der Luzerner Polizei, schlicht perfekt: blauer Himmel, angenehme Temperaturen, eine ausgezeichnete Küche und eine bezaubernde Begleitung. Doch während sich der Kommissar an der bretonischen Küste erholt, wird seine wackere Truppe in der Heimat mit Arbeit überhäuft. Eine Wasserleiche und das mysteriöse Verschwinden zweier junger Frauen halten die Luzerner Polizei gehörig auf Trab. Den Ermittlern werden unheimliche Polaroidfotos der vermissten Frauen zugespielt. Sind es Hinweise auf ein schlimmes Verbrechen in der Vergangenheit? Klar ist nur: Die einzige Spur führt ins Entlebuch, nach Sörenberg, in den hintersten Winkel des Waldemmentals. Dort aber bläst den Polizisten ein rauer Wind entgegen. Deshalb beschließt Emmenegger, seine Ferien zu unterbrechen und in seine alte Heimat, den «Wilden Westen Luzerns», zurückzukehren, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Mit einem kuriosen Polizeieinsatz löst Emmenegger den Fall auf seine ganz spezielle Weise. Wieder zurück in Saint-Malo hat der Kommissar allerdings noch eine weitere verzwickte Aufgabe zu lösen. Nach «Emmeneggers Wolfsjagd» der zweite Kommissar-Emmenegger-Krimi: unterhaltsam, spannend und mit viel Humor. 376 Seiten (Druckversion)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Gedenken an Gaston Marcel Buy, den einzigen echten Helden dieser Geschichte
Inhaltsverzeichnis
Johannes und Paulus
Bremsversagen
K.-o.-Tropfen
Jean-Pierres Problem
Der Tote im Wehr
Der schwarze Bulle
Astrids Bauchgefühl
Der Kiosk am Segelhafen
Im Verlies
Der nette Mann im Wald
Das Lichtsignal
Huber
Ein schlechter Scherz
Fernduell
Die Väter
Kawasaki
Picknick am Point de Grouin
Schattenloch
Cathédrale Saint-Vincent
Adi ist weg!
Flucht entlang der Waldemme
Meyer ist der Grösste!
Gabriela
Saubere Herren
Saint-Malo–Sörenberg einfach!
Nervenspiel
Observation vor Operation
Lehr- und Wanderjahre
Zugriff
Überraschung!
Katerstimmung
Nachwort
- 1 -
Johannes und Paulus
Schüpfheim, im luzernischen Amt Entlebuch. Ein eisiger Wind wehte den wenigen Trauergästen Schnee in die müden Gesichter, als sie die Pfarrkirche Johannes und Paulus durch den Seitenausgang verliessen. Ihre Nasenspitzen und Ohrläppchen färbten sich wegen der bissigen Kälte innert Kürze himbeerrot. Obwohl ein beflissener Friedhofsmitarbeiter noch kurz vor der Abdankungsfeier den schmalen Weg zum frisch ausgehobenen Grab freigeschaufelt hatte, hinterliessen der Pfarrer und seine drei jungen Ministranten bereits wieder eine erstaunlich tiefe Spur im Schnee. Die Sargträger mussten nach dem etwas zu lang geratenen Gottesdienst besonders achtgeben, damit ja keiner auf dem Neuschnee ausgleiten würde. Wobei der Sarg ja nicht besonders schwer war. Elisabeth hatte seit dem plötzlichen Tod ihres lieben Mannes kaum noch gegessen. Sepp starb knapp ein Jahr zuvor. «Herzversagen» stand damals auf Sepps Totenschein. Hildi, die liebenswerte Köchin des Restaurants Adler, behauptete aber steif und fest, dass Sepp an einem «gebrochenen Herzen» gestorben sei.
Wo sie Recht hat, hat sie Recht, die Hildi. Das kleine, unscheinbare, mit «Gabriela» beschrifte Steinkreuz neben Sepps Grab erinnert denn auch an die Tochter der beiden verstorbenen Eheleute. An Gabriela, die als knapp Achtzehnjährige Selbstmord begangen hatte. Sie hatte sich zwischen Entlebuch und Wolhusen vor den Zug geworfen. Wieso, um Gottes willen? Auf diese Frage wusste schon damals niemand im Dorf eine Antwort. Elisabeth oder sogar Sepp darauf anzusprechen, das hatte sich keiner getraut. Auch Gabrielas Chefin aus dem Dorfladen und ihre Arbeitskollegin hatten so etwas Schreckliches nicht kommen sehen, und selbst ihre ehemalige Schulfreundin Carla war ratlos. Gabriela war doch eine hübsche, aufgestellte, junge Frau gewesen. Und während sich die Aufregung über die Tragödie in der Dorfgemeinschaft allmählich legte, wandten sich die strenggläubigen Eltern immer mehr vom Dorfleben ab und zogen sich auf ihren Bauernhof Schattenloch zurück.
Toni, Gabrielas jüngerer Bruder, entschloss sich damals, eine Lehre als Elektroniker zu absolvieren und verliess, sehr zum Unmut des Vaters, den elterlichen Hof schon als junger Bursche.
Als Vater Sepp das Pensionsalter erreicht hatte, verpachtete er das Land einem Nachbarsbauern. Tonis Eltern vereinsamten immer mehr in ihrer Trauer, die sich zunehmend in religiösen Wahn steigerte. Toni vermied es, so gut wie es eben ging, ins Schattenloch zurückzukehren. Nach dem Tod seines Vaters kümmerte er sich zwar wieder vermehrt um seine Mutter, die aber wollte im Grunde gar keine Hilfe annehmen, sondern nur noch eines: sterben.
Weil seine Mutter seit zwei Tagen keinen Anruf mehr entgegengenommen hatte, ging Toni ins Schattenloch, um nach ihr zu schauen. Er fand seine Mutter tot auf dem schwarzweiss gekachelten Steinboden in der Küche. Die Ärzte gingen von einem Schwächeanfall aus – ein Sturz, Kopf am Boden aufgeschlagen. Fertig.
Nun stand Toni als einzig Lebender seiner engeren Familie vor dem noch offenen Grab und nahm die Beileidsworte der Anwesenden zwar entgegen, aber nicht richtig wahr. Auch die klammen, kalten Finger der Kondolierenden konnte er nicht wirklich spüren. Erst als Onkel Max ihn wachrüttelte und ihm ins Ohr trompetete: «Komm Toni, die Trauergäste sind ja schon alle im Kreuz. Da musst du jetzt durch, mein Junge», raffte sich Toni auf und trottete teilnahmslos neben Onkel Max, den er noch nie leiden konnte, in Richtung Wirtshaus.
Nur wenige Bekannte trafen nach der Beerdigung der Mutter im Kreuz zum Leichenschmaus ein. Toni war es recht. Erstens wegen der Rechnung und zweitens, weil er seit dem Tod seiner Schwester Beerdigungen kaum noch ertrug.
Nachdem die meisten der Gäste den Hackbraten mit Bratensauce und Kartoffelstock verschlungen hatten und zum Kaffeeschnaps übergegangen waren, setzte sich der Wirt Fredi neben Toni.
«Na, was machst du jetzt mit dem Schattenloch? Verkaufst du es?», fragte Fredi interessiert.
Toni betrachtete eine Weile nachdenklich seine Hände und antwortete ohne aufzusehen: «Nein, ich glaube nicht. Ich gebe wohl meine viel zu teure Wohnung in Malters auf und ziehe wieder hier nach Schüpfheim. Im Tenn hat es viel Platz. Ich baue mir da eine Werkstatt und mache mich vielleicht einmal selbständig. Meinem Chef in Luzern passt es sowieso nicht, dass ich bei den Leuten beliebter bin als er. Und mit der neuen Glasfasertechnik kommt er auch nicht mehr zurecht. Du wirst sehen, das wird sogar hier im Entlebuch einmal Standard für schnelles Internet.»
«Lieber Internet, als mit Vreni ins Bett», lallte ein schon gehörig angesäuselter Onkel Max, was ihm einzelne Lacher vom Männertisch und ein paar: «Nein aber auch – an einer Beerdigung!», von der Frauenrunde am Nebentisch einbrachte. Insbesondere von Tante Vreni, der als unverheiratete Frau der Kalauer galt. Aber Onkel Max kam immer mehr in Fahrt und bestellte der Runde ein weiteres «Schwarzes». Tante Vreni steigerte sich in eine gehörige Rage. Schliesslich konnte sie von Fredi dem Wirt nur durch eine Extraportion Meringue, einem luftigen Eiweissgebäck mit viel Schlagrahm, von einer Tätlichkeit gegen Onkel Max abgehalten werden. Max seinerseits entging dieser Schachzug zur Beschwichtigung gänzlich. Er unterhielt sein Publikum ungefragt und unüberhörbar mit weiteren unanständigen Witzen. Toni, den die taktlose Szenerie anwiderte, setzte sich zum Pfarrer, bedankte sich bei diesem für den einfühlsamen Abdankungsgottesdienst mit einer grosszügigen Spende in den Opferstock und regelte das Finanzielle mit dem Wirt. Dies war das Zeichen, dass nun jeder auf eigene Rechnung weiter konsumieren musste, was relativ schnell zur Auflösung der Runde führte. Onkel Max landete draussen vor dem Restaurant Kreuz bereits nach wenigen Schritten in einem Schneehaufen und wurde von zwei kräftigen Jungschwingern zu seinem Auto bugsiert. Dort wartete Tante Vreni mit verkniffenem Mund und steckte den Autoschlüssel, den sie Max vorsorglich schon im Restaurant abgenommen hatte, auf der Fahrerseite ins Türschloss.
«Fahrt vorsichtig», rief Fredi ihnen hinterher und verschwand schleunigst wieder in der warmen Wirtsstube.
Toni war froh, dass er das Mitfahrangebot von Dahinden, seinem Nachbarn im Schattenloch, angenommen hatte. Schon früh am Morgen waren sie zusammen mit dessen Allradjeep ins Dorf gefahren. Auf keinen Fall wollte er es riskieren, dass er mit seinem Geschäftswagen im Neuschnee einen Unfall baute. Und ein paar Kaffeeträsch hatte er nach der Beerdigung ja schliesslich auch schon intus.
Äusserst vorsichtig fuhr Dahinden Kurve um Kurve auf der schneebedeckten, schmalen Strasse in Richtung Finishütte, wo das Schattenloch an einem Waldrand unterhalb der Farnern auf einer Lichtung steht. Stumm rauchten beide eine «Krumme», und Toni liess gedankenversunken die verschneite Winterlandschaft an sich vorüberziehen, bevor ihn ein heftiger Hustenanfall übermannte. Dahinden schmunzelte über Toni: «Der war ja schon früher eher von der sensiblen Sorte gewesen», dachte er und liess Toni an einer Weggabelung aussteigen, bevor er zu seinem eigenen Hof abzweigte. Die letzten gut zweihundert Meter zum Schattenloch ging Toni zu Fuss. Er sog die saubere und beissend kalte Bergluft tief ein, was die vom starken Tabak gebeutelten Lungenflügel wieder beruhigte.
«Selber blöd», musste sich Toni eingestehen, «habe ich ja noch nie vertragen», und spuckte eine braune, unansehnliche Masse in den Tiefschnee.
Toni betrat den Hof über das Tenn. Eine Scheune, die über dem Stall und den Wohnräumen liegt. Mit einem Reisigbesen befreite er Schuhe und Hosen vom Schnee. Er schaltete das Licht an, und die Neonröhre flackerte auf. Toni sah sich im grossen Raum um. Eine Werkbank, eine Tischsäge, sein altes Mofa, das er als Jugendlicher mit seinem Lehrlingslohn erspart hatte. Diese Schrottmühle hatte wahrscheinlich eine grössere Revision nötig. Leere Holzkisten, mit denen Mutter früher die Kartoffeln ins Haus gebracht hatte. Oder Äpfel und Birnen von den wenigen Obstbäumen des Schattenlochs. Besser isolieren wollte er den Raum auf jeden Fall. Es wäre hier bestimmt viel zu kalt, wenn er später einmal jeden Tag in seiner Werkstatt arbeiten wollte. In Gedanken stellte er sich seinen neuen Arbeitsplatz vor. Da eine neue Werkbank, dort ein Lagergestell. Und mehr Licht, das war klar, viel mehr Licht brauchte er hier zum Arbeiten…
«Was war das?»
Toni hörte ein leises Winseln. Es kam von unten. Vorsichtig schlich er die Treppe in den Wohnbereich des Bauernhofs hinunter. Ihn fröstelte es.
«Fast wie das Wimmern eines kleinen Kindes», ging es ihm durch den Kopf. Toni horchte angestrengt in die Stille. Plötzlich hörte er wieder dieses unheimliche Geräusch, das aus dem Wohnzimmer kam. Leise schlich Toni durch die Küche zur Türe des Wohnzimmers. Er öffnete sie vorsichtig und schaltete das Deckenlicht ein. Die alte Lampe spendete nur spärlich Licht, was vor allem an dem gelblich verfärbten Lampenschirmchen lag, das wohl vor Jahren einmal weiss gewesen sein musste. Toni trat ein, und das Wimmern hörte schlagartig auf. Er getraute sich kaum mehr zu atmen. Doch dann, kaum wahrzunehmen, war ein leises Rascheln unter dem Sofa zu hören. Toni bückte sich, hob den gestickten Überwurf langsam hoch und blickte in zwei verängstigte Katzenaugen.
«Ja, was machst du denn hier?», fragte Toni eine junge, rabenschwarze Katze und streichelte das verängstigte Tier. Es war ausgezehrt und traute sich nur sehr zögerlich unter dem Sofa hervor. Toni hatte nicht gewusst, dass seine Mutter wieder eine Katze hatte, nachdem der alte und faule Kater Flecki eingeschläfert werden musste. Wahrscheinlich war ihr das Tierchen zugelaufen. Gestern als er ins Schattenloch gekommen war, hatte er es möglichst vermieden, sich in der Küche aufzuhalten, weil ihm der Anblick seiner toten Mutter, die er vor ein paar Tagen hier gefunden hatte, sofort wieder unangenehm präsent wurde. Er streichelte die kleine Katze, und sie liess sich vom Boden aufheben. Jetzt mauzte sie schon lauter, weil die Aussicht auf Futter in ihr neue Lebensgeister geweckt hatte. Toni trug das flaumige Knäuel in die Küche. Unter der hölzernen Eckbank fand Toni tatsächlich einen alten Fressnapf. Mutter musste sie also gefüttert haben. Wie lange wohl schon nicht mehr? Diesen grausigen Gedanken schob Toni ganz schnell von sich weg. Er selber hatte seine Mutter ja auch erst nach Tagen hier auf dem kalten Boden gefunden, nicht auszudenken, wie lange sie vorher schon dort gelegen hatte.
Toni öffnete den Kühlschrank. Die wenigen Resten darin rochen leicht moderig. Eine Kanne enthielt noch etwas Kuhmilch. Er goss von der säuerlich riechenden Milch ins Schälchen. Der bedenkliche Frischezustand der Milch schien dem hungrigen Kätzchen gar nichts auszumachen. Hastig und laut schmatzend schlürfte das halb verhungerte Tier die Milch in sich hinein. Katzenfutter fand Toni im Vorratsschränkchen nicht. Mutter fütterte die Katze wohl, wie es früher üblich war, nur mit Küchenabfällen.
Toni öffnete den Kühlschrank erneut und warf die nicht mehr geniessbaren Lebensmittel in den Abfalleimer. Morgen musste er wohl oder übel ins Dorf zum Einkaufen, da die meisten Esswaren verdorben waren. Ein Stück würziger Bergkäse von einer Alp oberhalb von Flühli sah noch ganz passabel aus. Sein Magen knurrte, am Mittag hatte er ja kaum einen Bissen herunterbekommen. Er beschloss, sich mit den paar schrumpeligen Kartoffeln, die er im Vorratsschrank fand, eine Sennenrösti zu brutzeln. Goldbraun und mit Käse überbacken.
«Du kriegst auch noch etwas ab», sagte er zärtlich zur schwarzen Katze. «Ich nenne dich Baghira, wie der schwarze Panther bei Mogli im Dschungelbuch.»
Toni öffnete die gusseiserne Tür des alten Ofens und legte nochmals gehörig Holz nach, damit sich das Bauernhaus bis am Abend einigermassen aufwärmen würde. In der Wohnstube schaltete er zudem einen gasbetriebenen Heizstrahler ein. Mutter hatte diesen nur ganz selten benutzt. Sie hatte eine Heidenangst vor Gas und behauptete immer und immer wieder, dass das Schattenloch noch einmal explodieren würde, vor allem als Vater in der guten Stube noch seine Pfeife paffte.
Nach dem Essen schlenderte Toni durch den engen Wohnbereich des Bauernhauses, in dem er aufgewachsen war, ihm aber jetzt doch sehr fremd und ungastlich vorkam. Im Elternschlafzimmer, dem grössten Zimmer im Haus, würde er sein Schlafzimmer einrichten. Mit neuen Möbeln in hellen Farben. Die zahlreichen Heiligenbilder und ein überdimensionaler Heiland am Kreuz mussten auch weg. Vielleicht würde er Verena, die schüchterne Sekretärin seines Chefs, fragen, ob sie ihm beim Einrichten helfen könnte. Damit sie hoffentlich einmal bei ihm übernachten würde. Er musste sich nur endlich getrauen und den ersten Schritt machen, um ihr seine Liebe zu gestehen. Herzensangelegenheiten waren Toni schon immer schwergefallen. Über die steile Holztreppe gelangte er in den oberen Stock des Bauernhauses. In seinem alten kleinen Zimmer hatte er gestern geschlafen. Geschlafen? Nicht wirklich. Eher gedöst, weil ihm zu viele Gedanken wegen der Beerdigung durch den Kopf gegangen waren. Hier würde er sein Büro einrichten, mit Computer, Drucker und allem Drum und Dran. Rechts neben seinem ehemaligen Schlafzimmer lag Gabrielas Kinderzimmer. Nie mehr war er seit dem Tod seiner Schwester in diesem Raum gewesen. Die Türe war abgeschlossen. Wo könnte Mutter nur den Schlüssel aufbewahrt haben?
«In der Buffetschublade in der Küche», kam es ihm in den Sinn. Darin hatte Mutter immer alle ihre persönlichen Sachen verstaut und ihnen als Kindern mit dem Teppichklopfer gedroht, wenn sie es wagen würden, die Schublade zu öffnen. Dort hütete Mutter Süssigkeiten, die es nur an speziellen Anlässen wie Geburts- oder Feiertagen gab. Unsicher öffnete er nun diese Schublade zum ersten Mal in seinem Leben. Tatsächlich fand er neben zwei Tafeln Schokolade und unzähligen Postkarten, vornehmlich mit Heiligenbildern, einen Schlüsselbund mit einigen Schlüsseln. Der grösste Schlüssel gehörte zum Schopf, wo die alte Mähmaschine stand, den kannte er noch von früher. Einer könnte zum Kaninchenstall passen. Ein weiterer glich einem Zimmerschlüssel. Aufgeregt stieg er wieder in den oberen Stock hinauf, gefolgt von Baghira, die ihm neugierig hinterherhopste und vor der Schlafzimmertüre um die Beine strich, weil sie noch nach mehr Futter betteln wollte. Sanft schüttelte Toni den kleinen Nimmersatt von seinem Hosenbein ab und steckte den Schlüssel ins Türschloss. Er passte. Behutsam öffnete Toni die Türe, schaltete das Licht ein und war sehr erstaunt: Das Zimmer sah aus, als ob seine Schwester Gabriela noch bis vor kurzem darin gewohnt hätte. Alles war abgestaubt und es roch sauber, im Gegensatz zum Zustand seines Jungenzimmers, wo er am Vortag zuerst die miefende Bettdecke aus dem Fenster schütteln musste, bevor er sich ins Bett legen konnte. Das schmale Bett, der hölzerne Tisch, der leicht lädierte Stuhl und das schmale Fenstersims waren von einer zentimeterdicken Staubschicht bedeckt. Selbst seine alte mechanische Schreibmaschine, auf der er vor Jahren mühsam das Zehnfingersystem mit mässigem Erfolg trainiert hatte, war total eingestaubt. Eine kleine Staubwolke entstand, als ein Buchstabe hart auf das Tintenband aufschlug, weil Toni beiläufig eine Taste angeschlagen hatte. Ganz anders sah es nun in Gabrielas Zimmer aus. Mutter musste noch vor kurzem ein Blumenarrangement auf das blanke Pult gestellt haben. Zwischen zwei gerahmten Fotografien. Eine von Vater. Und eine von Gabriela. Auch Gabrielas Taufkerze stand neben den Fotos. Alles war sorgsam drapiert worden. Wie ein Altar. Toni fand das alles ziemlich unheimlich.
Baghira, die Toni ins Zimmer gefolgt war, sprang aufgeregt auf das Bett und beschnupperte neugierig einen Teddybären und eine kleine Puppe, die neben dem Kopfkissen hingelegt worden waren, als ob sie Gabriela gerade eben noch zu Bett gebracht hätte. Als die kleine schwarze Katze den Teddybären in die Ohren beissen wollte, scheuchte Toni den Frechdachs weg. Baghira rannte aber nicht etwa aus dem Zimmer, sondern versteckte sich unter dem Bett.
«Komm raus, da hast du gar nichts zu suchen!» Toni ging in die Knie und schaute unter das Bett, um die Katze einzufangen, die sich hinter einem Bettpfosten verstecken wollte. Da Toni den kleinen Schlingel nicht erreichen konnte, stand er auf und zog das Bett ein wenig von der Zimmerwand weg, um die Katze von oben unter dem Bett hervorzuziehen und aus dem Zimmer zu verscheuchen. Da hörte er ein seltsames, dumpfes Geräusch. Irgendetwas war auf den Holzboden gefallen. Er schaute in den Spalt zwischen Wand und Bett, und tatsächlich lag da ein Buch, das zwischen dem Bettgestell und der Wand versteckt gewesen sein musste. Er hob es auf und legte es auf das Bett, bevor er die Katze am Nacken packte und aus dem Zimmer bugsierte. Nachdem er das schwere Bett wieder an die Wand geschoben hatte, betrachtete er das Buch näher. In einer verschnörkelten Kinderschrift stand:
Gabriela
Neugierig öffnete Toni das Buch. Es war Gabrielas Tagebuch. Weil es im Zimmer immer noch eisig kalt war, beschloss Toni, das Buch mit in die Küche zu nehmen. Er schaltete das Licht aus und schloss das Zimmer wieder ab. «Nicht, weil niemand in das Zimmer reingehen sollte, sondern, damit die Geister der Vergangenheit darin eingeschlossen blieben», ging es ihm durch den Kopf.
Mit einem Glas Wasser setzte sich Toni an den Küchentisch. Das rotweisse Karomuster des Plastiktischtuchs erinnerte Toni unmittelbar an seine Schulzeit, als er zusammen mit Gabriela am Küchentisch Hausaufgaben machen musste. Wenn seine Schwester guter Laune war, half sie ihm bei den schwierigen Rechnungsaufgaben, damit sie schneller spielen gehen konnten. Bei schlechter Laune liess sie ihn schmoren, und er musste unter der strengen Aufsicht der Mutter alles selber zustande bringen.
Toni schlug das Tagebuch auf. In einer schönen, aber doch noch sehr kindlichen Schrift begann der erste Eintrag:
Liebes Tagebuch…
Toni schmunzelte. Gabriela schilderte Begebenheiten aus ihrer Kindheit, an die er sich zum Teil noch selber erinnern konnte. Sie handelten vom Heuen im Hochsommer. Von frischen Ferkeln. Dem Drama, wenn ein Tier zum Metzger musste. Vom ersten Schnee im Jahr. Vom letzten Schultag vor den langen Schulferien. Vom ersten Besuch in der Badi in Schüpfheim. Von den ersten Schwimmzügen im grossen, tiefen Becken. Und relativ häufig waren Zeichnungen von Katzengesichtern zu sehen. Einmal malte sie auch einen grossen Käse mit einer Salami daneben. Das Mädchen hatte wahrscheinlich Hunger nach dem langen Schulweg vom Dorf bis zum Schattenloch.
Eines Tages hatte Gabriela anscheinend das Interesse am Tagebuchschreiben verloren, weil jeweils grössere zeitliche Abstände zwischen den Einträgen lagen. Die Handschrift wandelte sich merklich von der gut leserlichen Schulschrift hin zur schwungvollen Schrift einer jungen Frau. Nur noch selten fanden sich verschnörkelte Grossbuchstaben und Blümchenbilder im Text. Dafür interessierte sich Gabriela vermehrt für Mode und Popmusik. Ein sehr ausführlicher Eintrag handelte alleine vom Kauf einer Markenjeans, dem ein wochenlanger Kampf mit den Eltern sowie eine breit angelegte Sammelaktion bei Grosseltern, Götti und Gotte vorausging, bis die stattliche Summe zusammengespart war und Gabriela das heiss ersehnte Teil endlich anziehen konnte. Zugegeben, sie konnte es auch tragen, sie sah umwerfend darin aus, das war selbst ihm, Toni, damals schon klar. Mutter und Vater bestanden jedenfalls entschieden darauf, dass sie die Jeans niemals bei einem Kirchgang anziehen durfte.
Mit der Zeit veränderte sich ihr Musikgeschmack. War sie anfänglich noch ein grosser Fan von ABBA und den biederen Beatles, schmachtete sie bald schon für verschiedene Boygroups, deren Poster noch immer in ihrem Zimmer hingen. Ab dem sechzehnten Lebensjahr durfte sie auch hin und wieder in die Disco der Kirchgemeinde, die gelegentlich im Pfarreiheim stattfand. Selbstverständlich wurde Gabriela Punkt zehn Uhr von Vater höchstpersönlich wieder abgeholt, und wehe, sie verspätete sich….
Immer öfters wurden junge Burschen erwähnt, die der hübschen Gabriela den Hof machten, jedoch ohne Chance auf Erfolg. Irritiert beschrieb sie eine Situation, bei der ihr erwachsene Männer auf der Strasse hinterherpfiffen.
Sie schrieb von ihren Freundinnen, die sich eine nach der anderen verliebten und freimütig über ihre ersten sexuellen Erfahrungen berichteten. So erfuhr Toni, dass Sonja, für die er damals heftig schwärmte, in ihrer romantischen Verliebtheit schon recht jung ihre Unschuld verlor. Gabriela selber schien die Vorstellung, mit einem Jungen intim zu sein, eher anzuwidern. Getraut hätte sie sich ohnehin nicht. Mutter hatte sie ja auch zigtausend Mal vor den jungen Spunden gewarnt.
In einem Eintrag hielt sie dazu etwas trotzig fest:
Im Dorf nennen mich viele die eiserne Jungfrau. Trotzdem will ich einfach nicht mit dem Erstbesten ins Bett!
Toni blätterte einige Seiten weiter, weil ihm das pubertäre Geplapper seiner Schwester allmählich auf die Nerven ging. Auf einer der letzten Seiten begann Toni nach einer ganzseitigen Zeichnung eines Riesenherzens wieder zu lesen.
Liebes Tagebuch, jetzt ist ES passiert. Ich habe mich total verknallt. Er ist neu im Dorf. Er hat mich im Laden total süss angesprochen, als ich die Regale auffüllte. Soooo schnuggi… Die Chefin hat mich ganz böse angeschaut und mich zum Kartonkistenzerkleinern ins Lager geschickt. Blöde Kuh. Doch Janik, so heisst ER, kommt jetzt öfters in den Laden und fragt immer nur mich, ob ich wisse, ob wir noch dies oder das haben und so. Ich habe gehört, dass er im Fussballclub Mittelstürmer ist, und sehr gut! Leider ist er immer mit Kari unterwegs. Den mochte ich noch nie, der sieht mir nie in die Augen, sondern nur auf den Hintern.
Gespannt blätterte Toni zum nächsten Eintrag.
Liebes Tagebuch, Janik hat mich gefragt, ob ich mit ihm in die Badi komme! Natürlich gehe ich mit. Ach, wäre es nur schon Sonntag, dann muss ich nicht arbeiten.
Es folgte eine weitere Seite mit einem grossen Herzen in welchem Janik stand. Das war der letzte Tagebucheintrag, datiert nur wenige Tage vor dem Todestag seiner Schwester. Toni erinnerte sich, als wäre es gestern gewesen, wie die zwei Polizisten sie hier im Schattenloch aufsuchten und der Familie die traurige Nachricht über den Selbstmord seiner Schwester überbrachten. Nervös blätterte er die wenigen verbleibenden Seiten im Tagebuch durch. Als er auf ein eingeklebtes Polaroid-Foto stiess, stockte ihm der Atem.
- 2 -
Bremsversagen
Monate später stand Jérôme Dubois äusserst schlecht gelaunt am Flughafen der bretonischen Stadt Rennes und wartete auf sein Gepäck. Schon zuvor im Flugzeug hatte ihn eine zickige Stewardess genervt, weil sie ihm keinen dritten Gin Tonic servieren wollte. Sie hatte etwas von Sicherheit und solchem Mist gefaselt. Wie lächerlich. Er hatte seinem Unmut Luft verschafft, laut und deutlich und in der Wortwahl alles andere als salonfähig. Sein grimmiger Blick und die furchteinflössende Tätowierung an seinem Hals, die auf einen Knastbruder oder Fremdenlegionär hindeutete, hatten wohl zudem ihre Wirkung gezeigt, so dass er schliesslich doch noch zu seinem Drink gekommen war. Dubois hatte sich im letzten Moment zurückhalten können und es unterlassen, der sich von ihm abdrehenden Stewardess einen Klapps auf den süssen Hintern zu geben. Die Tusse dachte wohl, so könne man ihn beschwichtigen. So ein Blödsinn. Bah, einen Dubois beschwichtigt man nicht einfach so mit einem oder zwei Drinks, schon gar nicht dann, wenn er sauer war. Und er war sauer – stinksauer.
Jérôme François Dubois, Anhänger des Front National und Boss einer rechtsgerichteten, berüchtigten kriminellen Bande aus Paris, hatte in der Nacht zuvor erfahren, dass sein feiner Freund, Georges Lambert, bislang die Nummer zwei in Dubois Firma, schon länger ein Verhältnis mit seiner aktuellen Gespielin Nina pflegte. Dubois war ausser sich vor Zorn. Nicht dass Nina ihm besonders ans Herzen gewachsen wäre. Aber nein, Nina war eine, wie alle anderen auch, kuschte vor ihm und war gut zu vögeln. Nein, hier ging es um etwas ganz anderes: Um seine Ehre und um seine Autorität als Bandenoberhaupt. Zu erfahren, dass ein Mitglied seines Imperiums sich an seinen Sachen vergriff, war ein harter Schlag ins Gesicht des Bandenchefs, der von seinen Untergebenen absolute Loyalität – wenn nötig bis in den Tod – erwartete. Und ausgerechnet Georges tat ihm nun diese gemeine Demütigung an. Schorschi, wie er ihn nannte, war für ihn wie ein kleiner Bruder, seit er den damals Elfjährigen unter seine Fittiche genommen hatte und ihn erst als Drogenkurier einsetzte und später immer mehr in seine Geschäfte involvierte, bis er nun als seine rechte Hand und einer seiner wenigen Vertrauten fungierte.
Georges hatte also sein Vertrauen missbraucht, dieser räudige Bastard. Eine seiner Schwalben, wie er die Mädchen nannte, die er auf den Trottoirs von Paris auf den Strich schickte, hatte es ihm gezwitschert. Wahrscheinlich erhoffte sie sich, von ihm bevorzugt behandelt zu werden, wenn sie ihm solche Informationen zutrug. Darin hatte sie sich aber mächtig getäuscht, denn nachdem er Nina fast zu Tode geprügelt hatte, verging er sich an der Überbringerin der schlechten Nachricht und schickte die beiden dahin zurück, wo er sie kennengelernt hatte. Auf den Strassenstrich eines der miesesten Quartiere in der Banlieue von Paris.
Und was Lambert anging, nun ja, das wollte er auf keinen Fall einem seiner Handlanger überlassen, sondern selber an die Hand nehmen. Dubois duldete keinen Verrat. Das hatte Konsequenzen – tödliche Konsequenzen. Kurz angebunden hatte er deshalb bereits früh am Morgen Schorschi Lambert telefonisch aus den Laken geholt und ihm befohlen, ihn am Flughafen in Rennes abzuholen. Dubois war im Moment im Aufbau eines Menschenschmugglerrings in Saint-Malo. Hier war richtig Kohle abzusahnen, das wollte er sich nicht entgehen lassen. Klar waren da noch die herkömmlichen dreckigen Geschäfte wie Drogenhandel, Zuhälterei und Erpressung, aber die liefen in Paris immer schlechter. Die kriminelle Konkurrenz in den Strassen der französischen Hauptstadt wurde jeden Tag härter.
«Scheiss-Pied-noir», beschimpfte er die Algerienfranzosen jeweils, wenn er in blutigen Bandenkriegen wieder einmal einen Drogenumschlagplatz oder die Herrschaft über einen Teil eines Quartiers den Einwanderern überlassen musste. Für ihn waren diese französischen Bürger dreckiger Abschaum, wie übrigens alle restlichen Einwanderer auch, was aber nicht bedeutete, dass man mit ihnen kein Geld verdienen konnte. Genau das hätte Lampert für ihn in Saint-Malo erledigen sollen, aber nun war etwas schiefgelaufen. Jetzt musste der Boss persönlich ran.
Ungeduldig wartete Dubois an diesem warmen Frühsommertag an der Gepäckausgabe auf seinen Koffer. Anscheinend war auch die Klimaanlage des Flughafens vorübergehend «hors service». Dubois schwitzte wie ein Schwein. Der Schweiss rann ihm auf das speckige schwarze Gilet seines Anzugs. Seine unauffällige Reisetasche erspähte er schon von weitem auf dem Förderband der Ausgabe, und er bahnte sich rücksichtslos seinen Weg an die Rampe. Mit einem hastigen Griff packte er das Gepäckstück und wetzte schnurstracks in die Ankunftshalle. Er hielt Ausschau nach Lambert, der sich ja dort pünktlich hätte einfinden sollen. Doch er entdeckte ihn nirgends. Dubois schäumte vor Wut: «Dem Schorschi werde ich es zeigen. Fischfutter mache ich aus ihm…»
In dem Moment, als er sein Mobiltelefon aus der Westentasche zog, um Schorschi anzurufen, erspähte er eine junge Dame in einer hellblauen Uniform, die ein Schild mit seinem Namen in die Höhe hob.
«Kenne ich die?», fragte er sich, bevor er sie barsch ansprach.
«Was wollen Sie von mir? Wer sind Sie?»
«Ah, Monsieur Dubois, es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Monsieur Lambert hat für Sie bei unserer Firma ein Auto bestellt. Er lässt sich entschuldigen und erwartet Sie in Saint-Malo. Hier auf dieser Karte habe ich Ihnen eingezeichnet, auf welchem Parkplatz ihre Peugeot-Limousine steht. Voilà, Ihre Schlüssel. Könnten Sie mir hier noch kurz unterschreiben, wenn Sie so freundlich sein möchten?», lächelte die junge Frau Dubois beflissen an.
Dubois war paff. Da hatte dieser Emporkömmling doch glatt die Frechheit, ihn, den Boss, einfach selber fahren zu lassen, anstatt wie abgemacht, persönlich abzuholen.
«Na warte! Dies wird dein letzter Tag sein!», schnaubte Dubois. Und die immer noch bezaubernd lächelnde Schönheit fragte besorgt: «Ist etwas nicht in Ordnung, Monsieur?»
Dubois schnappte sich die Schlüssel samt Wegbeschreibung und stapfte grusslos in Richtung Ausgang. Die freundliche Angestellte des Autoverleihers ihrerseits rief ihm noch hinterher: «Viel Vergnügen bei Ihrem Aufenthalt in der Bretagne, Herr Dubois. Hat uns sehr gefreut, Ihnen gedient zu haben…»
Das bekam Dubois nicht mehr mit, weil er schon im Drehkreuz der Ausgangsschleuse verschwunden war. Er sah auch nicht, dass die Frau in der hellblauen Uniform der Autovermietungsfirma den Mietvertrag kurzerhand zerknüllte und in den nächsten Abfalleimer stopfte. Sie fischte ihr Mobiltelefon aus ihrem ledernen Handtäschchen, und bereits nach zweimaligen Rufzeichen begann sie zu sprechen: «Hallo Georges. Chéri, der Widerling ist auf dem Weg zu dir. Hat alles geklappt. Salut, bis heute Abend!»
Jérôme Dubois fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit aus dem Flughafengelände, missachtete sträflich die Vortrittsregeln, ohne es zu unterlassen, einer erschrockenen älteren Dame in obszöner Pose den Mittelfinger zu zeigen. Via Stadtautobahn und der D137, «Vois de la Liberté» genannt, donnerte Dubois in Richtung Meer und Saint-Malo. Nichtsahnend, dass dieser «Weg der Freiheit», ihn keineswegs in die Freiheit leiten würde. Eher zum Gegenteil.
Jérôme widmete der bezaubernden bretonischen Landschaft keine Sekunde seiner Aufmerksamkeit, sondern plante in Gedanken den langsamen, schmerzvollen Tod Lamberts. Sogar den salzigen Geruch der ersten Meeresbriese, die durch das halb geöffnete Autofenster in die Limousine strömte und den Ärmelkanal ankündigte, bemerkte er nicht, denn er hatte nur ein Ziel: Rache für die Schmach, die ihm Lambert zugefügt hatte.
Dubois fuhr bei Saint-Malo von der Schnellstrasse ab und tuckerte hinter einem alten «deux cheveaux» durch den Vorort Saint-Servan bis zum Segelhafen, wo er das Strässchen auf den Hügel bei Alet einschlug und hinter einem deutschen Mobile-Home, laut fluchend, zum Camping de la Cité d’Alet hochkroch. Schnurstracks stellte er seinen Wagen direkt vor der Rezeption des Campingplatzes ab und marschierte mit zügigen Schritten zum anderen Ende des grosszügigen Areals, wo das teuerste und luxuriöseste Wohnmobil weit und breit stand. Eigentlich war es eine fahrende Villa. Vor dem Wagen schlummerte in einem Klappstuhl einer seiner Leute mit einer halb leeren Bierflasche in der Hand. Dubois packte den dösenden Bodyguard am Kragen und schnauzte gehässig: «Bezahl ich euch zum Schlafen, ihr Nichtsnutze und Tagediebe?»
«Chef, Jérôme. Was machst du denn hier?», winselte Philippe, einer der Kriminellen aus Paris, die für Dubois arbeiteten.
«Wo steckt Lambert?», zischte Dubois und drückte dem eingeschüchterten Philippe mit einem geübten Griff kurz aber effizient die Kehle zu, um seiner Frage Nachdruck zu verleihen.
«Dein Freund speist gerade in der Brasserie am Segelhafen», keuchte Philippe unterwürfig, «da wo die Skipper der Segeljachten jeweils zu Mittag essen.»
«Nenn dieses Schwein nie mehr meinen Freund, sonst erwürge ich dich auf der Stelle!»
«Sorry Chef, ich konnte ja nicht wissen, dass ihr ein Problem miteinander habt.»
«Das will ich auch hoffen, du Wurm. Wenn ich erfahre, dass du gewusst hast, dass der meine Nina gevögelt hat, dann rate ich dir, das Land zu verlassen. Oder besser noch Europa.»
«George mit Nina? Ist denn sowas möglich! Chef, das kannst du nicht einfach so stehen lassen!»
«Natürlich nicht, du Vollpfosten. Gib mir deine Knarre!»
«Klar Chef. Aber was mache ich?»
«Du rufst die anderen zusammen. Wir treffen uns in zwei Stunden wieder hier. Bis dann bin ich mit diesem Hurensohn fertig, darauf kannst du Gift nehmen.»
Seine Männer sollten nur sehen, was er mit Verrätern anstellen würde. Dieses Exempel sollte allen eine Lehre sein. Dubois steckte sich die «Walther» in seinen Hosenbund, ging zielstrebig zurück zu seinem Mietauto vor der Rezeption, stieg ein und startete den Motor.
Philippe hingegen nahm sein Telefon, drückte auf eine gespeicherte Kurzwahltaste und sagte: «Georges, er fährt jetzt den Hügel hinunter.»
Nichts ahnend passierte Dubois den Platz vor dem Café La P’tite und bog gerade in die stark abschüssige Rue d’Alet ein, die zum Tour Solidor hinab führt, als er ein seltsames Klicken hörte, das irgendwo von der Lenkkonsole seines Peugeot herrührte. Erst als er auf die Bremse trat und das Tempo dadurch nicht gedrosselt wurde, als das Steuerrad sich keinen Millimeter mehr bewegen liess und der Hebel der Automatikschaltung vollkommen blockiert war, dämmerte es dem Gangster, dass ihn jemand gerade in eine üble Falle tappen liess. Hätte er noch Zeit gehabt, in den Rückspiegel zu schauen, was verständlicherweise nicht der Fall gewesen war, weil sein Wagen immer mehr Fahrt aufnahm und auf die äusserst soliden Festungsmauern des Tour Solidor zuraste, dann hätte er auf der Terrasse des schmucken Café La P’tite seinen alten Freund Schorschi lachend eine Art Fernbedienung vor sich hin und her schwenken sehen können. Aber da war es schon zu spät, denn Dubois knallte mit voller Wucht in die mittelalterliche Mauer, und der Wagen ging sofort in Flammen auf. Viel später stritten sich die Ermittler noch hitzig, ob auch die Benzinzufuhr an diesem Auto manipuliert worden war, oder ob die französische Ingenieurskunst an sich an der folgenden, schweren Detonation schuld war.
Bruno Emmenegger, Kommissar der Luzerner Polizei, der ferienhalber in Saint-Malo weilte, sass gerade im nahe gelegenen Bistrot Cancalais vor einer seiner innig geliebten Fischsuppen. Als ein ohrenbetäubender Knall die hölzerne Terrasse erzittern liess, zuckte Emmenegger zusammen und verbrannte sich dabei mit der siedend heissen Suppe die Zunge. Seine Freundin Eva verschüttete gleichzeitig ihren Kir Royal über das neu erstandene, blauweise Matrosen-T-Shirt im bretonischen Ringellook und wetterte wie ein Rohrspatz. Wobei sie innerhalb eines Satzes mehrfach von Kroatisch zur Entlebucher Mundart und wieder zurück wechselte.
Eine schwarze Rauchsäule stieg beim Tour Solidor in den Himmel. Schon bald waren aus der Ferne die ersten Martinshörner von Polizei und Feuerwehr zu hören. Die nette Bedienung mit dem knallrot geschminkten Schmollmund brachte Eva eine Zitrone um den rosaroten Fleck auf ihrem T-Shirt provisorisch wegzuwischen. Halbwegs zufrieden mit dem Resultat stieg Eva auf einen Stuhl, damit sie über die vielen Schaulustigen hinweg sehen konnte, was sich da vorne beim Turm zutrug. Vor dem Bistrot hatte sich eine grössere Traube von Touristen und Einheimischen versammelt, die alle aufgeregt und gespannt in die Richtung des Tour Solidor schauten.
«Woh, Bruno, da brennt ein Auto! Willst du nicht auch mal schauen.»
«Bin nicht im Dienst», stöhnte Emmenegger, der seine lädierte Zunge mit seinem eisgekühlten Weisswein pflegte. «Ich habe Ferien, Schatz! Das hier geht mich gar nichts an. Das ist Sache der französischen Polizei.» Womit Kommissar Emmenegger ja im Prinzip Recht hatte, sich aber trotzdem gehörig irrte…
- 3 -
K.-o.-Tropfen
In Luzern hatte die frühsommerliche Wärme den späten Schnee, der Ende April noch gefallen war, innert Tagen weggeputzt. Deshalb hatte die Reuss Hochwasser und der Uferweg unterhalb der Kirche Sankt Karl lag nur noch wenige Zentimeter über den gewaltigen Wassermassen des Flusses. Sigi, ein stadtbekannter Drogendealer, und notabene eigener bester Abnehmer, wartete in durchnässten Turnschuhen auf einem schlecht beleuchteten Abschnitt am Reussufer auf einen Kunden.
«Mann, wo steckt der Typ nur?», fluchte Sigi und schaute beklommen zur tobenden Reuss mit ihren weissen Schaumkronen auf den ungewöhnlich hohen Wellen. Die Strassenlampen der Sankt-Karli-Brücke zauberten ein gespenstiges Lichtspiel auf die Wasseroberfläche. Sigi war dem Wasser noch nie zugetan gewesen, denn er hatte nie schwimmen gelernt. Aber das tat jetzt nichts zur Sache, denn er hatte einen Deal. Vor wenigen Tagen hatte ihn so ein komischer Kerl vor dem Lebensmittelgeschäft an der Brünigstrasse angesprochen, als er sich nach dem Besuch der Gassenküche noch ein Bierchen aus dem Laden geholt hatte. Ob er ihm etwas verkaufen könne, hatte der Mann gefragt, der überhaupt nicht nach einem Drogenkonsumenten aussah. Aber was weiss man heutzutage denn schon...
«Was soll’s. Ein neuer Kunde ist einer mehr», dachte sich Sigi. Man wurde schnell handelseinig. Sigi machte mit seinem neuen Abnehmer einen Treffpunkt für die Übergabe der Ware ab. Sie einigten sich nach einigem Hin und Her auf diesen Uferweg an der Reuss, denn Sigi wohnte nicht weit entfernt an der Bernstrasse in einer versifften Wohngemeinschaft, wo er auch seine Drogen herbekam, und dieser Typ bestand fast panisch auf einen abgelegenen, dunklen Übergabeort, weil er ja keine Schwierigkeiten mit den Bullen wollte.
«Anfänger!», dachte Sigi, der vor allem schnell zu seinem Geld kommen wollte, damit er sich selber etwas reinziehen konnte. In der Baselstrasse solle es im Moment ganz günstiges «H» geben.
«Los, komm schon endlich, du Penner!», stöhnte er und erschrak fürchterlich, als plötzlich ein Mann hinter einem Baum hervortrat und ihn ansprach.
«War der schon die ganze Zeit da?», fragte sich Sigi hektisch und beruhigte sich erst wieder, als er die sanfte Stimme seines Kunden wiedererkannte.
«Hast du die Tropfen?»
«Ja klar, meinst du, ich würde mir sonst hier den Abend vertreiben?», antwortete Sigi dem Kerl und fragte keck: «Und du, hast du die Kohle dabei?»
«Ja sicher, aber kein Wort zu niemanden, verstanden? Zeig mir die Ware, dann kriegst du das Geld.»
«Du willst wohl mit den K.-o.-Tropfen eine Puppe flachlegen und ficken? Woher kommst du überhaupt? Mann, ich habe dich noch nie in der Szene gesehen! Vom Dialekt her aus dem Entlebuch oder dem Emmental, stimmt’s?»
«Pass auf, was du sagst! Das geht dich einen Dreck an!», sagte der Fremde ruhig, öffnete seine Brieftasche und entnahm ihr eine Hunderternote. Sigi konnte erkennen, dass er noch mindestens zwei weitere grosse Scheine dabeihatte.
«Die krall ich mir! Leichte Beute», dachte sich Sigi und täuschte sich gewaltig.
Sigi streckte dem Mann das Fläschchen mit den K.-o.-Tropfen entgegen und flüsterte verschwörerisch: «Hey Mann, die wirken prima. Habe sie neulich an einem Kumpel ausprobiert. Der war glatt für Stunden weg, und ich habe ihm die ganze Bar weggesoffen. Super Ware! Also die Tropfen, nicht die paar Flaschen meines Kumpels. Aber weisst du, das Beste daran war: Mein Kumpel wusste danach von nichts. Mattscheibe. Aber keine Sorge: Er hat sich wieder prima erholt. Wirst noch viel Spass damit haben, das garantiere ich dir!»
Als der Fremde nach dem Fläschchen greifen wollte, trat Sigi überraschend einen Schritt nach vorne und hielt dem vermeintlichen Anfänger sein Messer an den Hals.
«Los, rück das Geld raus. Ich will alles!»
Sigi bemerkte nicht, dass der Fremde vorsichtig das Fläschchen mit den Tropfen in eine seiner Hosentaschen gleiten liess und einen schwarzen Gegenstand aus der linken Tasche seiner Jack-Wolfskin-Jacke hervorzog. Gerade, als Sigi nach der Brieftasche greifen wollte, die ihm der Fremde brav entgegenstreckte, machte der Typ einen Ausfallschritt und drückte Sigi einen Elektroschocker an die Kehle. Der Schlag war überwältigend. Vor allem für den total überraschten Sigi, der noch immer geifernd auf die Brieftasche mit dem vielen Geld starrte, als er wuchtig in Richtung Reuss geschleudert wurde. Zu seinem Pech wurde gerade zu dieser Zeit das Geländer des Spazierweges renoviert. Das provisorische Geländer, das die Gemeindearbeiter der Stadt Luzern mit weissroten Holzlatten als Ersatz gezimmert hatten, hielt dem Aufprall nicht stand. Sigi flog rücklings in die tosende Reuss.
Der Fremde stellte mit Schrecken fest, dass Sigi keine Anstalten machte, irgendwelche Schwimmbewegungen zu machen. Er vermutete, dass der Stromschlag ihn kurzzeitig gelähmt hatte. Klar, der stand ja auch in einer Wasserpütze, von denen sich so einige gebildet hatten, da es am Nachmittag noch stark geregnet hatte. Das hatte den Schlag wahrscheinlich noch verstärkt. Der Fremde presste sich eine Hand vor den Mund, um nicht zu schreien, als er sah, wie Sigi sich langsam auf den Bauch drehte und mit dem Kopf nach unten in den riesigen Wassermassen im Dunklen Richtung Reussbühl verschwand.
«Jesus, das habe ich nicht gewollt…», stammelte der Typ. «Aber selber schuld», versuchte er sich zu beruhigen. «Mit dem Messer auf mich los. Der spinnt ja.»
Vielleicht sollte er doch wieder ein Bauteil aus dem Schocker ausbauen, den er vor wenigen Tagen kurz nach der deutschen Grenze am Bodensee bei einem dubiosen Waffenhändler in einem schäbigen Hinterhofladen erstanden hatte. Seine Modifikation schien fast zu gut zu funktionieren. Er wollte ja niemanden damit töten. Er griff in seine Hosentasche und fischte die K.-o.-Tropfen hervor. Nicht töten – aber betäuben!
- 4 -
Jean-Pierres Problem
«Will jemand noch etwas Käse zum Dessert?», fragte Kommissar Emmeneggers Mutter Florence in die gemütliche Runde. Bruno Emmenegger, seine Freundin Eva und Emmeneggers Cousin Jean-Pierre wehrten schon fast verzweifelt ab und tätschelten sich wohlig ihre vollen Bäuche.
«Danke Maman, danke. Aber nach deinem Choucroute de la mer mit den frischen Langusten und den wunderbaren Muscheln reicht mir eine Portion Camembert zur Genüge.»
«Mir auch, liebe Tante Florence, dein Sauerkraut war einfach göttlich», schmeichelte Jean-Pierre.
«Sauerkraut mit Fisch und Meeresfrüchten habe ich noch nie gegessen. Das ist wirklich eine vorzügliche Kombination! Und der Weichkäse machte den perfekten Abschluss», schwärmte Eva. «Aber jetzt bin ich mehr als satt. Keinen weiteren Käse also auch für mich. Und Bruno sollte sowieso etwas auf seine Linie achten, hat sein Arzt gesagt. In der Zeit, als er nach dieser entsetzlichen Geiselnahme-Geschichte verletzt im Spital lag, hatte er ein paar Pfunde zugelegt. Aber jetzt will Bruno ja wieder vermehrt Sport treiben. Hat er mir zumindest versprochen. Gell, Bruno?»
«Muss ich wohl», stöhnte der Kommissar und fasste sich an den Oberschenkel, wo vor noch nicht allzu langer Zeit eine Glasscherbe einige Blutgefässe zerfetzt hatte.
«Ich habe uns im Carrefour in Saint-Servan neue Laufschuhe gekauft. Ich will ja auch etwas für meine Figur tun», fügte Eva an und streckte eines ihrer langen Beine neben dem Tisch in die Höhe und zeigte auf einen blassrosa Trainingsschuh.
«Wow, du bist ja wirklich fit!», flirtete Jean-Pierre und pfiff durch die Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen, die die Frauen an ihm so attraktiv fanden.
Eva fühlte sich geschmeichelt und schielte kurz in den wuchtigen Spiegel über der Kommode. Zufrieden mit dem, was sie sah, stand sie vom Tisch auf, stapelte die schmutzigen Teller und sagte zu Emmeneggers Mutter: «Komm Florence, ich helfe dir in der Küche. Du wolltest mir doch noch ein kleines Geheimnis anvertrauen.»
Eva, ganz in ihrem Element, nahm flink noch die grosse Fischplatte vom Tisch und marschierte mit dem Geschirr schnurstracks in die Küche. Florence errötete verlegen, was Emmenegger als gelernten Kommissar nicht entging.
«Maman? Ist was passiert?»
«Nicht, dass ich wüsste», antwortete Florence allzu hastig und versuchte, vom Thema abzulenken, «öffnet doch bitte schnell die grossen Fenster. Es weht noch eine angenehm warme Meeresbrise. Macht es euch gemütlich, ich bringe später den Kaffee.»
Emmeneggers Mutter verschwand eiligst in der Küche und der Kommissar schaute der älteren Dame verdutzt nach.
«Die verstehen sich aber gut, deine Eva und Tante Florence, nicht wahr?», bemerkte Jean-Pierre, und Emmenegger brummelte etwas Unverständliches. «Komm Bruno, wir gehen in die Bibliothek, ich brauche dringendst eine Gauloise». Gleichzeitig kramte er eine Zigarettenschachtel aus seiner Hemdtasche.
Emmeneggers Grossvater selig hatte den kleinen, angrenzenden Raum stets Bibliothek genannt, was eine masslose Übertreibung war, denn das Zimmer beherbergte nur wenige Bücher. Es war aber der einzige Ort, in dem ihn Grossmutter seine Tabakpfeifen schmauchen liess. Die wenigen Bücher im dunklen Massivholzregal handelten allesamt von der Seefahrt, überwiegend aus der Zeit der französischen Piraten und Freibeuter. Es waren wilde Geschichten und abenteuerliche Berichte über Korsaren, die im Auftrag des französischen Königs die englischen Schiffe enterten und ausraubten. In den Sommerferien, die er als Knabe jeweils bei seinen Grosseltern verbracht hatte, konnte Bruno Emmenegger stundenlang über den Seekarten und Zeichnungen der Piratenschiffe verweilen und von verwegenen Abenteuern in fernen Ländern träumen.
Jean-Pierre öffnete ein grosses Fenster und die beiden Männer standen minutenlang stumm im dunklen Zimmer und bestaunten die grandiose Aussicht. Direkt unter ihnen lagen die grossen Anlegestellen der Autofähren, die zwischen England und Frankreich sowie den Kanalinseln verkehren. Am Horizont glänzten die Fenster der Häuser in Dinar im Sonnenuntergangslicht wie Gold. Auf der Mündung der Anse, die zwischen Saint-Malo und Dinar in den Ärmelkanal fliesst, kehrten noch einige Segler in den Jachthafen zurück, solange es der hohe Wasserstand bei Flut überhaupt noch erlaubte.
Emmenegger, den nun doch die Neugierde packte, zeigte südlich gegen den Tour Solidor und fragte: «Du, Jean-Pierre, weisst du eigentlich, was da heute Nachmittag beim Turm passiert ist? Da ist ein Auto explodiert.»
Jean-Pierre arbeitet beim französischen Zoll, der Douane française.
«Ein Polizist hat mir erzählt», begann er, «dass das Auto sehr wahrscheinlich manipuliert worden sei. Solche Sachen sind schon beunruhigend. Aber was mir ehrlich gesagt noch mehr Sorge bereitet, ist, dass der Kerl, der ihm Auto verschmorte, ein mehrfach vorbestrafter Gauner aus Paris war. Wenn solche Typen in unserer Stadt auftauchen, läuten bei uns am Zoll und bei der Polizei alle Alarmglocken gleichzeitig. Ob Schmuggel oder gar Menschenhandel, denen trauen wir alles zu. Aber es ist schwierig, ihnen auf die Schliche zu kommen. Zurzeit wissen wir nicht einmal, wo sie sich eingenistet haben. Denn alleine ist dieser Kerl sicher nicht hier gewesen. Der ist, oder besser war, ein Anführer einer grösseren Bande aus Paris. Seit die grösseren Häfen und der Eingang des Eurotunnels bei Calais besser bewacht werden und praktisch dicht sind, sind die kleinen Häfen, wie hier bei uns, ein gefundenes Fressen für die Gauner und Schlepper.»
«So wird es dir wenigsten nicht langweilig diesen Sommer», frotzelte Emmenegger.
«Mach keine Witze, du Bergbauer!», entgegnete ihm sein Cousin und nahm einen letzten tiefen Zug, bevor er seine Zigarette im Aschenbecher ausdrückte. Sehr ernst begann Jean-Pierre zu erzählen: «Letzte Woche meldete sich bei uns die britische Küstenwache. Bei einer Routinekontrolle einer grossen Segeljacht flüchtete die Crew des Segelbootes mit einem schnellen Beiboot. Starker Nebel und Untiefen verhinderten die Verfolgung des Beibootes. Weil die Mannschaft der Küstenwache ihr Schiff nicht aufs Spiel setzen wollte, kehrte sie zum Segelboot zurück und gab die Verfolgung auf. In der Jacht fanden die Beamten drei pakistanische Familien mit sieben Kindern, eines davon war ein Säugling. Alle waren völlig unterkühlt und geschwächt von ihren Schleppern zurückgelassen worden.»
«Dreckskerle, auch Kinder waren dabei, hast du gesagt?», fluchte Kommissar Emmenegger.
«Oui, incroyable! Und den Skipper des Schiffs fanden sie halb totgeschlagen in seiner Kajüte. Wir glauben, die Kerle haben den Skipper auf hoher See überwältigt und das Schiff mit Gewalt in Besitz genommen. Aber rätselhaft ist noch eine andere Sache. Per Zufall haben wir genau dieses Schiff nach dem Auslaufen hier in der Bucht vor Saint-Malo kontrolliert. Das machen wir gelegentlich bei den grösseren Hochseejachten. Ein bei uns in Saint-Malo registrierter Skipper und zwei neureiche Möchtegern-Segler aus Paris. Alles ganz normal. Aber woher kamen die Emigranten? Im Bordbuch auf dem Schiff war kein weiterer Hafen aufgeführt und ein Segelboot von dieser Grösse mit entsprechend grossem Kiel kann unmöglich ohne Hafenanlage irgendwo anlegen. Aber die Häfen haben wir vom französischen Zoll im Griff, da bin ich mir sicher!», meinte Jean-Pierre selbstsicher. «Aber wie haben es die Schlepper geschafft, die Emigranten an Bord zu holen? Die Kinder sind ja wohl kaum zum Schiff hinausgeschwommen.»
«Wirklich seltsam. Und die Gezeiten kommen ja noch erschwerend dazu!», stimmte der Kommissar Jean-Pierre zu.
«Wir hoffen, dass uns der Skipper mehr sagen kann, wenn die britischen Kollegen ihn vernehmen können. Aber im Moment liegt er immer noch in kritischem Zustand in einem Spital irgendwo in Südengland.»
Minutenlang blieben die beiden Männer noch am Fenster stehen und dachten, jeder für sich, über die seltsame Geschichte nach. Als die Sonne im Westen glutrot in den Atlantik versunken war, sagte Jean-Pierre: «Komm Bruno, wir gehen wieder zu den Frauen in die gute Stube rein. Was klage ich dir überhaupt über dieses Schmugglerpack? Du hast ja schliesslich Ferien. Meinst du, deine Mutter offeriert uns noch von ihrem exquisiten Calvados?»
«Aber nur ein Gläschen, meine Buben!», äffte Bruno Emmenegger seine Mutter nach, und die Männer lachten vergnügt, weil sie beide wussten, dass es nie bei einem Gläschen blieb.
Emmenegger war glücklich. Ferien bei seiner Mutter, die er in der Schweiz doch ab und zu vermisste. Eva und seine Mutter verstanden sich blendend! Die Wetteraussichten waren hervorragend. Und das Beste: Astrid, seine Assistentin und Vertretung bei der Luzerner Polizei, hatte ihm am Nachmittag eine Kurznachricht mit äusserst beruhigendem Inhalt gesendet: «Alles ruhig hier, geniess deine Ferien!»
Was um Gottes willen konnte jetzt seinen verdienten Urlaub noch stören?
- 5 -
Der Tote im Wehr
Tags darauf wurde Astrid Egger kurz nach sechs Uhr durch das unerbittliche Piepsen ihres Mobiltelefons unsanft aus einem wunderbaren Traum gerissen. Sie hatte von einem Segelturn in der Karibik geträumt. Nur sie und ihr Mann John, weisse Strände, Palmen und ein türkisblaues Meer. Keine zermürbende Polizeiarbeit, keinen Stress, keine Kongresse, wegen denen ihr amerikanischer Mann die meiste Zeit auf der ganzen Welt unterwegs war und als gefragter Psychologe Vorträge hielt. Nur Ruhe und warmer Wind. Keinen Regen, Regen, Regen wie hier in Luzern in diesem Frühsommer.
Chef-Kriminaltechniker Meyer war es, der sie aus ihrem süssen Traum in die bittere Realität zurückholte: «Guten Morgen Astrid, es tut mir sehr leid, dass ich dich so früh aus den Federn scheuchen muss, aber wir haben eine Leiche.»
Noch im Halbschlaf schlich sich Astrid aus dem Schlafzimmer, um ihren Mann nicht zu wecken, der erst um Mitternacht aus New York zurückgekehrt war. Sie schloss leise die Schlafzimmertüre und fragte: «Wo denn Meyer, und wieso kümmert sich nicht Huber darum?»
Huber war neu bei der Luzerner Kriminalpolizei. Aber er hatte es schon in erstaunlich kurzer Zeit geschafft, sich innerhalb des Teams ziemlich unbeliebt zu machen. Er verwendete die meiste Zeit dafür, sich beim Kommandanten einzuschmeicheln und führte sich wie dessen Adjutanten auf, obwohl er auf der gleichen Hierarchiestufe wie Astrid stand. Dass Kommissar Emmenegger in den Ferien weilte, nutzte Huber schamlos aus. Emmenegger hatte das Grossmaul, wie der Kommissar den Huber unumwunden nannte, schon verschiedentlich zurechtgewiesen, weil sich dieser gerne als Boss aufgespielte.
«Huber hat eine Strategiesitzung mit dem Chef. Weiss der Geier, was das soll! Ich brauch dich trotzdem, Astrid. Die Leiche wurde beim Reusswehr oberhalb von Rathausen gefunden. Treffen wir uns da?»
«Ok, Meyer, aber eine Dusche gönnst du mir schon noch?»
«Sicher, Madame Egger, aber ich gehe schon mal los, damit ich dort bin, bevor alle Spuren vom Regen weggewaschen worden sind.»
Als Astrid mit noch feuchtem Haar und brötchenkauend das Wehr erreichte, war die Leiche schon geborgen. Röbi und Heinz, die ehemaligen Motorradpolizisten, die vor einiger Zeit ihre Motorräder aus Spargründen abgeben mussten und wie alle anderen Streifenpolizisten auf vier Rädern im Dienst unterwegs waren, waren die ersten, die bei der völlig aufgelösten Spaziergängerin eintrafen, die die Leiche beim Wehr gefunden hatte. Was eigentlich ja gar nicht stimmte, denn ihr pummeliges Wauwau war es. Das Hündchen hatte sie kläffend ans Wehr mitgeschleppt, wo eine Kreatur in der Böschung hing und ihr zuwinkte. Also eher passiv, denn der Kopf der Person war unter Wasser und das Winken eines steifen Arms entstand durch den Wellengang der Reuss im Wehr. Der Körper hatte sich an einem dicken Ast des Schwemmholzes verfangen, welches sich nach dem heftigen Unwetter der letzten Nacht am Wehr aufgetürmt hatte. Da sich der Körper nahe genug am linken Reussufer verfangen hatte, war es für Röbi und Heinz möglich, die Leiche zu fassen und an Land zu ziehen. Wie gewohnt, bestand Heinz darauf, vorher erst einmal zu knobeln, wer von den beiden sich am leblosen Körper zu schaffen machen musste.
«Kopf oder Zahl?», fragte Heinz.
Röbi verlor wie meistens und machte sich missmutig daran, den Toten aus dem Wasser zu heben. Er schaffte es aber doch nicht alleine, weil der Tote viel zu schwer war. Gemeinsam zerrten Röbi und Heinz verbissen an der Leiche, rutschten auf den nassen Ufersteinen aus und zogen je einen nassen Schuh aus dem kalten Gewässer, was sie fluchend zur Kenntnis nahmen. Nachdem der Körper an Land gezogen und geborgen worden war, kümmerten sich die beiden Polizisten um die arme Spaziergängerin, die den grausigen Fund gemacht hatte. Die bemitleidenswerte Frau machte den Anschein, innert Kürze zu kollabieren, während ihr Hund unaufhörlich kläffte. Röbi führte die Frau zu einer nahegelegenen Bank beim Uferweg und blieb sicherheitshalber bei ihr sitzen, während Heinz zurück zum Ufer eilte und die Leiche auf den Rücken drehte.