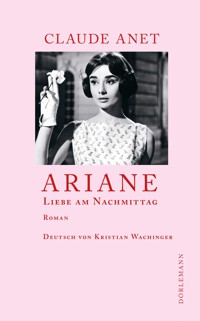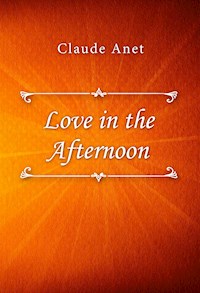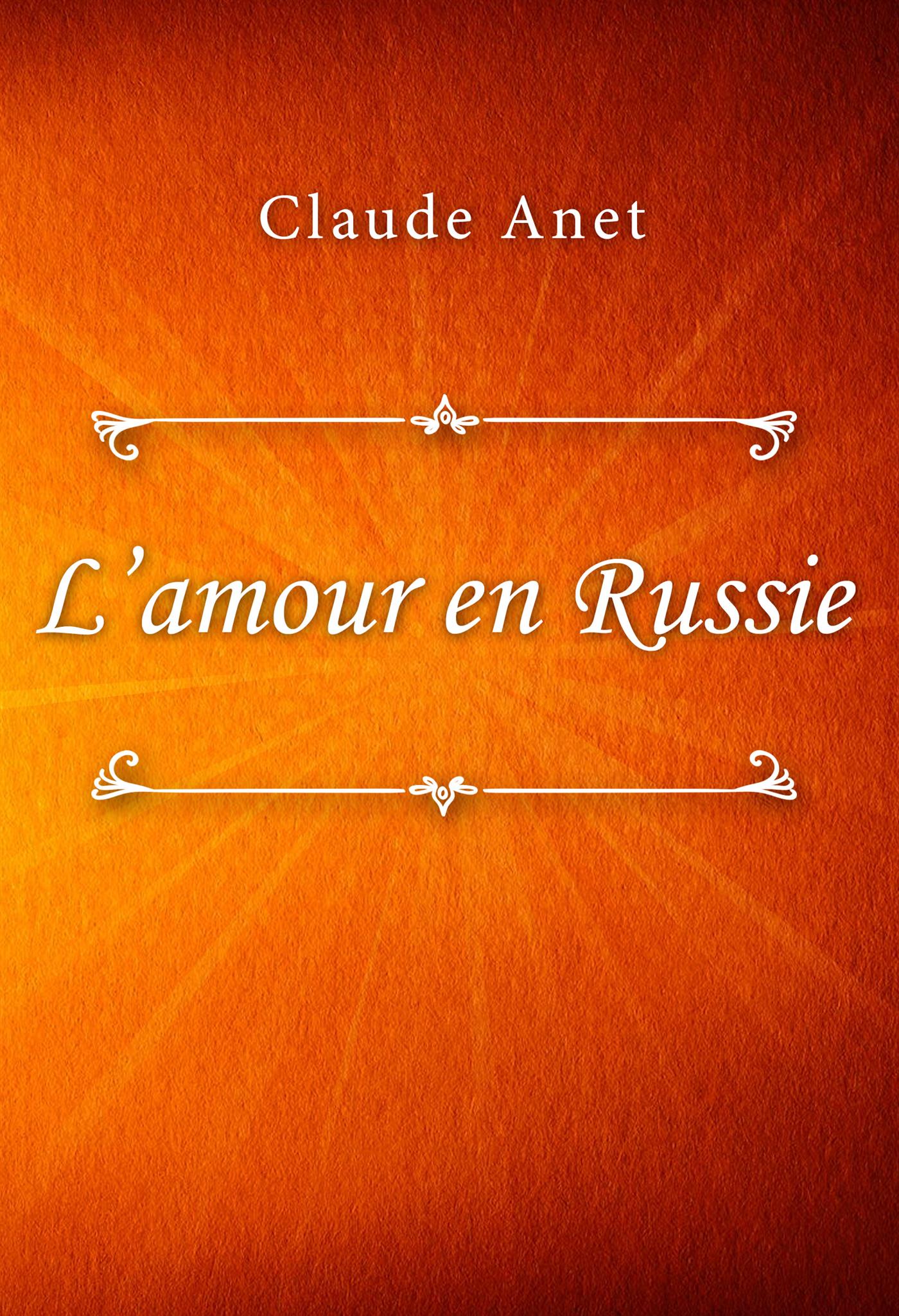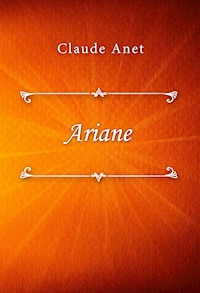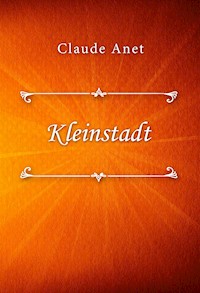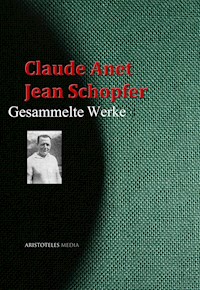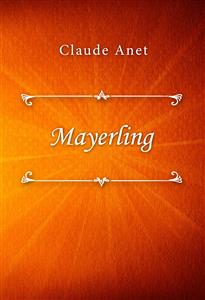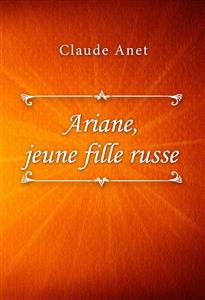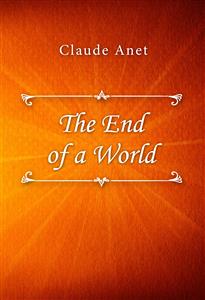1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1920. Der Erste Weltkrieg ist vorüber, und die Welt ist eine andere. Jean-Christophe, ein junger Künstler, kehrt nach Paris zurück, voller Idealismus und Hoffnung. Er hofft, dass er in dieser neuen Welt etwas verändern kann. Doch er findet sich in einer Welt wieder, die von Krieg und Zerstörung geprägt ist. Die Menschen sind verbittert und zynisch, und die Gesellschaft ist in Unordnung geraten. Jean-Christophe versucht, sich in dieser Welt zurechtzufinden, aber er findet keinen Platz für sich in dieser Gesellschaft. "Ende einer Welt" ist ein pessimistischer Blick auf die Welt nach dem Ersten Weltkrieg. Es zeigt, wie der Krieg die Menschen und die Gesellschaft verändert hat. Jean-Christophe ist ein Symbol für die verlorene Generation, die in einer Welt aufwächst, die von Krieg und Zerstörung geprägt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Claude Anet
Ende einer Welt
Vorwort
Ein Roman muß für sich allein bestehen, und darum habe ich diesen durch keinerlei Anmerkungen beschwert. Bei einem Thema aber wie das vorliegende, das so schwierig ist und so vielerlei Studien erfordert, schulde ich dem Leser doch wenige kurze Erklärungen und Dank jenen, deren Arbeiten mein Werk ermöglichten.
Ich habe die Ufer der Vézère (Nebenfluß der Dordogne, Südfrankreich), an denen jene Menschen im letzten Abschnitt der Renntierzeit lebten, deren Schicksal ich schildere, und die Höhlen dieser Gegend in Begleitung des Herrn Peyrony, der sie besser als irgend jemand anderer kennt, eingehend studiert. Meine Unterhaltungen mit Salomon Reinach, Boule, Abbé Henry Breuil, Peyrony, A. Viré und Maury waren mir äußerst nützlich. Unentbehrlich waren mir die gelehrten Arbeiten dieser Herren, denen noch die von Cartailhac, Mortillet, Capitan, Lévy-Bruhl, Saint Périer in Frankreich, jene von Robertson Smith, E. B. Tylor, Sir James George Frazer in England, H. F. Osborn in Amerika und Sigmund Freud in Österreich hinzugefügt werden müssen, denn nur aus ihnen konnte ich Kenntnis über die wichtigsten Theorien der fossilen Anthropologie und über die Mentalität der Urvölker schöpfen.
Claude Anet
Ende einer Welt
Flache Täler durchschneidend, zogen Ketten ungleichförmiger Hügelrücken bis zum Horizont. Aus diesem wirren Auf und Nieder hob sich eine Rinne im Erdboden ab, die mannigfaltige Windungen beschreibend – breitausladende Bogen mit engen Halbkreisen abwechselnd, die oft von felsigem Gestein eingefaßt waren – den Lauf eines Flusses anzeigte, der trotz aller Launen seines Weges doch recht stetig von Nord nach Süd hinabströmte. Viele Täler, aus denen kleine Bäche flossen, mündeten auf dem einen und dem anderen Ufer. Sanfte Hänge, die sich hie und da bildeten, wechselten auch wieder mit steil ansteigenden, hohen Wänden, in deren felsigen Grund das eisige Wasser in jahrtausendelanger Arbeit oft tiefe Schichten des Bodens zu geräumigen Kavernen aushöhlend, seinen Weg gegraben und geglättet hatte.
Sträucher und Buschwerk hatten sich zwischen den Steinen festgeklammert. Ein Wald, in dem Fichten und Birken vorherrschten, bedeckte fast das ganze Land, nur in den Niederungen breiteten sich Sümpfe und einige Wiesen in den höher gelegenen Tälern. Dieser Wald zeigte fast ebensoviel gestürzte Stämme wie aufrecht stehende Bäume. Wurzeln und Holz gefallener Riesen faulten im Morast. Andere versanken nach und nach im sandigen Boden, Eichen, deren Gipfel noch grüne Triebe zeigten, waren halb zusammengebrochen, sterbende Tannen- und Ahornbäume lehnten an ihren noch kräftigen Brüdern. Vom Blitz getroffen, vom Orkan entwurzelt oder nur vom Alter überwunden, blieben sie liegen, wohin sie fielen. Moose und Flechten, grau von Feuchtigkeit, bedeckten den Boden. Einige wenige Büschel Gräser ragten vereinzelt aus ihnen hervor. Quellen entsprangen an verschiedenen Stellen. Schneeflecke hafteten an den Hängen, die gegen Norden abfielen.
Die Sonne versank in einen bleichen Himmel. Es war kalt, und mit einbrechender Nacht würde es frieren. Doch fühlte man durch eine gewisse Milde der Luft, daß der Winter seinem Ende entgegengehe, und daß bald die zarten Enden der Zweige zu Knospen anschwellen würden.
Kein menschliches Wesen war auf der Oberfläche dieses Landes zu erblicken. Es gehörte dem Wind, der von Westen strich, und den Tieren, die sich für Augenblicke hier zeigten. Eine Bisamratte machte einen Satz über den Boden und verschwand. Ein Silberfuchs strich geschmeidig am Waldrand entlang, ohne Hast, als würde nichts ihn bedrohen und nichts ihn erregen. Ein Fischadler zog große Kreise über dem Fluß. Vom Gipfel einer Lärche ließ eine Eule ihre klagende Stimme ertönen und verstummte sogleich wieder, beschämt darüber, sich bemerkbar gemacht zu haben, solange noch Tag war. Wie weit der Blick auch schweifte, kein Feld, keine Straße, kein Turm war zu bemerken. Selbst Ruinen waren auf diesem Boden nicht zu finden. Unverändert, wie es aus den gleichgültigen Händen der Natur hervorgegangen war, ehe der Mensch ihm seinen Stempel aufdrückte, erschien dieses Land.
Und doch entdeckte man, als die schrägen Strahlen der untergehenden Sonne nur noch die Rücken der Hügelketten streiften, einen bläulichen Rauch, der sich mit den Dünsten, die aus dem Tale aufstiegen, mischte. Er stieg vom Fluß den Hang entlang, wurde von den Sträuchern zerteilt und verwandelte sich, am Gipfel der Böschung angelangt, in zarte Wölkchen, mit denen der Wind spielte.
In einiger Entfernung erhob sich eine andere, ganz zarte Rauchwolke wie eine schlanke Säule in die Luft, schwankend, bis auch hier der über das Tal streichende Wind sie entführte.
Der Mensch war da, gegenwärtig und verborgen in diesem weiten Lande.
Am Rande einer Schlucht hob sich im Dämmerlicht eine menschliche Gestalt vom Stamme einer Lärche ab. Es schien fast, als wäre sie selbst ein Teil des Stammes gewesen, der sich nun plötzlich in zwei Stücke spaltete. Mit vorsichtig gedämpftem Schritt ging sie dem Wind entgegen und bückte sich, um die zarten Spuren einer Tierfährte zu prüfen. Diese Spuren führten zu einem engen Loch, neben dem sich der Jäger zur Erde gleiten ließ. Er war ein junger, fast bartloser Mann, in Renntierfell gekleidet, mit kurzem Wams und Hosen, die bis zur Mitte der Waden reichten. Sandalen aus geflochtenem Leder schützten seine Füße. Die Tierhaut, das Fell nach innen gewendet, war schmiegsam, gut bearbeitet und besaß die stumpfen Tönungen, vom Grau ins Bräunliche und vom Bräunlichen ins Rosa spielend, der Flechten, auf denen No, Sohn des Timaki, vom Stamme der Bären, sich eben ausgestreckt hatte. Hätte ihn nicht der dunklere Fleck seiner kastanienbraunen Haare verraten, er wäre in dem schwindenden Licht vom Boden, auf dem er mit aufgestützten Ellbogen unbeweglich lauerte, nicht zu unterscheiden gewesen. Sein Kopf war klein, seine Züge regelmäßig, die Nase wohlgeformt, und aus einem von Sonne und Wind gebräunten Antlitz blitzten helle Augen. So harrte er lange Zeit unbeweglich wie ein Stein. Die Sterne, die gleichen Sterne, die heute noch über unseren Köpfen schimmern, leuchteten schon damals einer nach dem anderen und bald zu Tausenden am Himmel auf. Die Luft wurde eisig. No schien es nicht zu bemerken. Schlief er? Eine Maus, getäuscht von seiner Reglosigkeit, huschte über ihn hinweg. Sie verweilte einen Augenblick, um mit einem Stückchen Moos zu spielen. Bald darauf hörte No ein leichtes Geräusch aus dem Loch dringen. Er hielt seinen Atem zurück. Eine Schnauze zeigte sich; beruhigt durch die Stille ringsum, kam endlich der ganze Kopf hervor. Lebhafte kleine Augen durchforschten das Dunkel. Doch sie konnten sich kaum einen Atemzug lang umsehen, denn schon fuhr die mit einem behauenen Stein bewaffnete rechte Hand Nos auf den kleinen Kopf nieder und zerschmetterte mit einem harten, wohlgezielten Schlag den Schädel, während die linke Hand in nicht minder rascher Bewegung das Tier, das sich im Verenden in die Tiefe seines Loches hinabrollen ließ, festhielt.
Jetzt sprang No mit einem Satz auf die Beine. Er lächelte behaglich, während er seine Beute prüfte. Es war ein wundervoller Zobelmarder, dessen Winterpelz voll weicher, dichter Haare war. Mit dem langen, buschigen Schweif, biegsam, als ob noch Leben in ihm wäre, koste No zärtlich sein Gesicht. Dann drückte er das tote Tier sanft an seine Wange und flüsterte:
»Nicht ich war es, der dein Leben genommen hat, mein Tierchen, es war der Stein. Es hat so sein müssen. Du verstehst es. Doch sieh, wie ich dich behandle. Erzähle deinen Brüdern davon, damit sie mich nicht fliehen.«
Und er wiegte es in seinen Armen, wie ein weinendes Kind, das man beruhigen will.
Dann ging er mit großen Schritten dem Tale zu. Einen Augenblick zeichnete sich seine Silhouette vom Gipfel des Hügels gegen den sternbesäeten Himmel ab: die Gestalt eines jungen Mannes von mehr als sechs Fuß Höhe, breiten Schultern und schlanken Hüften. Seine Beine waren lang, und sein Gang glich dem eines Tieres, das unermüdlich mit gleichmäßig elastischen Sprüngen über den Boden eilt. So verfolgte er seinen Weg bis zur Einmündung eines Seitentales, das zum Flusse hinunterführte.
Hier blieb er stehen. Ein Hang, aus Felsbrocken gebildet, fiel vor ihm zum Flusse ab, und drüben am anderen Ufer lag der heilige Boden, den keiner, außer an den Tagen der religiösen Feste, zu betreten wagte. Wohl hätte No dem linken Ufer dieses Flusses folgen können, doch er war jung, knapp achtzehn Jahre, und abergläubischer Schrecken erfüllte seine Seele. Konnte er, ein Kind, wissen, wie man sich gegenüber den unsichtbaren Mächten, die uns umschleichen, zu verhalten hat? Noch war er in die Reihe der Eingeweihten nicht aufgenommen, noch war er nicht im feierlichen Zuge ins Innere jener Grotte geführt worden, die sich in den nahen Felsen barg. Die bösen Geister, die die Gegend durchirren, beunruhigten ihn mehr als alle wilden Tiere, denen er begegnen konnte. So sprang er lieber den halben Abhang entlang über die Steine, auch hier wohl darauf bedacht, alle Gebüsche, von denen bekannt war, daß sie den Geistern zur Wohnung dienten, im Bogen zu umgehen.
Endlich stieg er doch ins Tal nieder, schritt noch etwa fünfhundert Schritte dem Flußlauf entgegen, durchquerte hier in einem kleinen Kahn, den er an einem Baum befestigt fand, mit einigen Ruderschlägen das Wasser und landete auf dem gegenüberliegenden Ufer unter einem vorspringenden Felsen, der gegen Osten zu lag.
Er kletterte durch das Geröll aufwärts, bis er eine breite Terrasse erreicht hatte. Hier, unter dem Schutze eines überhängenden Felsens, war die Nacht noch dunkler. Sechs Feuer brannten mit ruhiger Flamme in gleichmäßigen Abständen voneinander, und ihr Lichtschein fiel auf ebensoviel Hütten, deren Vorderwände in senkrechten Streifen mit lebhafter Farbe bemalt waren. Alles andere verschwamm in der Finsternis. Überall herrschte tiefe Ruhe. Bloß das leise Wimmern eines Kindes oder das tiefe Schnarchen eines Schläfers unterbrach manchmal die Stille. Keinen Wächter gab es vor diesen Wohnstätten, in denen sechs Familien hausten, ein Zeichen für die Sicherheit, in der die Menschen am Flusse seit Jahrhunderten lebten. Die lohenden Flammen vor dem Eingange jeder Hütte genügten, um die Hyänen zu verscheuchen, die sich nachts frech der Niederlassung der Menschen näherten. Das Knacken ihrer starken Kiefer, die die Knochen zernagten, die tagsüber aus den Hütten geworfen worden waren, verriet ihre nächtliche Anwesenheit.
No schlüpfte, ohne zu zögern, in eine der mittleren Wohnstätten. Wie leise er auch eintrat, das scharfe Ohr des Mannes, der nahe dem Eingange lag, vernahm sein Geräusch, der Schläfer richtete sich auf und fragte mit gedämpfter Stimme:
»Etwas Neues?«
»Nichts«, antwortete No. »Ich war weit genug und fragte alle, denen ich begegnete. Den ganzen Fluß entlang ist man beunruhigt.« Er fügte in verändertem Tone hinzu: »Dies hier habe ich erlegt.«
Er zog den Zobelmarder aus seinem Wams und reichte ihn dem Vater hin, der ihn prüfte.
»Ein schönes Stück«, urteilte Timaki befriedigt. Er warf das Tier in den Hintergrund der Hütte, legte sich wieder nieder und setzte seinen Schlaf fort. No hockte indessen beim Feuer nieder, holte ein Stück Fleisch unter einem heißen Stein hervor und begann zu essen. Nach beendetem Mahl ging er einige Schritte weit bis zu einem kleinen Bächlein, das zwischen zwei Hütten rieselte, trank in durstigen Zügen und ließ sich das Wasser noch über Gesicht und Hände laufen. Er blieb eine Weile in den Anblick des aufgehenden Mondes versunken, der auf einer flachen Kuppe, hinter der er hervorkam, zu ruhen schien. Er lauschte den vielstimmigen Geräuschen der Nacht, deren Bedeutung ihm bekannt war. In weiter Ferne klang die Stimme eines jagenden Uhus. Leichtes Knistern in einem Gebüsch verriet ihm ein Tier, das zum Flusse abwärts stieg. »Ein Eber«, murmelte No.
Er trat in die Hütte zurück, schlüpfte in seinen pelzgefütterten Sack, der neben dem seines Vaters lag, und schlief augenblicklich ein.
Im Osten zeigte sich schon ein heller Streifen am Himmel. Heftiger Frost herrschte. No schreckte unruhig aus seinem Schlafe auf und rief:
»Ich habe sie gefunden, während der Nacht habe ich sie gefunden! Ich folgte ihren Spuren, bis mir der Atem versagte.« Und er keuchte wie nach einem rasenden Laufe. »In dieser Richtung, der Quelle des Flusses zu, sind sie davon.«
Und sein Arm wies gegen Nordost.
»Ich werde es sofort dem Häuptling melden«, entgegnete Timaki, der damit beschäftigt war, das Feuer anzufachen.
Durch den Klang ihrer Stimmen geweckt, erhoben sich zwei Frauen, die im Hintergrund der Hütte geschlafen hatten, und kamen zu No. Die ältere war Bahili, eine stattliche Matrone, deren faltiges Gesicht und deren Augen voll Güte waren. Sie näherte sich ihrem Sohn. Stolz und bewundernd blickte sie auf ihn. Wo fand man im ganzen Stamm der Bären, der wegen der Schönheit seiner Männer berühmt war, einen Jüngling, der herrlicher gewachsen, stärker und gelenkiger war? Sicherlich konnte seine Mutter auf ihn stolz sein. Doch ihr Herz krampfte sich schon jetzt bei dem Gedanken zusammen, daß es die letzten Monate waren, die sie gemeinsam verlebten. Im Sommer sollte er zum Manne geweiht und dadurch von ihr getrennt werden.
Hinter ihr reckte ihre Tochter die Arme. Drei Jahre jünger als No, war sie doch wie eine Gerte emporgeschossen, schon entwickelt, mit leicht geschwungenen Hüften. Ihr kleiner Kopf mit den reizvoll feinen Zügen wiegte sich auf einem langen, schmalen Hals. Mah war ihr Name, und nur ein Jahr noch blieb ihr bis zum Hochzeitsreigen. Sie gähnte und zeigte dabei gesunde Zähne, so weiß wie die Narzissen auf der Wiese, und ihr Gähnen ging in ein Lächeln über, mit dem sie ihren Bruder begrüßte. So oft es die gerade in dieser Hinsicht sehr strengen Sitten des Stammes erlaubten, suchte sie seine Gesellschaft und begleitete ihn, wenn er in der Nähe der Hütten umherstreifte. Die Geschwister hatten übrigens eine große Ähnlichkeit, an ihr war Anmut, was bei ihm Kraft war, doch beiden gemeinsam war die freie Haltung, Geschmeidigkeit und Ausdauer, die selbst bei diesem Volk der Jäger, das in langen Märschen und schnellem Lauf geübt war, in solcher Vollendung überraschten. Oft nahmen sie am Spätnachmittag, wenn No Zeit fand und das Wetter günstig war, ihre Harpunen und gingen zum Flusse hinab. Wenn sie dann bei Einbruch der Dämmerung zurückkehrten, glänzten ihre Augen vor Freude, und sie trugen viele prächtige Fische heim, deren Schuppen perlmutterfarbig schimmerten. Die Frauen, an denen sie vorüberkamen, blickten No bewundernd nach, die Männer aber, deren Augen Mah verfolgten, sprachen zueinander: »Glücklich derjenige, der sie als seine Frau entführen wird.« –
Timaki kauerte mit einigen anderen Männern des Stammes am Rande der Terrasse. Sie betrachteten die bleiche Sonne, die auf dem noch winterlichen Himmel ihren Lauf begann. No gesellte sich zu ihnen, denn er mußte Mutter und Schwester die Hütte überlassen, damit sie in Ruhe ihre Morgentoilette beenden konnten. Auch Nos Bruder, der kleine, sechsjährige Knabe, wurde hinausgeschickt, um mit seinen Altersgenossen zu spielen. Nur diese drei Kinder waren Bahili geblieben, und sie war noch glücklich darüber, von sieben Kindern, die sie gehabt hatte, diese behalten zu haben, denn die Säuglinge des Stammes starben in großer Zahl. Allein in der Hütte, entledigten sich die Frauen ihrer Kleider und bestrichen ihre Körper mit feinem Fett, das von wohlriechenden Kräutern duftete, die lange darin gelegen hatten. Die Haare Bahilis waren aufgesteckt und mit kleinen, dünnen Knochen befestigt. Mah dagegen trug sie offen über die Schultern und flocht sie nur zuweilen in Zöpfe.
Als Mah aus der Hütte heraustrat, war sie wie ihr Bruder gekleidet, aber ihr Wams, das nicht so eng anlag, war am Halsausschnitt mit Blaufuchs verbrämt. Zierliche, kleine Knochenstifte, durch Lederösen gesteckt, schlossen es über ihrer jungen Brust. Sie ließ sich mit ihrer Mutter, die den von No erlegten Marder mit herausbrachte, vor der Hütte nieder. No trat zu ihnen.
»In diesem Sommer,« sprach er zu den Frauen, »wenn die Händler vorbeikommen, werden wir gewiß zwei Halsketten für unsere Felle erhalten. Eine benötige ich für den Tag, da ich jenen Ort betreten werde, den man nicht nennt, die andere aber soll für dich sein, Mah.«
Mah klatschte zum Zeichen ihrer Freude in die Hände und begann das Tier abzuhäuten. Sie hatte für diese Arbeit eine ganze Anzahl verschiedengeformte, geschärfte Steine vorbereitet, die zum Abschaben dienten. No saß dabei und aß ein Stück Fisch, während die Frauen fleißig arbeiteten. Er hatte den Marder getötet und damit seine Mannespflicht erfüllt. Nun war es Sache der Frauen, das Fell zu bearbeiten. Bahili und Mah verstanden dies vortrefflich. Durch ihre stete Achtsamkeit verhüteten sie es, daß die Haut zusammenschrumpfte und spröde wurde. Sie wußten sie weich und geschmeidig zu erhalten, und das Pelzwerk behielt, wenn sie es sorgfältig behandelt hatten, stets seinen natürlichen Glanz. Es war eine eigene Handfertigkeit, ein von Müttern und Großmüttern übernommenes Geheimnis, das sie sorgsam hüteten. Sie waren beide wegen ihrer Geschicklichkeit im Stamme berühmt und wurden ob der Schönheit ihrer Pelze beneidet.
Zu dieser frühen Tageszeit war die Terrasse, auf der die Wohnstätten standen, ungemein belebt. Die Strahlen der aufgehenden Sonne übergossen sie mit ihrem Licht und drangen bis in die engsten Winkel ein. Die ganze Fläche, die dem Stamm als Wohnort diente, maß in der Länge hundertfünfzig, in der Tiefe dreißig Schritte, und diese ganze Fläche war von einem einzigen Felsblock überdacht. Die sechs Hütten, die hier standen, waren alle in gleicher Weise erbaut. Auf einem Rechteck von etwa zwölf zu acht Schritt erhoben sie sich, die Wände, aus langen Streifen Pferde- und Renntierhaut gebildet, waren an starken Pflöcken befestigt. Die Anordnung dieser Streifen, die abwechselnd schwarz, rot und grau gefärbt waren, bewies, daß die Leute vom Fluß einen ausgeprägten Farbensinn hatten. Der rückwärtige Teil der Hütten diente als Aufbewahrungsort für die Waffen und verschiedenen Werkzeuge, für die Pelze und die Nahrungsmittel. Im vorderen Teil schliefen die Mitglieder der Familie, Vater und Mutter in der Mitte, ihnen zur Seite die Kinder, die Söhne auf der Seite des Vaters, die Töchter neben der Mutter. Eine einzige Öffnung bot Zutritt in die Hütte; vor dieser befand sich die Feuerstätte, die die Wohnung wärmte und zum Kochen diente. Man röstete hier Fleischschnitten auf heißen Steinen, man kochte in gleicher Weise Schwämme, Beeren und Kräuter, denen man eine Schicht in Fett getränkter Flechten unterlegte. An Pflöcken aufgehängt wurden Fische über dem Feuer geräuchert, die im Hintergrunde der Hütte angesammelt als Vorrat für die schwere Winterszeit dienten. In der heißen Asche des Feuers wurden genießbare Wurzeln aufbewahrt.
An den Wänden der Hütte sah man allenthalben urwüchsig, aber gut gezeichnete und durch Farben belebte Nachbildungen von Tieren, denen plastische Wirkung durch die außerordentlich kunstreiche Ausnutzung der Vertiefungen und Erhebungen des Felsens gegeben war. Hier und da war ein kleineres Tierbild in den Felsen selbst eingeschnitten. Unter diese Bilder befestigte man Opfergaben, um das dargestellte Tier in guter Stimmung zu erhalten. Vor einem Bison hing ein Büschel Gras und Würmer vor dem offenen Rachen eines Lachses.
Ein Bächlein, das einer Höhle entsprang, rieselte den Fels entlang. Die Einwohner hatten es in fünf kleine Kanäle abgeleitet, die an den Hütten vorbeiflossen, und vor jeder Wohnung waren diese Kanäle zu einem in die Erde gegrabenen Becken verbreitert, das stets von frischem Wasser durchspült wurde.
Der Boden der Terrasse war mit Knochen und Asche in halber Fußhöhe bestreut. Wolken von Staub aufwirbelnd, sprangen hier die kleinen Kinder umher und suchten emsig nach Holzstückchen, die sie ins Feuer warfen. Die größeren waren in den nahen Wald gegangen, um Tannenzapfen zu sammeln. Andere wieder brachten Zweige, die sie längs der Felswand zu Stößen aufschichteten. All dies ging natürlich nicht ohne Zank und Streit, Raufen und Schreien ab, auch nicht ohne Püffe, mit denen ungeduldige Mütter ihre Kinder bedachten. Doch auch Lachen und Spielen gab es, Zärtlichkeiten und Scherze. Immerhin legten die Kinder einen gewissen Ernst in diese Arbeit, der zeigte, daß sie sich bewußt waren, dem gemeinsamen Wohl zu dienen.
Mütter und Töchter saßen vor ihren Hütten und waren damit beschäftigt, Pelze zu bearbeiten und Felle für Kleider zuzuschneiden. Zum Nähen verwendeten sie getrocknete Pflanzenfasern oder auch die feinen Nervenstränge von Tieren, die erlegt worden waren, um gegessen zu werden, und fädelten sie in kleine, äußerst dünne Knochennadeln. Darum mußte auch jedes Loch zuerst mit einem Steinpfriem in das Fell gebohrt werden, bevor der Faden mit der dünnen Nadel durchgezogen werden konnte. Die Arbeit ging auf diese Weise nur langsam vorwärts, aber die Zeit hatte ja keinen Wert: Was heute nicht fertig wurde, überließ man unbekümmert dem nächsten Tag, und der bloße Gedanke, sich zu eilen, wäre diesen Matronen ganz und gar unverständlich gewesen.
Andere Frauen richteten das Fleisch und die Kräuter für die Mahlzeit her. Wieder andere zermahlten in ausgehöhlten Steinen die schwarzen und roten Farben, die in großer Menge verbraucht wurden, sei es für die Wände der Hütten, für die Darstellungen der Tiere auf den Felsen, oder um Gesicht und Körper bei den zahlreichen Festen zu bemalen, zu denen die Mitglieder des Stammes sich versammelten.
Während Frauen und Mädchen arbeiteten, blieben die Männer untätig am Rande der Terrasse oder, wenn es kalt war, in der Nähe des Feuers sitzen. Sie wachten nur über den guten Zustand ihrer Waffen, der Beile und Spieße, Harpunen, Pfeile und Speere. Sie besuchten die Nachbarn, um Angelegenheiten des Stammes mit ihnen zu besprechen, oder sie waren im nahen Wald beschäftigt, Fallen auszulegen. In der schlechten Jahreszeit faulenzten sie auf diese Art zwischen zwei ausgedehnten Jagdzügen, von denen sie vollkommen erschöpft, aber mit reicher Beute zurückkehrten, die ihren Familien für mehrere Tage Nahrung bot.
Seit undenklichen Zeiten bewohnte der Stamm diesen Talwinkel, dessen zahlreiche, von der Natur selbst in die Felsen gegrabene Schlupfwinkel sicheren Schutz gegen Kälte und Wind, Schnee und Regen boten.
Die ältesten Überlieferungen von Generation zu Generation, in gleichen Ausdrücken vererbt, an denen man nicht wagte, auch nur ein Wort zu ändern, gaben verwirrten Bericht von einem früheren Leben in weit entfernten Ländern, »in denen heiße Sonne brannte«. Dann kamen große klimatische Umwälzungen, und die Kälte zwang zur Flucht gegen Süden »quer durch trostlose Länder, ohne Bäume, durch Schnee und Eis, wo man oftmals gezwungen war, mangels anderer Nahrung – schmachvoll unverwischbare Erinnerung! – Ratten zu essen«. Der Stamm floh, gepeitscht vom Nordwind, der ihm keine Rast gönnte. Leichen bezeichneten die Spur seines Weges. Die Tiere flüchteten mit den Menschen. Eine Herde der schwankenden, friedlichen Mammute trabte, so schnell ihre durch Fasten geschwächten Beine den unförmigen Körper zu tragen vermochten, den in einem günstigeren Klima erhofften Weideplätzen zu. In dunklen Nächten vernahm man das Brüllen jagender Löwen. Erschreckte Renntiere sah man von weitem fliehen. Gruppen von Bisons rasten angsterfüllt vorbei. Es waren die einzig glücklichen Tage, wenn man ihre untersetzten Gestalten in der Ferne erblickte. Die Jäger nahmen eifrig ihre Verfolgung auf. Sie kehrten bald, gebeugt unter der Last der erlegten Tiere, zurück. Ruhelos zogen die Leute immer weiter gegen Süden. Noch immer hatten sie keine Möglichkeit gefunden, sich niederzulassen. Kaum hatten sie ein Jahr in einer milderen Gegend geweilt, so jagte sie der unerbittliche Nordwind weiter. Ein trüber Himmel, auf dem schweres Gewölk sich ballte, dehnte sich, soweit das Auge blicken konnte. Schon im Sommer schlugen eisige Regengüsse auf die Erde; mit dem Beginn des Herbstes hielt der Schnee seinen Einzug. Die Tiere, die sich von Pflanzen nährten, starben zu Tausenden, wenn der Winter kam, der sechs Monate dauerte.
Endlich war der gelichtete Stamm in dieses glückliche Tal gelangt. Was war von ihm geblieben? Vier Söhne und vier Töchter waren es: der große Ahne hatte trotz der Kräfte und des Mutes eines Bären nur die Seinen retten können. Und war er nicht nach seinem Tode durch die Kraft seines Willens selbst zum Bären geworden, zum edelsten aller Tiere? In dieser Gestalt wachte er weiter über alle, die von ihm abstammten und einander als Brüder von seinem Blut erkannten.
Niemals gab es ein vollkommeneres und tiefer empfundenes Gefühl einer Gemeinsamkeit, ohne daß es nötig gewesen wäre, es durch Vorschriften zu festigen und durch Verbote zu schützen. Jener eine, dessen Namen man nicht nannte, weil die Ehrfurcht vor ihm zu groß war, und weil man fürchtete, ihn durch schlecht gewählte Worte zu verstimmen, war niemals ganz entschwunden. – Gibt es denn jemals ein vollkommenes Ende, und ist nicht der wesentlichste Teil von uns zur Unsterblichkeit bestimmt? So fuhr auch der Stammvater fort, seine geliebten Kinder zu beschirmen. Einige Bevorzugte von ihnen vermochten ihn sogar manchmal zu erblicken, denn er offenbarte sich jenen, die dazu befähigt waren, das zu sehen, was anderen verborgen bleibt, und Worte zu hören, die gewöhnliche Ohren zu vernehmen unfähig sind.
Seltsam zurückhaltend waren die mündlichen Überlieferungen, soweit sie das Leben und das Verschwinden des Ahnherrn in diesem Lande betrafen, in dem sein Geschick, das durch so lange Zeit von feindlichen Mächten bedroht worden war, endlich Ruhe gefunden hatte. Und es war verständlich, daß dies Wenige, das man berichten konnte, nicht vor den Ohren der geschwätzigen und unbedachten Frauen erzählt wurde. Nur den Männern wurden diese Geheimnisse mitgeteilt, und auch ihnen nur stufenweise und unter feierlichen Umständen, wie die Gebräuche sie für jene bestimmten, welche, zu Männern herangereift, die Proben der Einweihung in jener selben Höhle bestanden, in der der Stammvater nach dem Verlassen der menschlichen Gemeinschaft weitergelebt hatte. Der Felsen selbst zeigte den Abdruck seiner Tatzen, fast zehn Fuß hoch über dem Boden, den er, der Riese, dort hinterlassen hatte. Es gab keinen geheiligteren Ort im ganzen Stamm, und jeder, der ihn leichtfertigen Sinnes aufgesucht hätte, wäre eines plötzlichen Todes gestorben. Auf zweihundert Schritte im Umkreis durfte der Boden nicht betreten werden. Und wenn man von ihm sprach, beschränkte man sich darauf, mit Absicht unbestimmte Worte zu flüstern, in denen »ein so schweres Verbrechen« angedeutet wurde, »dessen Enthüllung kein menschliches Ohr zu vernehmen vermöchte« und, seltsamer Widerspruch, »ein Verbrechen, notwendig dennoch, mit Folgen, die niemals aufgehört haben, wohltätig dem ganzen Stamme zu dienen«. Wußte man mehr darüber? Niemand hätte gewagt, außerhalb der heiligen Grotte diese Dinge zu besprechen, denn Geheimnisse, durch deren Besitz eine menschliche Gesellschaft lebt und gedeiht, dürfen nicht in der Öffentlichkeit enthüllt werden.
Und daß die Gesellschaft, die der Ahne begründet hatte, von Bestand gewesen war, vermochte niemand zu leugnen, denn es hatten nach den genauesten Berechnungen seit jener Zeit, da der Stamm von dieser Gegend am Flusse Besitz ergriffen hatte, zehnmal zwanzig Generationen ein friedliches Dasein gelebt. Eine so lange Periode friedlicher Entwicklung fand nicht ihresgleichen auf der Welt. Ist doch die Vergangenheit bis in die weitest zurückliegenden Zeiten, die erforscht wurden, eine endlose Kette grausamer Kämpfe, und alle Gerüchte, die aus fernen Ländern bis zum Flusse gelangten, kündeten nur blutige Gemetzel. Die Leute vom Fluß aber waren nur zweimal gezwungen gewesen, anders als zur Jagd zu ihren Waffen zu greifen. Das erstemal gegen Eindringlinge, die als wilde Horden ohne Kultur und Gesetz von Norden hereinbrachen. Mühelos wurden sie zurückgewiesen. Das zweitemal, um sich gegen Menschen zu wehren, die sie vom Süden her bedrängten und wahre Fremdlinge waren, denn von Kopf bis zu Füßen schwarz, schienen sie die bösesten Geister der Nacht zu verkörpern. Groß und stark waren sie und im Kampfe wohlgeübt. Und vielleicht hätten die Leute vom Fluß trotz ihres Mutes sie nicht zu besiegen vermocht, wenn sich nicht in diesem entscheidenden Augenblicke der allmächtige Schutz des großen Ahnen offenbart haben würde. Frühzeitig ließ er einen furchtbar strengen Winter über das Land hereinbrechen, so daß vier Fuß hoher Schnee den Boden bedeckte, und wie die Schwalben vor dem ersten, rauheren Westwind, hatten jene aus dem Süden gekommenen schwarzen Männer vor der ungewohnten Kälte die Flucht ergriffen.
Friedlich lebte der Stamm seit dieser Zeit an den wildreichen Ufern des Flusses, Alleinherrscher über ein Land, dessen Besitz ihm niemand streitig machte.
Ging man zwei Tagemärsche lang das Tal aufwärts, so traf man Menschen der gleichen Abstammung, die Söhne des Ebers, und noch ein wenig weiter die Söhne des Mammut, die an der Quelle des Flusses siedelten. Im Westen erreichte man nach vier Tagemärschen ungeheure, unüberwindbare Sümpfe, die sich bis zum Horizont ausdehnten. Ein großer Strom, der nur eine Tagereise weit von Sonnenaufgang gegen Westen floß, bildete im Süden die Grenze des Jagdgebietes. Beziehungen zu den Nachbarstämmen gab es wenige. Zum Streit gab es gewiß keinen Anlaß, vermochte doch jeder Jäger in diesen ungeheuren Gebieten, ohne dem anderen in die Quere zu kommen, ausreichende Beute zu finden. Unter allen Tieren, die diese Menschen nur verfolgten, soweit sie sie zu ihrem Lebensunterhalt benötigten, stand an erster Stelle das Renntier. Schon seit den ältesten Zeiten war es den Menschen, die in diesem harten Klima leben mußten, unentbehrlich geworden. Sein Fell, zugleich geschmeidig und fest und mit einem warmen Pelz bedeckt, diente dem Stamm zur Bekleidung. Man verwendete es sogar, da es sich so leicht bearbeiten ließ, als Behang für die Wände der Hütten. Sein starkes, hartes Geweih wurde in mühevoller Arbeit für die Enden der Speere und Harpunen brauchbar gemacht. Sein Fleisch diente als kräftige und beliebte Nahrung, seine Hufe schließlich waren, wie man allgemein wußte, ein unübertroffenes Heilmittel gegen die Fallsucht.
Herden von Bisons streiften durch das Land, aber sie verschwanden ebenso unvermittelt wie sie aufgetaucht waren, ohne daß man eine Ursache dafür zu finden vermochte. Unendlich schwierig war die Jagd auf diese Tiere, denn die gewaltige Kraft, die sie besaßen, war mit ebenso großer Tücke gepaart, und mehr als ein mutiger Jäger des Stammes war von einem wütenden Bison zu Tode gestampft worden.