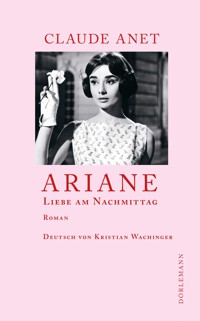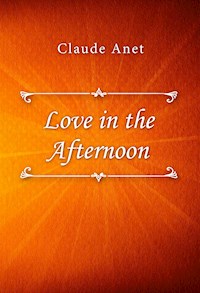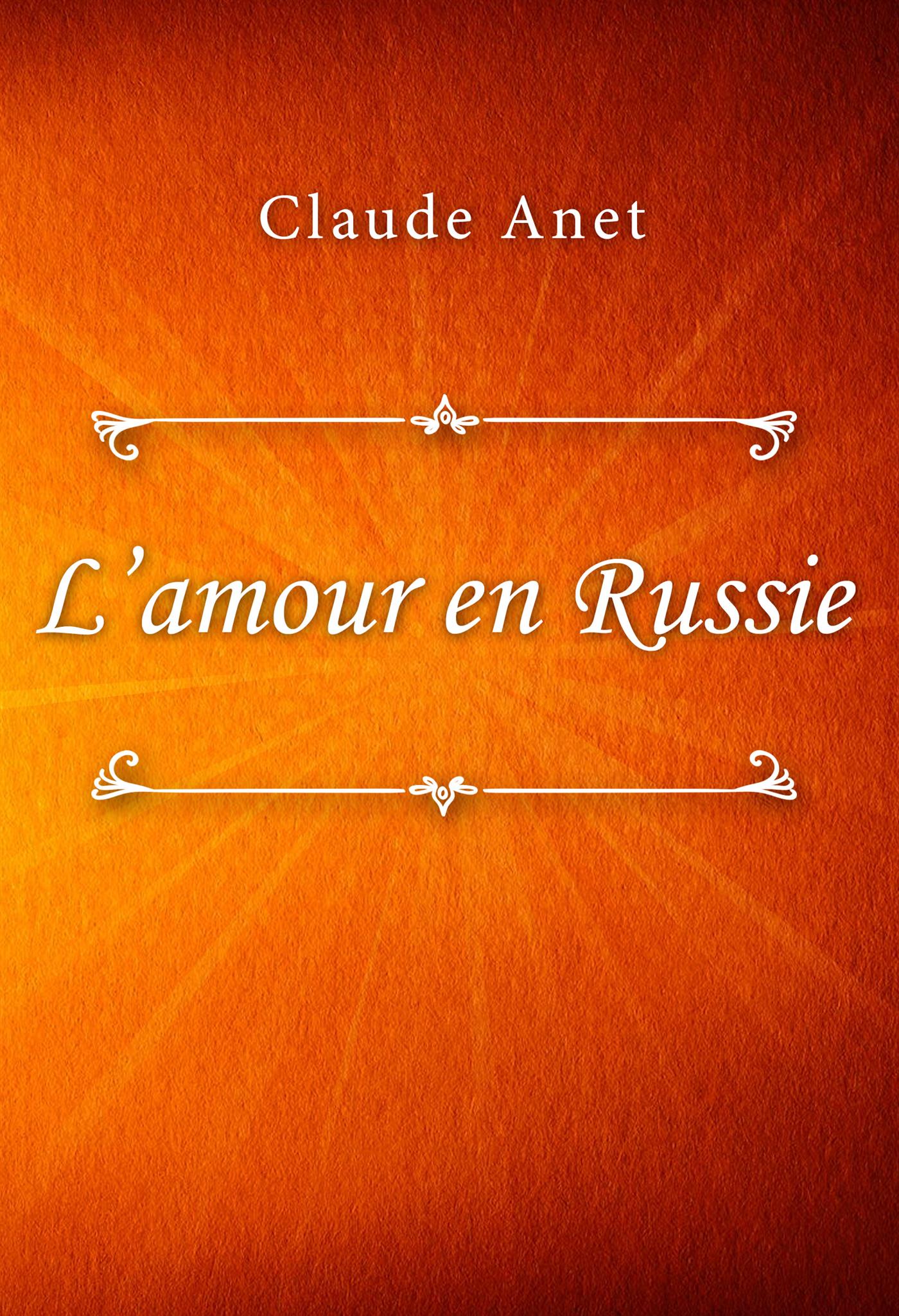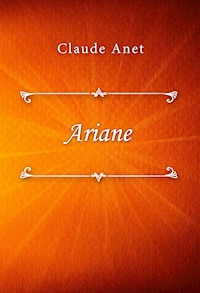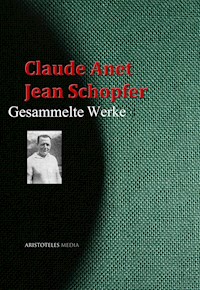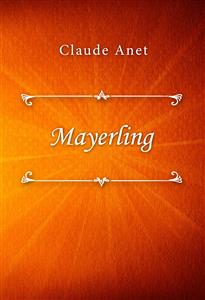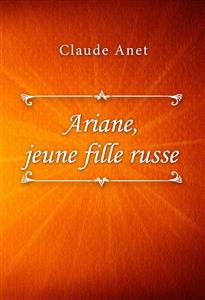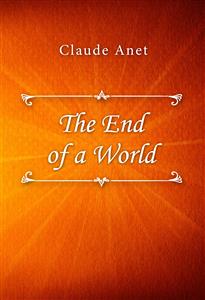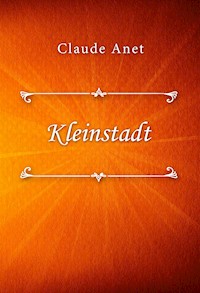
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Als kleiner Junge las ich oft heimlich die Bücher meines Vaters. Wenn ich die glühenden Schilderungen der Romane mit dem Leben rings um mich verglich, dann beglückwünschte ich mich in meiner kindlichen Unschuld dazu, in einer sittsamen, kleinen Stadt zu wohnen, in der nichts geeignet gewesen wäre, die Aufmerksamkeit jener zu erregen, deren Beruf es ist, zur Unterhaltung anderer zu schreiben.
Später, als mit meinem Bart auch die Vernunft mir wuchs, sah ich manches mit anderen Augen. Soll ich’s bekennen? Ich empfand ein seltsames Gefühl verletzten Stolzes. Mein kleines Städtchen unterschied sich nicht im mindesten von allen anderen!
Meine Kleinstadt zählt nicht mehr als sechstausend Einwohner mit gutbürgerlichen Sitten, stillen und beschaulichen Gewohnheiten: sie liegt fast abseits vom Leben. In der Gerichtsstatistik gebührt ihr der höchste Rang, denn die Vergehen sind dort selten, Verbrechen ganz unbekannt.
Doch hat sie ihre Dramen.
Schriftsteller pflegen häufiger zu erfinden als zu berichten; und die Schulung unseres Geistes hat uns so daran gewöhnt, weniger auf Wahrheit, als auf Einfachheit und Vernunft zu sehen, daß Romane, die das Leben vollkommen wahrheitsgetreu wiedergeben, auf uns nur weniger lebensecht wirken.
Ich ziehe die Vielgestaltigkeit des Lebens allen Erdichtungen vor.
Schriftsteller suchen das dramatische Moment in einzelnen bewegten Ereignissen, aber der gewöhnliche Verlauf der Dinge in seiner ereignislosen Stetigkeit ist meist viel dramatischer als die erregendsten konstruierten Begebenheiten.
Schriftsteller lieben es, ihre Geschichten wirkungsvoll abzuschließen: Julien Sorel stirbt auf dem Schafott; die Schönheit von Valerie Marneffe wird von einem furchtbaren Aussatz zerfressen; Madame Bovary endet durch Vergiftung; den zarten Körper Anna Kareninas zermalmt eine schwere Maschine.
Ich kannte eine große Anzahl Entgleister; ihr Ende war weniger effektvoll.
Meine Erzählungen sind wahr. Selbst ihre Vereinigung ist nicht künstlich. Alle spielten sich unter meiner Beobachtung ab, die noch nicht allzulange währt.
Ich bin weder Arzt noch Anwalt noch Priester; es dürfte im Leben noch viele fesselnde Dinge geben, die mir unbekannt blieben. Trotzdem wage ich zu behaupten, daß jene, die ich aufzeichnete, hinreichen, um jedem zu Betrachtungen neigenden Menschen genügend Stoff zu geben, über das Elend aller Verhältnisse nachzudenken und über die Macht und Vielfältigkeit aller Leidenschaften zu staunen, die sich oft unter der alltäglichen Oberfläche verbergen.
Wenn diese Notizen zur Veröffentlichung kommen sollten, wird es nur nötig sein, die Namen der Orte und Personen zu ändern. Die meisten der vorkommenden Menschen sind tot; die übrigen aber haben sich seither so verändert, daß sie unerkannt bleiben werden.
Ich kann ohne Furcht vor einem Ärgernis zur Veröffentlichung schreiten.
Selbst falls jene, deren Schicksale in diesen Erzählungen geschildert sind, sie lesen sollten, würden sie sich nicht wiedererkennen, denn es ist das Los der meisten Menschen, das Drama ihres eigenen Lebens nicht zu erfassen.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Claude Anet
KLEINSTADT
Liebesgeschichten aus der Provinz
Übersetzt
Copyright
First published in 1927
Copyright © 2020 Classica Libris
Original title
Claude Anet
Petite ville
Vorwort
Als kleiner Junge las ich oft heimlich die Bücher meines Vaters. Wenn ich die glühenden Schilderungen der Romane mit dem Leben rings um mich verglich, dann beglückwünschte ich mich in meiner kindlichen Unschuld dazu, in einer sittsamen, kleinen Stadt zu wohnen, in der nichts geeignet gewesen wäre, die Aufmerksamkeit jener zu erregen, deren Beruf es ist, zur Unterhaltung anderer zu schreiben.
Später, als mit meinem Bart auch die Vernunft mir wuchs, sah ich manches mit anderen Augen. Soll ich’s bekennen? Ich empfand ein seltsames Gefühl verletzten Stolzes. Mein kleines Städtchen unterschied sich nicht im mindesten von allen anderen!
Meine Kleinstadt zählt nicht mehr als sechstausend Einwohner mit gutbürgerlichen Sitten, stillen und beschaulichen Gewohnheiten: sie liegt fast abseits vom Leben. In der Gerichtsstatistik gebührt ihr der höchste Rang, denn die Vergehen sind dort selten, Verbrechen ganz unbekannt.
Doch hat sie ihre Dramen.
Schriftsteller pflegen häufiger zu erfinden als zu berichten; und die Schulung unseres Geistes hat uns so daran gewöhnt, weniger auf Wahrheit, als auf Einfachheit und Vernunft zu sehen, daß Romane, die das Leben vollkommen wahrheitsgetreu wiedergeben, auf uns nur weniger lebensecht wirken.
Ich ziehe die Vielgestaltigkeit des Lebens allen Erdichtungen vor.
Schriftsteller suchen das dramatische Moment in einzelnen bewegten Ereignissen, aber der gewöhnliche Verlauf der Dinge in seiner ereignislosen Stetigkeit ist meist viel dramatischer als die erregendsten konstruierten Begebenheiten.
Schriftsteller lieben es, ihre Geschichten wirkungsvoll abzuschließen: Julien Sorel stirbt auf dem Schafott; die Schönheit von Valerie Marneffe wird von einem furchtbaren Aussatz zerfressen; Madame Bovary endet durch Vergiftung; den zarten Körper Anna Kareninas zermalmt eine schwere Maschine.
Ich kannte eine große Anzahl Entgleister; ihr Ende war weniger effektvoll.
Meine Erzählungen sind wahr. Selbst ihre Vereinigung ist nicht künstlich. Alle spielten sich unter meiner Beobachtung ab, die noch nicht allzulange währt.
Ich bin weder Arzt noch Anwalt noch Priester; es dürfte im Leben noch viele fesselnde Dinge geben, die mir unbekannt blieben. Trotzdem wage ich zu behaupten, daß jene, die ich aufzeichnete, hinreichen, um jedem zu Betrachtungen neigenden Menschen genügend Stoff zu geben, über das Elend aller Verhältnisse nachzudenken und über die Macht und Vielfältigkeit aller Leidenschaften zu staunen, die sich oft unter der alltäglichen Oberfläche verbergen.
Wenn diese Notizen zur Veröffentlichung kommen sollten, wird es nur nötig sein, die Namen der Orte und Personen zu ändern. Die meisten der vorkommenden Menschen sind tot; die übrigen aber haben sich seither so verändert, daß sie unerkannt bleiben werden.
Ich kann ohne Furcht vor einem Ärgernis zur Veröffentlichung schreiten.
Selbst falls jene, deren Schicksale in diesen Erzählungen geschildert sind, sie lesen sollten, würden sie sich nicht wiedererkennen, denn es ist das Los der meisten Menschen, das Drama ihres eigenen Lebens nicht zu erfassen.
Fräulein Bourrat
Die Bourrat zählten zu den angesehenen Familien in Valleyres, wo ihre Vorfahren seit einigen Jahrhunderten das bescheidene Leben kleiner Bürgersleute führten, die an der Scholle hängend, ihren Besitz verwalten und durch geschickte Heiraten vermehren.
Schon seit zwei Generationen hatten sie indes dieses Städtchen verlassen, in dem Politik und Kleinhandel sich breitmachten. Sie hatten sich auf ihre Familienbesitzungen zurückgezogen; ein Teil nach Prévoux, eine Meile östlich, der andere Teil nach Vermand, drei Meilen westlich von Valleyres.
Zum Markt in Valleyres traf Herr Ferdinand Bourrat aus Prévoux mit Herrn Karl Bourrat aus Vermand zusammen. Herr Karl fuhr zweispännig; Herr Ferdinand hatte nur ein Roß und noch dazu ein altes vor sein Wägelchen geschirrt. Die beiden Vettern plauderten auf dem Marktplatz, wo sie den einen oder anderen der vornehmen Bürger der Stadt trafen, wie Herrn Anton Verlot, Herrn Maigret oder Herrn Lanterle, deren angesehene Familien seit ein- oder zweihundert Jahren die gute Gesellschaft von Valleyres bildeten. Die Herren besprachen die Aussichten der kommenden Ernte und verkauften je nach der Jahreszeit ihr Getreide oder ihren Wein den anwesenden Händlern.
Nach Beendigung seiner Geschäfte besuchte Herr Ferdinand Bourrat eine alte ledige Tante, die nun schon seit zehn Jahren ihr Haus in der Hochstraße nicht mehr verließ; nachdem er schließlich bei den Krämern der Stadt noch einige Einkäufe gemacht hatte, kehrte er in langsamem Trab wieder den gleichen Weg nach Prévoux zurück.
Seine Frau, eine geborene Maigret, erwartete ihn. Sie war eine dürre und – wie alle Frauen ihrer Familie – herrschsüchtige Person, deren Tagewerk durch die tausenderlei Kleinigkeiten eines Haushaltes ausgefüllt war, den sie mit schmutzigem, systematischem Geiz führte. Sie zählte immer wieder die Wäsche, kochte im Sommer Obst ein, hängte im Herbst ihre Trauben in den Speicher, überwachte auf Schritt und Tritt ihre Mägde und erfand stets neue Möglichkeiten, um den ohnehin auf das Nötigste beschränkten Ausgaben hier oder dort noch einen Sou abzuzwacken. Sie gab auch dem Gärtner ihre Anweisungen, bestimmte, welche Gemüse zu pflanzen seien; sie überließ es niemandem, die Spargel zu schneiden und die reifen Früchte zu pflücken und wußte genau, wieviel Pfirsiche und Birnen am Spalier sein mußten.
Herr Bourrat beaufsichtigte die Arbeiten auf seinen Feldern. Ihre Kinder wurden auswärts erzogen, die Söhne bei den Geistlichen in der Provinzhauptstadt, die Tochter in einem Kloster im Süden. Das Leben in Prévoux verlief ohne Überraschungen. Die Entfernung von der Stadt verhinderte häufige Besuche; zwei- oder dreimal im Monat brachte ein altertümlicher Wagen eine der Damen aus Valleyres. Wenn Frau Bourrat in die Stadt wollte, ließ sie das Pferd, das ihren Mann zum Markt führte und das sonst auch zu Feldarbeiten verwendet wurde, vor eine Kutsche spannen: so war es ihr während der großen Arbeiten zur Zeit der Ernte oder Weinlese gar nicht möglich, Besuche zu machen.
Prévour war ein Haus aus dem Ende des letzten Jahrhunderts mit einem schönen Dach und einem Giebel. Vor dem Hause lag mit einer Gruppe herrlicher Bäume der Garten, der durch ein kleines Wäldchen im Osten abgeschlossen wurde. Frau Bourrat wagte sich niemals bis dorthin, selbst in der größten Hitze arbeitete sie in ihrem Salon, dessen Fenster stets geschlossen blieben. Nur morgens vor dem Frühstück und abends vor dem Nachtessen verließ sie das Haus, um den westlich gelegenen Gemüsegarten zu inspizieren. Sie tadelte ihren Mann, daß er die Blumen liebe und zwei bis drei Beete Geranien und Rosen auf der Wiese hielt; die Zeit, die der Gärtner für ihre Pflege brauchte, wäre besser für die Gemüsezucht verwendet: denn der Überschuß an Gemüse ließ sich in der Stadt verkaufen.
Fräulein Bourrat verließ, achtzehn Jahre alt, das Kloster und kam im Juli nach Hause. Die Bewohner von Valleyres zerbrachen sich den Kopf, mit wem man sie verheiraten werde. Die Bourrat hatten, obgleich sie wohlhabend waren, weder das Vermögen noch die Beziehungen der Duret, deren Töchter gute Partien gemacht hatten, indem sie so angesehene Leute wie Roussy aus Marseille und Perquer de Bonnenfant aus Bourges geheiratet hatten, überdies gab es wenig junge Leute in Valleyres; obwohl ihnen doch mit allgemeiner Hochachtung begegnet wurde, pflegten sie die kleine Stadt frohen Herzens zu verlassen, um in der namenlosen Menge der großen Städte unterzutauchen. Nach ihrem Militärdienst kehrten nur sehr wenige in ihre väterlichen Häuser zurück. Paris hatte zwei junge Bourrat, Neffen von Ferdinand, einen Duret, einen Maigret und einen Lanterle behalten, die dort ungewisse Studien, Medizin oder Jus, betrieben. In Le Havre war ein Vertot, ein Loretty in Nantes, ein zweiter Maigret in Rouen und alle waren nur allzu glücklich, bescheidene Posten gefunden zu haben, die es ihnen ermöglichten, in den großen Städten zu bleiben, wo die meisten – sei es aus Überlieferung oder auch, weil sie guten Familiensinn hatten – mit kleinen, auf der Straße oder in Fabriken aufgelesenen Mädchen wie verheiratet lebten. Würden sie jemals nach Hause zurückkehren?
Keinerlei Aussichten für Fräulein Bourrat. Wird sie die große Zahl der alten Jungfern von Valleyres vermehren? Werden die Bourrat vielleicht den Winter in der Provinzhauptstadt verbringen, wo sie wohlhabende Verwandte besitzen? Werden sie vielleicht gar einen Ball geben? So diskutierten die Gevatterinnen der Stadt, aber sie wurden sehr enttäuscht; denn es geschah nichts von alledem und das ruhige Leben in Prévoux ging unverändert weiter.
Sonntags kam Fräulein Bourrat zur Messe. Sie war ein großes, eher häßliches Mädchen, von einer derben, ländlichen Gesundheit, die auch den Jahren im Kloster widerstanden hatte, mit ausdruckslosen Augen, schon entwickeltem Busen und einem etwas breiten Mund; gutmütig und schlaff wie ihr Vater, ganz eine Bourrat, hatte sie keinerlei Ähnlichkeit mit den Maigret.
Ihr Leben in Prévoux war grau und einförmig. Die Mutter hatte ihrer Rückkehr ohne Freude entgegengesehen: sie fürchtete die geringste Störung, die sie in der peinlichen Überwachung des Haushaltes behindern könnte. Sie regelte das Tagewerk ihrer Tochter nach ihren unantastbaren Geboten. Morgens sollte Fräulein Bourrat sie bei ihrem Rundgang durch das Haus begleiten, der täglichen Besprechung mit der Köchin beiwohnen, ihr helfen die Wäsche vorzubereiten, die nachmittags von den Hausmädchen geflickt werden sollte; so würde sie später imstande sein, ihren eigenen Haushalt mit Umsicht zu leiten. Dann war eine Stunde Klavierspiel und eine Nähstunde vorgesehen. Nach Tisch durfte sie in dem von Mauern umgebenen Garten spazierengehen. Dann mußte sie ins Haus zurückkehren, wo sie ihre Mutter im Salon traf, hatte wieder Klavier zu üben und schließlich für die von ihrer Tante, Frau Julius Maigret, geleitete Krippe zu arbeiten. Einmal wöchentlich kam sie in die Stadt; ihre Mutter wohnte den Klavierstunden bei, die der junge Herr Marthe ihr erteilte. Einmal im Monat verbrachte sie den Nachmittag bei ihren Cousinen in Vermand, die ebenfalls monatlich nach Prévoux zu Besuch kamen.
Maßlos lastete die Langeweile, die das alte Haus erfüllte, auf Fräulein Bourrat. Als Lektüre erlaubte man ihr nur die kleinen Traktätchen einer religiösen Bibliothek, die unerträglich fade waren, übrigens las sie überhaupt nicht gerne.
Ihre einzige Freude war der Garten, wohin sie vor den ewigen, nörgelnden Belehrungen ihrer Mutter gleich nach Tisch flüchtete. Lange, einsame Stunden verbrachte sie dort, ohne anderes zu tun, als zu schauen.
Sie kannte die Insekten und ihre Gewohnheiten, wußte, wo die Vögel ihre Nester hatten und wie sie einander riefen. Auch auf den Gutshof ging sie, aber nur im geheimen. Mit raschem Blick vergewisserte sie sich, daß der Hof leer sei, dann stieß sie die Türe zum Stall auf und schlüpfte hinein. Sie liebte diese dunstige Atmosphäre, in der gegen fünfzehn Kühe wiederkäuend vor ihren leeren Trögen standen, schmeichelnd glitt ihre Hand über die warmen Rücken. Manchmal stieg ihr eine merkwürdige Glut zu Kopf und sie ging ein wenig benommen hinaus. Im Geflügelhof verfolgte ein Hahn eine Henne und deckte sie. Fräulein Bourrat sah zu und eilte dann, wie auf schlechter Tat ertappt, davon, um auf einer Bank im Garten, gedankenlos, zu sitzen.
Die Regentage waren am traurigsten. Der Winter kam und schien endlos. Sie war bei zwei oder drei Gesellschaften, aber ohne sich zu unterhalten. Aus ihrer Einsamkeit plötzlich unter Leute versetzt, wußte sie nichts zu sagen; sie hörte nur zu. Wenn ein Mann zu ihr sprach, hatte sie, trotz der Mahnungen der Nonnen, eine fast peinliche Art, ihre guten, sanften Augen nicht von ihm abzuwenden, obgleich sie sich gar nichts dabei dachte. Während der schlechten Jahreszeit kam sie fast gar nicht aus dem Haus; hie und da begleitete sie Herrn Bourrat auf seinen Fahrten über Land. Sie sprachen nur einzelne Worte, trotzdem aber fand sie ihren Vater angenehm. Sie sehnte sich allmählich nach dem Kloster zurück, obgleich sie sich auch dort sehr gelangweilt hatte; aber sie hatte doch wenigstens Freundinnen gehabt. Wenn das Licht im Schlafraum verlöscht war, konnte man mit seiner Nachbarin Dinge flüstern, die dadurch, daß sie im Dunkel der Nacht geheimnisvoll gezischelt wurden, unendliche Wichtigkeit bekamen. Hier in Prévoux gab es niemand; Vater und Mutter, beide alt, waren ihr gewiß keine Gesellschaft.
Sie schlief schlecht; Träume bedrängten sie. Gnadenbilder, die sie in der Kirche gesehen hatte, begannen vor ihr zu leben; eine Magdalena zeigte ihre nackte, goldig wie eine reife Frucht leuchtende Brust; vor einem Jesus mit kraftlosen Augen sah sie sich beten. Sie küßte mit solcher Inbrunst seine Füße, daß sie erwachte; heiße Wellen liefen über ihren Körper; sie war atemlos, als ob sie gelaufen wäre; sie drehte sich auf die andere Seite, fand aber lange keinen Schlaf. Früh erwachte sie müde und zerschlagen.
Sie wurde bleichsüchtig, ihre guten Farben verschwanden. Zwei oder drei Sonntage fehlte sie bei der Messe. Die guten Frauen von Valleyres bedauerten sie. „Armes Kind, wie muß sie sich in Prévoux langweilen.“
Mit dem wiederkehrenden Frühling nahm Fräulein Bourrat neuerdings vom Garten Besitz. Nach Tisch saß sie auf einer Bank beim Wäldchen. Das Leben summte ringsum; auf einem winzigen Pfad hasteten die Ameisen; auf der Wiese zirpten die Grillen; mit großem Lärmen verfolgten einander die Vögel auf den Zweigen; sie war aufmerksamer Zeuge der tausend kleinen, leidenschaftlichen Kämpfe in der erwachenden Natur. Manchmal ging sie auch wieder in den Stall, gern hätte sie in der reinen Streu geschlafen, sich in dem warmen, goldgelben Stroh ausgestreckt, bei den feuchten Kühen mit ihren langsamen Bewegungen, ihren im Halbdunkel phosphoreszierenden Augen. Eines Tages, als sie wieder vorsichtig auf den Hof schleichen wollte, bemerkte sie dort zwei Männer mit einer Kuh. Sie blieb stehen und verbarg sich hinter einer Fichte. Die Entfernung war groß genug, daß man sie nicht sehen konnte. Plötzlich kam der Stier aus seinem Stall. Sie wollte fort, doch eine unwiderstehliche Neugierde lähmte sie. Der Stier brüllte, die Männer verbargen ihn ihren Blicken; aber sie sah seinen mächtigen Kopf sich heben, seine Vorderbeine auf den Rücken der reglosen Kuh gestützt, seinen gestreckten Hals. Das war alles. Sie ging mit schweren, müden Schritten zu ihrer Lieblingsbank zurück und ihr Herz war unruhig.
In der folgenden Nacht weckte sie ein glühender Traum. Die Erregung war so groß, daß sie morgens im Bett bleiben mußte. Ihre Mutter warf ihr diese Faulheit mit bitteren Worten vor. Gegen Abend erst ging sie aus; sie war matt, wie nach einer Krankheit; nahe der Wiese nahm sie einen Sessel.
Die Luft war ruhig und milde. – Der Gärtner kam und arbeitete an einem Blumenbeet in ihrer Nähe. Er war ein großer, stämmiger Bursche aus der Normandie. Fräulein Bourrat sah ihm zu, wie er die Erde mit kräftigen Spatenstichen umlegte. Sie dachte an nichts. Bei einer Bewegung, die er während des Bückens machte, öffnete sich sein Hemd, das nicht zugeknöpft war: sie sah seine Brust mit einem Büschel brauner Haare in der Mitte. Sie fühlte es wie einen Schwindel und wollte sich erheben, aber eine neuartige, geheimnisvolle Erregung hielt sie gegen ihren Willen zurück; sie blieb unbeweglich auf ihrem Stuhl und spähte jedesmal, wenn der Mann sich niederbeugte, um einen Stein aufzuklauben, wie gebannt nach dem Schimmern seiner Haut in der Hemdöffnung. Indessen beendete er seine Arbeit und, seine Geräte zusammenraffend, ging er grüßend an ihr vorbei.
Von nun an gab es in ihrem Leben das eine große Interesse: den Gärtner arbeiten zu sehen. La Bruyére war es, der einst sagte: „Den Damen der Gesellschaft ist ein Gärtner nur ein Gärtner und ein Maurer nichts als ein Maurer. Für manche andere, zurückgezogener lebende Frauen aber ist ein Maurer ein Mann und ein Gärtner ein Mann.“
In der fast gänzlichen Einsamkeit, in der Fräulein Bourrat lebte, wurde das Erscheinen dieses blühenden, kraftstrotzenden Burschen ein Ereignis. Sie suchte ihn geradezu im Garten. Manchmal arbeitete er an der Allee oder er war bei den Beeten beschäftigt; andere Male wieder setzte er Stecklinge bei einem kleinen Glashaus, das in einer sonnigen, geschützten Ecke des Gartens, weit vom Haus und vom Hof lag; oder auch fand sie ihn gar nicht, wenn er im Gemüsegarten arbeitete. Das war dann ein verlorener Nachmittag, denn seit ihre Mutter dort einmal den Abdruck ihrer Schuhe entdeckt hatte, traute sich Fräulein Bourrat nicht mehr hin.
Hatte sie ihn gefunden, dann blieb sie bei ihm stehen, als wäre sie unentschlossen, wohin sie gehen sollte. War eine Bank in der Nähe, dann setzte sie sich nieder. Sie sprach nicht, aber der Gärtner wurde, sobald er sie in der Nähe wußte, verlegen. Manchmal blickte er zu ihr hin, dann senkte sie die Augen Allmählich wurde sie kühner, sie kam noch näher, sie wechselte einige Worte mit ihm. Eines Tages, als er sich nach ihr umdrehte, hielt sie sogar seinem Blick stand; während einiger Sekunden sahen sie einander in die Augen. Ihre Brust hob sich. Dann ging Fräulein Bourrat wieder fort.
Sie dachte nur noch an die Stunde, da sie ihn treffen könne. Sie hatte dabei keine bestimmten Wünsche, nur die Gegenwart des Gärtners brauchte sie. Er zog sie an, wie der Magnet das Eisen. Sie blieb, ohne ein Wort zu sprechen, drei Schritte vor ihm stehen. Er hatte eine merkwürdige Art sie anzusehen. Einmal rief er ihr einen Scherz zu, den sie nicht verstand: sie nickte trotzdem mit einfältigem Lächeln. Sie hatte den glühenden Wunsch, mit ihrer Hand seinen braunen Arm zu berühren, an dem die Muskeln wie straffe Stricke lagen, aber sie traute sich nicht. „Tu’ ich’s, tu’ ich’s nicht?“ Sie blieb angstvoll unentschlossen. Der Mann fühlte ihren brennenden Blick; zuweilen unterbrach er seine Arbeit und starrte vor sich hin, dann preßte er die Zähne zusammen und setzte sein Werk hastig fort.
Fräulein Bourrat hatte unruhige Nächte. Sie erwachte mit schmerzenden Augen und müden Gliedern. Sie war bleich geworden, jetzt wurde sie auch noch nervös. Der geringfügigste Anlaß, oft bloß ein Wort ihrer Mutter genügten, um sie in Tränen ausbrechen zu lassen. Dann wieder hatte sie ebenso unbegründete Lachanfälle, die nicht aufhören wollten.
Gegen Ende April fühlte sie sich eines Tages so elend, daß sie ihre Mutter nicht nach Vermand begleiten wollte. Sie blieb allein zu Hause und ging gegen drei Uhr in den Garten. Als sie den Gärtner auf der Wiese nicht fand, hätte sie fast geweint. Sie ging bis zu dem kleinen Glashaus; hier kniete er, damit beschäftigt, Stecklinge aus dem Frühbeet in Töpfe zu setzen. Sie kam näher und sagte ihm mit müder Stimme guten Tag; er erwiderte ihren Gruß. Dann setzte sie sich nahe bei ihm auf einen Sandhaufen, der heiß in der Sonnenglut lag. Von den weißen Mauern der Gartenecke strahlte einschläfernde Hitze. Der Gärtner hatte sein Hemd geöffnet; sie starrte zu ihm hin. Einen Augenblick schloß sie die Augen. Es war ihr, als wenn die Sonne sie röstete. Sie atmete heftig. Als der Mann sie so hörte, wandte er sich zu ihr um; sie hatte einen unruhigen, stieren Blick in den Augen. Er zögerte eine Sekunde, dann arbeitete er, an seiner Lippe nagend, weiter.
Sie vermochte ihre Blicke nicht von ihm loszureißen. Gerne wäre sie noch näher bei ihm gewesen, so nahe, daß er sie bei jeder seiner Bewegungen hätte streifen müssen. Sie streckte ein Bein so weit vor, daß sie an seinen mit starken Stiefeln bekleideten Fuß ankam, aber die Berührung war so schwach, daß er sie nicht fühlte. Sie zog ihr Bein wieder zurück, dabei schob sich ihr Rock ein wenig zum Knie hinauf. Sie saß nun mit an die Brust herangezogenen Knien und ihr Rock ließ die Beine frei.
Einen Augenblick später drehte er sich plötzlich um. Er sah die schwarzen Strümpfe von Fräulein Bourrat und höher oben, zwischen Strumpf und Höschen, schimmerte es weiß. Dieser Streifen weißer Haut raubte ihm die Besinnung. Er ließ den Blumentopf fallen.
„Teufel“, schnaufte er.
Er warf sich über sie. Sie fiel in den warmen Sand und wehrte sich nicht. Eine Flamme durchlohte sie: es war ein Entspannen aller ihrer Nerven.
Der Mann erhob sich, warf einen unruhigen Blick ringsum und nahm dann, einen Marsch pfeifend, seine Arbeit wieder auf.
Sie erreichte das Haus. Nur in ihrem Zimmer konnte sie sich verbergen. Schon aber fühlte sie sich zu ihrem Erstaunen gar nicht schuldig. Sie hatte diesen Wahnsinnsausbruch nicht provoziert. Was wußte sie überhaupt? Wie ein Gewitter im Sommer war’s gekommen, wie ein wütender Platzregen, der vorüberrauscht und das verdurstete Land erfrischt.
Abends aß sie – wie schon seit Monaten nicht – mit großem Hunger und schlief, kaum im Bett, schon ein, um erst morgens aufzuwachen. Dann überlegte sie kalten Blutes, was geschehen war. Sollte sie dem Herrn Pfarrer beichten? Sie zögerte nicht allzulange mit der Antwort. Ein solches Geständnis könnte ernste und unvorhergesehene Folgen haben. Sie beschloß also zu schweigen? übrigens würde das Erlebnis keine Fortsetzung haben. Nie mehr wollte sie zu der Gartenecke gehen, das war ihr fester Entschluß. Zwei Tage hielt sie sich an ihren Vorsatz, dann hatte sie wieder eine schlechte Nacht; ein bedrückender Traum, deutlicher als früher, quälte sie. Doch noch widerstand sie.
Am vierten Tage aber war ihre Kraft erschöpft. Sie ging in den Garten. Der Mann war da, selbstbewußt, spöttisch, sicher, daß sie kommen werde. Er folgte ihr in das Wäldchen. Nun traf sie ihn zwei-, dreimal wöchentlich unter den Fichten. Es geschah nach Tisch in der größten Mittagsglut. Herr Bourrat hielt seine Mittagsruhe, seine Frau arbeitete im Salon. Fräulein Bourrat ging fort und der Garten lag so verlassen, das Leben in Prévoux war so gut geregelt, daß niemand ihre Zusammenkünfte störte.
Anfang Mai jedoch wurde sie unruhig. Sie wartete vergeblich. Noch ein Monat verging, ihre Unruhe wuchs. Indessen fühlte sie eine Schwere in ihren Gliedern, ein Unbehagen, einen unerklärlichen Widerwillen gegen Speisen. Dann schien es ihr, als wäre sie in ihrem Mieder eingepreßt, obgleich es doch immer so weit gewesen war. Eines Abends vor dem Niederlegen prüfte sie sich. Sie war sicher krank. Schon wollte sie mit ihrer Mutter darüber sprechen, als sie der Gedanke, es könne irgendein Zusammenhang zwischen ihrem Unbehagen und den Erlebnissen im Garten bestehen, die Absicht aufgeben ließ.
Das war zu derselben Zeit, als Frau Bourrat plötzlich selbst entdeckte, was sich zugetragen hatte.
Und das geschah folgendermaßen.
Wie die meisten alten Familien von Valleyres, hatten auch die Bourrat die Gewohnheit der großen Waschtage beibehalten. Es wurde nicht jede Woche gewaschen? das mochte für jene kleinen Leute gut sein, die in ihren mächtigen Kästen nicht große Stöße weißer Wäsche, den ehrwürdigen Stolz aller reichen Bürgersfrauen, behüteten. Viermal im Jahre wurden gewaltige Tröge in den Hof geschleppt, man nahm Waschfrauen und die Wäsche von drei Monaten ging durch ihre derben Hände. Es gab so wenig Unvorhergesehenes im Leben der Bourrat, daß die Hausfrau ganz genau vorher wußte, wieviele Leinentücher oder Servietten oder Wäschestücke jeder einzelnen Gattung nach getaner Arbeit in die Kästen zu räumen sein würden. – Die St.-Johannes-Wäsche war vorbei. Das Leinen trocknete zwischen den Apfelbäumen des Obstgartens an langen Stricken im Wind. Dann wurde geflickt und gebügelt und auf großen Tischen im Vorraum des Hauses alles schön zusammengelegt aufgestapelt. Das war dann der Moment, in dem Frau Bourrat mit ihrem großen Buch erschien. Sie zählte jeden Stoß nach, nicht ein einziges Stück fehlte. Aber als sie zu der Leibwäsche ihrer Tochter kam, stimmte die Rechnung nicht. Sie zählte nochmals, ging die ganze Wäsche ein zweites Mal durch, vergeblich. Mißtrauisch wie sie war, sagte sie kein Wort vor den Dienstboten. Sie ging zuerst in das Zimmer ihrer Tochter, um sie zu befragen. Das junge Mädchen war nicht da. Sie öffnete den Kasten, prüfte ihn von oben bis unten, durchwühlte den Wäschekorb, aber das, was sie suchte, fand sie nicht. Sie durchstöberte jetzt das ganze Zimmer, schob die Möbel von den Wänden, blickte in jeden Winkel. Der alten Waschweiber war sie ganz sicher, arbeiteten sie doch seit dreißig Jahren für ihre zweiundzwanzig Sous im Tag, viermal jährlich in Prévoux. Frau Bourrat suchte weiter. Ihre spitze Nase kam immer näher zu den schmalen Lippen, ihre Bewegungen wurden scharf und bestimmt, sie suchte jetzt ganz methodisch. Auch unter Bettdecke und Leintuch war ihre Mühe vergeblich. Jetzt packte sie ein so wütender Eifer, daß sie nicht einen Augenblick zögerte unter das eiserne Bett zu kriechen, um die Matratze zu untersuchen. Sie hatte sich auf den Rücken gelegt und blickte hinauf – da erbleichte sie. Das, was sie suchte, war hier, zwischen die Spreizen gesteckt, sauber zusammengefaltet, als wäre es eben aus dem Kasten genommen.
Mit zitternder Hand griff sie danach und richtete sich mühsam auf. Sollte sie in der fleckenlosen Weihe dieser Wäschestücke die Schande der Familie Bourrat lesen? – Vielleicht blieb noch eine Hoffnung, vielleicht war ihre Tochter krank, anämisch? Sie erinnerte sich, wie bleich, wie nervös sie gewesen. Warum dann aber dieses listige Verstecken? Frau Bourrat sank vernichtet in einen Lehnstuhl: ihre ganze dürre Gestalt war wie gebrochen, so erwartete sie die Rückkehr ihrer Tochter. Endlich erschien Fräulein Bourrat. Mit dem ersten Blick umfaßte sie die Anordnung im Zimmer und das Wäschepäckchen auf dem Tisch; sofort erkannte auch Frau Bourrat die Berechtigung ihrer schlimmsten Befürchtungen. Zwischen Mutter und Tochter war ein tragisches Schweigen. Dann verlangte Frau Bourrat alles zu wissen: unter Tränen und Schluchzen erzählte die Tochter, was geschehen war.
An diesem Abend hatte Frau Bourrat mit ihrem Manne hinter versperrten Türen eine lange Unterredung. Und da bewies sie die Überlegenheit ihrer Rasse, der zielbewußten Maigret, über die nervenschwachen Bourrat. Alle Maigret waren dürr und gelb, alle Bourrat dick und rosig; die Maigret verfolgten stets ihre Pläne; die Bourrat kannten keinerlei Pläne. Während der dicke, jammernde Mann nur Seufzer hören ließ, entwickelte Frau Bourrat einen ganzen Feldzugsplan. In den Nachmittagsstunden, als sie allein gewesen war, hatte sie schon alles genau überlegt.