
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein echtes Muss für alle Engel-Fans! **Zwischen Himmel und Erde liegt nur ein Flügelschlag…** »Einfach himmlisch.« »Verzaubernd.« »Klar zu empfehlen!« (Leserstimmen auf Amazon) Jade Brooks ist ein Nerd, wie sie im Buche steht. Ihr Herz gehört der Wissenschaft und mit Partys oder süßen Jungs hat sie nicht gerade viel am Hut. Zumindest bis sie auf den vermeintlichen Bad Boy und Rockmusiker Caspar Sinclair trifft. Doch bevor es zwischen dem ungleichen Paar ernsthaft zu knistern beginnt, hat Jade einen Unfall und findet sich plötzlich buchstäblich im Himmel wieder. Ausgerechnet sie soll von nun an als Liebesengel dienen. Und ihr erster Auftrag lautet, den Mann zu verkuppeln, für den ihr eigenes Herz schlägt: Caspar Sinclair. //»Engelsstaub« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2015 Text © Anne-Marie Jungwirth, 2015 Lektorat: Pia Trzcinska Redaktion: Pia Praska Coverbild: shutterstock.com / © Kitsana1980 / © Volodymyr Tverdokhlib / © d1sk Covergestaltung: Renee Rott / Dream Design – Cover and Art Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-60145-9
Für meinen wundervollen Ehemann Rainer.
1. KAPITEL
Tonight’s special – Caspar Sinclair war an die Tür des All The Lost Souls plakatiert. Ich sah hinüber zu Angela und verdrehte demonstrativ meine Augen. »Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«
»Jade, du solltest mich gut genug kennen, um zu wissen, dass das mein voller Ernst ist.«
Ich zögerte. Caspar Sinclair. Mir war schleierhaft, was alle an ihm fanden. Vielleicht war ich einfach immun gegen diesen Bad-Boy-Charme.
»Komm schon, Jade«, sagte Linda schließlich. »Du hast uns heute den ersten Sieg in der Mannschaftsgeschichte gegen die Oakland Wildcats beschert. Das muss gefeiert werden.«
»Die Oakland Wildcats«, drang es aus unterschiedlichen Richtungen in mein Ohr. Es war ein vor Ehrfurcht triefendes Echo. Und es war natürlich maßlos übertrieben. Die Annalen unseres Hockey-Teams reichten gerade einmal fünf Jahre zurück. Dabei von einem historischen Angstgegner zu sprechen schien mir statistisch nicht haltbar. Zwanzig Augenpaare ruhten erwartungsvoll auf mir. Ich hatte schon mindestens ein Dutzend Mal eingewandt, dass ich keine Party-Maus sei, ohne dass jemand Notiz davon nahm. Ein weiteres Mal würde vermutlich auch nicht helfen. Außerdem – was waren die Alternativen? Nach Hause zu meiner vor Wut schäumenden Mutter zu fahren? Nein. Ich war noch nicht bereit mich wieder ihren vorwurfsvollen Blicken auszusetzen. Und ich hatte keine Lust, mir anzuhören, ich solle mich in ihre Lage versetzen. Mehr aus Verzweiflung als aus Überzeugung stieß ich die Tür auf. »Lasst uns feiern, Mädels.«
»Woo hoo«, schallte es mir im Chor entgegen.
Das All The Lost Souls war nur spärlich beleuchtet, vermutlich um von der heruntergekommenen Inneneinrichtung abzulenken. Es mag Zeiten gegeben haben, in denen schwarzes Holz und roter Samt der letzte Schrei waren, aber mit sechzehn war ich zu jung, um sie miterlebt zu haben. So oder so, kaum hatten wir den Laden betreten, wäre ich am liebsten schon wieder rückwärts rausgegangen. Der Duft von billigem Parfüm drang mir in die Nase und unter meinen Füßen knirschte das Glas zerbrochener Bierflaschen. Die Bar war voll mit Mädchen, die ganz offensichtlich nicht wegen ihres Intellekts bewundert werden wollten. Das Konzert – falls man das so nennen konnte hatte bereits begonnen. Keine namhafte Band, sondern wie der Aushang schon verkündet hatte, Caspar Sinclair aus der Abschlussklasse, auf einem Barhocker, mit einer Gitarre unter dem Arm. Meine Mitspielerinnen starrten wie hypnotisiert auf die Bühne und lauschten seiner rauchigen Stimme. Wäre er nicht erst siebzehn, man hätte meinen können, er würde zu viel Whiskey trinken. Mit geschlossenen Augen und schmerzverzerrtem Gesicht performte er einen Song nach dem anderen. Ich wünschte mir, Coach Jenkins wäre mitgekommen. Dann gäbe es jetzt wenigstens eine Person im Raum, mit der man ein normales Gespräch führen könnte. Er hatte abgewunken. Kluger Mann.
Angela wandte ihren Blick kurz von Caspar ab und sah mich kopfschüttelnd an. »Jetzt zieh endlich dieses hässliche Ding aus«, sagte sie und zeigte auf meinen verwaschenen National-Science-Fair-Kapuzenpullover.
Ich legte immer großen Wert darauf, neben meiner übergroßen Hornbrille immer mindestens ein weiteres Teil zu tragen, das mich zweifelsfrei als Nerd klassifizierte. Das war zwar oft einfach aus Gewohnheit, hatte aber auch System. Denn es entband mich pauschal von dem oberflächlichen und kindischen Wer-ist-die-Schönste-der-ganzen-Schule-Wettbewerb. Wozu Energie in ein aussichtsloses Unterfangen stecken?
Ich zog die Vorderseite meines Pullovers glatt und dachte an das Projekt der solarbetriebenen E-Bike-Ladestationen, das ich gemeinsam mit meinem Dad entwickelt hatte. Unser letztes Projekt. »Dieses hässliche Ding ist zufällig mein Lieblingspulli.«
Angela seufzte theatralisch. »Ich weiß, das macht ihn trotzdem nicht schöner.«
Schön hin, schön her. Es war warm und stickig im All The Lost Souls und ich schälte mich unter Angelas wachsamen Augen aus meinem Pullover. Sie betrachtete mich prüfend und ehe ich es verhindern konnte, hatte sie mir schon den Pferdeschwanz gelöst und meine Haare mit ihren Fingern so verwuschelt, dass mir einige granatrote Strähnen ins Gesicht fielen. »Wow, Jade. Du siehst ja richtig heiß aus so.« Ich sah an mir herab und konnte ihre Äußerung überhaupt nicht nachvollziehen. Schließlich hatte ich nur meinen Pullover ausgezogen. Ich trug immer noch den Jeansrock von heute Morgen und die braunen Booties. Der Rock war zwar nicht sonderlich lang, aber keinesfalls zu kurz und das weiße Baumwoll-Tanktop, da war ich mir sicher, verwandelte mich jetzt auch nicht in eine Femme fatale. Ich sollte das auch nicht überbewerten. Schließlich war es Angela, die das gesagt hatte. Und Angela fand eigentlich in allen Dingen irgendwas Anzügliches.
»Fehlt nur noch eines«, sagte Angela und wollte sich an meiner Brille zu schaffen machen.
»Denk nicht einmal dran«, sagte ich und klopfte ihr leicht auf die Finger.
Angela zuckte mit den Schultern. »Bleibt mehr für mich.«
»Ist der nicht süß«, sagte Linda und starrte zu Caspar auf die Bühne.
»Caspar ist nicht süß. Er ist heiß«, sagte Angela. »Meinst du, er hat Tattoos?«
Vielleicht war das des Rätsels Lösung. Mädchen, die auf Tattoos standen, standen auch auf Caspar. »Ich gehe mir etwas zu trinken holen«, rief ich den beiden zu und verschwand an die Bar. Es wäre der ideale Abend für meinen ersten Rausch gewesen, aber der Gedanke, nicht klar bei Verstand zu sein, blieb mir einfach fremd. Also bestellte ich mir eine Cola und ging, während ich sie mit einem Strohhalm schlürfte, zu den anderen zurück.
Ich blickte auf die Bühne und wunderte mich einmal mehr über das Geheimnis von Caspars Anziehungskraft. Meine Mutter hätte vermutlich gesagt, er sehe aus wie ein Junkie. Und so ungern ich auch mit ihr einer Meinung war, in diesem Punkt hätte ich ihr uneingeschränkt Recht gegeben. Sein betont heruntergekommenes Outfit, seine unter dem weit ausgeschnittenen T-Shirt hervortretenden Schlüsselbeine, das kantige Gesicht mit den Schatten unter den Augen. Das alles sprach eine sehr eindeutige Sprache. Und in meinem persönlichen Übersetzungsprogramm bedeutete es: Lass besser die Finger von mir.
***
Caspar machte eine kurze Pause und fuhr sich durch seine blonde, verwuschelte Mähne. Als er den Raum mit einer Unschuldsmiene scannte, die so gar nicht zu ihm passen wollte, streiften sich unsere Blicke für den Bruchteil einer Sekunde. »Und jetzt einen Song für alle Mädchen hier im Raum«, sagte er sein nächstes Stück an, das er dann erst nach einigen bedeutungsschweren Atemzügen begann. Für alle Mädchen im Raum? Im Publikum befanden sich nicht mehr als eine Handvoll Jungen. Und das waren wahrscheinlich die Einzigen, die wirklich wegen der Musik gekommen waren. Obwohl die Songs, die er spielte, gar nicht schlecht klangen, war ich froh, als er sein Konzert endlich beendete. Schließlich bestand nun die reelle Chance, wieder ein einigermaßen normales Gespräch zu führen. Kaum hatte er die Gitarre abgelegt, wimmelte es schon von Mädchen an der Bühne. Groupies. Ganz vorne dabei auch Angela, die es geschafft hatte ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Die beiden kamen zu uns herüber und reihum bekundeten alle, wie großartig sein Gig gewesen sei. Sogar Meredith. Breitbeinig und mit verschränkten Armen sah sie zu Caspar hinüber, formte mit ihren Lippen eine anerkennende Geste und sagte schließlich: »Das war der Hammer.« Meredith? Ich hätte schwören können, dass sie eher an einer der Mitspielerinnen interessiert war als an Jungs. Der Sieg musste allen den Verstand geraubt haben.
Plötzlich spürte ich, wie sein Blick auf mir ruhte. Ich war die Einzige, die noch nichts gesagt hatte. Ohne mich davon beeindrucken zu lassen musterte ich ihn. Er trug eine enge Jeans, schwarze Boots und ein graues T-Shirt, das so aussah, als hätten schon die Motten daran geknabbert. Aber vielleicht trug man das ja auch so. Was verstand ich schon von Mode? Neben einem kleinen, fast femininen Nasenring erregten vor allem seine Hände meine Aufmerksamkeit. Er hatte lange feingliedrige Finger, doch das war es nicht, was mir auffiel. Es waren seine Fingernägel. Sie waren etwas länger, als man es für einen Jungen erwarten konnte und seine beiden Zeigefinger – und nur die waren schwarz lackiert.
»Ich kann dir das Nagelstudio meiner Mutter wärmstens empfehlen, falls du mit deinem unzufrieden bist«, sagte ich, ohne genau zu wissen warum.
»Das wäre reizend«, sagte er ruhig. »Und was machst du hier, Brooks? Sind dir zu Hause die Knobelaufgaben ausgegangen?«
»Nein, eigentlich hatte ich ein Experiment vor. Ich wollte testen, wie viel ich trinken muss, um deine Musik und dein Gequatsche zu ertragen.«
»Brooks, du trinkst Cola.«
»Ich heiße Jade.«
»So was – ich dachte, du magst deinen Vornamen nicht.«
»Woher weißt du das?«
»Sollten wir nicht an die Bar gehen und ein Bier trinken?«, fragte er, während er mich süffisant anlächelte. »So wird das ja nichts mit deinem Experiment.«
»Nein, danke. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich gar nicht genug trinken kann, um …«
Noch ehe ich meinen Satz beendet hatte, wandte er sich von mir ab und ging zu einem Mädchen an die Bar. Sie trug Hotpants und Overkneestiefel und war bestimmt auch nur wegen der Musik hier. Eine Glasscherbe klebte an meiner Sohle. Eine von der widerspenstigen Sorte, die sich partout nicht abstreifen lassen wollte. Ich spürte eine leichte Wut in mir aufsteigen. Nicht, dass mich interessieren würde, mit wem er sprach, aber auch in einer Bar durfte man meiner Meinung nach ein Mindestmaß an Benehmen erwarten. Meine Empörung verblasste, als ich feststellte, dass mich die gesamte Hockeymannschaft ungläubig ansah.
»Was?«, fragte ich.
»Caspar Sinclair hat dich auf ein Bier eingeladen«, sagte Linda.
»Und du hast abgelehnt«, zischte Angela, als wäre das ungeheuer blasphemisch von mir gewesen.
»Ich überlasse ihn euch gerne. Ist nicht mein Typ«, sagte ich schulterzuckend.
Nachdem ich weder Lust hatte mir dieses Schauspiel noch länger anzusehen noch mich für meine Worte zu rechtfertigen, beschloss ich nach Hause zu gehen. Ich hatte mir kaum den Pullover vor der Bar angezogen, da bemerkte ich plötzlich, dass Caspar hinter mir die Bar verlassen hatte.
»Brooks«, rief er. »Soll ich dich heimfahren?«
Verzweifelt stellte ich fest, dass ich mit Angela gefahren war und mein Fahrrad zu Hause stand. »Nein danke, ich laufe«, sagte ich und ging los.
Ohne mich umzudrehen merkte ich, wie er zu mir aufschloss. »Brooks.«
Ich ging weiter.
»Brooks. Jade. Komm schon. Es ist spät und dunkel. Stell dich nicht so an und komm mit.«
Ich blieb stehen und drehte mich um. Er stand nun unmittelbar vor mir und musterte mich eingehend. Ich wollte mich gerade von ihm abwenden und weitergehen. Doch genau in diesem Moment sah er mir direkt in die Augen und ich schaffte es nicht seinem Blick auszuweichen. Unwillkürlich zuckte ich zusammen. Nicht, weil es mich verlegen machte, sondern wegen dem, was ich sah. Um seine Pupille herum zog sich eine dünne grüne Corona, die seine sonst braune Iris nach außen hin durchzog. Seine Augen sahen aus wie grüne Sterne auf braunem Grund. Caspars Augen waren quasi der Negativabdruck von meinen. Bei mir waren es braune Sterne auf grünem Grund. Ich schüttelte den Gedanken wieder ab.
»Sind da drinnen nicht genug Groupies, die sich danach verzehren, vom Meister des schlechten Geschmacks persönlich heimgefahren zu werden?«, fragte ich.
»Dir ist schon klar, dass, wenn du meinen Geschmack beleidigst, du damit im Moment auch dich beleidigst?«
Ich erwiderte nichts darauf. Was hätte ich auch sagen sollen? Keine Ahnung, was er hier für eine Show mit mir abzog. Bis vor einer Stunde hatten wir noch kaum ein Wort miteinander gewechselt und nun tat er so, als ob … Ach, was auch immer. Als ob er mich heimfahren müsste.
»Na, gut«, sagte ich. »Bilde dir bloß nichts darauf ein.«
»Worauf? Darauf den größten Nerd der Schule heimfahren zu dürfen?«
»Es hat dich niemand dazu gezwungen.«
»Jetzt heul nicht rum Jade, sondern steig ein.« Er öffnete die Fahrertür und machte eine einladende Geste.
Ich sah ihn mit gerunzelter Stirn an.
»Sorry, aber die Beifahrertür lässt sich leider nicht öffnen. Du musst hier durchrutschen.«
»Das sollte ich gerade noch hinkriegen«, sagte ich und schlängelte mich mit den Beinen voran auf den Beifahrersitz.
Caspar grinste und stieg ein. »Geschmeidig wie eine Katze.«
»Vorsicht, sonst fährt die Katze ihre Krallen aus.«
Caspar zog eine Augenbraue nach oben und startete den Motor. Wortlos fuhr er mich nach Hause und ich war froh, als die ersten Häuser unserer Siedlung an meinem Fenster vorbeizogen.
»Das graue Haus dort vorne ist es«, sagte ich und blickte auf das Gebilde aus Beton und Glas. Unser Haus war wie meine Mutter. Es war stylish, wirkte toll auf Fotos, doch es war kalt und ungemütlich. Zumindest für meinen Geschmack. Es war zu kantig, zu reduziert, es fehlten die Dinge, die ein Haus zu einem Zuhause machten. Es fehlte das Leben.
»Wie modern«, sagte Caspar.
»Ja, wenn wir noch etwas anbauen, können wir an das Bundesgefängnis untervermieten.«
Caspar schüttelte belustigt den Kopf und stellte den Motor ab. Ich merkte, wie er meinen Blick suchte, ohne ihn zu erwidern. »Danke«, nuschelte ich in meinen Bauch. Als ich fluchtartig das Auto verlassen wollte, fiel mir ein, dass ich ja über den Fahrersitz klettern musste. Caspar saß neben mir und schien keine Anstalten zu machen aufzustehen. »Stehst du auf?«, fragte ich. »Oder muss ich über dich drüberklettern?«
»Ich hätte nichts dagegen«, sagte er und lächelte mich dabei schief an.
Ich senkte meinen Kopf und merkte, dass ich nervös an meiner Unterlippe zu zupfen begann. Mir war gar nicht aufgefallen, dass Caspar bereits ausgestiegen war. Er lehnte an der geöffneten Fahrertür und bedeutete mir mit einem Winken auszusteigen. Ich kletterte dieses Mal mit dem Oberkörper voran über den Fahrersitz. Er hielt mir seine Hand hin, um mir hinauszuhelfen. Sei nicht kindisch, Jade. Ich nahm seine Hand und spürte erst, als mich seine umschloss, wie ich zitterte – dabei war mir weder kalt noch war ich unterzuckert. Irritiert über meine Reaktion hielt ich kurz inne. Caspar nutzte das Zögern, um mit seiner anderen Hand meine Schulter zu umfassen und mich aus dem Wagen zu heben. Sein Griff war kraftvoll, seine Berührungen hingegen zärtlich.
Er hielt meine Hand noch immer fest und war gerade dabei mich etwas näher an sich heranzuziehen, als etwas anderes meine Aufmerksamkeit erregte. Vor der Haustür standen meine zwei Mäusekäfige.
»Nein!«, rief ich.
Caspar wich zurück und sah mich verwundert an. »Schon gut. Ich wollte nicht –«
»Nicht du«, sagte ich und zeigte auf die Tür. »Die Mäuse.«
Caspar wirkte irritiert. »Sind das etwa deine?«
»Ja, allerdings sind das nicht meine Haustiere. Sie sind für mein Projekt für den Wissenschaftsbasar am Montag.«
»Das macht es natürlich viel besser.«
Der ironische Unterton in seiner Stimme verleitete mich augenblicklich dazu ihn böse anzufunkeln. »Spar dir einfach deine Kommentare, okay.«
Caspar hob entschuldigend seine Hände.
»Sie hat es tatsächlich getan«, sagte ich und raufte mir die Haare.
»Wer hat was getan?«, fragte Caspar und seine Stimme klang ernsthaft besorgt.
»Meine Mutter – sie hat die Mäuse aus dem Haus geschmissen.«
»Und jetzt?«, fragte Caspar. Er war lässig gegen sein Auto gelehnt und hatte die Hände in den Hosentaschen vergraben.
»Keine Ahnung. Mir muss irgendwas einfallen, wo ich sie bis Montag unterbringen kann.«
»Na dann«, sagte Caspar, ging die Stufen zu unserer Haustür hoch, packte einen der Mäusekäfige und kam mit ihm zurück. Flüchtig blickte er von mir zum Auto. »Mach mal bitte den Kofferraum auf.«
»Aber … was hast du vor?«
»Ich nehme die Mäuse bis Montag.«
»Wirklich?«
»Ja, wirklich. Und jetzt steh da nicht doof rum, sondern hilf mir und mach den Kofferraum auf.«
»Oh. Ja, klar«, sagte ich. Ich fummelte eine gefühlte Ewigkeit am Kofferraum herum, bis er endlich aufsprang und Caspar neben mir den ersten Käfig hineinstellte. Wenige Augenblicke später war er auch schon mit dem zweiten Käfig zur Stelle und verstaute ihn behutsam im Kofferraum.
»Warum machst du das?«, fragte ich.
»Vielleicht hoffe ich ja, dass die Katze kommt, um mit den Mäusen zu spielen«, sagte er und sah mich herausfordernd an.
»Ich werde irgendwie nicht schlau aus dir.«
»Dann sind wir ja schon zwei«, sagte er und hatte sich schon abgewandt, um den Kofferraum zu schließen. Ich stand da und wusste nicht, was ich sagen sollte. Er hatte mich aus dem Konzept gebracht und das passierte mir eigentlich nie. Caspar war schon dabei einzusteigen, als ich ihm hinterher rief: »Warte.«
Er drehte sich zu mir um.
»Ich muss morgen noch einmal zu den Mäusen und den Versuchsaufbau für Montag proben.«
»Komm einfach vorbei. Ich bin zu Hause. Gaven Street 409.«
»Gut«, sagte ich, während Caspar einstieg. Er hatte den Motor bereits gestartet, als ich zaghaft an die Scheibe klopfte. Er kurbelte das Fenster herunter und sah mich fragend an. »Danke«, sagte ich. Dann fuhr er davon. Bis morgen.
2. KAPITEL
Erschrocken fuhr ich hoch. Schon wieder erwachte ich schweißgebadet aus diesem Albtraum. Es sollte mich nicht überraschen, schließlich hatte ich in den letzten drei Monaten von nichts anderem mehr geträumt. Doch gestern Abend hatte ich ganz kurz die Hoffnung, die Nacht würde anders werden. Die Ereignisse des gestrigen Tages hatten mich lange wach gehalten. Der Streit mit meiner Mutter, der triumphale Sieg gegen die Wildcats und schließlich die Mäuse vor unserer Haustür – all das arbeitete in mir. Und so hatte ich tatsächlich kurz geglaubt, die Träume würden ruhen. Zumindest für diese eine Nacht. Dem war nicht so.
Der Traum hatte wie immer damit begonnen, dass ich die Haustür hinter mir ins Schloss fallen ließ und nach Dad rief. Er antwortete nicht. Ich ging weiter in die Küche und dort lag er – der Länge nach auf den kalten Granitfliesen. Sofort warf ich mich auf den Boden und kniete neben ihm. Seine Augen waren weit aufgerissen und sahen mich ungläubig an. Als wollten sie mich fragen, wie das nur hatte passieren können. Und tatsächlich war das auch die Frage, die mir seit seinem Tod wieder und wieder durch den Kopf spukte. Doch was dann im Traum passierte, hatte nichts mit der Realität zu tun. Mein Biologielehrer Mr Lescroat saß am Küchentisch. Seine dreckige Jeans hatte er auf einen der weißen Ledersessel gebettet und seine in Ledersandalen steckenden Füße provokant auf dem wuchtigen Holztisch ausgebreitet. Ein achtlos umgestoßener Salzstreuer lag neben seinen Füßen.
»Hallo Jade«, sagte er mit einem Unterton, der mich schaudern ließ.
»Mr Lescroat?«, fragte ich ungläubig.
»Ich weiß nicht, wen du sonst erwartet hast, Jade. Ja, ich bin es.«
»Was tun Sie in diesem Traum?«
»Ich bin hier, um dir zu sagen, dass dein Mangel an Glauben ihn getötet hat.«
»Das ist total absurd. Sie sind doch krank im Kopf.«
»Klar, deshalb habe ich ja auch diesen verrückten Traum und nicht du.«
Ich ballte die Hände zu Fäusten und versuchte damit die aufsteigende Wut zu kompensieren. »Mein Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben und nicht an Gottes Strafe für seine ungläubige Tochter zu Grunde gegangen.«
»Ach wirklich«, sagte er und verschränkte dabei übertrieben langsam seine Arme im Nacken. »Entspricht es nicht der Wahrheit, dass du ihn hättest retten können, wenn du nicht nachsitzen hättest müssen und pünktlich zu Hause gewesen wärst?«
»Möglicherweise.«
»Möglicherweise, Jade? Wir wissen beide, dass es so ist. Und sag mir, Jade, warum musstest du an diesem Tag nachsitzen?«
»Weil ich Ihnen nichts als die Wahrheit gesagt habe. Nämlich, dass ihre Ansichten zur Schöpfungsgeschichte Mist sind«, schleuderte ich ihm entgegen. »Ein Märchen, das kein aufgeklärter Mensch ernsthaft glauben kann. Ein Mythos, der vor vielen hundert Jahren von Menschen, die kein Verständnis von der Erde, auf der sie lebten, besaßen, niedergeschrieben wurde.«
»Wie ich gesagt habe. Dein Mangel an Glauben hat ihn getötet.«
»Ich glaube. Allerdings nicht an diese Märchen, sondern an die Gesetze der Naturwissenschaft. Und wenn es Ihren Gott wirklich gibt, dann ist er auch der Schöpfer dessen und damit auch meiner.«
Mister Lescroat hatte meine Worte nicht mehr gehört. Er war verschwunden, bevor ich den Satz beenden konnte. Doch seine letzten Worte hallten in einer Endlosschleife in meinen Ohren – ihn getötet, ihn getötet, ihn getötet.
***
Die dünne Sommerdecke klebte an meinem Körper und umhüllte mich wie ein Kokon. Ich schlug sie auf und zog die Knie zur Brust. Mein Blick streifte die Wand über meinem Bett entlang. Sie war tapeziert mit Bildern von mir und Dad bei Science Fair, Mathematikolympiaden und der Comic-Con. Daneben die Postkarten vom MIT und der University of New York – Erinnerungen an die Gastvorträge, zu denen ich ihn begleitet hatte. Und die Urkunden all der Wettbewerbe, die ich dank seiner Unterstützung gewonnen hatte. Zumindest die landesweiten Auszeichnungen, die restlichen waren chronologisch geordnet und abgeheftet. Mein Blick schweifte zurück zu den Fotos und wie so oft fuhr ich sie mit meinen Fingern nach. Dads verwuscheltes dunkles Haar, in das sich jedes Jahr mehr graue Strähnen gemischt hatten, seine warmen braunen Augen und die schwarze Hornbrille auf seiner Nase. Ich biss mir auf die Unterlippe und schluckte.
Niemand wusste von meinen Träumen. Und das war auch gut so. Ich wollte keinen Trost oder falsche Beschwichtigungen. Denn in einem Punkt hatte Mr Lescroat Recht. Ich war schuld. Ich war nicht rechtzeitig da gewesen, um ihn zu finden. Und es gab rein gar nichts, womit ich diese Schuld jemals büßen könnte. Vermutlich am ehesten noch damit, dass ich mir meinen Dad genommen habe. Den einzigen Menschen, bei dem ich mich verstanden und geborgen gefühlt hatte. Er wollte nie etwas aus mir machen, was ich nicht war, sondern hat mich bedingungslos geliebt und unterstützt. Er war ein angesehener und hochdekorierter theoretischer Physiker. Für jemanden, der wie ich mit Magazinen wie Science oder Nature statt Girls’ Life aufwächst, ist jemand wie mein Dad quasi eine Art Rockstar. Und jede Minute, die ich mit ihm verbrachte und mit ihm über Forschungsprojekten tüftelte, war unendlich kostbar. Und dann war er weg. Manchmal fragte ich mich, wie ich es überhaupt schaffte mich seit seinem Tod zum Aufstehen zu motivieren. Manchmal war die Antwort darauf auch ganz einfach. Ich war klatschnass und musste dringend unter die Dusche, um den Schweiß, die Albträume und vielleicht auch etwas von der Schuld, die auf mir lastete, abzuwaschen.
Ich ging ins Bad und spritzte mir etwas kaltes Wasser ins Gesicht, und während ich mir die Zähne putzte, erschrak ich beim Anblick meines Spiegelbildes etwas. Falls das überhaupt möglich war, sah ich heute noch schlimmer aus als sonst. Die Schatten unter meinen Augen waren viel zu dunkel für mein Alter und meine blasse Haut und meine roten Haare verstärkten die optische Wirkung noch weiter. Man sah mir meine schlaflosen Nächte zweifelsohne an und ich hatte nicht einmal die Möglichkeit sie zu vertuschen, denn so etwas wie Concealer besaß ich nicht. Nicht, dass ich mich für eine Naturschönheit gehalten hätte, die so etwas wie Make-up nicht nötig hat. Es war vielmehr so, dass ich jedes Mal einfach gruselig aussah, wenn ich versuchte mich zu schminken. Ich war mir nicht sicher, ob das an meiner mangelnden Feinmotorik lag oder daran, dass es für mich einfach ungewohnt aussah. So oder so. Ich hatte längst beschlossen, dieses Terrain nicht für mich zu erkunden. Schließlich gab es wirklich Wichtigeres als permanent um ein makelloses Aussehen bemüht zu sein. Natürlich würde mir meine Mutter in diesem Punkt vehement widersprechen, doch in welchem Punkt tat sie das schon nicht?
Ich drehte die Dusche so heiß wie möglich auf und genoss den warmen Wasserstrahl, der meinen Rücken herunterfloss. Als das Badezimmer schon in dichte Nebelschwaden gehüllt war, griff ich nach dem weißen Seifenstück, das einsam auf einer schwarzen Schieferplatte lag. In puncto Körperpflege war ich old school. Ich mochte das Gefühl, die Seife durch meine Hände gleiten zu lassen und dabei Schaum zu erzeugen. Den Kontrast, den das kühle Seifenstück auf meiner Haut zum warmen Wasser bildete. Und außerdem – was gab es Besseres, als einfach nur nach Seife zu riechen? Genau nichts. Deshalb wäre ich auch nicht im Traum darauf gekommen, diesen Duft nach dem Waschen mit Parfüm zu zerstören.
Ich drehte den Hahn ab und beobachtete, wie sich Wasser und Schaum den Abfluss hinunterwanden. Mit geschlossenen Beinen und eng an den Körper gepressten Armen stand ich da und verfolgte dieses kleine Spektakel. Viele Menschen glauben, dass sich die Wasserwirbel auf der Nord- und Südhalbkugel in unterschiedliche Richtungen drehen. Aber das ist Quatsch. Die Wirbel sind viel zu klein, als dass die Corioliskraft Einfluss auf sie ausüben könnte. Im Grunde genommen ist es purer Zufall, ob das Wasser links oder rechts herum abfließt.
Erst als die letzten Tropfen verschwunden waren, setzte ich meine Füße auf die kühlen Marmorfliesen und hüllte mich in ein weißes, flauschiges Handtuch. Auf dem Weg zurück in mein Zimmer stellte ich fest, dass der Tag bereits angebrochen war. Ich musste lange unter der Dusche gestanden haben. Verzweifelt suchte ich meine Brille auf meinem Nachtkästchen und fand sie schließlich auf meinem Schreibtisch. Und schon bekam die Welt um mich herum wieder Kontur. Mechanisch öffnete ich den Kleiderschrank und griff wahllos hinein. Beim Blick in den Spiegel zuckte ich zusammen. Ein rot-grünes Ringelshirt und eine Latzhose. Okay – das schmerzte selbst mir in den Augen. Später würde ich mich noch einmal umziehen müssen. Vielleicht würde ich heute sogar etwas von den noch unberührten Sachen tragen, die meine Mutter mir immer in den Schrank hängte. Eines der harmloseren Teile. Die Sachen waren ja nicht aus Protest ungetragen. Bisher war mir nur einfach kein plausibler Grund eingefallen, mich für die Schule so aufzubrezeln. Außerhalb der Schule noch weniger. Im Moment gab es auch Wichtigeres. Ich blickte zu meinem Schreibtisch, an den Platz, an dem gestern noch die Mäuse für mein Experiment gestanden hatten. Meine Mutter hatte es tatsächlich getan. Sie hatte meine Mäuse aus dem Haus geworfen. Nicht, dass sie es getan hatte, schockierte mich, sondern die Tatsache, wie wenig sie mich zu kennen schien. Sie sollte doch wissen, dass mich das nicht aufhielt, sondern nur noch mehr anstachelte.
***
Ich griff nach meinem Handy und wählte Theos Nummer, die die gesamte erste Seite meiner Anrufliste füllte.
»Hey, Jade«, nuschelte Theo verschlafen. »Sag mal, weißt du wie spät es ist?«
»Hi. Sorry. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass du noch schlafen könntest.«
»Nicht so schlimm. Was gibt’s?«
»Ach – nichts. Schlaf ruhig weiter«, murmelte ich entschuldigend.
»Zu spät. Schieß los.«
»Ich muss einfach raus hier. Und ich dachte, vielleicht hast du ja Lust mit mir die Präsentation für den Wissenschaftsbasar vorzubereiten.«
»Klar hab ich Lust. Vor allem werde ich endlich eingeweiht. Bei diesem Projekt warst du ja ziemlich geheimniskrämerisch. Was dir eigentlich nicht ähnlich –«
»Dann kann ich also vorbeikommen?«, schnitt ich ihm das Wort ab.
»Wann immer du willst.«
»Gut. Ich bin in 15 Minuten bei dir. Ich kann bis Mittag, danach muss ich noch etwas anderes erledigen.«
»In 15 Minuten?«
»Ja, spätestens. Bis dann.«
Mir war klar, dass ich Theo damit überfahren hatte, doch ich brauchte jetzt etwas Zerstreuung. Und dass sie sogar im Zusammenhang mit meinem Mäuseexperiment stand, war umso besser. Ich schnappte mir meine ausgebeulte ockerfarbene Umhängetasche und stopfte den Laptop und die Unterlagen hinein. Mein Blick blieb auf dem Button an meiner Tasche hängen. Natürlich sind Buttons albern, aber dieser hier hatte eine Funktion. Er ersetzte einen kaputten Verschluss. Meine Augen ruhten immer noch auf dem Button. Wehmütig las ich den Schriftzug. Die in meinen Augen schönste Liebeserklärung an die Wissenschaft, die am besten die Faszination dafür erklärt, herausfinden zu wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Es war der Lieblingsspruch meines Dads. Sein Mantra. Unser Mantra. God is a mathematician.
3. KAPITEL
Es klopfte an der Tür, doch ehe ich etwas sagen konnte, stand meine Mutter auch schon bei mir im Zimmer.
»Guten Morgen, Jade. Ich wollte dich nicht stören«, sagte sie und trat näher. »Ich habe nur bemerkt, dass bei dir schon Licht brennt, und wollte kurz nach dir sehen.«
Ich antwortete nicht und versuchte stattdessen sie so reserviert wie möglich anzusehen.
Sie kam auf mich zu, nahm mein Kinn in ihre Hand und drehte meinen Kopf zum Profil. »Du siehst schrecklich aus«, sagte sie und sah dabei selbst natürlich fabelhaft aus. Es war noch nicht einmal 6 Uhr morgens, und ohne dass sie vermutlich viel hatte dazu tun müssen, sah sie bereits besser aus als die Moderatorin im Frühstücksfernsehen. Ihre blonde Mähne umrahmte mit geschmeidig fallenden Locken ihr anmutiges Gesicht. Ihre grünen Augen funkelten umrahmt von traumhaft langen Wimpern und ihr schlanker Körper steckte in einem enganliegenden Kleid, unter dem die meisten Stars wohl Spanx tragen würden, die meine Mutter allerdings überhaupt nicht nötig hatte. Ihre makellose Figur war schließlich nicht nur ihr Kapital, sie war ihr Lebensinhalt.
»Ich habe eine Idee«, sagte sie. »Warum machen wir zwei uns nicht einen schönen Tag? Wir gönnen uns eine schöne Gesichtsbehandlung bei der Kosmetikerin oder gehen zum Friseur und setzen diesem grauenhaften Granatrotexperiment auf deinem Kopf ein Ende.« Sie knuffte mir mit ihrem Ellbogen in die Seite, als würden ihre unterschwelligen Beleidigungen dadurch plötzlich komisch wirken.
Ich blieb reserviert. »Nein, danke.«
»Mit einem schönen warmen Braunton – du würdest wunderschön aussehen. Und es würde so viel besser zu deinen Augen passen, als«, sie machte eine ausladende Geste in Richtung meines Kopfes »rot.«
»Ich könnte mir vorstellen, dass auch eine Papiertüte ganz wunderbar zu meinen Augen passen würde.«
»Unsinn.«
Es war die Wahrheit. Meine Mutter hatte, wie alle Frauen in ihrer Familie, diese tiefgrünen Katzenaugen. Und wenn ich sage alle Frauen in der Familie, dann meine ich wirklich alle. Deshalb war mein Dad fest davon überzeugt, dass auch ich sie erben würde. So sicher, dass er mir den Namen Jade gab. Leider hatte sich nur ein Hauch Grün in sie verirrt. Es war wie es war. Meine Eltern behaupteten immer, dass meine Augen – eben weil sie nicht nur rein grün waren etwas ganz Besonderes wären. Sternchen. Mein Dad nannte mich immer Sternchen. Ich dachte früher, dass mein Vater für einen Wissenschaftler vielleicht etwas zu viel Fantasie hatte. Denn ich selbst hatte die Sterne, von denen er sprach, nie gesehen. Bis ich gestern in Caspars Augen blickte.
»Vielleicht hörst du jetzt besser auf«, sagte ich und wandte meinen Blick von ihr ab. »So zu tun, als wäre nichts gewesen.«
»Ich habe dir gesagt, dass die Mäuse verschwinden. Und ich denke, ich habe dir erklärt, warum.«
»Und nur deine Sichtweise zählt?«
»Es geht nicht um Sichtweise, Jade. Es geht um Gefühle. Und ein Experiment, in dem du beweisen willst, dass Mäuse, die bei ihren Vätern aufwachsen, intelligenter sind als Mäuse, die bei ihren Müttern aufwachsen – das, Jade, ist sehr verletzend für mich.«
»Es ist ein wissenschaftliches Experiment und kein persönlicher Rachefeldzug gegen dich. Warum kriegst du das nicht in deinen Kopf?«
»Ich wünschte, du hättest normale Hobbys.«
»Ich spiele Hockey, das ist doch normal.«
»Für deine Verhältnisse vermutlich schon«, sagte sie und rollte ihre Augen. »Ich dachte allerdings an etwas, das Mädchen gerne tun wie …«
»Stundenlang im Shoppingcenter herumhängen und Klamotten kaufen, die unter ethisch und ökologisch fragwürdigen Bedingungen hergestellt werden?«
Sie verschränkte die Arme und bohrte ihre rot lackierten Nägel dabei leicht ins Fleisch. »Ja, das wäre ein gesunder Anfang.«
Ich griff nach meiner gepackten Umhängetasche. »Daraus wird leider nichts. Ich muss los und an meinem Projekt arbeiten.«
Meine Mutter zog an ihrer Halskette, so stark, dass sich eine deutlich ausgeprägte rote Linie um ihren Hals bildete. Sie schluckte, blickte zu Boden, zog noch stärker an ihrer Kette und sah mich durch ihre zusammengekniffenen Katzenaugen an. »Dann ziehst du es also durch«, sagte sie mit bebender Stimme. »Trotzdem.«
»Selbstverständlich«, sagte ich, während ich auf die Zimmertür zuging. »Und du betrachtest das zu eindimensional. Die Mäuse, die bei ihrer Mutter aufwachsen, weisen dafür ein ausgeprägteres Sozialverhalten auf.«
»Wenn du glaubst, dein Vater würde das, was du tust, gutheißen, dann hast du dich getäuscht«, sagte sie und blickte mich dabei eisig an.
Ohne etwas zu erwidern, verließ ich mein Zimmer. Wann sah sie endlich ein, dass ich nicht war wie sie. Im Gegensatz zu ihr war mein Lebensziel nicht den ersten Preis bei einer Schönheitskonkurrenz zu gewinnen. Und wenn ich mir vorstellte, dass mein Gesicht mir von einem Cover entgegenlächelte, dann war das nicht die Sports Illustrated, sondern ein wissenschaftliches Magazin und die Überschrift lautete: Jade Brooks löst Millennium-Probleme der Mathematik.
***
Ich ging zur Garage und holte mein Fahrrad. Es war rot und sah bei flüchtiger Betrachtung so aus, als wäre es in einen feinen weißen Sprühregen geraten. Wenn man genau hinsah, erkannte man allerdings, dass es sich nicht um Punkte, sondern um filigrane Sterne handelte. Ein Sternchen-Rad. Dad hatte es mir zu meinem 12. Geburtstag geschenkt. Auch wenn ich dem Design schon entwachsen war liebte ich dieses Fahrrad. Es musste schon in Strömen regnen, damit ich es stehen ließ und auf den Schulbus oder die Cable Cars auswich. Ich zog den Riemen meiner Umhängetasche nach unten, um sie quer über den Rücken zu positionieren. Dann schwang ich mich aufs Rad und ließ mich von der, für San Francisco so typischen, kühlen und feuchten Morgenluft einhüllen. Die Straßen waren leer und die Ampeln noch nicht in Betrieb. Natürlich. Wer war schon am Samstagmorgen um diese Zeit unterwegs? Ich dachte über den Streit mit meiner Mutter nach. Streit war nicht ungewöhnlich zwischen uns und normalerweise perlte er von mir ab wie Wasser von einer polymerversiegelten Fensterscheibe. Doch in ihren Worten schwang etwas mit, das mich tief beunruhigte. Die Frage, ob sie Dad besser verstand als ich. Und ich fürchtete mich vor der Antwort.
Kräftig trat ich in die Pedale und versuchte die Gedanken dadurch abschütteln. Als ich um die letzte Kreuzung bog, zeichnete sich das Haus der Wilkens schon ab. Mit seiner roten Holzbretterfassade mutete es sehr skandinavisch an und stach dadurch sofort zwischen all den farblosen Häusern hervor. In einer Art Damenreitposition fuhr ich die Auffahrt hoch und lehnte mein Fahrrad an die Veranda. Ich war gerade im Begriff die Stufen hinaufzugehen und zu klingeln, als mir einfiel, wie früh es noch war. Im vorderen Teil des Hauses brannte noch kein Licht, ich konnte jedoch einen schwachen Lichtstrahl im Garten erkennen, der aus der Küche kam. Ich ging hinters Haus, lugte durch die mit weißen Spitzenvorhängen bekleideten Fenster und kam mir plötzlich reichlich albern vor. Doch meine Verlegenheit wurde jäh unterbrochen. Mrs Wilkens erspähte mich fast augenblicklich und öffnete mir die Hintertür. »Guten Morgen, Jade. Komm herein.«
»Guten Morgen Mrs Wilkens. Danke.«
»Theo muss jeden Augenblick da sein«, sagte sie und legte mir mit einer mütterlichen Geste eine Hand auf meine Schulter. »Möchtest du mit uns frühstücken oder hast du schon etwas gegessen?«
Mein Magen knurrte. »Sehr gerne. Es riecht schon köstlich.«
Ohne dass ich danach gefragt hätte, drückte sie mir eine große Tasse mit dampfendem Kaffee in die Hand, den ich dankend annahm und augenblicklich einen großen Schluck davon nahm.
»Es gibt Blaubeerpfannkuchen«, sagte Mrs Wilkens, während sie zurück zum Herd ging. Sie trug eine blau-gelb-geblümte Kittelschürze. Bis ich Theo und damit seine Mum kennenlernte, hatte ich gar nicht gewusst, dass es dieses Kleidungsstück überhaupt gab. Meine Mutter hätte so etwas vermutlich nicht einmal zu Halloween getragen. So antiquiert diese Kittelschürze auch war, so sehr das grelle Muster auch in den Augen schmerzte, es passte zum Gesamtbild dieses durch und durch gemütlichen Hauses.
Theo schlurfte in die Küche. Er trug eine nicht sehr vorteilhaft geschnittene Jeans, ein weißes T-Shirt und darüber ein offenes Hemd, das einmal schwarz gewesen war. Jetzt war es eher dunkelgrün oder grau – je nach Lichteinfall. Seine Brille mit dem fragil wirkenden Messingrahmen saß leicht schief auf seiner Nase. Die Gläser wirkten wie immer leicht beschlagen und seine dunklen Haare hingen ihm strähnig ins Gesicht. Theo war einer der Menschen, die, man mochte es kaum glauben, noch weniger Wert auf ihr Erscheinungsbild legten als ich. Mit ihm war alles immer so ungezwungen. Das rechnete ich ihm hoch an.
Theo wirkte, als wäre er eben erst aufgestanden. Was er vermutlich auch war. Die Müdigkeit wich augenblicklich aus seinem Gesicht und machte einem Lächeln Platz. Kein Wunder. Wer wird nicht gerne mit Blaubeerpfannkuchen geweckt?
Theo erhob salutierend seine Hände. »Da ist ja die Heldin der Schule.«
»Heldin der Schule?«, fragte ich. »Jetzt drehst du gerade völlig durch, oder?«
»Überhaupt nicht. Euer Sieg und vor allem deine Tore sind das Thema auf Facebook und Twitter.«
»Ach das«, sagte ich und versuchte das Thema mit einer Handbewegung wegzuwischen.
Theo schüttelte den Kopf und lachte. »Ich habe dich gar nicht kommen gehört.«
»Deine Mum mit ihren telepathischen Kräften hat meine Schwingungen aufgenommen und mich zur Hintertür reingelassen.«
»Warum bist du denn zur Hintertür gegangen?«
»Ich wollte nicht klingeln und jemanden wecken.«
Theo lächelte und musterte mich mit seinen warmen braunen Augen. »Das ist sehr … Aber bei mir hattest du keine Bedenken?«
»Sagen wir so. Sie sind etwas zu spät gekommen.«
»Schluss mit dem Geplänkel, Kinder«, sagte Theos Mum und stellte einen großen Teller voll mit daumendicken Blaubeerpfannkuchen auf den Tisch. Daneben zwei kleine Schalen. Eine mit geschlagener Sahne, die andere mit einer Zimt-Zucker-Mischung. »Essen fassen.«
Ich spießte einen Pfannkuchen auf meine Gabel und bestreute ihn mit einem Hauch des Zimt-Zuckers. Der Pfannkuchen war noch so warm, dass der Zucker begann zu zerlaufen und zu karamellisieren. Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Während ich den ersten Bissen kaute, fragte ich mich, wann ich zuletzt so ein schönes warmes Frühstück hatte. Doch die Antwort war zu schmerzlich, als dass ich weiter darüber hätte nachdenken wollen.
»So was gibt’s bei deiner Model-Mama nicht – oder?«, fragte Theo und nickte dabei in Richtung meines Tellers.
»Nein. Ob das an den Kalorien oder an den nicht vorhandenen Kochkünsten meiner Mutter liegt, kann ich nicht sagen.«
Theos Mum schnaubte verächtlich. »Als ob Kalorien zählen eine Religion wäre.«
»Für meine Mutter schon«, sagte ich.
Theo sah mich tadelnd an. »Jetzt sei nicht so.«
»Wie – so?«
»Gemein. Außerdem sie sieht toll aus.«



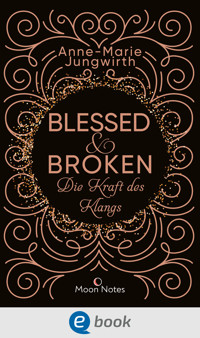
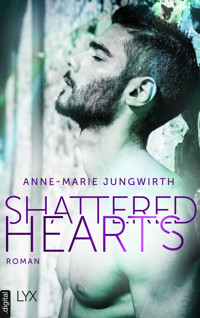
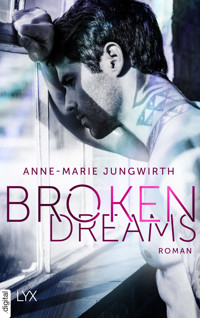













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









