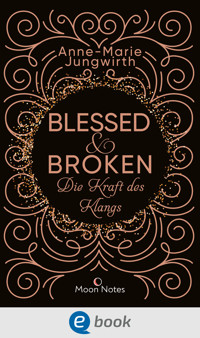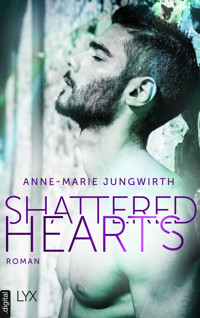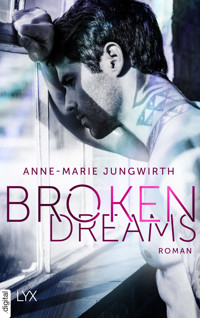Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Superior
- Sprache: Deutsch
Ein privilegiertes Leben und schier unbegrenzte Möglichkeiten – das bietet die Superior Human Society ihren Mitgliedern. Zumindest denen, die es wert sind … "Du bist eine Superia, aber deine Gaben sind minderwertig." Unzählige Male hat die 20-jährige Amelia diesen Satz schon gehört. Und jedes Mal war sie froh darüber. Sie wollte nicht dazugehören. Sie wollte nicht die Pflichten. Sie wollte nicht, dass man ihr vorschrieb, mit wem sie sich paaren sollte. Doch was Amelia will, ist für eine Andere bestimmt. Und was man von ihr will, ist schlimmer als eine Zwangsheirat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Superior
Das dunkle Licht der Gaben
Anne-Marie Jungwirth
Copyright © 2017by
Astrid Behrendt
Rheinstraße60
51371 Leverkusen
http: www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Kerstin Ruhkieck
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Illustrationen: Anne-Marie Jungwirth
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-219-8
Alle Rechte vorbehalten
Für Emilian
Du bist die beste Entscheidung meines Lebens.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Danksagung
Über die Autorin
Prolog
Salome
6 Jahre vorher
Der Gerichtssaal 105B des Detroit Family Court spiegelte Salomes Verfassung treffend wider. Kaputt und heruntergekommen – wie die gesamte Stadt. Risse dekorierten die ansonsten kahlen Wände und ein leichter Modergeruch kaschierte den Angstschweiß, der sich langsam, aber sicher unter ihren Achseln bildete.
Salome saß im Zeugenstand und nestelte an den Ärmeln ihres weißen Hemdes, das sie sich extra für die heutige Verhandlung besorgt hatte. Sie wollte seriös aussehen. Wie eine gute Mutter. Salome war eine gute Mutter – auf ihre Weise.
»Miss Zephyr«, sagte der Anwalt des Jugendamtes. »Ihre Akte ist nicht gerade übersichtlich. Allein in den letzten vierundzwanzig Monaten finden sich darin fünf Betrugs- und Diebstahlsdelikte. Würden Sie sagen, dass eine gute Mutter so etwas macht?«
Hilfe suchend sah sie ihren Anwalt an. Doch von dem jungen Pflichtverteidiger, den man ihr gestellt hatte, war nicht viel zu erwarten. Im Gegensatz zum Pitbull der Gegenseite. Er sah aus wie der Typ Mann, der als Kind gern Fliegen die Flügel ausgerissen hatte und es vermutlich heute noch tat, wenn er sich unbeobachtet fühlte. »Nein, und ich weiß, dass es falsch war. Aber es ging mir doch nie darum, Menschen zu schädigen, ich habe einfach nur versucht, mich und meine Tochter über Wasser zu halten.«
»Andere Mütter gehen arbeiten.«
Mühsam unterdrückte Salome ein Augenrollen. Nicht provozieren lassen. »Es ist nicht leicht, einen Job zu finden – ohne Ausbildung, alleinerziehend, ohne Familie, die einen unterstützt.«
»Die Welt ist sehr böse zu Ihnen, Miss Zephyr«, sagte der Pitbull mit unverhohlenem Sarkasmus, während er sich auf den Zeugenstand und Salome zubewegte. Seine Körperhaltung schrie Angriff und er genoss seinen Auftritt sichtlich. »Doch dafür, dass Sie Ihre Tochter in ihre Gaunereien mit hineinziehen, kann die Welt nichts. Bei zwanzig von insgesamt sechsundzwanzig aktenkundigen Delikten hat Ihre Tochter als Komplizin fungiert. Rechnungen prellen scheint Ihre gemeinsame Spezialdisziplin zu sein. Acht Restaurantrechnungen, vier Hotelrechnungen, sechs Tankrechnungen und jeweils einmal Friseur und Nagelstudio.« Bei den letzten beiden Punkten verzog er das Gesicht, als würden die Wörter einen unangenehmen Geruch verströmen. »Eine gute Mutter, Miss Zephyr«, setzte der Pitbull an und suchte den Augenkontakt und die Zustimmung des Richters, »… beschützt ihre Tochter vor Kriminalität und macht sie nicht zum Werkzeug dessen. Ihre Tochter ist vierzehn. Ein kritisches Alter. Leicht beeinflussbar. Aber glücklicherweise auch noch positiv formbar.« Abschätzig sah er sie an. »Innerhalb eines positiven Umfeldes, verstehtsich.«
Salome wurde schlecht. So, wie er das sagte, hörte es sich an, als wäre sie ein selbstsüchtiger und verantwortungsloser Mensch. Und vermutlich war sie das auch. Aber nicht, wenn es um Amelia ging. Für sie hatte sie auf alles verzichtet. Hatte versucht, sie zu beschützen und sie beide durchzubringen – irgendwie. Über die Methoden konnte man sicherlich streiten.
Für Salome gab es jedoch nicht viele Alternativen. Man durfte nicht zimperlich sein. Nicht, wenn man aus ihren Verhältnissen kam. Nicht, wenn es um ihr Ein und Alles ging. Und genau darum ginges.
Wie einfach wäre ihr Leben gewesen, wenn sie damals Nein gesagt hätte. Wie einfach, wenn sie Ja gesagt und nach der Entbindung allein gegangenwäre.
Seit sie denken konnte, zog sie Probleme und Ärger an wie Motten das Licht. Doch den schweren Weg hatte sie nicht aus einer Laune heraus eingeschlagen.
Vielleicht hatte sie Amelia kein gutes Leben geboten, aber es war besser als das, was ihr vorherbestimmt war. Diese Leute waren ernsthaft krank. Psychopaten. Wäre sie noch einmal in der gleichen Situation, sie würde wieder so handeln. Für Amelia.
Salome hatte viele falsche Entscheidungen in ihrem Leben getroffen. Doch diese eine war die richtige. Und wenn sie etwas bereute, dann, dass sie nur ein Kind retten konnte.
Und nun drohte sie auch dieses zu verlieren.
Sie sollte jetzt etwas sagen, wusste aber nichtwas.
Schuldbewusst blickte sie zu Boden. »Es tut mir unendlich leid. Ich weiß, dass es falsch war. Und ich verspreche, mich zu ändern und zu bessern.«
»Ein Dollar für jedes Mal, dass ich diesen Satz gehört habe …«, konterte der Pitbull und das Schmunzeln, das dieser Kommentar bei allen Anwesenden erzeugte, entging Salome nicht.
Sie biss sich auf die Lippen. »Aber es ist so. Ich habe einen Job. Sogar einen festen.«
Niemand schien beeindruckt, am wenigsten der Pitbull. »Ja, das habe ich gelesen. Sie kellnern.«
»Das ist nichts Schlechtes.«
»In einem Strip-Club.«
»Mich hat sonst niemand eingestellt. Und ich bringe da nur die Getränke an den Tisch.« Nervös zog Salome die Sitzfalten aus ihrer Bluse. Es lief gar nicht gut fürsie.
»Stimmt, Miss Zephyr. Es ist vermutlich schwer, mit Ihrem Vorstrafenregister und Ihrer Drogenvergangenheit einen vernünftigen Job zu finden.«
Salome fühlte sich elend. Ihre gesamte Vergangenheit, jeder ihrer Fehler kam gerade zu ihr zurück wie ein Bumerang. Bang! So langsam verstand sie das Konzept von Karma. »Das mit den Drogen ist doch schon ewigher.«
Der Pitbull klatschte in die Hände. Ob vor Freude oder um sich mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, konnte Salome nicht sagen. »Sollen wir einen Drogentest anberaumen, um Ihrer Aussage mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen? Gleich hier und jetzt?«
Verfluchte Scheiße. Salome blickte flehentlich zu ihrem Anwalt, der ihrem Verhör ungerührt beiwohnte, und räuspertesich.
»Haben Sie dafür eine richterliche Anordnung?«, fragte Salomes Pflichtverteidiger.
Der Pitbull wirkte genauso überrascht vom Eingreifen des Verteidigers wie Salome selbst. »Nein, das habe ich nicht. Ich wollte Ihrer Mandantin nur eine Möglichkeit geben, ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen. Möchten Sie uns von Ihren Besserungsabsichten überzeugen, Miss Zephyr?«
Salome würde den Test nicht bestehen. Nichts Schlimmes. Sie hatte nur ein wenig gekifft in den letzten Wochen. Die Situation, seit man ihr Amelia weggenommen hatte, war unerträglich. Und es war wirklich nur Gras. Sie hatte nicht wieder angefangen zu spritzen. Und würde das auch nie mehr. Und auch mit dem Kiffen würde sie aufhören, sobald Amelia wieder bei ihr war. »Nein, ich verzichte darauf.«
Die Miene des Pitbulls erhellte sich. »Das spricht fürsich.«
»Einspruch«, rief Salome.
Der Richter sah sie an. »Worauf begründen Sie Ihren Einspruch, Miss Zephyr?«
Salome zuckte mit den Schultern, überlegte krampfhaft und versuchte, etwas Halbwissen aus Gerichtsfilmen zutage zu befördern. »Mutmaßung?«
»Stattgegeben.« Der Richter quittierte seine Aussage mit einem Hammerschlag.
Zornig blickte Salome zu ihrem Pflichtverteidiger. »Wäre das nicht Ihr Job gewesen?«
»Ja, Einspruch. Mutmaßung«, wiederholte er das Offensichtliche.
Pff. Das hier war aussichtslos.
»Keine weiteren Fragen, Euer Ehren«, schloss der Pitbull sein Kreuzverhör.
Der Richter nickte dem Pflichtverteidiger zu. »Ihre Zeugin.«
Verzweifelt sah Salome zu ihm. Sie hoffte inständig, dass er noch irgendetwas auf Lager hatte. Vielleicht kein Ass, aber wenigstens einen König. Oder eineZehn …
»Keine weiteren Fragen, Euer Ehren«, sagte er stattdessen.
Sie würde ihre Tochter verlieren. Daran bestand nun kein Zweifelmehr.
Obwohl es keinen Sinn hatte, die Schuld hierfür bei anderen zu suchen, kochte Wut in ihrhoch.
Wenn jemand für diese Situation verantwortlich war, dann sie. Sie hatte zu viel falsch gemacht und nun würde sie dafür den höchsten Preis bezahlen, den esgab.
Und so gern sie ihren Ärger nur gegen sich selbst gerichtet hätte, etwas machte sie stutzig. Diese ganze Verhandlung war wie ein Suchbild. Und nun hatte sie den Fehler gefunden.
Warum saß er hier? Das ergab keinen Sinn. Er war es schließlich, der sie gewarnt hatte.
Das konnte nichts Gutes bedeuten.
Sie würde ihre Tochter nicht nur verlieren, Salome würde sie an sie verlieren.
1
Amelia
Wo um alles in der Welt war nur ihr Slip? Nicht, dass Amelia nicht ohne ihn gehen konnte oder der Verlust ihrer Unterwäsche sie schmerzen würde, aber hier wollte sie ihn nun wirklich nicht lassen. Amelia kniete sich hin und suchte unter dem Bett. Nichts. Abgesehen von den zwei benutzten Kondomen. Unschön, aber das Risiko, Marcus mit einer ausgeweiteten Suchaktion aufzuwecken, wollte sie definitiv nicht eingehen. Leise sammelte sie ihre übrigen Kleidungsstücke ein und schlich auf Zehenspitzen zur Tür. Sollte das lautlose Verlassen von Zimmern irgendwann einmal eine olympische Disziplin werden, dann wäre Amelia eine Medaille sicher. Sie blickte auf ihre Uhr und schlüpfte eilig in ihre Sachen.
Als Amelia auf die Straße trat, umwehte sie ein Hauch kalter Morgenluft. Sie schüttelte sich. Vor Kälte und wegen der letzten Nacht.
Marcus! Marcus aus dem Schwimmteam. Ihm lagen die Mädchen zu Füßen. Es gab dafür durchaus Argumente. Wobei, in Amelias Augen eigentlich nur eines – sein Oberkörper. Ansonsten fand sie ihn irgendwie schleimig, was nicht nur an seinen geschniegelten Haaren lag. Er war einfach der Prototyp eines Harvard-Schnösels. Ein Rich Kid. Sie hatte nur mit ihm geflirtet, weil diese dürre Theta-Tussi ihn so angehimmelt hatte und Amelia sie damit ärgern wollte. Mehr nicht. An irgendeinem Punkt des Abends war das außer Kontrolle geraten. Der Gin Tonic war daran vermutlich nicht ganz unschuldig.
Passiert.
Es war ja auch nicht so, dass sie Rich Kids diskriminierte. Sie erschienen ihr nur meist schrecklich eindimensional. Geld, wie man es ausgab und zur Schau stellte, bestimmte ihr Leben. Amelia mochte Menschen, die eine Geschichte hatten. Eine, in der es Probleme gab, die nicht mit Daddys Kreditkarte gelöst werden konnten. Das war eine von Amelias selbstzerstörerischen Vorlieben – fand Catherine.
Apropos Catherine.
Amelia zog ihr Telefon aus der Tasche. Ihr Display zeigte bereits sieben Anrufe und drei WhatsApp Nachrichten von ihrer Pflegeschwesteran.
Ich hoffe, du kommstbald.
Wo bleibstdu?
Und: Allesokay?!
Catherine würde sie umbringen. Die Benutzung eines Ausrufezeichens in ihrer Nachricht deutete stark darauf hin. Für Catherine war dies die schriftliche Form des Anschreiens und damit unschicklich. Die Lage war ernst.
Bin auf dem Weg, schrieb Amelia zurück und eilte barfuß quer über den feuchten Rasen.
Es war verhältnismäßig ruhig auf dem Campus. Ein paar kleine Grüppchen hier und da, vereinzelte Jogger und die obligatorische Besuchergruppe, die ihren Weg kreuzte. Wie so oft wurde diese von Laura, eine von Catherines Freundinnen, geführt. Empört sah Laura Ameliaan.
»Was bist du nur für ein Vorbild für diese jungen Menschen?«
Amelia wusste, wie sie aussehen musste. Ihre braunen Locken waren zwar immer etwas wirr, gerade aber ziemlich messy. Dazu die Mascara-Reste unter ihren Augen. Viel Fantasie brauchte man für die Deutung nicht.
Ihr war das egal. Für Amelia war es eine Frage der Gleichberechtigung. Es war nicht so, dass Frauenorganisationen sie als Rednerin einluden. Ein Skandal. Aber ernsthaft: Für gleiche Bezahlung zu kämpfen war ehrenhaft, für das Recht, sich genauso zu amüsieren wie ein Kerl, aber verpönt? Warum Geld wichtiger sein sollte als ein selbstbestimmtes Leben, wollte ihr nicht einleuchten.
Amelia musterte Laura. Sie trug einen Harvard-Hoodie, der mit der Farbe der Backsteingebäude hinter ihr verschmolz.
»Im Gegensatz zu dir strebe ich es überhaupt nicht an, ein Vorbild zu sein. Deshalb muss ich auch nicht ständig so eine verlogene Show abziehen und lebe einfach das Motto der Uni.« Amelia deutete auf das Wappen von Lauras Pullover.
Veritas. Wahrheit.
Das Motto der Universität.
Dann wandte sie sich der Gruppe zu. »Glaubt mir, ich kenne ihren Vortrag. Er geht ungefähr so: langweilig, langweilig, langweilig. Aber lasst euch nicht einschüchtern. Auch in Harvard kann Studieren Spaß machen.«
Die Jungen reckten ihre Fäuste in die Luft und grölten »Veritas«, während die Mädchen tuschelten. Laura senkte den Kopf und murmelte etwas vor sichhin.
»Viel Spaß noch«, rief Amelia ihnen zu und lief weiter.
Sie musste sich nun wirklich beeilen. Catherine war bestimmt schon außer sich. Und ihren Zorn heraufzubeschwören, war keine gute Idee. Schließlich konnte Catherine allein durch die Kraft ihrer Gedanken töten. Sie könnte Amelias Blut zum Kochen bringen, ihr Herz aufhören lassen zu schlagen. Möglichkeiten gab es viele. Für gewöhnlich wandte ihre Pflegeschwester ihre Gaben jedoch nicht für etwas Profanes wie einen Rachefeldzug an. Das letzte Mal hatte sie das vor drei Jahren gemacht. Amelia war eigentlich mit Oliver Bannermann verabredet gewesen. Weil Catherine aber insgeheim für ihn schwärmte, verpasste sie ihr mit ihrer Gabe, die Körperfunktionen anderer zu kontrollieren, einen Durchfall. Amelias Date fand daraufhin mit der Kloschüssel und nicht mit Oliver statt. Rückwirkend betrachtet fand sie es lustig. Aber selbst damals vergab sie ihrer Schwester schnell. Sie war nicht der Typ, der lange nachtragend sein konnte. Catherine hingegen hielt sich das selbst ewig vor. Diese Entgleisung.
Seitdem hatte Amelia nie wieder erlebt, dass ihre Schwester die Kontrolle über sich verlor. Und sie hoffte, dass es auch heute nicht so weit kommen würde.
Noch während sie den Schlüssel ins Schloss steckte, öffnete Catherine die Tür von innen. Man musste ihre Pflegeschwester schon gut kennen, um zu wissen, dass sie sauer war, denn Catherine war ungemein beherrscht. Aber die Art, wie sich ihr Kiefer anspannte, ließ keinen Zweifelzu.
»Wo zur Hölle hast du gesteckt?«, fauchte Catherine siean.
Beschämt senkte Amelia den Blick. »Es tut mir leid.« Tat es wirklich. »Aber so spät ist es doch noch gar nicht. Wir haben noch genug Zeit, um …«
Catherine ließ sie mitten im Satz stehen. Mit langen, schnellen Schritten durchquerte sie den schmalen Flur Richtung Wohnzimmer. »Ach, haben wir das, ja? Es ist elf Uhr. Ich hatte mit Pascal vereinbart, dass er seinen Laden von zehn bis zwölf für mich schließt, damit wir uns ungestört umsehen können. Und jetzt!« Das Sonnenlicht fiel durch die raumhohe Fensterfront auf Catherines Gesicht und zeichnete ihre Züge weich. Amelia konnte das jedoch nicht täuschen. Sie kannte ihre Schwester und das verräterische Zucken ihrer Schläfe. Ein falsches Wort und ihre Pflegeschwester würde anfangen zu weinen. »Es tut mir ehrlich leid. Aber wir können die Kleider doch genauso gut aussuchen, wenn wir nicht allein im Ladensind.«
»Natürlich können wir das. Ich kann ja auch selbst meine Maße nehmen und ein Kleid bei Amazon bestellen.«
Gott bewahre! Manchmal war ihr Catherine ein Rätsel. Wie konnte jemand, der jedes Wochenende in der Suppenküche aushalf, nur solche Meldungen vom Stapel lassen? »Du bist manchmal so versnobt«, sagte Amelia. »Aber weil das eine große Sache für dich ist, sehe ich es dirnach.«
»Und eben weil es eine große Sache für mich ist, hätte ich mich gern auf dich verlassen. Aber das war wohl ein Fehler. Dir war es ja anscheinend mal wieder wichtiger, einen Typen abzuschleppen.« Catherines harte Worte hallten durch den Raum. Selbst die Backsteinwände, die sonst jeden Lärm fraßen, verschluckten den Zorn, der darin schwang, nur zögerlich.
»Cathy«, sagte Amelia entschuldigend.
»Nichts Cathy. Sieh dich doch an. Ist dir das nicht peinlich?«
»Peinlich?«
»Na, dieser morgendliche Walk of Shame über den Campus.«
Amelia schnaufte. »Mir ist es nicht peinlich. Aber dir offensichtlich.«
Seufzend nahm Catherine auf dem weißen Sofa Platz. Sie verschränkte ihre Arme vor der Brust und sah Amelia fest in die Augen. »Natürlich ist es das, Amelia. Ich hoffe, es hat sich wenigstens gelohnt.«
»Geht so. Das zweite Mal war ganzokay.«
Lachend schüttelte Catherine den Kopf. »Ich wusste gar nicht, dass du zwei Mal mit dem Gleichen schläfst.«
»Ich auch nicht. Aber das erste Mal war so enttäuschend, das konnte Marcus mit seinem Über-Ego nicht so stehen lassen.« Amelia klopfte Catherine spielerisch auf den Oberarm und ließ sich auf der Armlehne neben ihr nieder.
»Marcus? Der Schwimmer-Marcus?«
»Jep.«
Catherine riss ihre Augen weit auf. »Du weißt schon, dass er seine Abenteuer immer filmt und großzügig vorführt?«
»Ähm, nein.« Amelia biss sich auf die Zunge. »Stand das in deinem Pornhub-Newsletter?«
»Haha«, sagte Catherine und stemmte ihre Hände in die Hüften. »Ich weiß es von einer Freundin.«
»Kümmerst du dichdrum?«
»Wieso sollte ich?«, fragte Catherine bitter und wandte den Kopf von ihrab.
»Stell dir vor, du tust es nicht und das Ganze dringt an die Öffentlichkeit … unsere Eltern bekommen davon Wind … Und ich werde mit enttäuschten Blicken, aber noch viel schlimmer, endlosen Moralpredigten gestraft.« Amelia seufzte und sah zu Catherine. »Worauf würde das hinauslaufen?«
»Darauf, dass du bekommst, was du verdienst?«
»Es würde darauf hinauslaufen, dass ich schrecklich, schrecklich genervt bin. Eher angepisst. Und du weißt doch, wie ich dann so reagiere und zu ertragen bin, oder?«
»Mhm.«
»Und wen treibe ich mit meinen Launen dann immer in den Wahnsinn? Dich. Genau. Siehst du jetzt, worauf das hinauslaufen würde?«
»Miststück«, zischte Catherine. »Ich hasse es, meine Gaben einzusetzen, um deinen Mist geradezubiegen.«
Amelia stand auf, setzte sich auf den Couchtisch genau gegenüber von Catherine und legte ihren Hundeblick auf. »Und trotzdem wirst du es tun, oder?«
»Ja, aber nicht für dich. Sondern weil das irgendwann zum Skandal werden könnte. Nicht für dich. Für unsere Familie.« Catherine lächelte versöhnlich, setzte dann aber nach: »Und hör auf, dich ständig auf diesen Tisch zu setzen. Er ist ein handgefertigtes Unikat, ungeleimt aus dem Stamm eines Nussbaums gearbeitet.«
Amelia erhob sich. Die Nerven ihrer Schwester waren heute schließlich schon strapaziert genug. Sie nahm Catherines Hände in ihre und drückte sie sanft. »Danke.«
Catherine erwiderte die Geste und Amelia war froh, dass die Wogen wieder geglättet waren. »Ich springe nur schnell unter die Dusche und dann gehen wir dir das schönste Kleid in der Geschichte des Maturity Feasts aussuchen. In Ordnung?«
Catherine nickte. »Aber beeildich.«
Amelia nahm sie in den Arm. »Machich.«
»Gut, du riechst nämlich fürchterlich«, sagte Catherine und kicherte.
»Das ist der Geruch von Sünde«, zwinkerte ihr Amelia zu. »Du kommst auch noch auf den Geschmack.«
Sie drückte ihrer Schwester einen feuchten Schmatz auf die Wange, den Catherine angewidert wegwischte, und verschwand dann ins Badezimmer.
Amelia parkte ihren Maserati auf dem Gehsteig vor dem gorgeous4gorgeous und warf dem Parkboy ihren Schlüsselzu.
»Aber Vorsicht. Das Schätzchen istneu.«
»Selbstverständlich«, gab dieser pflichtbewusst zurück.
Catherine blickte sie tadelnd an. Sie war verdammt gut darin, ihr ein schlechtes Gewissen zu machen. In diesem Punkt jedoch nicht. Ihr Cabrio war ein Traum. Der perlmuttfarbene Lack und das rote Leder. Es war genau die Mischung aus eleganter Aggressivität, in die sie sich verliebt hatte. Und das unsichere Auftreten des Parkboys gefiel Amelia gar nicht. »Aber …«
»Nichts aber«, sagte Catherine barsch und zog sie am Arm mitsich.
Es war nicht nötig, die Ladentür selbst zu öffnen. Eine Mitarbeiterin machte das für sie und unmittelbar danach wurden sie von Pascal, dem Inhaber des gorgeous4gorgeous, begrüßt. Catherine kannte ihn gut. Schließlich war sie häufig auf irgendwelchen Chichi-Veranstaltungen, für die sie ein Abendkleid brauchte. Und Pascal war der Mann ihres Vertrauens, wenn es darum ging, sie ins rechte Licht zu rücken.
Nachdem Catherine links und rechts ein Küsschen bekommen hatte, war auch Amelia an der Reihe.
»So, meine Hübschen«, sagte er und klatschte erfreut in die Hände. »Ich habe alles vorbereitet. Kommt mit mir nach hinten.«
Catherine und Amelia folgten ihm durch das Geschäft. Der Showroom war sehr minimalistisch und Kleiderstangen suchte man dort vergebens. Dafür gab es Schaufensterpuppen mit teils üppigen, teils gewagten Kreationen, Tische mit Stoffmustern und rundherum Videoleinwände, auf denen Models diverse Schnitte präsentierten. Erst im hinteren Teil des Ladens türmten sich die exklusiven Roben.
»Hast du alle Modelle hier, die wir besprochen haben?«, fragte Catherine.
Pascal sah sie mit gespielter Empörung an. »Natürlich, meine Hübsche. Aber glaub mir, du willst gar nicht wissen, was ich dafür alles machen musste.«
Amelia wollte es definitiv nicht wissen.
»Du bist ein Schatz«, hauchte Catherine ihmzu.
Das war er. Vor allem, weil er mit keinem Wort erwähnte, dass er seinen Laden inklusive Personal seit zwei Stunden sinnloserweise für sie beide geschlossen hatte.
Pascal schnippte zweimal mit den Fingern und eine seiner Assistentinnen eilte herbei. Sie schob einen Kleiderständer, der mit prachtvollen Roben bestückt war, vor sich her. Catherine grinste wie ein Honigkuchenpferd. In der Hinsicht war sie echt süß. »Gott, ich bin so aufgeregt«, entfuhr esihr.
»Ich auch«, erwiderte Amelia. Und es war nicht einmal komplett gelogen. Sie war tatsächlich neugierig, was für ein Kleid sich ihre Schwester aussuchen würde. Wie zu erwarten war, stachen Amelia haufenweise pudrige Farbtöne insAuge.
Catherine begutachtete den Berg an Kleidern. »Beginnen wir mit meinen Favoriten und arbeiten uns durch die Auswahl.«
Amelia ließ sich auf einen der samtigen Sessel sinken. »Klingt nach einemPlan.«
»Das hellblaue Marchesa.«
»Patricia«, sagte Pascal. Seine Assistentin holte das betreffende Kleid heraus und hängte es Catherine in die Kabine.
Ihre Schwester war auf der Suche nach einem Kleid für das Maturity Feast. Das Fest zu Ehren ihres einundzwanzigsten Geburtstags. Dem Tag, an dem sie ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden würde. Amelia fragte sich, was sie wohl veranstalten würde, wenn sie tatsächlich heiratete.
»Darf ich meinen Schönheiten ein Gläschen Champagner anbieten?«
»Gern!«, rief Amelia augenblicklich.
»Für mich nicht«, sagte Catherine. »Ich muss noch fokussiert sein. Und du solltest auch nicht zu viel trinken.«
Amelia nahm das Glas, das Patricia ihr entgegenhielt. »Ja, Mama.«
»Ich wünschte, du würdest das etwas ernster nehmen. Mir zuliebe.« Catherine verdrehte ihre Augen und verschwand in der Kabine.
Amelia wünschte sich, ihre Schwester würde das etwas weniger ernst nehmen. Nicht für Amelia, sondern ihr selbst zuliebe. Sie verstand nicht, wie sie sich so auf diesen Tag freuen konnte. Es war nichts falsch daran, sich auf seinen einundzwanzigsten Geburtstag zu freuen. Die meisten taten das jedoch, weil sie sich dann endlich offiziell betrinken konnten. Amelia würde es nächstes Jahr, wenn es bei ihr so weit war, auf jeden Fall ordentlich krachen lassen. Aber wegen dieser archaischen Zeremonie? Der Gedanke daran, potentielle Heiratskandidaten vorgestellt zu bekommen, rief bei Amelia Fluchtgedanken und Brechreiz hervor. Vorfreude sicher nicht. Aber Amelia betraf das ja auch nicht. Für jemanden mit so minderwertigen Gaben wie sie betrieb die SHS diesen Aufwand nicht. Zum Glück.
Für eine Superia mit Catherines Gaben wurden jedoch keine Kosten und Mühen gescheut, den perfekten Zuchtbullen zu ermitteln.
Die SHS, die Superior Human Society. Manchmal fragte sich Amelia wirklich, was das Human im Namen zu suchen hatte. Sie konnte an all dem nichts Menschliches finden. Und wenn man das Human wegließe, wäre man wieder direkt am Ursprung des Programms. Bei verqueren Ideologien und Rassenhygiene. Natürlich sprach man darüber nicht. Unschicklich.
Ob Amelia Catherines Euphorie nun verstand oder nicht, große Erwartungen führten unweigerlich zu großen Enttäuschungen. Und davor würde sie ihre Schwester zu gern bewahren.
Während Catherine in der Kabine mit Patricias Hilfe in Kleid Nummer eins schlüpfte, nippte Amelia an ihren Champagner. Besser. Viel besser. Der Vorhang zu Catherines Kabine wurde beiseitegeschoben und ihre Schwester trat in den Raum. Genau so hatte Amelia sich das Kleid der Wahl vorgestellt. Catherine sah aus wie eine Disney-Prinzessin – einfach grauenvoll.
»Und?«, fragte Catherine erwartungsvoll.
»Hinreißend«, sagte Pascal und meinte es vermutlich auchso.
»Zu viel von allem.« Amelia seufzte und ließ sich tiefer in den weichen Sessel sinken. »Nächstes Kleid.«
Prompt erntete sie empörte Blicke von allen Seiten.
»Das ist alles, was dir dazu einfällt?«, fragte Catherine.
Natürlich hätte Amelia noch mehr auf Lager. Nur würde nichts davon die Sache besser machen. »Ja, nächstes Kleid.«
Enttäuscht wandte sich Catherine an Pascal und kündigte an, was sie nun probieren wollte. Sie schlüpfte in eine Reihe weiterer Kleider, die für Amelia alle mehr oder weniger gleich aussahen.
»Was stimmt denn damit nun wieder nicht?«, fragte Catherine und blickte auf ihr Kleid hinab. Es hatte eine rosa Korsage und einen weißenRock.
»Was damit nicht stimmt? Du siehst aus wie ein Strawberry Cheesecake. Also ehrlich. Wenn ich ein Mann wäre, mich würde das in die Flucht schlagen.«
Catherine zog eine Schnute und betrachtete sich im Spiegel. »Du hast ja recht. Ich sehe aus wie eine Barbie und nicht wie eine Frau, die bald heiratet.«
Amelia erhob sich von ihrem Sessel und ging auf einen Kleiderständer zu, der nicht zu Catherines Auswahl gehörte. »Dann werden wir das Ganze mal etwas verkürzen.« Amelia zog ein rotes Kleid vom Ständer und hielt es Catherine hin. »Probier das malan.«
»Elli Saab«, murmelte Pascal, während Catherine das Kleid mit einem skeptischen Blick entgegennahm.
»Schau nicht so. Wir brauchen jetzt mal was ganz anderes, um das Richtige zu finden.«
Pascal stand in Denkerpose neben ihnen und Amelia musste ein Lachen unterdrücken. Schließlich ging es nur darum, ein Abendkleid auszusuchen. Die beiden taten gerade so, als ginge es um die Rettung der Welt. Mindestens. »Meine Hübsche – ich glaube, Amelia hat recht.«
Catherine gab sich geschlagen. Als sie wieder aus der Kabine kam, trat sie unsicher vor den Spiegel. Das Kleid war der Wahnsinn. Es bestand aus mehreren Lagen roten Chiffon. Dabei wirkte es nicht bauschig, sondern fließend. Über das eng anliegende Oberteil ragte asymmetrisch eine Lage Stoff über die rechte Schulter. Gegengleich dazu gab ein langer Schlitz die Sicht auf ihre langen, schlanken Beine frei. Pascal und Patricia starrten Amelias Schwester mit offenen Mündern an. Auch Catherine selbst stand ein stummes Wow ins Gesicht geschrieben. Sie raffte den Stoff mit ihren Händen und drehte sich vor dem Spiegel. Strahlend und mit ausgebreiteten Armen ging sie auf Amelia zu. »Ammy, du bist ein Genie«, sagte sie und drückte sie ansich.
»Ich weiß«, erwiderte Amelia trocken. »Aber das«, sie zeigte auf ihr Kleid, »ist es noch nicht.«
»Was? Spinnst du? Das Kleid ist atemberaubend.«
»Ich weiß, deshalb werde ich es auch nehmen.« Denn ob sie dieser Viehschau nun etwas abgewinnen konnte oder nicht, aussehen wie das Aschenbrödel wollte sie neben ihrer schönen Schwester nicht. »Es ist so gar nichtCatherine.«
»Du bist ein Miststück. Wenn ich nicht so gut erzogen wäre, würde ich dir jetzt eine scheuern.«
Die Münder der Zuschauer standen immer noch offen. Nun allerdings nicht mehr vor Begeisterung.
»Krieg dich wieder ein. Ich sage das nicht, weil ich dir das Kleid ausspannen möchte. Es ist die Wahrheit.«
»Die Wahrheit? Und vor fünf Minuten war die Wahrheit noch, dass ich andere Dinge ausprobieren soll.« Catherines Augen verengten sich zu Schlitzen.
Unbeeindruckt ging Amelia zurück zu dem Kleiderständer, von dem sie das rote Kleid geangelt hatte, und sondierte weiter die Auswahl.
Ein Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht, als sie das Kleid, dessen goldenes Funkeln sie angezogen hatte, zur Gänze erblickte. Zufrieden nickend zog sie es hervor. »Das ist es«, sagte sie und drückte es Catherine an die Brust. »Ja, genau. Das ist es, wonach ich gesuchthabe.«
Nur langsam wandte Catherine ihren Blick zum Spiegel. Ihre Miene hellte sich langsam auf, als sie das Kleid betrachtete. Amelia war klar, dass sie es nicht zugeben wollte, aber sie war sich sicher, dass sich ihre Schwester genau in diesem Augenblick in das Kleid verliebt hatte.
»Das rote Kleid steht mir hervorragend«, sagte sie. »Von wem ist dashier?«
Scheißegal.
»Oscar de la Renta«, antwortete Pascal prompt.
»Gut, ich schlüpfe mal schnellrein.«
Klar. Amelia kannte ihre Schwester. Einen Fehler zuzugeben, war nicht gerade ihre Stärke. Es war vermutlich auch schwer, wenn man so perfekt war wiesie.
Als Catherine die Kabine wieder verließ, wussten alle, dass sie das perfekte Kleid für sie gefunden hatten. Es war in A-Linie geschnitten und um die Brust herum mit groben Blattgold-Teilchen bedeckt. Diese dünnten nach unten hin immer weiter aus, bis nur noch der feine cremefarbene Tüllrock zu sehen war. Es hatte das besondere Etwas, war aber immer noch Catherine.
»Ich weiß«, grinste Amelia. »Ich bin ein Genie.«
Catherine strahlte verlegen bis über beide Ohren, antwortete aber nicht.
»Das werte ich als ein Ja.« Amelia wandte sich an Pascal. »Also, dann einmal den Traum in Gold für meine Schwester und das Rote fürmich.«
»Sehr gern«, antwortete er und nickte Patricia instruierend zu, die sich augenblicklich in Bewegung setzte.
»Und jetzt zieh dich wieder um, Schwesterherz. Ich habe noch was anderesvor.«
»Willst du dein Kleid gar nicht anprobieren?«, fragte Catherine.
»Nein, ich weiß, dass es mir passt und dass ich einfach umwerfend darin aussehen werde.«
»Amelia«, sagte Catherine in einem Tonfall, der nicht klar erkennen ließ, ob er tadelnd oder belustigtwar.
Amelia zuckte mit den Schultern. »Ich bin ein Genie. Schon vergessen?«
»Und ein Miststück.«
»Ich hab dich auch lieb«, sagte Amelia schmunzelnd.
Die ernste Miene ihrer Schwester verwandelte sich in ein Lächeln.
»Einigen wir uns auf geniales Miststück.«
Catherine legte ihren Kopf auf Amelias Schulter. »Ich hab dich auch lieb, Ammy.«
2
Amelia
Amelia hatte tatsächlich noch etwas vor. Nichts, worauf sie großen Wert legte, aber etwas, um das sie nicht herumkam. Die monatliche Untersuchung im Superior Medical Center.
Ein lästigesÜbel.
Die Status quo-Untersuchungen waren nicht schlimm. Blutabnahme, manchmal eine MRT. Aber die halbjährliche emotionale Disposition war grauenvoll. Man wurde verkabelt und bekam schreckliche Szenen in den Kopf projiziert. Alles, um einen emotionalen Ausbruch zu triggern, der dazu führte, dass sich die Schalter für neue Gaben in der DNA umlegten. Diese Tortur war kein Kino. Es waren nicht nur die Bilder voller Schmerz, Trauer und Erniedrigung, die in Gestalt von Folter, Vergewaltigung, Hunger, Verrat oder Verlust erschienen. Denn sie waren auf keiner Leinwand, sie waren im Kopf. Es fühlte sich an, als würde man all das selbst erleben. Auch wenn man wusste, dass es nur eine Illusion war, sie ging einem doch sehr nahe. Und die wenigen schönen Szenen von Glück, Liebe und Lust glichen den Rest bei Weitem nicht aus. Das Einzige, was dazu fähig war, ihre Gefühle danach wieder zu erden, war Gin Tonic.
Seit Amelia zum Studieren von New York nach Boston gezogen war, waren die Besuche im Medical Center allerdings um einiges angenehmer geworden. Der Grund dafür war männlich und gut aussehend. Normalerweise interessierte sich Amelia nicht für Superior-Männer. Optisch gab es an ihnen nichts auszusetzen, ganz im Gegenteil. Amelia hatte wohl noch nie einen unattraktiven Superior gesehen, gleich welchen Geschlechts. Ob das am guten Genmaterial lag oder am Geld, konnte sie nicht sagen. Mit genug Geld war es schließlich einfach, gut auszusehen. Die besseren Klamotten, die coolere Frisur – Stil und Erscheinungsbild waren nun einmal käuflich.
Was sie an den Superior-Männern jedoch störte, war ihre Sicht auf das Leben. Für Amelia war das, was sie führten, kein richtiges Leben. Sie alle folgten einer Mission, arbeiteten an einem Plan. Insofern war Amelia froh, dass niemand sie dort ernst nahm. Ihre Gabe war schließlich minderwertig. Nicht die Gabe an sich, aber deren Ausprägung. Sie konnte den Zweifel eines Menschen ausschalten. Allerdings funktionierte das nur mit Körperkontakt und die Wirkung verflog in der Regel, wenn sie ihn wieder unterbrach.
Verglichen mit anderen Superior, war das nicht von Bedeutung. Amelia konnte gut damit leben. Schließlich hieß es, dass man für sie nicht den perfekten Fortpflanzungskandidaten suchen würde und sie nicht das intensive Schulungsprogramm absolvieren musste. So neidisch sie auch manchmal auf die Gaben anderer Superior war – diesen Preis hätte sie nicht zahlen wollen. Sie war nicht der Typ für sowas.
Die SHS kam ihr manchmal vor wie eine Sekte. Nicht ganz unbegründet. Einerseits waren sie esoterische Spinner, mit dem Unterschied, dass ihre Spinnereien keine Spinnereien waren. Schließlich hatten sie all diese abgefahrenen Gaben. Aber sie diktierten ihren Mitgliedern unheimlich viel, mehr, als sich ein mündiger Mensch gefallen lassen sollte. Und in noch einem Punkt unterschieden sie sich von einer Sekte: Nicht nur ihre Anführer waren reich, sondern alle Superior waren es. Nicht einfach reich. Stinkreich. Ein Kinderspiel, wenn man mit seinen Gaben Menschen kontrollieren und steuern konnte. Die geistigen Fähigkeiten waren vermutlich deshalb auch am höchsten bewertet.
Die SHS war verdammt gut darin, jedem seinen Stellenwert zu zeigen. Sie taten das sehr direkt in Form eines Scorings, das die Gaben bewertete. Je höher, desto besser. Amelias Scoring als unterdurchschnittlich zu bezeichnen, wäre noch geprahlt. Ihre Gabe war wertlos für die SHS und somit auch sie selbst.
Amelia war ihr Scoring jedoch herzlich egal. Wenn sie sich etwas hätte aussuchen dürfen, wäre es eine körperliche Gabe oder eine Naturkraft gewesen. Teleportation hätte ihr gut gefallen. Oder ein Gewitter heraufbeschwören. Nicht weil man damit etwas anfangen konnte, sondern einfach, weil sie damit so viel Spaß gehabt hätte.
Leider konnte Amelia nichts von alldem. Und obwohl sie für die SHS so uninteressant war wie ein Stück Tofu für einen Löwen, bestellte man sie wieder und wieder hierher.
Ob sie das je wegen Sinnlosigkeit einstellen würden?
Man gewöhnte sich an vieles. Und vieles von dem, an das man sich nicht gewöhnen wollte, wurde durch Dinge, ohne die man nicht mehr leben möchte, kompensiert. Trotzdem, dieser Untersuchungsterror musste irgendwann ein Ende nehmen. Angeblich tat er das auch. Gerüchteweise.
Amelia blickte auf die verspiegelte Fassade des Medical Centers. Heute nur Status quo. NurBlut.
Hoffentlich.
Sie betrat das Gebäude durch die gläserne Drehtür, presste ihren Daumen auf das Touchpad der Schranke und passierte die erste Schleuse. Dort gab sie dem Wachmann ihre Tasche und durchschritt die Metalldetektoren. Die Sicherheitsmänner nickten ihr zu und gaben ihr ihre durchleuchtete Tasche zurück. Man kannte sich. Leider.
Während sie auf den Aufzug wartete, suchte sie bereits nach dem Termincode auf ihrem Handy. Was genau in welchem Stockwerk untergebracht war, wusste Amelia nicht. Sie hatte sich bisher nur im zehnten und elften Stockwerk aufgehalten. Was, wenn sie es sich genau überlegte, komisch war. Schließlich hatte bis in den neunten Stock – sofern man es ins Gebäude geschafft hatte – jeder Zutritt. In alle darüberliegenden Stockwerke gelangte man nur über den Scan des Termincodes imLift.
Der Scanner quittierte ihren QR-Code und brachte sie in den zehnten Stock, in dem ihr Termin stattfinden sollte. Glücklicherweise. Zehnter Stock hieß üblicherweise Blutabnahme.
Die Fahrstuhltür öffnete sich, ein Sicherheitsbeamter wartete dort im Flur auf sie. Er nickte ihr zu und geleitete sie zur mittleren Tür, die von Schwester Greta geöffnet wurde.
Sie lächelte. Wie eigentlich immer. Es war dieses unheimliche Lächeln, das stark an die Hausfrauen von Stepford erinnerte. Amelia versuchte sich vorzustellen, wie Schwester Greta jemandem die Nachricht vom Tod eines Familienmitglieds überbrachte. Wie sie auch dabei ihr emotionsloses, gruseliges Lächeln aufsetzte. Gut, dass das hier keine gewöhnliche Klinik war. Man wurde untersucht. Nicht behandelt oder operiert.
»Amelia«, begrüßte Schwester Greta sie. Der Klang ihrer Stimme war gewohnt sachlich, ganz anders, als man bei ihrem Erscheinungsbild erwarten würde. Doch er passte hervorragend zum kühlen Platinblond ihrer Haare.
»Greta«, erwiderte Amelia, während der vertraute Geruch von Desinfektionsmittel in ihre Nase drang.
Greta schritt den Flur voran und brachte Amelia in das Wartezimmer. »Setz dich doch schon einmal. Ich bin gleich wieder beidir.«
Eine vertraute Unruhe machte sich in ihr breit. Amelia zog ihr Handy aus der Tasche und checkte mithilfe der Frontkamera Haare und Make-up.
Er würde sie nicht untersuchen, aber mit etwas Glück würde sie ihn sehen.
Nathan
Nathan blickte von seinem Computer auf, als er das Piepsen von Schwester Gretas Smartphone vernahm, die ihre nächste Blutabnahme ins System einbuchte. Er blickte auf sein Handy, das sich nun ebenfalls zu Wort meldete. Einerseits hasste er diese Dinger. Andererseits war er froh, dass sie für ihn Superior-Termine und -Pflichten koordinierten. So musste er keine unnötigen geistigen Kapazitäten dafür verschwenden und hatte seinen Kopf frei für die wichtigen Dinge.
»Schwester Greta«, sagte er. »Bitte bringen Sie mir direkt nach der Blutabnahme zwei Röhrchen von Amelia Zephyrs Blut und die Befunde, sobald sie aus dem Labor kommen.«
»Selbstverständlich, Dr. Hall.« Sie blickte auf ihre Armbanduhr. »Aber ich fürchte, es wird morgen werden.«
»Heute, Greta. Heute.«
Es war ihrem erstarrten Lächeln deutlich abzulesen, wie wenig sie von dieser Anweisung hielt. »Aber …«
»Sie schaffen das. Lassen Sie einfach Ihren Charme spielen.« Nathan achtete nicht auf Gretas Reaktion, sondern vervollständigte die Einträge in der Akte, die er vor sich offen auf dem Bildschirm hatte.
Die Tür zum Behandlungszimmer öffnete sich und Schwester Greta kehrte mit Amelia im Schlepptau zurück.
Amelia hob ihre Hand, deutete ein leichtes Winken an. Während sie die Türklinke noch festhielt, bog sie ihren Körper so, dass ihre Kurven wunderbar zur Geltung kamen, und schenkte ihm ein Lächeln. Wie eine Welle schwappte es von ihr durch den gesamten Raum, überflutete ihn mit ihrer Präsenz.
Nathans Aufmerksamkeit war nun ganz beiihr.
»Oh, Dr. Hall«, sagte Amelia spöttisch. »Hat die SHS gerade einen Personalengpass oder wie komme ich zu der Ehre, heute von dir Blut abgenommen zu bekommen?«
Dieses kleine Miststück. Er zog seine Brauen nach oben. »Träum weiter.«
Sie verzog ihren Mund zu einer Schnute, löste ihren Körper geschmeidig von der Tür und sah ihn herausfordernd an. »Stimmt. Ich vergaß. Du übernimmst nur Untersuchungen, bei denen ich mich nackig machenmuss.«
Nathan betrachtete Amelia, wie sie mit ihm flirtete, das Spiel, das sie spielten.
Alles daran war falsch. Und trotzdem genoss er ihre Gegenwart.
Sie zog ihn in ihren Bann. Ihre Ausstrahlung, ihr Sexappeal, es war schwer, sich dem zu entziehen. »Irgendwer muss sich ja opfern.«
Sie lachte auf, während Schwester Greta die Spritzen bereitstellte und so tat, als würde sie nicht zuhören.
Nathan schüttelte Amelia die Hand. Er achtete darauf, nicht näher als nötig an sie heranzutreten und ihre Hand nicht länger als nötig zu halten. »Ich melde mich bei dir, sobald die Ergebnisse dasind.«
»Irgendwer muss sich ja opfern.«
Nathan verließ den Raum und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Mit gemischten Gefühlen machte er sich auf den Weg in das Büro von Dr. Erika Jensen. Er hatte gute Nachrichten, schlechte Nachrichten und Themen, bei denen sie wohl verschiedener Meinung sein würden. Nur zu gern hätte er dieses Gespräch vertagt, doch es stand ihm nicht zu, ihre Termine zu hinterfragen. Er klopfte zweimal an Erikas Tür. Sie antwortete nicht. Er öffnete die Tür einen Spalt und sah hinein, ihr Büro warleer.
Merkwürdig. Erika war die Pünktlichkeit in Person. Noch nie hatte er erlebt, dass sie zu spät war, und das trotz ihrer Position. Er wollte gerade wieder die Tür schließen, als sie kam. Nathan hatte sie weder kommen noch gehen hören – diese Frau konnte sich beinahe übermenschlich leise anschleichen -, doch ihr Parfüm hatte sie verraten. Unaufdringlich, schnörkellos, frisch und ein Hauch maskulin. Ganz wie sie selbst. Er ging einen Schritt zur Seite, damit sie das Büro vor ihm betreten konnte.
»Nathan«, sagte sie. »Tut mir leid, wir müssen unseren Termin vertagen.«
»Dasist …«
»Der Rat hat eine Sitzung einberufen, zu der meine Anwesenheit erwünscht ist.« Sie schnaubte leise, während sie einige Akten auf ihrem Schreibtisch zusammensuchte. Erika war eine der wenigen im Center, die eine Vorliebe für Papier hatte. Dabei war sie, genau wie Nathan, gerade einmal vierundzwanzig.
»Gab es einen Zwischenfall, Erika?«
Sie sah ihn stirnrunzelnd an. »Nicht, dass ich wüsste.«
»Dann …«
»Dann bringen Sie mich auf dem Weg zum Fahrstuhl auf den aktuellen Stand unserer beiden Sorgenkinder.«
Beide verließen ihr Büro. Das Tempo, in dem sich Erika auf dem Gang zum Lift hin bewegte, war nicht gerade ideal zum Plaudern. Nathan kam das durchaus gelegen, seine Lust dazu hielt sich nämlich in Grenzen.
»Die Untersuchungsergebnisse von Dave sind meines Erachtens widersprüchlich«, begann Nathan gehetzt seine Ausführungen. »Anhand der DNA-Analysen konnte keine Veränderung zum letzten Status quo festgestellt werden. In der MRT allerdings konnte ich mit intensiveren Tests kleine Abweichungen feststellen. Ob diese jedoch auf einen Sprung hindeuten, ist fraglich. Ich könnte weitere …«
»Nein«, unterbrach sieihn.
»Aber es gibt vieles …«
»Nathan«, fiel sie ihm ins Wort. »Ich möchte nicht, dass Sie Ihre kostbaren Kapazitäten für solche aussichtslosen Fälle verschwenden.«
»Wirklich?« Das würde ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
Erika hob ihre Brauen und deutete ihm damit an, dass die Diskussion beendet war. »Und Amelia Zephyr?«
»Ist meines Erachtens auch ein Fall für die Kategorie aussichtslos.« Nathan versuchte seine Worte so teilnahmslos wie möglich klingen zu lassen.
Erika, die gerade am Lift angekommen war, drehte sich zu Nathan um und baute sich dominant vor ihm auf. »Das entscheide immer noch ich. Und Amelia Zephyr ist es nicht. Also, was gibt es Neues?«
»Sie gibt in ebendiesem Augenblick eine weitere Blutprobe ab. Ich würde meine Erkenntnisse dann nach den DNA-Untersuchungen mit Ihnen teilen.«
Erika Jensen musterte ihn mit zusammengekniffenen Lippen.
»Wenn Sie nichts dagegen haben«, sagte Nathan und hoffte, die sich gerade öffnende Fahrstuhltür würde das Gespräch beenden.
»In Ordnung. Parker wird einen neuen Termin mit Ihnen vereinbaren.« Sie betrat den Aufzug, wandte sich kurz noch einmal zu Nathan um und nickte knapp.
Etwas behagte ihm an dieser Sache nicht. Er hatte das Gefühl, dass er etwas Entscheidendes übersah. Und er wollte herausfinden, was das war. Warum sollte Dave ein aussichtsloser Fall sein und Amelia nicht? Dave war sogar ein wenig jünger als Amelia und ihre Scorings waren durchaus vergleichbar.
Abgesehen davon – er war von der Praxis der emotionalen Disposition im Allgemeinen nicht wirklich überzeugt. Sie lieferte wenig Ergebnisse, verursachte großen Aufwand und war auch für die Patienten nicht gerade angenehm. Es musste andere Wege geben, die Gaben zu aktivieren. Er hasste es, jedes Mal mundtot gemacht zu werden, wenn er das Thema anriss. Und jetzt auch noch diese irrationalen Fallklassifizierungen. Er würde sich noch Gehör verschaffen. Wenn nicht bei Erika, dann eben an anderer Stelle.
Eine Berührung riss ihn aus seinen Gedanken. Jemand hatte ihm auf die Schulter getippt.
Er wandte sich um und da war sie wieder. Seine Ablenkung vom Alltag im SMC. Amelia.
»Oh, Dr. Hall, wäre doch nicht nötig gewesen, dass Sie hier auf mich warten und sich vergewissern, dass ich beim Blutabnehmen nicht umgekipptbin.«
»Frauen wie du kippen nicht so leichtum.«
»Keine Ahnung, ob das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung war. Aber ich kippe gleich um, wenn ich nicht endlich zu meinem Frühstück komme«, sagte sie und stemmte dabei ihre Hände in die Hüften.
Nathan blickte auf die Uhr. »Frühstück? Es ist vierzehnUhr.«
»Die erste Mahlzeit des Tages, also definitiv Frühstück.« Amelia hatte ihren Mund leicht geöffnet und fixierte ihn mit ihren warmen braunen Augen. »Und was ist mit dir? Hunger?«
Er sah sie an, wie sie sich ihre Lippen benetzte. Er war Amelias Arzt! Er sollte sie nicht so ansehen. Es war nur so verdammt schwer, es nicht zu tun. »Ich habe schon gefrühstückt.«
»Ich hatte auch eher an ein saftiges Stück Fleisch gedacht.« Amelia fuhr sich mit den Fingerkuppen über ihr Schlüsselbein und sendete ihm schwer zu ignorierende Signale.
Es wäre so viel einfacher, wenn sie das lassen würde.
»Ein Steak.«
In seinem Inneren drohte eine Diskussion zu entflammen, der er sofort den Nährboden nehmen musste.»Dann würde ich an deiner Stelle schnell das Weite suchen. Die Cafeteria hier ist nämlich keine Offenbarung.«
»Ja, klar! Als würde ich hier freiwillig meine Freizeit verbringen.«
Was ist so schlimm an einem Frühstück? Nichts. Doch wenn er sie ansah, dann wusste er tief in seinem Inneren, dass er eigentlich nicht mit ihr frühstücken wollte. Viel lieber wollte er ihr die Bluse aufknöpfen, ihre wunderschönen Brüste berühren und sie … Doch das wäre unprofessionell. Hochgradig unprofessionell. Und wenn Nathan Hall irgendetwas nicht war, danndas.
Abgesehen davon musste er einen klaren Kopf bewahren. Seine Triebe waren hier zweitrangig. Um mehr ging es ihm bei ihr auch nicht. Ihr Körper war das Einzige, was ihn an Amelia Zephyr reizte. Sie war nicht der Typ Frau oder gar Mensch, mit dem er für gewöhnlich seine Freizeit verbrachte. Aber wenn sie nicht seine Patientin wäre, würde er sie auf der Stelle vögeln.
Amelia
Dieser Mann trieb sie noch in den Wahnsinn. Was war das denn heute wieder für ein Auftritt? Dr. Hall & Charming Nathan. Manchmal hatte sie wirklich das Gefühl, dass Nathan einen charmanten Zwilling hatte, der gelegentlich seine Identität annahm. So wie bei der Untersuchung letzten Monat. Bei der emotionalen Disposition, beim vollen Programm.
Es war kindisch, total bescheuert und wie Catherine wohl sagen würde, Teil ihrer selbstzerstörerischen Vorlieben, so zu denken. Aber so schrecklich die emotionale Disposition auch war, sie sehnte sich nach dem Nathan, der sich ihr immer dann zeigte. Es waren diese kleinen Gesten, die Vertrautheit, die zwischen ihnen herrschte. Das alles entschädigte nicht für die Qualen der Untersuchung, für die grauenvollen Bilder, die man ihr durch den Kopf jagte, für die Albträume, die sie mit sich brachten, und für die Tränen, die sie zutage beförderten.
Aber es tat gut. Und jedes Mal, wenn sie Nathan sah, wünschte sie sich nichts sehnlicher als dieses Gefühl, das er ihr gab … wenn er sein charmanter Zwilling war. Einfach alles, was er danntat.
Wie er ihre Hand nahm, wenn er sie in den Raum führte. Wie er dicht hinter ihr stand, wenn sie dort ankamen. Das Gefühl seines Atems auf ihrem Hals. Wie er ihr half, den Untersuchungskittel auszuziehen. Die Art, wie er langsam mit einer Hand die Schleife löste und behutsam das Hemd über ihre Schultern streifte, bis es von selbst zu Boden fiel, seine Hände jedoch wärmend auf ihrer fröstelnden Schulter verweilten.
Wie er ihr zärtlich von oben nach unten über ihre Wirbelsäule strich, entlang ihres Reißverschluss-Tattoos. Wie er es verspielt mit seinen beiden Zeigefingern nachfuhr, als würde er ihn öffnen. Wie er sie an seinen Oberkörper drückte, wenn sie mit der Untersuchung fertig waren. Ihr über die Haare strich. Ihr mit seinen Fingerspitzen die Tränen aus dem Gesicht wischte. Entlang ihres Tattoos den imaginären Reißverschluss wieder schloss. Und dann, bis sie sich wieder beruhigt hatte, einfach nur hinter ihr stand und mit ihr im selben Rhythmus atmete.
Für eine einfache Blutprobe war der charmante Nathan wohl leider nicht zu haben. Und leiden, um einen Kerl zu bekommen? Das war erbärmlich. Amelia würde sich eher die Hand abhacken als so tief zu sinken.
Gedankenverloren lag sie auf ihrem Bett und starrte zur Decke, die sie aus einer Laune heraus hatte blutrot streichen lassen. Es klopfte leise an ihrer Tür, und noch bevor sie herein gesagt hatte, öffnete sie sich einen Spalt und Catherine lugte hindurch. »Stör ich?«, fragtesie.
Amelia schüttelte den Kopf und klopfte neben sich aufsBett.
Augenblicklich schlüpfte Catherine durch die Tür und ließ sich neben ihr nieder. »Allesklar?«
»Klar«, murmelte Amelia. »Und beidir?«
Beide starrten zur Decke. »Klar.«
»Hast du dich um das Video gekümmert?«
»Ja«, sagte Catherine abwesend.
Wenn eines klar war, dann, dass nichts klar war. Und beide wussten, dass sie nicht darüber reden würden.
»Cathy«, setzte Amelia an. »Wir werden uns heute so richtig betrinken.«
»Ich weiß nicht.«
Amelia blickte auf den Boden. Neben ihrem Bett türmten sich ihre getragenen Kleider der letzten Wochen. Irgendjemand sollte hier dringend wieder mal aufräumen. »Ich schon.«
Catherine drehte ihren Kopf zur Mitte und sah Amelia an. »Habe ich eineWahl?«
»Nein.« Amelia lachte. »Und es wird lustig.«
»Wenn du meinst.«
»Und ab Mitternacht darfst du uns sogar ganz legal Drinks kaufen.«
»Drinks kaufen«, prustete Catherine. »Seit wann kaufst du dir denn selber Drinks?«
»Auchwahr.«
»Außerdem«, Catherine schmunzelte. »Ich habe Angst, dass dir der fehlende illegale Kick fehlt und du mir dann mit deiner schlechten Laune meinen Geburtstag ruinierst.«
Amelia knuffte ihr mit dem Ellbogen in die Seite. »Ich freumich.«
»Ich mich auch – merkwürdigerweise.«
»Ich dachte schon, du feierst mit deinen Freundinnen.«
»Morgen Abend. Es wird so eine Art Birthday Maturity Shower Party.«
»Klingt widerlich«, sagte Amelia. »Gut, dass du heute Abend noch einmal mit mir feiern gehst, bevor dein Leben morgen vorbeiist.«
»Mein Leben ist nicht vorbei. Es beginnt ein neuer Abschnitt. Einer, auf den ich mich schon seit vielen Jahren freue.«
»Wie aus dem Werbeprospekt.« Ausgesprochen klangen die Worte nur halb so verächtlich, wie Amelia sie empfand.
Catherine nahm Clifford, den alten weißen Stoffhund, von Amelias Bett in die Hand und warf ihn ihr an den Kopf. »Hör auf damit.«
»Der arme Clifford.« Amelia nahm den Hund, der neben ihr lag, und legte ihn auf ihre Brust. Clifford war eigentlich Catherines Hund gewesen. Als Amelia zu den Davis’ kam, hatte sie ihn ihr geschenkt. Amelia war damals vierzehn und Catherine fünfzehn, und damit dem Stofftieralter schon entwachsen. Aber Clifford war Catherines Schmusetier aus Kindertagen. Sie sagte Amelia, dass er ihr immer geholfen hatte, wenn sie traurig war, und er ihr bestimmt auch helfen würde. Amelia fand das zuerst total kindisch. Erst als sie gemerkt hatte, wie viel Clifford Catherine bedeutete, kam das Geschenk wirklich an. Es war nicht der Hund. Es war die liebe einer Schwester, die Amelia mitten ins Herztraf.
Sie blickte Catherine fest in die Augen. »Cathy, versprichst du mir etwas?«
»Ja«, antwortete sie, ohne zu zögern.
»Wähle deinen Aspiranten nicht aufgrund des Scorings. Hör auf dein Herz und nimm den, für den es am heftigsten schlägt.«
Catherine nickte, doch es wirkte gequält.
»Wirklich, versprich es. Ich will nicht, dass du dich unglücklich machst, indem du den wählst, für den der Algorithmus dir Nachkommen mit den höchstgescorten Gaben ermittelt. Es sollte der sein, der dir weiche Knie verursacht. Der, dessen Nähe dich nervös macht und bei dem dein Herz zu flattern beginnt, wenn er dich berührt.«
»Wieso ist dir das so wichtig?«, fragte Catherine stirnrunzelnd.
»Weil du meine Schwester bist.« War es denn so schwer zu verstehen? Amelia wollte doch nur, dass ihre Schwester glücklichwar.
Catherine lächelte matt. »Ich werde es versuchen.«
»Versuchen?«
»Ich kann es dir nicht versprechen, das weißt du. Aber ich werde es versuchen.« Sie sah sie ernst an. »Versprichst du mir auch etwas?«
»Was?«, fragte Amelia.
»Hör auf, so zu leben, als wäre dein Leben nichtswert.«
»Aber …«
»Lass mich ausreden«, unterbrach Catherine sie. »Ich weiß, du sagst, du hast Spaß am Leben und machst, was du willst. Aber so wie du lebt jemand, der schwer krank ist und nicht mehr lange hat. Niemand, der eine Zukunft für sich sieht – eine gute und lebenswerte –, verhält sich so wiedu.«
Catherine verstand Amelias Art zu leben nicht, das hatte sie nie. Und umgekehrt konnte Amelia Catherines Sichtweise nicht immer nachvollziehen. Es lag wohl daran, dass beide so unterschiedlich aufgewachsen waren. Bevor Amelia zu ihrer Pflegefamilie kam, war ihr Leben nun einmal verdammt anders gewesen als das der behüteten Catherine. Das ließ sich nicht abstreifen wie ein Kleidungsstück. Es war ein Teil vonihr.
»Ich werde es versuchen«, sagte Amelia und presste Clifford, der immer noch auf ihrer Brust lag, fest ansich.
Catherine drückte ihre Hand und beide wussten, wie wenig ihre Versprechen wert waren.
3
Erika
Erika stand am Fenster ihres Büros im vierzehnten Stock mit Blick auf die Bostoner Waterfront. Sie mochte diese Ecke der Stadt. Mittags saß sie dort gern auf einer Bank, sah aufs Wasser und aß ein Sandwich. Zumindest an den Tagen, an denen sie nicht vergaß zu essen. Oft gab es einfach wichtigere Dinge, die ihren Einsatz forderten. Erika hatte ihre Stirn an die kühle Scheibe gepresst und ließ die Lichter der Straße langsam vor ihrem geistigen Auge verschwimmen. Das Xyto, das sie vor ein paar Minuten mit ihrem Briefbeschwerer klein gemahlen und geschnupft hatte, begann langsam zu wirken. Sie liebte diese Droge. Sie selbst hatte sie mit vierzehn Jahren, während eines nicht enden wollenden Sommers, entwickelt.
Xyto war fantastisch. Es trug alles, was das Leben schwer machte, fort und ließ nur Leichtigkeit zurück. Und es machte unfassbar wach und aufnahmefähig. Sie hatte ihre bedeutendsten Arbeiten unter Einfluss von Xyto erzielt, und das Beste daran war: Das Down-Gefühl, wenn die Wirkung nachließ, war ein anderes. Man fühlte sich einfach nur müde und schlapp. Andere Amphetamine waren in diesem Punkt die Hölle. Insofern machte Xyto auch nur bedingt abhängig.
So ganz ohne konnte Erika nie, dazu lastete zu viel Druck auf ihr, den sie loswerden musste. Ihre Gabe des Emotionstausches konnte sie schließlich nur selten dazu nutzen, um sich eine positive Emotion anzueignen und eine negative abzugeben. Zumindest offiziell nicht.
Aber immerhin hatte ihre Gabe dazu beigetragen, dass der Senat in D.C. deregulierende Entscheidungen getroffen hatte, die der SHS und ihren Mitgliedern weitreichende finanzielle und administrative Privilegien sicherte. Diese Erfolge hatten Erika innerhalb der SHS eine gewisse Sonderstellung verschafft, die sie nicht missen wollte. Ein Zuckerschlecken waren ihre Einsätze allerdings nicht. Und ohne Xyto wäre sie in diesen für sie emotional intensiven Phasen zugrunde gegangen. Aber es gab auch Zeiten, in denen sie die Dosis herunterfuhr.
Für Erika war es wie ein Zaubertrank, und immer wenn sie es herstellte, kam sie sich ein klein wenig wie eine Druidin vor. Natürlich teilte sie ihr Geheimnis nur mit wenigen. Xyto gehörte ihr. Sollten sich die anderen klugen Köpfe doch etwas Eigenes entwickeln. Die Forschungen, die sie interessierten, ließ der Superior-Rat schließlich auch links liegen. Und warum sollte sie Leuten helfen, die sie selbst ausbremsten?
Erika ging zu ihrem Schreibtisch und fuhr ihren PC herunter. Anschließend verschloss sie alles, was sich auf dem Schreibtisch befand, in ihrem Rollcontainer. Sie wusste, dass es etwas Zwanghaftes hatte, doch das Büro zu verlassen, ohne alles sauber zu hinterlassen, schaffte sie nicht.