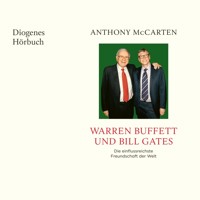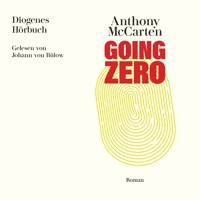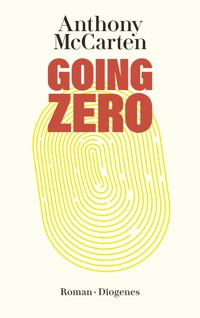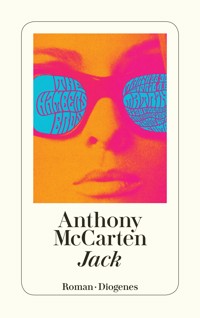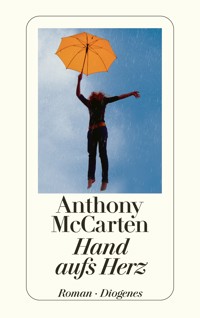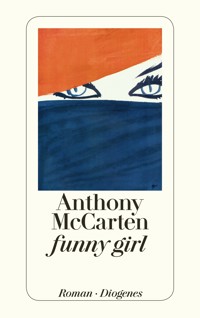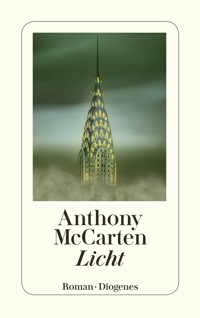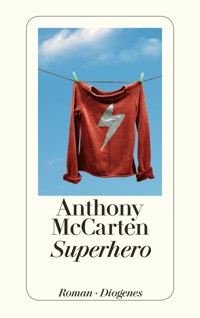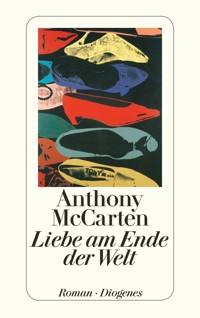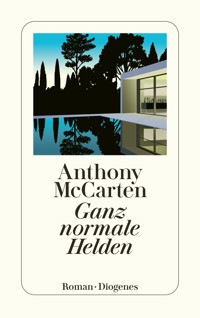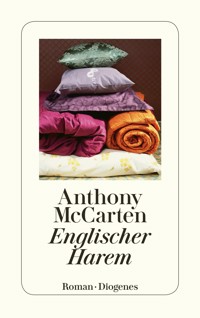
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau zu ihren Eltern, untere Mittelschicht im Londoner Vorort: »Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Ich heirate, die schlechte: Er ist Perser. Und übrigens: Er hat bereits zwei Frauen.« So beginnt ein provozierender Roman über Heimat, Kochen und die Faszination des Fremden … und eine Liebesgeschichte wie keine andere – für diese Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Anthony McCarten
Englischer Harem
Roman
Aus dem Englischen von
Manfred Allié
und Gabriele Kempf-Allié
Titel der 2001
als Vintage Book bei
Random House, Neuseeland, und 2005 bei
Alma Books Limited, Richmond/Surrey, England,
erschienenen Originalausgabe:
›The English Harem‹
Copyright ©2001, 2005 by Anthony McCarten
Die deutsche Erstausgabe erschien 2008
im Diogenes Verlag
Die vorliegende Übersetzung basiert
auf einer revidierten Fassung des Romans
Covermotiv: Foto von Patrik Engquist (Ausschnitt)
Copyright ©Patrik Engquist/ Etsa/Corbis/Dukas
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright ©2020
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23940 9
ISBN E-Book 978 3 257 60325 5
[7] Noch eh es Priester gab, vor langer Zeit,
Die Männer hatten oft mehr als ein Weib.
Die Saat empfing nicht nur ein Schoß allein,
Kein Mann verdammt, nur einer treu zu sein…
John Dryden (1631–1700)
Ach könnten wir dem Schicksal uns verbünden,
Mein Herz, den Lauf der Dinge zu ergründen,
Wir würden ihn zerschlagen – und alsdann
Neu formen, doch wie wir es wünschen!
[8] Ich danke Firouzeh Afsharnia und Sassan Saatchi, dass ich mir ihre Namen für zwei Figuren in diesem Buch ausborgen durfte, und dafür, dass sie ihre Geistesblitze und unverwechselbar persischen Geschichten mit mir teilten.
[9] Der Lauf der Dinge
Um sich die öde Arbeit angenehmer zu machen, ließ Tracy sich vom Rhythmus ihrer Scannerkasse gern in Tagträume wiegen.
Sie schob Artikel um Artikel über das Lesegerät – blip… blipblip… blip… blipblip – und ließ ihrer Phantasie freien Lauf, und dabei verlor sie sich immer mehr in ihrem Spiel.
Sie vertrieb sich gern die Zeit damit, dass sie in Gedanken die mürrische, missmutige Vorstadtkundschaft im Sainsbury-Supermarkt von Tooting durch Berühmtheiten aus Geschichte, Film, Fernsehen und Literatur ersetzte. An diesem Morgen hatte sie bereits Johanna von Orléans, Lawrence von Arabien, Prinzessin Leia und Omar Sharif bedient. Diese Phantome tauchten ganz unvermittelt in ihren Kostümen zwischen den gewöhnlichen Kunden auf; sie zogen ihre antiken Brieftaschen, Geldkatzen und Portemonnaies aus Spitzenkleid, Pantalons und Burnus und bezahlten mit Sovereigns, Dukaten, Dublonen und Dinaren, bis es einfach irgendwann zuviel für Tracy wurde. Sie musste ihre Kasse schließen, um am Trinkbrunnen aus der hohlen Hand hastig ein paar Schluck Wasser zu trinken – nachdem sie sich zuvor noch bei einer Scheherazade aus Tausendundeiner Nacht entschuldigt hatte. Doch kaum war sie zurück, ging das verrückte Spiel weiter. Genau genommen musste sie [10] diese Gespenster gar nicht mehr heraufbeschwören. Mittlerweile kamen sie von ganz allein: Lord Byron in albanischer Tracht, Julia Roberts in Kostümen aus diversen Rollen, Cat Stevens – ihr Lieblingssänger –, so wie er 1966 auf dem Cover von Matthew and Son ausgesehen hatte, Laurence Olivier als Heathcliff und Johnny Weissmüller als Tarzan – die letzteren beiden natürlich in Schwarzweiß.
Mitten in einer solchen Prozession, genauer gesagt als sie die Einkäufe von Königin Elisabeth I. einscannte, blip… blipblip, geschah das Unvermeidliche: Die Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit verschwamm, und als Ihre Königliche Hoheit eine Packung Mandeltörtchen in die Handtasche gleiten ließ, ohne dafür zu bezahlen, wandte Tracy diskret den Blick ab. Beim Hinausgehen griffen Ladendetektive die alte Frau auf und brachten sie in den Supermarkt zurück, wo sie dann die Handtasche ausleerte, ihre Adresse angab und weinte.
Bei Tracys Entlassungsgespräch wurde das Beweismaterial vorgespielt. Deutlich sah man, wie eine gebeugte Rentnerin die Törtchen unbeholfen in eine Stofftasche mit Bambusgriffen stopfte, und wie Tracy keinerlei Versuch unternahm, sie daran zu hindern. Aber wie hätte sie auch erklären sollen, dass sie geglaubt hatte, es sei ihre Untertanenpflicht, dass sie bei der Herrscherin ein Auge zudrückte?
»Sie haben mal wieder geträumt, geben Sie es doch zu«, sagte ihr Chef, der auf der Schreibtischkante thronte, auf sie herabsah und den Betroffenen mimte. »Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie sich nicht selbst bemühen, Trace. Wo um Himmels willen waren Sie mit Ihren Gedanken?«
[11] Unter seinem herausfordernden Blick sackte sie wie jedes Mal in sich zusammen. Sie hatte nichts zu ihrer Verteidigung vorzubringen. Er seufzte tief. Sie sei ein nettes Mädchen, sagte er, aber was könne er tun? Ihm seien die Hände gebunden. »Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze.« Sein Fuß streifte ihre nackte Wade. Ein Zufall? Sie musste wegsehen.
Sie sei fleißig und zuverlässig, fuhr er fort, und habe die Preise der Waren gut im Kopf, besser als jede andere. Doch wenn sie den Vorfall nicht erklären könne, müsse man sich leider von ihr trennen.
Aber Tracy bekam den Mund nicht auf, sie hing weiter ihren Gedanken nach.
»Tracy? Ich warte. Trace? Hören Sie mir überhaupt zu?«
Doch es war zu spät: Sie war längst außer Reichweite für ihn.
»Tracy!«
Sie erinnerte sich nicht einmal, wie sie aus dem Supermarkt gekommen war. Sie nahm den Bus nach Hause. Und auf dem Weg in den Osten der Stadt, zum vierten Mal arbeitslos binnen zwei Jahren, berührte ein Sonnenstrahl ihre Schulter. Sie reckte den Hals und drehte das Gesicht in die Sonne. Wärme durchströmte sie. Als sie aus dem langen Tagtraum, in dem sie selbst die Rolle der Heldin spielte, erwachte und in die Wirklichkeit zurückkehrte, spürte sie eine ganz und gar grundlose Zuversicht.
Die Waschmaschine schaltete mit einem Klick in den Schleudergang und ließ die gesamte Wohnung erzittern, Teetassen und Aschenbecher und draußen auf dem Balkon Erics Kisten mit verrosteten Motorradteilen. Nur der [12] Himmel kannte die Zahl der Wohnungen unter ihnen, die von dieser klapprigen Maschine in Schwingungen versetzt wurden. Als inoffizieller Hausmeister wusste Eric nur zu genau, dass das Gebäude mit seinen dreiundzwanzig Stockwerken vibrierte wie eine Stimmgabel.
Eigentlich hatte er sich vorgenommen, der Waschmaschine an diesem Nachmittag endlich die Launen auszutreiben, aber dann hatte er sich doch wieder verzettelt.
Die Bedienungsanleitung einer anderen Waschmaschine, die er schon vor drei Jahren ausrangiert hatte, hielt ihn völlig gefangen, und er war immer noch ganz in die vergilbten Seiten vertieft, als die Wohnungstür aufging.
»Die haben mich rausgeschmissen, die Scheißkerle«, verkündete seine Tochter theatralisch und schleuderte ihren Rucksack in die Ecke, als koche sie vor Wut. »Unüberbrückbare Differenzen.«
Aber Eric hob nicht einmal den Kopf. »Ach je«, murmelte er.
Tracy war klar, dass er nicht zugehört hatte. Sonst hätte ein so überängstlicher Vater wie er anders reagiert.
»Nicht zu fassen ist das. Dad? Hörst du mir überhaupt zu? Dad? Ich bin rausgeflogen. Die haben mich vor die Tür gesetzt.«
»Wer?« Eric hob den Kopf.
»Wegen charakterlicher Unvereinbarkeit. Aber ist schon in Ordnung. Ich hatte sowieso die Nase voll.«
Jetzt endlich zeigten sich erste Anzeichen von Besorgnis auf seinem Motorradfahrergesicht, gerötet vom jahrzehntelangen schnellen Fahren bei geöffnetem Visier, Jahren, in denen er es, vom Gegenwind gepeitscht, mit riesigen [13] Lastwagen aufgenommen hatte. »Die haben doch gar keinen Charakter. Wie kann er da unvereinbar sein?«
»Ist ja auch egal. Jedenfalls bin ich gefeuert.«
Zwei Dinge gab es, die wirklich wichtig waren in Eric Pringles Leben: sein Wohlergehen und das seiner Tochter, allerdings in umgekehrter Reihenfolge.
Tracy kam für Eric immer zuerst, sein eigenes Wohl hing unmittelbar von ihrem ab. In den letzten Jahren hatte er sich wegen dieser allzu großen Nähe – einer Folge seiner Arbeitslosigkeit vielleicht, von zu viel Freizeit – allerhand Kritik eingehandelt. Freunde hatten ihm gesagt, diese Affenliebe sei die Ausrede dafür, dass er selbst nichts unternehme. Er könne nicht von anderen erwarten, dass sie sein Leben stellvertretend lebten, schon gar nicht von einem Kind. Er habe sein eigenes Leben vernachlässigt, habe es verrosten lassen wie seine Motorräder.
»Was ist denn passiert?«
»Keine Ahnung. Die haben mich rausgeschmissen. Zack. Einfach so.«
»Wieso? Was hast du denn gemacht?«
Ihre Antwort war wohlüberlegt. »Nichts habe ich gemacht.« Das war die reine Wahrheit, und sie wollte ihren Vater nicht noch mehr aufregen. Sie wusste, wie leicht ihn etwas umwarf. »Halb so schlimm. Ist sogar besser so. Ich finde schon was anderes, mach dir keine Sorgen. Gleich heute Nachmittag ziehe ich los und suche mir einen neuen Job.«
Sie musste ihrem Vater sagen, dass er sich keine Sorgen zu machen brauchte. Immerhin war er ein Vater, der sämtliche Milchzähne seiner Tochter wie Trophäen in einem [14] Döschen aufbewahrte; ein Vater, der die winzigen Kratzer und Narben, die sie ihm als Kind versehentlich beigebracht hatte, mit dem Stolz eines Kriegsveteranen vorzeigte; ein Vater, der nachts erst einschlafen konnte, wenn er das beruhigende Klicken ihrer Zimmertür gehört hatte. »Wie können die dich rausschmeißen, wenn du nichts gemacht hast?«
Sie machte eine resignierte Handbewegung, dann warf sie einen Blick über seine Schulter. »Kriegen wir jetzt eine neue Waschmaschine?«
»Lass doch die Waschmaschine. Da kümmere ich mich schon drum. Wie zum Teufel willst du einen Job finden?«
»Ich schaff das, Dad. Ich such mir eine andere Arbeit. Ich habe sogar schon eine Idee.«
»Und was?«
»Sag ich dir, wenn’s geklappt hat. Einverstanden?«
Mit dieser knappen Auskunft ließ sie ihn stehen und verschwand in ihrem Zimmer.
Er starrte auf die vertraute Zimmertür und überlegte, was seine Tochter jetzt wohl im Schilde führte. Zwei Versager im Haus – das waren wirklich zuviele.
Er legte die Bedienungsanleitung beiseite und wandte sich wieder der Waschmaschine zu.
Als er sie neu anschloss, spürte er doch eine gewisse Genugtuung bei dem Gedanken, dass er etwas an ihr in Ordnung gebracht hatte, wenn auch nicht das, was er sich eigentlich vorgenommen hatte – das Wasser, das heraussickerte.
Als seine Frau Monica von der Arbeit zurückkehrte und keuchend in der Tür auftauchte, stand Eric noch immer [15] neben der Maschine und verfolgte die Abläufe eines Waschgangs. Insgeheim hoffte er, die Erschütterungen hätten vielleicht das Leck abgedichtet. Ein solcher Erfolg würde ihn in ihrer Achtung steigen lassen.
»Donnerwetter«, staunte sie, als sie sah, dass er die immer wieder verschobene Arbeit endlich in Angriff genommen hatte. »Zeichen und Wunder.«
»Bis jetzt läuft nichts raus.«
»Der Aufzugsmonteur ist auch endlich da. Scheint ein Glückstag zu sein.« Ihre Wohnung lag im dreiundzwanzigsten Stock. Da freute man sich, wenn der Aufzug ging.
»Sie ist rausgeflogen«, berichtete Eric, den Blick starr auf den Boden geheftet, als rechne er jeden Augenblick mit einer Überschwemmung.
»Das ist nicht wahr!«
»Wegen unüberbrückbarer Differenzen, sagt sie.« Die Pfütze, die sich jetzt bildete, war unglaublich zähflüssig.
»O nein. Und wo ist sie jetzt?«
»Fort Knox.« Er nickte in Richtung Flur zu Tracys verschlossener Zimmertür.
Vor sieben Jahren hatten sie beide zugestimmt, als Tracy ein Schloss an ihrer Tür anbringen wollte. Schließlich konnten sie nicht ahnen, welche Konsequenzen das haben würde. Seither durften sie das Zimmer ihrer Tochter nicht mehr betreten. Kein einziges Mal in sieben Jahren! Weder zum Staubsaugen – das machte Tracy selbst – noch um mit ihr zu reden – bei solchen Gelegenheiten war sie jedes Mal herausgekommen und hatte die Tür rasch hinter sich zugezogen –, noch um ihr eine Tasse Tee zu bringen – die mussten sie wie ein heidnisches Trankopfer auf dem Teppich [16] abstellen, und wenig später wurde sie von einer Hand mit schlangenförmiger Bewegung nach drinnen gezogen. Mittlerweile wussten sie aus leidvoller Erfahrung, wie entschlossen und beharrlich ihr einziges Kind sein konnte, und sie kannten die geopolitischen Machtkämpfe in einem Haushalt mit Teenagern: die bewachten Grenzen, die Annexionen, die mühsam ausgehandelten Waffenstillstände, Entspannungspolitik und Wiederannäherung. Eric hatte, auch wenn er wusste, wie lächerlich es klang, ein Bild dafür, das er wie ein Mantra wiederholte: »Der Ballon stieg in die Höhe, und wir hielten ihn fest. Eigentlich hatten wir ihn immer loslassen wollen.«
»Hu-hu!« Das war Emily Powell, Emily die Nachbarin, Emily, die ›Huhu‹ rief und mit den Fingern winkte, die frisch verwitwete Emily, deren Leben in Auflösung war und die wie immer herüberkam, um sich auszuweinen.
Sie war um die Fünfzig, genau wie die Pringles, und hatte eine Tochter, Christina, die früher mit Tracy in eine Klasse gegangen war. Diese eine Gemeinsamkeit hatte die Powells und die Pringles zusammengeschweißt: Erfolgsmeldungen über die eine Familie klangen automatisch wie eine Herabsetzung der anderen. Christina hatte ein Stipendium bekommen und studierte allen Erwartungen zum Trotz in Oxford, Tracy hatte die Schule abgebrochen und war »in Lord Sainsburys Dienste getreten«, wie Eric sich ausdrückte. Andererseits war Graeme Powell tot, und Eric lebte noch. Damit waren sie irgendwie quitt, fand Monica.
»Sie haben sie entlassen«, verkündete Monica, noch ehe sie es selbst ganz verdaut hatte.
»Nein! Wen? Tracy? Nein!« Emily wusste genau, wer [17] »sie« war. »Das lässt sich bestimmt wieder einrenken. Sie ist so klug. Das wird schon wieder. Ganz bestimmt. Ist das nicht schrecklich? Die Ärmste.«
Monica wandte sich wieder ihrem Mann zu. »Weswegen?«
Eric wiederholte die Antwort, die Tracy ihm gegeben hatte. »Unüberbrückbare Differenzen.«
Emily nickte. »Ja, das kommt vor. Aber sie findet bestimmt etwas Neues.« Allzu viel Mitgefühl hatte sie nicht. Dazu war sie zu sehr mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt. Als ihr ein Platz angeboten wurde, setzte sie sich sofort.
In der langen Zeit, in der sie darauf warteten, dass Tracy aus ihrem Zimmer kam und ihnen Genaueres berichtete, nutzte Emily die Gelegenheit und erzählte mit leiser Stimme die nächste Folge des traurigen Fortsetzungsromans vom Tod ihres Mannes, der vor zwei Monaten am Non-Hodgkin-Lymphom gestorben war – ein langsamer, qualvoller Abschied. Heute nahm sie allen Mut zusammen und ließ eine Bombe platzen: Er hatte sie betrogen.
Die erschütternde Nachricht lockte Monica an die Küchentür und riss Eric aus seinem Studium der Bedienungsanleitung.
Wie aus einem Munde riefen sie: »Nein! Emily! Nie im Leben!«
Emily brach in Tränen aus und erzählte, aschgrau und unter schwerem Schluchzen, dass Graeme ihr auf dem Sterbebett alles gebeichtet hatte. Es waren praktisch die letzten Worte ihres Mannes gewesen. Trotzdem hatte sie seine schwache Hand nicht losgelassen, denn er lag schließlich im Sterben – bis, fuhr Emily fort, er ihr entglitten sei und ihr [18] damit zum zweiten Mal binnen nur fünf Minuten alles genommen habe. Ganze Arbeit.
»Ach, Emily. Das… das ist doch einfach…« Aber es gab keine Worte für solch schmerzliche Erfahrungen. Monica konnte sich nicht einmal ausmalen, wie man sich in so einem Falle fühlen musste.
»Unglaublich!«, schnaubte Eric, denn als Mann reagierte man auf so etwas mit Wut – Wut und Habe ich mir doch gleich gedacht, dass da was war.
Emily hatte ihre eigene Schachtel Papiertücher dabei.
Es folgten eher unwichtige Details. Die Frau arbeitete als Floristin bei Harrods, »spricht ja nichts gegen«, eine einfache und gutmütige Person – so hatte Graeme sie beschrieben. Und er hatte nicht einmal Schluss mit ihr gemacht. Der Tod musste übernehmen, wozu Willenskraft nicht ausgereicht hatte.
Jetzt, wo die grässliche Wahrheit heraus war, verstanden Monica und Eric, warum Emily seit der Beerdigung immer so bleich ausgesehen und sich kaum noch vor die Tür gewagt hatte.
Mitten in Emilys leidvoller Erzählung trat Tracy aus ihrem Zimmer, die Hände trotzig in die Hüften gestemmt, hochzufrieden mit ihrer Aufmachung – aufgedonnert wie eine Prostituierte, ihr Look für die glanzvolle Zukunft.
»Na, wie seh ich aus? Ich gehe jetzt und suche mir einen neuen Job.«
Tracy nahm natürlich an, dass alle ihretwegen so betroffen dreinschauten.
[19] Hinter verschlossener Tür hatte sie in der letzten halben Stunde den Inhalt ihres Kleiderschranks aufs Bett geworfen und jedes Stück gemustert. Was dabei herausgekommen war, war kein Versehen, sondern das Ergebnis sorgfältiger Überlegungen. Für das, was sie am heutigen Abend vorhatte, musste sie sexy sein. Diesmal wollte sie die wirkliche Welt betreten, nicht einen armseligen Supermarkt, und sie wusste, wie es da zuging. Busen, Beine, ein aufreizendes Lächeln, das Rezept für Nutten; wie beim Safeknacken kam es nur auf die richtige Kombination an: klick, klack, und schon war man drin.
Eine spannende Sache, aber Tracy war auch sehr nervös. Ihre Hand zitterte, als sie Augen und Lippen vor dem Spiegel schminkte. Vielleicht würde sie schon in wenigen Stunden die Einnahmen der ersten Nacht hier auf der Bettdecke zählen. Nun wo sie letzte Hand an ihr Make-up legte und die Augenbrauen mit einem Stift kräftiger nachzog, wurde ihr allmählich klar, was es bedeutete, seinen Job zu verlieren. Kassiererin zu sein hatte schon Vorteile gehabt. Diese Arbeit hatte nie etwas von ihr verlangt, was sie nicht bereitwillig gegeben hatte. Zeit spielte für Tracy keine Rolle, das war kein großes Opfer. Ihr Gehirn störte sich nicht daran, wenn es unterfordert war; sie machte sich keine Illusionen über sich selbst: Sie konnte gut mit Zahlen umgehen, aber eine große Denkerin war sie nicht. Sie war dazu bestimmt, ihr Leben im Dienste anderer zu verbringen. Und schließlich leistete der Job das, wozu ein Job nun einmal da war: Er fraß die Stunden, die man sonst damit zubringen müsste, dass man sich einredet, wie glücklich man ist, wie beliebt, faszinierend, wertvoll, attraktiv, talentiert, gefragt, [20] gefällig, witzig, liebenswürdig, tiefgründig. In einem Buch, das sie gelesen hatte, war einmal eine Figur als »tiefgründig« beschrieben worden. Das schien ihr der Gipfel des Erstrebenswerten.
Sie legte den Augenbrauenstift beiseite und befeuchtete mit der Zunge ihren Finger, bis sie den Ring mit dem goldenen Herzen abstreifen konnte. Dann hielt sie ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und fuhr sich damit über den unteren Lidrand, wo sich ein pochendes Gerstenkorn zu bilden begann. Dieses alte Hausmittel hatte noch nie versagt. Selbst wenn ihre Beziehung zu dem treuherzigen Ricky Innes, Lehrling im morbiden Familienbetrieb seines Vaters drüben in Tooting, nicht lange hielt oder keine Probleme löste, würde der Ring, den er ihr geschenkt hatte, der einzige Gegenstand aus Gold, den sie besaß, ihr immer dabei helfen, Gerstenkörner im Keim zu ersticken.
»Hi«, hatte er gesagt, als sie sich zum ersten Mal in einer dröhnenden Disco begegnet waren.
»Hi.«
»Was machst ’n du so?«
»Kassiererin bei Sainsbury. Und du?«
»Ich arbeite mit Steinen.«
»Äh… so ’ne Art Maurer?«
»Nee. Ich mache Inschriften.«
»Verstehe. Du bemalst die.«
»Nee. Bildhauer sozusagen.«
»Oh… das heißt Kunst?«
»Nee. Grabsteine.«
»Grabsteine.«
»Sag ich doch.«
[21] »Du willst mich verarschen! Grabsteine – nie im Leben.«
»Kannst du Gift drauf nehmen. War ’n Witz. Das ist ’n guter Job. Ehrlich.«
Der Bildhauer, ihr ganz persönlicher Meisterschüler in der Kunst der Grabsteingestaltung, hatte ihr als Beweis für seine Absichten – wenn schon nicht seine Liebe – einen Ring geschenkt, den sie jetzt blinzelnd und mit ein paar Tränen in den Augen wieder über den Finger streifte, wobei sie sich zugleich die Haare hinter die Ohren strich.
Sie war bereit.
»Wie eine Schlampe«, sagte ihr Vater schließlich und brachte damit die Gefühle sämtlicher anwesender Erwachsenen auf den Punkt.
Ihre Mienen zeigten allerdings weniger Missbilligung als Nachdenklichkeit, ein Nachdenken darüber, ob alle späteren Katastrophen im Leben, Katastrophen wie die, über die sie gerade gesprochen hatten, so ihren Anfang nahmen; in Tracys Alter, damit, wie sich ein junger Mensch zum Ausgehen anzog.
Tracys Aufmachung war einfach unmöglich. Der Rock reichte kaum über den Po, die Stöckelschuhe und hoch aufgetürmten Haare waren mehr als aufreizend, und das Gleiche galt für das Make-up. Das rückenfreie Lycra-Top, das ein vorher eher unauffälliges Dekolleté ins rechte Licht rückte, präsentierte einen Körper, den keiner im Raum als den von Tracy erkannt hätte.
»Ich bin dann mal weg. Ich such mir Arbeit«, verkündete sie.
»Arbeit?«, brüllte Eric. »Um diese Zeit?«
[22] »Bin spät dran. Bis dann.«
Monica warf ihrem Mann einen fragenden Blick zu: Wer geht um diese Zeit auf Stellensuche?
Eric griff die Frage auf: »In diesem Aufzug? Es ist schon nach… es ist fünf Uhr, halb sechs!«, sagte er mit einem Blick auf seine Armbanduhr.
»Ich weiß. Aber ich suche nach einem Job im Restaurant.«
»Red keinen Quatsch. Jetzt setz dich hin und schlag dir das aus dem Kopf. Erzähl deiner Mutter erst mal, was heute passiert ist.«
»Ehrlich. Ich meine das ernst. Die Geschäftsführer sind nur um diese Zeit da. Bye!«
Bevor jemand sie aufhalten konnte, war sie weg. Eric rief ihr von der Wohnungstür aus etwas nach, aber ihre immer schnelleren Schritte verhallten im Flur, und schon war sie auf dem Weg nach unten. Sie nahm nicht den Lift, und er hörte ihre Absätze auf der Treppe, den Anblick des wippenden Hinterteils und ihrer Oberschenkel noch genau vor Augen.
»Ehrlich. Vielleicht geht sie auf den Strich.«
Emily war wieder fort. Eric und Monica saßen nebeneinander auf den neuen hohen Barhockern an der Theke zwischen Kochnische und Wohnbereich. Monica lachte, sie war in ein kniffliges Kreuzworträtsel vertieft. »Du bist ja verrückt.« Sie grübelte über der Definition: H 100–98 O.Sechs Buchstaben.
Eric sah ihr über die Schulter. »Es ist mein voller Ernst.«
»Nie im Leben.«
[23] »Die stammen oft aus ganz normalen Familien.«
»Nicht so normal wie unsere.«
Er knuffte sie. »Jetzt bleib mal ernst.«
»Sie ist nicht der Typ.« Monica kaute auf ihrem Bleistift. »Sechs Buchstaben.«
»Das ist es ja gerade. Es gibt keinen bestimmten Typ, verstehst du? Die kommen aus allen Schichten, und die Eltern sind immer ahnungslos. Die meisten Prostituierten…«
»Ach, halt endlich die Klappe.«
»…die meisten sind ganz normale Mädchen, so wie Tracy. Ich meine nicht die, die auf Drogen sind, nicht die kaputten. Die ganz Normalen sind die, die wirklich Geld machen, die sind richtig gut im Geschäft.«
»Du scheinst dich ja auszukennen.«
»Die sind genau das, was die Kerle wollen. Ganz normale Mädchen. Die Töchter von Leuten wie uns, die von nichts eine Ahnung haben. Wir geben ihnen einen Kuss beim Auszug, sie machen Karriere, kaufen ein Auto, ein Haus – braves Mädchen –, dann das zweite Haus, das zweite Auto – Moment mal, da stimmt doch was nicht, ein Boot!… Herr im Himmel, zehn Jahre später schreiben sie ein Buch: ›Mein Leben als Hure‹. Verstehst du, was ich meine?« Eric rieb sich hektisch die Stirn. Er hatte sich buchstäblich in Rage geredet.
»Sie ist nicht sexy, Eric. So was kommt ihr nicht in den Sinn. Daran denkt sie nicht mal im Traum. Kein Sex-Appeal.«
»Dann hat sie sich aber ziemlich gut verstellt. Und wenn sie es mit diesem Richard treiben kann, dann kann sie es auch mit jedem anderen tun.«
[24] »Sie käme nie auf die Idee.«
Eric sagte nichts, aber der Grund für seine Besorgnis war ein Artikel in der Zeitung, die Monica gerade in der Hand hielt.
»Wasser«, sagte sie.
»Wie kommst du denn da drauf?«
»Hier, siehst du?« Sie füllte die Kästchen.
»Was?«
»Ganz schön raffiniert, was? H… zwei… O.«
Das sieht doch schon besser aus, dachte Tracy. Persischer Garten? Klingt verlockend. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg.
Die chinesischen, thailändischen und italienischen Restaurants, bei denen sie gerade vergeblich ihr Glück versucht hatte, hatten weder Atmosphäre noch den nötigen Glamour gehabt. Aber das hier war anders. An einem solchen Ort konnte man sich all die geheimnisvollen Dinge, die sie vom Leben erwartete, mühelos vorstellen. Genau was sie gesucht hatte: mehr als ein Job – eine Wendung ihres Schicksals, ein Neubeginn.
Die Einrichtung des schummrigen Lokals war orientalisch: Wandteppiche zeigten alte Schlachtendarstellungen oder idyllische Waldszenen; kleine, niedrige Tische waren zu behaglichen Grüppchen arrangiert und in bernsteinfarbenes Licht getaucht, das aus kampferduftenden Lampions fiel.
Der Mann, der hinter einem durchbrochenen Wandschirm hervortrat, war etwa fünfzig, untersetzt und mit schütterem Haar. Er wirkte wehmütig, wie jemand, der sein [25] ganzes Leben dem Studium der menschlichen Natur gewidmet hat. Er fasste sich hinter den Rücken und versuchte, eine mehlbestäubte Schürze abzunehmen, die ihm bis zu den Knöcheln reichte. Sein Gesicht war voller Lachfältchen. Seine Haut schimmerte wie poliert. Sie blickten sich in dem schummrigen Licht an, mit der Gemessenheit von Menschen, die auf Anhieb erkennen, dass sie aus vollkommen verschiedenen Welten stammen. »Ja bitte?«
Er trat vor. Im Licht konnte er sie besser sehen. Sie sah den erschrockenen Blick, als seine Augen über ihren Ausschnitt und die nackten Schenkel glitten. Zum Glück bemerkte sie auch, wie dieser Blick wieder verschwand, als seine Augen nüchtern und kühl wieder nach oben wanderten. Er schien verblüfft. Klick, klack, dachte sie.
»Was kann ich für Sie tun?«
»Ich komme wegen dem Job im Fenster.«
»Job? Ach so, verstehe.« Er lachte und schien zugleich erleichtert.
»Was ist?«
»Nichts.«
»Was?« Nun war sie wieder verwirrt.
»Das hier ist ein persisches Restaurant.«
»Ist mir klar. Ich kann schließlich lesen.«
»Gut. Immerhin etwas.«
Mistkerl, dachte sie.
»Ich will sagen, hier gibt es keine Jobs. Tut mir leid.«
»Sie haben keinen Job?«
»Nein. Vielen Dank für Ihr Interesse.« Er musterte die spärlich bekleidete junge Dame, die da vor ihm stand: So lange war er noch nicht fort aus dem Iran, dass ihn solcher [26] Exhibitionismus nicht immer noch verwirrte. Für ihn war sie der Inbegriff der jugendlichen englischen Straftäterin, aufgetakelt für weiß Gott was – fehlte nur der Ring in der Nase – sicher hörte sie entsetzliche Popmusik – alles, was er verabscheute. Er schüttelte den Kopf. »Tut mir leid.«
»Wozu haben Sie dann das Schild im Fenster?«
Er drehte sich um und blickte zur Tür. »Wir haben ein Schild im Fenster? Keine Ahnung, was das da zu suchen hat. Sie haben vollkommen recht. Ich nehme es sofort herein.« Tracy rührte sich nicht. Sie sah ihm nach, als er zur Tür ging, den Klebestreifen abzog und die Pappe entfernte. »Bitte entschuldigen Sie. Vielen Dank für Ihren Besuch.«
»Oder liegt es einfach an mir?«
»Nein.« Er seufzte. Allmählich wurde es ihm zu viel. »Nein, es liegt nicht an Ihnen. Jemand muss geglaubt haben, wir bräuchten eine Kellnerin, obwohl das nicht stimmt.«
»Na gut«, sagte sie. »Aber ein bisschen irreführend ist es schon.«
»Tut mir leid.« Er hielt ihr die Tür auf.
»Hübsch hier.«
»Oh. Danke.«
Sie schlüpfte unter seinem Arm hindurch, und er folgte ihr hinaus auf die Straße und sah ihr kopfschüttelnd nach, bis der Anflug eines Lächelns auf seinem Gesicht erschien.
[27] Fleisch
Auf die eine oder andere Weise war Fleisch von jeher der bestimmende Faktor im Leben von Saaman Sahar gewesen, dem Besitzer des Persischen Gartens.
Saaman, der redselige Sohn eines gewissen Mostafa Sahar, eines bekannten Schlachters in Teheran, war im Schatten des Hackbeils aufgewachsen. Das dumpfe Geräusch, wenn der Stahl auf den massigen hölzernen Hackklotz traf, war seine früheste und stärkste Erinnerung. In den späten fünfziger Jahren war der Junge auf dem sengend heißen Markt des Meidan-e-tareh-bar seinem Vater nicht von der Seite gewichen.
Da er als Kind immer klein war – selbst jetzt als Erwachsener brachte er es nur auf eins fünfundsechzig –, hatte er von dem eigentlichen Schlachten nie viel sehen können, doch das erbarmungslose Geräusch des Hackbeils hinterließ tiefe Spuren in seiner Seele und besiegelte sein Schicksal.
Um die Mitte der siebziger Jahre – sein Vater hatte es zu Wohlstand gebracht, besaß eine ganze Kette von Läden, und der Marktstand existierte nur noch in nostalgischer Erinnerung – wurde Saaman wie viele seiner Generation unter beträchtlichen Unkosten auf eine westliche Universität geschickt, um sich die heiligen Lehrsätze der [28] Keynesianischen Ökonomie anzueignen. Alle gingen davon aus, dass er nach dem Examen in die Heimat zurückkehren würde, um dort in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, den Familienbetrieb weiter auszubauen und zu modernisieren und so als Speerspitze des Fortschritts Zugang zur gesellschaftlichen Elite des modernen Teheran zu finden.
Aber in England geschahen zwei Dinge.
Als Erstes entwickelte er eine Vorliebe für alles Englische. Geistig erfrischt von der kühlen Luft in Oxford, fand er dieses Land den besten Ort für seine Tatkraft und sein Kapital. England, die Heimat aller höflichen Umgangsformen, der Inbegriff des gesunden Menschenverstands, die fortschrittlichste und charismatischste Kultur, die der Westen vorzuweisen hatte.
Mit der unbeirrbaren Zielstrebigkeit der Jugend ließ er sein ästhetisches Empfinden vom Anblick eines Sonnenuntergangs über den sanften Hügeln der Cotswolds prägen, der Duft des englischen Waldes nach einem Regenschauer setzte die Maßstäbe für seinen Geruchssinn, und ein warmes englisches Bier nach einem langen Spaziergang war für ihn der Gipfel des Wohlgeschmacks. Er idealisierte England über alle Maßen. Mit dem sentimentalen Blick eines John Constable machte er es zur Heimat seiner Seele.
Als er seiner Mutter dieses Märchenland schilderte, schrieb sie zurück: »Wenn du so denkst, kannst du gleich ganz dableiben.«
Dabei war sie stolz auf ihren Sohn, prahlte bei jeder Gelegenheit damit, dass die Sahars es sich jetzt leisten konnten, ihren Ältesten an der »bedeutendsten Universität der Welt« studieren zu lassen; ja sie glaubte selbst an die [29] kulturelle Überlegenheit des Westens, aber sie wollte doch nicht ihren Sohn an ein degeneriertes, sittenloses Leben verlieren. Der Westen hatte keinen Sinn für die Seele. In diesen Dingen konnte man nichts von ihm lernen. Was sie verehrte, fürchtete sie zugleich. Mochte ihr Sohn England ruhig vergöttern, aber bald würde er wieder zu Hause sein, und das ohne Bedauern.
Der zweite Vorfall, der sein Leben erschütterte, ereignete sich nach einer Kricketpartie am Christ Church College in Oxford.
Als er nach einem trägen Eintagesmatch, bei dem er und seine Kommilitonen ein gepflegtes Unentschieden erreicht hatten, an seinem Earl-Grey-Tee nippte, geschah das Unvorstellbare.
An dem fraglichen Nachmittag – die Anzeigetafel zeigte fünfundzwanzig Runs hinter dem Namen SAHAR S. – entschied das Los, dass er für alle das Mittagessen spendieren sollte: Fleischpastete. Woher hätte er wissen sollen, was ihm bevorstand, als er hungrig die Füllung aus Rindfleisch und Nieren hinunterschlang, die in der Teighülle vor sich hinmoderte? Und wie hätte er ahnen können, was für eine Kettenreaktion dieses sommerliche Picknick in seinem Leben auslösen würde?
Die Wirkung ließ nicht lange auf sich warten. Eine Salmonelleninfektion setzte ihn drei Wochen lang außer Gefecht. Der Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen und explosionsartigen Durchfall war so hoch, dass er ins Krankenhaus kam und unter intensive Beobachtung gestellt wurde. Man benachrichtigte sogar seine Eltern. Er verlor zwölf Kilo, als seien sie Ballast, den man einfach über Bord werfen konnte. [30] Er rang mit dem Fieber. Und irgendwann im Delirium wurde ihm die Vorstellung von Fleisch unerträglich. Danach konnte er nicht einmal mehr an Fleisch denken, ohne dass aus seinem Zwölffingerdarm eine Gasblase aufstieg. Allein die Vorstellung, er könne an die Seite seines Vaters zurückkehren, in die dampfenden Läden mit dem unablässigen dumpfen Wumm-Wumm-Wumm, den aufgerissenen Mäulern und Kadavern aus Fleisch und Knochen, reichte aus, um ihm jede Mahlzeit aus schonend gedämpftem Gemüse und frischen Salaten wieder hochkommen zu lassen. Nur mit größter Anstrengung konnte er das Würgen unterdrücken.
In den Augen der Daheimgebliebenen war er natürlich ein Versager. Seine Postkarten wurden verbrannt. Ein Sahar, der kein Fleisch aß? Eine unverzeihliche Schande.
Bei der Rückkehr nach Teheran erklärte Saaman (der sich inzwischen lieber mit Sam anreden ließ, weil das englischer klang, und der zu allem Überfluss einen Abschluss in Englischer Literatur in der Tasche hatte) seinem Vater, er wolle lieber ein vegetarisches Restaurant aufmachen.
Messer, Hackklötze und Wetzsteine landeten unter Getöse auf der Straße vor dem neuesten Laden der Saharschen Metzgereikette. Erst nach Stunden ließ das Gebrüll nach. Dass Saaman an diesem Tag nicht Bekanntschaft mit der Klinge eines Hackbeils machte, verdankte er weniger der Beherrschung des alten Mannes als dessen nachlassenden Kräften. Sein Vater kehrte ihm den Rücken und ging in seinem weiten Nadelstreifenanzug gebeugt von dannen. Dabei hinterließ er eine blutige Fußspur auf dem grauen Zementboden. Sam betrachtete die Abdrücke: Sie wurden mit jedem Schritt schwächer, der Stempel musste zurück [31] aufs Stempelkissen, ein Abbild des allmählichen Niedergangs seiner Familie, ein Vorbote für das Ende des alten Mannes.
Von diesem Tag an ging es mit Mostafa bergab. Kaum einen Monat später erlitt er einen leichten Schlaganfall, und bis an sein Ende würde er nicht begreifen, wie sein Sohn eine so abartige Vorliebe für Gemüse entwickeln konnte. Als es Zeit war, sich zur Ruhe zu setzen, kam eine weitere, noch größere Sorge dazu: Er hatte keinen Erben. Sams jüngere Brüder waren beide noch nicht alt genug, um das Familienimperium zu übernehmen. Er hatte keine Wahl.
»Da gehen sie hin, tausend Jahre Patriarchat, und nur wegen einer englischen Pastete«, verkündete er.
Die Läden wurden einzeln zum Verkauf angeboten und rasch versteigert, zu Preisen, die weit über den Mindestgeboten lagen, denn nichts galt in Teheran als so sicher wie ein weiteres Jahrtausend Fleischtöpfe und Bratpfannen. Aber der plötzliche Überfluss an Bargeld war nur ein schwacher Trost für Mostafa, für den Fleisch gleichbedeutend mit Leben war und umgekehrt. Das konnte man nicht einfach so wegwerfen. In ihrem letzten Streit darüber versuchte der alte Mann, seinen Sohn vor der göttlichen Vergeltung zu warnen.
»Ohne einen Bissen Fleisch im Bauch bist du schon so gut wie tot. Hör auf die Stimme deiner Vorfahren. Du bist nicht dazu geschaffen, dich von Gemüse zu ernähren. Ein solcher Mann ist eine Null!«
Sein Vater rollte sanft aufs Abstellgleis, und seine Mutter verbrachte ihre Tage in verdunkelten Zimmern. Doch inzwischen wuchs und gedieh Sams Restaurant, weit besser [32] als er je geglaubt hatte. Er gewann Geldgeber für einen Markt mit Zukunft. Mit der Eröffnung eines zweiten und dritten Lokals profitierte er von der Begeisterung für alles Westliche in der Regierungszeit des letzten Schahs. Seine Gemüseburger zum Mitnehmen waren bald der letzte Schrei in Tausenden trendbewussten Haushalten Teherans. Er bescherte seiner Generation Pommes frites und Ketchup. Der Höhepunkt seiner Karriere war der Kauf eines legendären Restaurants im Herzen von Teheran, wo Stalin, Churchill und Roosevelt 1943 beim Lunch die Rückeroberung Europas geplant hatten. Er war so erfolgreich, dass man ihn – zu Unrecht – für einen Playboy hielt.
Aber als er den Ayatollah Khomeini in seinem Exil zum ersten Mal im Fernsehen sah, wusste er, dass die Party zu Ende war. Er hörte den flammenden Aufruf zur Erneuerung der religiösen Werte, zum Kampf gegen die Korruption durch die Eliten und erkannte die Zeichen der Zeit. Das Antlitz des Irans würde sich über Nacht verändern, und für jemanden, der, wie er, gefangen war zwischen zwei unvereinbaren Welten – vor einer wichtigen Entscheidung las er bisweilen im Koran, aber in England hatte er Madrigale in einer anglikanischen Kirche gesungen –, war es nicht mehr der richtige Ort. Er beschloss, zu gehen, wenn er sein Vermögen irgendwie mitnehmen konnte.
Wie vorher die väterlichen Läden kamen seine Restaurants schnell unter den Hammer und erzielten einen guten Preis. Für kurze Zeit war er reich. Die neuen Besitzer, junge Unternehmer, die das schnelle Geld witterten und kein Gespür für den gesellschaftlichen Wandel hatten, hielten die Anzeichen eines Aufstands für das übliche Gejammer der [33] Unterschicht. Jahre später hörte Sam, dass sie bei dem Umsturz alles verloren hatten.
Auch seine besten Freunde kümmerten sich nicht um die Zeichen der Zeit und fuhren mit ihren italienischen Autos weiterhin viel zu schnell, ohne Rücksicht auf Gesetze und Vorschriften. Sie flogen häufiger denn je zum Einkaufen nach Paris und ließen sich die Nase operieren. Obwohl seine beiden jüngeren Brüder ihn inständig baten zu bleiben, schaffte er sein Geld heimlich auf Schweizer Konten. An dem Tag, an dem der Schah gestürzt wurde und der neue Imam offiziell die Macht übernahm, verließ Saaman mit der ersten Maschine das Land. Er saß neben einer Nichte des Schahs in der ersten Klasse und nippte an einer Weinschorle.
Tags darauf stand er auf englischem Boden, spielte, noch unter Jetlag und den Nachwirkungen eines mittäglichen Aperitifs, Tennis im eleganten Club von Wimbledon und rief »guter Schlag«, ein echter Bonvivant in seinen weißen Shorts.
So begannen die Jahre in London, das ihm zwei Jahrzehnte lang als ruhige, sichere Basis diente. Er hatte ein gutes Auskommen nach englischen Maßstäben, spekulierte ein wenig an der Börse und eröffnete ein Restaurant, anfangs nicht viel mehr als ein Zeitvertreib. Doch wie andere Chamäleons geriet auch er bald in emotionale Nöte. Der Widerspruch zu seiner Vergangenheit beunruhigte ihn zutiefst. Er wahrte bestimmte Traditionen, pflegte die Verbindung zu seiner Familie und ein paar Freunden, aber die unterschwellige Anspannung nagte an ihm und weckte seinen Zorn über den rückwärtsgewandten Kurs seiner Heimat. Er schlug einen Bogen zwischen Ost und West, doch [34] er war in keiner der beiden Welten wirklich zu Hause. Die Folge war, dass er seine Energien noch mehr auf die neue Wahlheimat konzentrierte. Er entwickelte einen übertriebenen Patriotismus und ließ die Verbindungen zu seiner alten Heimat schleifen. Die weinerliche Sentimentalität eines Emigranten, das war nichts für ihn.
Sein englisches Restaurant war bescheiden. Als er sein Geld in Pfund umtauschte, reichte es nicht allzu weit. Und seine Unternehmungslust hatte ihn verlassen. Aber mit seiner vegetarischen Speisekarte und den phantasievollen Gerichten war der Persische Garten originell genug für eine Stadt, in der man bis in die Mitte der neunziger Jahre kaum wusste, wie ein Salat aussieht. Er erzielte ohne große Anstrengungen einen hübschen Gewinn und besaß auch nach dem Erwerb eines schönen frei stehenden Hauses – ein Luxus für Londoner Verhältnisse – immer noch ein paar Aktien als eiserne Reserve. Sein Schisch Kebab aus Tofu und Zuckerschoten galt als Geheimtipp. Und das köstliche Kaschk Bademjan aus Auberginen hatte er direkt von seiner alten Speisekarte in Teheran übernommen. Seine Köche vollbrachten wahre Wunder mit Dolmeh, scharf gewürzten roten Rüben und gefülltem Kohl. Saaman redete unablässig davon, dass er in London ein zweites Restaurant aufmachen wollte, hatte auch schon erste Pläne, aber er sagte – immer noch der Intellektuelle aus Oxford –, er warte auf den richtigen Markt.
Mit seinen zweiundfünfzig Jahren war er vor der Zeit müde geworden, melancholisch, übergewichtig, fremd, ein Schatten an den Rändern einer Kultur, die er verehrte.
[35] Am nächsten Morgen um zehn war Tracy wieder da.
Als Sam Sahar aus seinem Mercedes stieg und die Straße überquerte, wartete sie schon auf ihn. Ihre Aufmachung war nicht mehr so auffällig wie am Vorabend, und so erkannte er sie erst auf den zweiten Blick.
»Hi«, sagte sie in triumphierendem Ton.
»Sie schon wieder?«
»Das Schild im Fenster«, sagte sie und zeigte auf das Pappschild, das über Nacht wieder an seinem alten Platz aufgetaucht war.
Er rieb sich das Kinn, errötete und wandte den Blick ab. »O ja, ja… offenbar hat es sich jemand anders überlegt.«
»Wirklich? Haben Sie immer noch keinen Job für mich?«
»Na ja, vielleicht… dann kommen Sie erst mal mit rein… und lassen Sie wenigstens… Ihre Telefonnummer da.« Er machte sich an der Tür zu schaffen. »Treten Sie bitte ein… lassen Sie uns drinnen weiterreden.« Er wollte nicht mit ihr auf der Straße gesehen werden.
Sam musste sich nicht viel aufschreiben. Tracy hatte sich die Mühe gemacht und über Nacht einen handgeschriebenen Lebenslauf aufgesetzt. An einem Tisch, von dem er zwei Stühle herabnahm, zwang sie ihn mit ihrem eindringlich hoffnungsvollen Blick, die halbe Seite mit der Liste ihrer Triumphe zu studieren. »Schön. Kassiererin? Gut. Schulbildung. Hm-hm. Das ist in Ordnung. Aber keine Erfahrung als Kellnerin.« Das Telefon in der Küche klingelte. »Oh, einen Moment bitte.«
Die Stimmung in dem leeren Restaurant mit den Stühlen auf den Tischen, der Ruhe wie in einer Höhle, den Bildern an den Wänden mit ihren Szenen aus kaiserlicher Zeit, von [36] Mord und Schandtat unter den Moguln, von ländlicher Muße und Lust, dem Geruch nach Wachs und dem Holzkohlenrauch des gemauerten Ofens, all das gab Tracy das aufregende Gefühl, dass sie in einen ihrer eigenen Tagträume eingetaucht war.
Hier zu arbeiten, das wäre bezahlter Urlaub, dachte sie.
Sie sah sich das Schlachtgetümmel auf dem Bild neben sich genauer an: Krieger mit gezückten Krummschwertern, eine halb im Sand vergrabene, zerbrochene Laute, gefallene Helden, die sich ihre durchbohrten Seiten hielten und ihren letzten Seufzer im Schoß weinender, verzweifelter Jungfrauen taten.
Fast unbemerkt betrat eine Frau das Restaurant und kam quer durch den Raum. Sie war groß und schlank, ihr Haar war zu einem Knoten gebunden. Als Tracy sich zu ihr umdrehte, wurde sie mit einem Lächeln bedacht. Die Frau bückte sich, hantierte mit etwas und richtete sich mit einem Bündel Geldscheine, das sie sich in die Handtasche steckte, wieder auf. Dann verschwand sie, als wäre der ganze Auftritt nichts weiter gewesen als die Erscheinung eines Geistes.
»Das Lokal find ich wirklich toll«, sagte Tracy, als Sam wieder auftauchte.
Für Komplimente war er nicht unempfänglich. »Danke.« Er hielt am Tresen inne, stutzte und brummte dann etwas vor sich hin.
»Oh, eine Frau war hier und hat es mitgenommen.«
»Ich weiß. Ich weiß. Danke. Das ist in Ordnung. Sie plündert mich immer aus.« Zum ersten Mal grinste er. »Meine Frau. Sie ist es auch, die hinter meinem Rücken [37] Schilder mit ›Kellnerin gesucht‹ ins Fenster stellt. Was mich in die peinliche Lage bringt, dass ich mit erwartungsvollen jungen Damen sprechen muss, obwohl ich… keinerlei Absicht habe, sie anzustellen.«
»Überhaupt keine?«, fragte Tracy enttäuscht.
»Tut mir leid. Wir sind in vielerlei Hinsicht ein sehr traditionelles Lokal, mit Ausnahme der Speisekarte. Ja, wir brauchen Kellnerinnen, deshalb macht Yvette so etwas hinter meinem Rücken.« Er murmelte etwas in seiner eigenen Sprache. »Aber wir haben eine große persische Klientel, die kaum oder gar kein Englisch spricht. Und auch die Speisekarten sind auf Farsi.«
»Salaam, esman Tracy Pringle e«, sagte sie. »Khosh amedeem Persischer Garten. Hallo, mein Name ist Tracy Pringle. Willkommen im Persischen Garten.«
Er hob die Augenbrauen. »Wo haben Sie das gelernt?«
»Eine Stunde im Internet. Ich lerne schnell.«
»Und Sie sind hartnäckig.«
»Sie werden es nicht bereuen. Ich arbeite gut.«
»Habe ich vielleicht ein Schild umhängen, auf dem ›leicht rumzukriegen‹ steht?«
»Ihre Frau findet, Sie brauchen jemanden. Die Speisekarte kann ich auswendig lernen. Im Supermarkt konnte ich mir von allen im Laden die Preise am besten merken.«
Er stieß einen Seufzer aus, überschlug im Geiste, wie viel Schaden sie maximal anrichten konnte, und sagte dann: »Schon gut. Schon gut. Eine Woche.«
»Ehrlich?« Sie sagte es mit einem kleinen Lachen.
»Eine Woche. Zur Probe. Aber ich will keine Diskussionen, wenn wir beide merken, dass es ein Fehler war.«
[38] Tracy drückte den Halteknopf und stieg an der Rycroft Street aus, und beinahe hätte sie ihre Flasche Tesco-Champagner auf dem Sitz neben sich vergessen. Sie tauchte so unvermittelt in der Wohnung ihres Freundes auf, dass sie den Burschen kalt erwischte.
Sie wollte ihn mit der Nachricht überraschen, wollte im Wohnzimmer die ganze Flasche mit ihm austrinken, und dann wollte sie offen für Neues sein. Spontaneität war nicht gerade die starke Seite ihrer Beziehung, doch an diesem Abend war sie einfach bei allem optimistisch.
Er lebte in einer Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss eines modernen Apartmenthauses, so hässlich und kahl, dass der abblätternde Putz schon als Verschönerung durchging. Er hatte einen Goldfisch, der in einem Bowletopf auf dem Fensterbrett sein Leben fristete, sah gern Satellitenfernsehen – die Schüssel vor dem Fenster schirmte sämtliches Sonnenlicht ab – und verabscheute Hausarbeit. Sein rotes Auto hingegen, das am Rinnstein stand, war makellos. Unter dem Scheibenwischer steckte ein Kärtchen: »Frisch lackiert.« Jetzt, gerade zurück aus der Werkstatt, sah der Wagen nagelneu aus.
Sie musste einfach probieren, ob die Farbe schon trocken war. Ein leichter Abdruck ihrer Fingerspitze blieb auf der klebrigen Substanz zurück; wahrscheinlich würde er ihn entdecken – er war furchtbar pingelig mit seinem Auto – und die Täterin anhand der forensischen Beweise ermitteln. Aber am heutigen Abend hatte es etwas sehr Romantisches, dass sie ihren Abdruck hinterließ. Wie ein geschnitztes Herz in einem Baumstamm, wie eine Widmung in einem Buch würde diese kleine Rosette die Jahre überdauern.
[39] Was hatte sie zusammengeführt? Einmal hatten sie sich gesehen, aber sie hatte ihn längst wieder vergessen gehabt, als der Tod ihrer Großmutter für ein Wiedersehen sorgte. Schon damals bei der ersten Begegnung war ihr klar gewesen, dass er ein Frauenheld war. Er hatte den rauhen Charme eines Mannes, der fest davon überzeugt ist, dass die Frauen ihm zu Füßen liegen – was sie abstieß, aber auch faszinierte. Und sie hatte nicht begriffen, dass sie ihn, als sie ihn damals in der Disco einfach stehenließ, erst recht angestachelt hatte, sie zu erobern – dass sie ein verliebtes Monstrum aus ihm gemacht hatte.
Bei der zweiten Begegnung, ein paar Monate später, fand der Steinmetz sie noch schöner und elfenhafter als in seiner Erinnerung, ihre Augen leuchtender und ihre ganze Art lieblicher als bei jeder anderen Frau, die er seit Jahren begehrt hatte.
Tracy stimmte ihm zu, dass die Welt in der Tat klein sei, als sie neben ihrer Mutter Monica stand, die Rickys Vater den Text für die Inschrift auf der noch spiegelglatten Fläche des Grabsteins diktierte. Liebe. Immer und ewig. Die großen Worte.
Beider Blicke begegneten sich über die Schultern ihrer Eltern hinweg, und der Lehrjunge lächelte ihr die ganze Zeit zu. Die Trauer tat das Ihre: Sie machte sie empfänglicher für die Augen, die Gesten, und sorgte auch dafür, dass sie eine vollkommen überzogene Vorstellung vom Stellenwert seiner Arbeit bekam. Das Gewerbe des Grabsteingestalters kam ihr in ihrem Kummer um vieles größer vor, als es in Wirklichkeit war. Es kam ihr vor wie etwas, was im Mittelpunkt des Lebens stand. Mit einem Mal schien es ihr [40] der wichtigste, wertvollste, romantischste Beruf, den es auf Erden gab.
Richard hatte seine Entscheidung getroffen. Dieses Mädchen musste er haben, und nicht weil er sie mehr liebte als seine anderen Eroberungen, sondern weil er nun in ihrer Eroberung die Chance zum schönsten Sieg seines Lebens sah.
Als der Stein neu gemacht werden musste – durch einen Fehler im Geburtsdatum wäre die Großmutter mit 180Jahren gestorben –, sah er seine Chance.
Beim zweiten Besuch kam der Lehrjunge allein.
Der junge Mann fand, ein solcher Geschäftstermin war eine erstklassige Gelegenheit, sich der trauernden Enkelin zu nähern. Um sie zu beeindrucken, entwarf er den Stein vollkommen neu. Er breitete seine aberwitzigen Pläne auf dem Wohnzimmertisch aus, wies hierhin und dorthin, ein Napoleon über seinen Landkarten.
Der neue Grabstein sollte nun fast doppelt so groß sein, er schlug Schnörkel und Seraphim vor, einen Amor, Rankenwerk im Basrelief, Falken im manirierten Stil eines Grinling Gibbons, alles so weit hergeholt, dass die Pringles überhaupt nicht begriffen, wie abstrus es war. Er versicherte ihnen, dass es sie keinen Penny mehr kosten werde – das sei doch das mindeste, was er tun könne, um seinen Fehler wiedergutzumachen. Am Ende des Besuches war niemand überrascht, als er Tracy fragte, ob sie nicht Lust habe, sich irgendwann mal auf ein Glas Bier mit ihm zu treffen.
Überzeugt, dass der junge Mann ein Künstler war, ein Poet der Friedhöfe, gestattete Tracy sich den Tagtraum, dass sie im Begriff sei, sich in ihn zu verlieben. Sie konnte zwischen einem Dutzend romantischer Szenen wählen.
[41] Aber um tatsächlich ans Ziel seiner amourösen Wünsche zu kommen, brauchte der junge Mann mehr als ein Basrelief oder einen Amor mit gut gefülltem Köcher.
Drei volle Wochen lang gelang es ihr, wenn sie gemeinsam aus gewesen waren und er sie wieder zu Hause absetzte, ihm zu entschlüpfen, bevor er den Motor abstellen konnte. Als der Akt dann schließlich vollzogen wurde, hinten in dem schmutzigen Lieferwagen, wo es glitzerte vor Schiefersplittern, Obsidianstaub, Quarzkrümeln, Feldspat und Glimmer, gab sie keinen einzigen Laut von sich. Sie schien in Gedanken anderswo, und er fühlte sich kritisiert durch ihren Mangel an Kooperation. »Alles in Ordnung?«, fragte er mitten bei der Arbeit. Was sollte sie darauf antworten? Er machte Stöße wie ein Metronom, und sofort war sie in Gedanken wieder bei Sainsbury, beim rhythmischen Blip-blipblip, mit dem die Waren über den Laserstrahl hüpften.
Außerdem hatte sie ihn nicht nur gezwungen, ein nachtleuchtendes Präservativ überzuziehen – mit dem er sich, jetzt, wo es beim Rein und Raus blitzte, vorkam wie in einem Nachtclub –, sondern er hatte auch noch eine Unmenge spermizide Creme auftragen müssen.
»Die hatten keine anderen im Laden«, erklärte sie ihm gleichmütig zum Thema Kondom. Das waren die einzigen Worte, die sie an diesem Abend mit ihm sprach.
Er setzte sie an ihrem Hochhaus ab. Sie ging ohne Abschiedskuss. Er fand, es war ein guter Abend gewesen.
Überzeugt, dass dies der Anfang einer ernsthaften Beziehung war, verwarf Richard schon bald seine letzten Skrupel und betrat den Laden von Finkelstein, dem Juwelier des Viertels. Der kurzsichtige alte Mann breitete seine Schätze [42] vor ihm aus, und Richard dirigierte seinen Blick zu einem Goldring mit einem Herzen darauf. »Was kostet der?« Zwei Stunden später trug Tracy ihn am Finger: So war die Liebe in Tooting.
Sie nahm den Ring, weil sie Ricky nicht enttäuschen wollte, und am Abend ging wieder ein phosphoreszierendes Lämpchen an und aus, an-aus, an-aus, hinten in seinem Lieferwagen im Schatten der Albert Bridge.
»Freundschaftsringe nennt man die«, erklärte er ihr im Dunkeln, betrachtete das Herz, wie es an ihrem Finger schimmerte, und machte sich dann an den Versuch, sie mit einem neuen Repertoire an Küssen zu beeindrucken.
Es war Tracys erster Ring.
Die Wohnungstür stand offen, und sie ging hinein. Als er die Tür hörte, rief er: »Ich bin hier drüben.« Sie fand Richard im Wohnzimmer. Er saß vor dem Fernseher und aß kalte Fish and Chips.
»Hübsche Farbe«, sagte sie und wies mit dem Daumen in Richtung Straße.
»Tracy!« Er wurde bleich.
»Dein Auto«, sagte sie.
»Oh. Natürlich. Mann, hast du mich erschreckt! Himmel! Was machst du denn hier? Du hättest anrufen sollen. Wieso hast du nicht geklingelt?«
»Ich dachte, ist doch ’ne schöne Überraschung.«
»Oh, toll. Das ist toll.«
Als sie zum Sofa ging, sah sie, dass er sich ein Pornovideo ansah – für eine Woche ausgeliehen, erklärte er hastig, für sie beide. Er sehe nur mal rein, ob es gut sei. »Also, was gibt’s?«
[43] Sie antwortete ihm, dass sie nicht im Traum dran denke, ihm das zu sagen, solange sich auf dem Bildschirm zwei nackte Frauen küssten, knallte die Champagnerflasche auf den Couchtisch und machte keinerlei Anstalten, sie zu öffnen.
»Champagner? Was ist passiert?«
»Nichts. Absolut nichts.«
»Und wozu dann der Schampus?«
»Hab ’ne neue Arbeit, das ist alles.«
Endlich sah er sie an: »Toll. Mann, das ist toll, Tracy. Würd ich furchtbar gerne mit dir feiern, Pech aber auch, ich… ich muss jetzt gleich weg. Scheiße. Dumm gelaufen. Bin zum Snooker verabredet, um zehn. Mist aber auch, dass das ausgerechnet heute ist. Scheißpech das.« Er drückte auf den schnellen Rücklauf, und die Videobilder hüpften zurück. »Aber morgen Abend, versprochen. Da gehn wir aus. Mist, ich muss jetzt los.«
Er ging auf den Flur und zog die Jacke an, und als er Tracy fassen und umarmen wollte, schlüpfte sie unter seinem Arm durch, und aus seinem Kuss wurde nur ein Hauch auf die Wange. »Schon gut. Wir sehen uns irgendwann, okay? Und leih nicht noch mal eine von den Kassetten da aus.«
»He… sei doch nicht so.« Aber ihre Absätze klackten schon draußen vor der Tür. »Trace?« Er sah ihrem Hüftschwung nach, bis sie um die Ecke bog und verschwand.
Man hätte eine enttäuschte Miene erwartet, aber er sah ganz und gar nicht so aus. Er warf einen Blick auf die Uhr, schloss die Tür, hängte seine Jacke wieder an den Haken und ging ins Wohnzimmer, und dann wurde er aktiv.
Er holte zwei Gläser aus dem Schrank, wischte sie mit [44] dem Hemdsärmel ab und stellte sie neben den Champagner, entfernte die Folie von der Flasche und klatschte in die Hände, begeistert über diese glückliche Fügung. »Fertig.« Sein Blick wanderte zum Fernseher, wo die Action noch immer in hohem Tempo rückwärts lief: hyperaktive Lesben halfen sich gegenseitig in magische Kleider, die ihnen aus allen Ecken des Zimmers in die Hände geflogen kamen. Aus Leidenschaft wurde Verlegenheit, bis sie am Ende vollkommen Fremde waren. Morgen würde er es bei Tracy wiedergutmachen, mit Blumen, echten Blumen aus dem Laden, aber jetzt gerade hatte er keine Zeit. Er trat vor die Haustür und sah die Straße hinauf und hinab.
Und als gehorche die Welt nun seiner Fernbedienung, hörte man aus der Ferne, wie eine Autotür zugeschlagen wurde, und gleich darauf kam das Klick-klick-klick eines anderen Paars Absätze, unterwegs zu ihm. Tracys Ablösung, mit einer Figur, die sich sehen lassen konnte. Sie kam mit schnellen Schritten auf ihn zu stolziert, warf sich in seine Arme und ließ sich eine Neuauflage des Kusses gefallen, der beim ersten Versuch danebengegangen war.
»Komm rein, du«, sagte er zu der forschen Zweitbesetzung und stieß die Mattglastür mit dem Fuß zu. Dann warf sich das schwer atmende Paar dagegen.
Benebelt von ihrem billigen Parfüm machte er sich gleich an Ort und Stelle daran, sie auszuziehen.
In ihrem Samstagabendvergnügen kamen sie nicht weiter als bis zum Flur. Wie eine entfesselte Venus ließ sie ihre Lustschreie los, als ihr der Mantel vom Leib gerissen wurde, das Kleid hochgeschoben, das Höschen heruntergezogen, der nackte Hintern gegen das kalte Glas gepresst. Jeder auf [45] der Straße hätte zusehen können, wie die Monde dieses Frauenhinterns mit jedem Stoß ihres unersättlichen Liebhabers zu- und wieder abnahmen.
Tracy wartete auf den Bus, das Fahrgeld abgezählt in der Hand. Sie fuhr gern mit den Bussen, wenn die Rushhour vorüber war. Sie waren menschenleer, und sie hielten nicht mehr überall. Sie sah sie als riesige Limousinen, die sie brachten, wohin sie wollte. Sie kamen mit quietschenden Reifen um die Ecke wie auf Verabredung, fuhren sie flink nach Hause, bevor das Badewasser, das ihr Dienstmädchen schon eingelassen hatte, kalt wurde. Sie hätte sogar bei Cartier halten können, um sich noch zu später Stunde und in aller Verschwiegenheit ihren Ring richten zu lassen.
Sie spielte mit dem Schmuckstück an ihrem Finger. Sie hatte ihn, allerdings bei einem anderen Juwelier, enger machen lassen, und nun war er zu eng. Er ließ sich nur schwer abziehen, und er drückte, gerade wenn ihr so zumute war wie jetzt im Augenblick. Je mehr sie daran zerrte, desto mehr schwoll der Finger an, und jetzt saß der Ring fest.
Trotzdem zerrte sie weiter. Es war ihre Schuld. Sie war mit jemandem zusammen, den sie überhaupt nicht mochte. Wie konnte das sein? Jedenfalls war er nicht der Künstler, für den sie ihn gehalten hatte. Der Grabstein war ein echter Reinfall gewesen. Wenn sie nicht aufpasste, würde sie den Kerl noch heiraten. Eins stand fest: Man musste sich sehr gut überlegen, zu wem man in diesem Leben ja sagte, besonders wenn man den Verdacht nicht loswurde, dass man es nur tat, um den einen grandiosen Augenblick zu genießen, nicht um dessentwegen, was dann folgte.
[46] Das Studium der Frauen
Fest entschlossen herauszufinden, ob seine Tochter tatsächlich, wie er es befürchtete, zur Prostituierten geworden war, riss Eric Pringle sich von den Sechsuhrnachrichten los und folgte ihr. »Überlass das mir«, sagte er zu seiner Frau. »Ich kümmere mich drum.«
»Nicht, Eric…«
»Überlass das mir.«
Als seine einzige Tochter den Bus bestieg, um zur »Arbeit« zu fahren, drehte er den Zündschlüssel seines Autos. Er hatte unauffällig gegenüber der Bushaltestelle geparkt und aus dem Schatten heraus beobachtet, wie sie gekommen war, wie sie zwei Zigaretten geraucht – dagegen konnte er nichts sagen – und ungeduldig Kieselsteine auf die Straße gekickt hatte. Er kam sich wie ein Polizist vor, doch was er beobachtete, war sein eigenes Kind.
Als der Bus anfuhr, legte er den ersten Gang ein. Er wollte unauffällig Distanz halten – zwanzig Meter etwa.
Er sah das so: Sie als Eltern hatten versucht, eine Tochter großzuziehen, die optimistisch in die Welt blicken sollte. Sie hatten ihr bestimmte Werte und Überzeugungen mitgegeben und konnten nur hoffen, dass ihr Leben sich um diese Werte und Überzeugungen drehen würde wie ein Planet um die Sonne. Eric und Monica hatten nur dieses eine Kind, [47] und vielleicht erwarteten sie zu viel von ihm. Konnte gut sein, doch das ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Ihre schönsten Träume, ihre Hoffnungen, Einstellungen, Ideale, Vorlieben, ihre Ressourcen, ihre Zeit, ihre Gedanken, ihren Rat und ihre Ängste – allem voran ihre Ängste –, all das hatten sie über die Jahre in sie investiert. In ihrer Vorstellung war sie ganz und gar das Produkt ihrer Eltern, ein wandelndes Reklameschild ihrer Werte und ihrer Gene in der Welt von heute und ihre einzige Vertreterin in der von morgen.
Aber was half das? Es gab nie die Gewissheit, dass sie oder sonst ein Kind in den vorbestimmten Bahnen blieb. Da gab es nichts Absolutes, und keine zwei Umlaufbahnen waren gleich. Und so konnte Eric Pringle, wie er sich nun hinter das Lenkrad seines Autos duckte, nicht ausschließen, dass er längst, ohne es zu wissen, der Vater einer billigen Hure war. Ein so jähes Scheitern seiner Hoffnungen konnte er nicht verkraften. Das, sagte er sich, konnte einfach nicht sein, und er ließ die Ereignisse der Woche Revue passieren und überlegte, ob sie sich anders deuten ließen.
Als sein Verdacht erst einmal geweckt war, hatte er sie mit Adleraugen beobachtet. Ihre Garderobe war wieder dezenter geworden, doch das hatte ihm die Ängste nicht genommen. Vielleicht war sie in einem der besseren Bordelle untergekommen. Er hatte überlegt, ob er in ihr Zimmer einbrechen sollte, ihre Sachen durchsuchen, aber er war noch rechtzeitig zur Vernunft gekommen. Ihr Zimmer war ihr Allerheiligstes, und mit einem Einbruch hätte er einen Schaden angerichtet, der nicht wiedergutzumachen gewesen wäre. Besser abwarten und die Augen offen halten.
[48] Eric hatte vor dem Fernseher zu Abend gegessen und sich dabei ausgemalt, wie er die Handtasche seiner Tochter packen und auf dem Couchtisch ausleeren und wie er »Du Nutte!« brüllen würde, wenn er Beweise für ihr neues Gewerbe fand. Wusste der Himmel, was es da an Ausrüstung, Cremes oder dergleichen gab. Aber der Gedanke, dass er solches Beweismaterial tatsächlich finden könnte, setzte ihm zu sehr zu. Stattdessen löcherte er sie mit der Frage nach einer Kellnerinnenuniform – während Tracy nur an einer Scheibe Toast knabberte und erklärte, sie werde sicher im Restaurant essen. Eric wollte wissen, was das für eine Kellnerin war, die keine Uniform trug.
»Wahrscheinlich bekomme ich heute Abend eine.«
Als sie dann auch noch sein Angebot, sie zur Arbeit zu fahren, ablehnte und zum Mantel griff, war er wirklich misstrauisch geworden.
»Glaubst du es jetzt?«, sagte er bereits im Mantel zu Monica. »Wann hat sie jemals eine Fahrgelegenheit ausgeschlagen?«
»Komm ja nicht auf den Gedanken und fahr ihr nach. Du machst dich lächerlich.«
»Misch du dich da nicht ein. Keine Uniform? Wenn ich mich irre, bin ich froh. Wenn nicht, wirst du mir dankbar sein.«
»Eric!«, rief sie, als er schon die Hand nach der Tür ausstreckte.
»Pssst!« Er zeigte nach unten. »MrsWilson.«
»Sie ist zwanzig! Lass sie in Ruhe!«
Die Tür schloss sich.
MrsWilson war die Rentnerin in der Wohnung unter [49] ihnen. Sie war ans Bett gefesselt und trug ein Hörgerät von so phänomenaler Leistung, dass sie der reinste Horchposten war. Für den Rest des Abends sollte sie allerdings nichts mehr zu hören bekommen.
An der Haltestelle in der Larchmont Street stieg Tracy aus und ging mit schnellen Schritten weiter in Richtung Osten. Eric behielt seine Tochter im Auge, bis er das Auto auf einem Parkplatz abstellen und die Verfolgung zu Fuß fortsetzen konnte. Seine neue Rolle war ihm schon jetzt zuwider. Vor ein paar Jahren war er seiner Tochter manchmal mit dem Auto nachgefahren und hatte sie beobachtet, wenn sie nicht genau sagen wollte, was sie vorhatte, und er ein Rendezvous mit einem schmuddeligen Knaben vermutete, der nichts als Pornographie im Kopf hatte; aber zu Fuß war er ihr noch nie gefolgt.
Als sie ein unbeleuchtetes Restaurant betrat, blieb er stehen und zündete sich eine Zigarette an. Persischer Garten – so, so. Mit den arabischen Schriftzeichen auf der Fensterscheibe konnte das gut eine Deckadresse für einen Puff sein. Sein Herzschlag beschleunigte sich wieder. Was hatte er gelesen? Ein Pornonetz oder etwas in der Art? Mädchenhandel? Ja, jetzt fiel es ihm wieder ein: Sie hielten sie als Geiseln fest, so war es. Schafften sie per Schiff nach Korfu und von dort weiter in die Türkei, nach Istanbul. Es hatte in der Sun gestanden: »Sexsklavinnen!«, in großen Lettern.
Eric stellte sich auf die Zehenspitzen und versuchte, ins Innere des Restaurants zu spähen, aber da die alte Verletzung an seinem linken Fuß noch immer schmerzte, konnte er sich nicht so hoch recken, dass er über die [50] Gardinenstange blicken konnte. Seine Tochter war irgendwo da drin und trieb Gott weiß was, und er war zehn Zentimeter zu klein, um etwas dagegen zu unternehmen! Er hörte sogar schwülstige Musik. Wenn das kein schlechtes Zeichen war! Um diese Tageszeit war Musik fast schon gleichbedeutend mit Ausschweifungen. Er wich zurück, sah sich um, entdeckte einen Absperrkegel und zerrte ihn ans Fenster. Mit einem Fuß balancierte er auf der Spitze, vollführte dabei eine unbeholfene Pirouette und legte die Hände seitlich vors Gesicht, weil die Fensterscheibe spiegelte. In dieser Haltung, heftig blinzelnd bei dem Versuch, seine Tochter in dem dunklen Innenraum zu erspähen, bemerkte er nicht, dass Sam Sahar, der mittlerweile eingetroffen war, neben ihm stand und ihn fasziniert beobachtete.
»Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?«, fragte der Restaurantbesitzer schließlich.
Eric sah nach unten. »Oh. Ähm, ja. Hallo. Guten Tag. Ich wollte mich nur, ähm… mal ein bisschen umsehen.«
»Suchen Sie etwas Bestimmtes?«
Eric sprang so lässig wie möglich von dem Absperrkegel herunter. »’tschuldigung. Nein. Nichts Besonderes. Nettes Lokal. Wollte einfach nur, na Sie wissen schon… Sieht echt gut aus.« Er wies mit dem Daumen auf das Restaurant, während er den gutgekleideten, gepflegten Herrn mit einem gewinnenden Lächeln musterte: offensichtlich wohlhabend, irgendwie arabisch, sicher, aber wie ein Sklavenhändler sah er nicht aus.