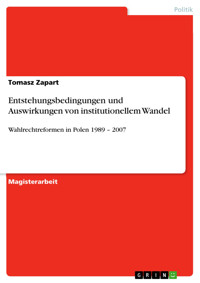
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Politik - Region: Osteuropa, Note: 1,5, Ludwig-Maximilians-Universität München, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Einführung kompetitiver Wahlen in Ostmitteleuropa (OME) brachte ein grundlegendes Problem ans Tageslicht. Welches der zur Verfügung stehenden Wahlrechtsysteme sollte in den jeweiligen OME-Staaten in den Gründungswahlen verwendet werden? Recht bald zeigte sich, dass in den meisten Fällen bereits kurz nach den ersten freien Wahlen ein erneutes Reformbedürfnis entstand. Gründe dafür waren breit verstreut und verdeutlichten den Anfang vom institutionellen Wandel, der noch einige Jahre die meisten OME-Staaten begleiten sollte. Die Dritte polnische Republik zeigte eine enorm hohe Reformintensität, die kaum mit westlich demokratischen Standards zu vergleichen war, und erweckte damit das Interesse von politikwissenschaftlichen Wahlforschern. Bis in die neunziger Jahre hinein konzentrierte sich die Wahlsystemforschung auf die Untersuchung der Auswirkungen von Wahlrechtsystemen auf Parteiensysteme. Ausgehend von stabilen und nur sehr selten reformierten Systemen in den westlichen Demokratien und einem dem entsprechend geringem empirischem Untersuchungsfeld erschien dies nicht überraschend. Doch die Konstellation in den OME-Staaten nach 1989 ermöglichte es den neuen politischen Kräften, Einfluss auf die Übersetzungsmethode der Wählerstimmen in Parlamentssitze zu nehmen. Die Dynamik, die diesen Prozess des institutionellen Wandels begleitete, brachte eine enorme Fülle an empirischem Analysematerial. Das Beispiel Polens steht exemplarisch für die wahlrechtlichen Prozesse in den OME-Staaten. Die polnischen electoral engineers konnten in den Jahren 1989 bis 2005 das Wahlrecht fünf Mal erfolgreich reformieren. Rechnet man die semikompetitiven Vorgründungswahlen von 1989 mit und geht damit von sieben abgehaltenen Wahlen bis 2007 aus, so ergibt sich daraus der Schluss, dass nur zwei Mal in aufeinanderfolgenden Wahlen identisches Wahlrecht angewendet wurde. Die enorm häufige Reform des Wahlrechts und die damit verbundenen Akteurskonstellationen politischer Entscheidungsträger, während der jeweiligen Gesetzesänderungen, sind ein deutliches Indiz für sitzmaximierende Handlungsmotivationen der Parteien. Dabei zeigt vor allem die Untersuchung über das Abstimmungsverhalten Reformkoalitionen, die keinerlei ideologische Kongruenz aufweisen, und untermauert so den Befund über nutzenmaximierend handelnde parteipolitische Akteure.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Page 4
1. Einleitung
Die Einführung kompetitiver Wahlen in Ostmitteleuropa (OME) brachte ein grundlegendes Problem ans Tageslicht. Welches der zur Verfügung stehenden Wahlrechtsysteme sollte in den jeweiligen OME-Staaten in den Gründungswahlen verwendet werden? Recht bald zeigte sich, dass in den meisten Fällen bereits kurz nach den ersten freien Wahlen ein erneutes Reformbedürfnis entstand. Gründe dafür waren breit verstreut und verdeutlichten den Anfang vom institutionellen Wandel, der noch einige Jahre die meisten OME-Staaten begleiten sollte. Die Dritte polnische Republik zeigte eine enorm hohe Reformintensität, die kaum mit westlich demokratischen Standards zu vergleichen war, und erweckte damit das Interesse von politikwissenschaftlichen Wahlforschern.
Bis in die neunziger Jahre hinein konzentrierte sich die Wahlsystemforschung auf die Untersuchung der Auswirkungen von Wahlrechtsystemen auf Parteiensysteme. Ausgehend von stabilen und nur sehr selten reformierten Systemen in den westlichen Demokratien und einem dem entsprechend geringem empirischem Untersuchungsfeld erschien dies nicht überraschend. Doch die Konstellation in den OME-Staaten nach 1989 ermöglichte es den neuen politischen Kräften, Einfluss auf die Übersetzungsmethode der Wählerstimmen in
Parlamentssitze zu nehmen. Die Dynamik, die diesen Prozess des institutionellen Wandels begleitete, brachte eine enorme Fülle an empirischem Analysematerial. Das Beispiel Polens steht exemplarisch für die wahlrechtlichen Prozesse in den OME-Staaten. Die polnischenelectoral engineerskonnten in den Jahren 1989 bis 2005 das Wahlrecht fünf Mal erfolgreich reformieren. Rechnet man die semikompetitiven Vorgründungswahlen von 1989 mit und geht damit von sieben abgehaltenen Wahlen bis 2007 aus, so ergibt sich daraus der Schluss, dass nur zwei Mal in aufeinanderfolgenden Wahlen identisches Wahlrecht angewendet wurde. Die enorm häufige Reform des Wahlrechts und die damit verbundenen Akteurskonstellationen politischer Entscheidungsträger, während der jeweiligen Gesetzesänderungen, sind ein deutliches Indiz für sitzmaximierende Handlungsmotivationen der Parteien. Dabei zeigt vor allem die Untersuchung über das Abstimmungsverhalten Reformkoalitionen, die keinerlei ideologische Kongruenz aufweisen, und untermauert so den Befund über nutzenmaximierend handelnde parteipolitische Akteure. Diese Tatsachen blieben nicht ohne Auswirkung auf die Wahlsystemforschung. Seit Mitte der neunziger Jahre wurden neben den Effekten von Wahlrechtsystemen auf Parteiensysteme verstärkt die Entstehungsbedingungen dieser in den Fokus der Analyse gerückt. Der in diesem Zusammenhang stehende Begriff desconsitutional design(Lijphart 1992; Sartori 1996)
Page 5
wurde immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit gelenkt. In der Folge dieser Diskursentwicklung beschäftigten sich die Untersuchungen mit den Hintergründen und der Genese von Wahlrechtreformen sowie den strategischen Motivationen der jeweiligenelectoral engineersin den OME-Staaten (Benoit et al. 2001, 2004; Ka-Lok 2001; Birch et al. 2002; Grotz 2005).
Die Verschiebung des Erkenntnisinteresses in der neuen Generation der Wahlsystemforschung ist für diese Arbeit grundlegend und lenkt den Schwerpunkt der Analyse auf die Entstehungsbedingungen von institutionellem Wandel am Beispiel der Wahlrechtreformen in Polen. Die Auswirkungen des Wahlrechts auf das Parteiensystem, als Fokus der traditionellen Wahlsystemforschung, werden in diesen Untersuchungskontext hinein gebunden.
Für diese Arbeit ist somit zum einen die Untersuchung der Genese von Wahlrechtreformen sowie der dahinter steckenden Motivationen der verantwortlichen politischen Akteure und damit die Beantwortung der Frage, warum sie gerade diese oder jene Änderung des Wahlsystems befürworteten, von größtem Interesse. Zum anderen werden die Konsequenzen und Effekte der getroffenen Entscheidungen aufgezeigt und vor allem im Hinblick auf die Kondition des Parteiensystems untersucht, um damit die Realisierung der strategischen Ziele
der sitzmaximierend handelnden parteipolitischen Akteure verifizieren zu können. Anders formuliert kann das Erkenntnisinteresse auf drei zentrale Fragen zugespitzt werden. Wie kamen die Wahlrechtreformen in Polen in den Jahren 1989 bis 2007 zustande? Warum wurden bestimmte wahlrechtliche Lösungen von den parteipolitischen Akteuren präferiert und andere verworfen? Und welche Auswirkungen hatten die so vorgenommen Änderungen des Wahlrechts auf das sich herausbildende Parteiensystem?
Welche politikwissenschaftlichen Theorien, Methoden und Konzepte lassen sich in diesem Zusammenhang anwenden, um diese Aspekte fundiert beleuchten zu können? Im Bereich der Wahlsystemforschung liegt eine Vielzahl von möglichen Untersuchungsschemata in der politikwissenschaftlichen Literatur vor, auf die innerhalb dieser Arbeit zurückgegriffen werden kann.
Das auf die Genese und Motivationen von Wahlrechtreformen gerichtete Haupterkenntnisinteresse dieser Arbeit wird in ein Theorieprogramm eingebunden, das von Politikwissenschaftlern als das große neue disziplinübergreifende Theoriekonzept bezeichnet wird. Der „Neoinstitutionalismus“ ist deswegen besonders geeignet, das hier vorliegende Thema zu charakterisieren, weil er besonderes Augenmerk auf das Problem des „Institutionendesigns“ legt und dieses mit interagierenden Akteuren in Verbindung bringt.
Page 6
Damit stellt er den Gegenpol zur anderen großen Theorieperspektive des 20. Jahrhunderts, der Systemtheorie, dar und wird bei der Motivationsanalyse aufgrund seiner soziologischen Herkunft von besonderer Wichtigkeit sein. Dabei werden zwei spezielle Ausprägungen dieser „Supertheorie“ in dieser Arbeit als Untersuchungsrahmen angewandt, die sich insbesondere mit den Konstellationen von Akteuren im institutionellen Kontext beschäftigen. Zum einen handelt es sich dabei um das „Vetospielertheorem“ (Tsebelis 2000), zum anderen um den „akteurszentrierten Institutionalismus“ (Scharpf/Mayntz 1995). Bei beiden handelt es sich um eine Handlungstheorie, die ihren Ursprung in der Soziologie besitzt und hier vor allem zur Systematisierung verschiedener Akteurskonstellationen verwendet wird. Mit Hilfe dieses theoretischen Konzeptes wird es möglich sein, die in unserem Fall parteipolitischen und institutionellen Zusammenhänge darzustellen und in den Zusammenhang von Entstehungsbedingungen und Motivationen der analysierten Institutionenreformen zu bringen. Für die Erstellung sehr präziser Untersuchungsergebnisse wird ein weiteres Untermodell dieses großen Theoriegebäudes angewandt. Das sogenannte „office-seeking-Modell“, als Gegenkonzept zum „policy-seeking-Modell“ (Benoit et al. 2001, 2004), wird im Hinblick auf die genaue Bestimmung der Motivationen aller beteiligten Akteure nützlich sein. Mit dem Ansatzpunkt, Wahlsystementwicklung als institutionenpolitischen Prozess und damit als eine
besondere Variante von „policy-Reform“ (Grotz 2005) zu betrachten, sind klare Auskünfte über die angestrebte Erkenntnis zu Entstehungsbedingungen und Motivationen von Wahlrechtreformen in Polen in den Jahren 1989 bis 2007 zu erwarten. Zur Beantwortung der Frage nach den Auswirkungen des Wahlrechts auf das Parteiensystem wird, ausgehend von den durch Duverger (1959) formulierten Gesetzmäßigkeiten, auf eine sogenannte „Theorie mittlerer Reichweite“ zurückgegriffen. Die von Duverger aufgestellte und in der Wahlsystemforschung bereits längst überholte Kausalitätsbeziehung wird vor allem mit den Arbeiten von Sartori (1996) und Nohlen (2007) auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht, um aktuelle Befunde am hier untersuchten polnischen Beispiel überprüfen zu können. Die Effekte des Wahlsystems auf das Parteiensystem werden nicht nur etwas über dessen Kondition verraten, sondern im Hinblick auf den ersten Teil der Untersuchung das Gelingen bzw. Misslingen der jeweiligen Akteure bezüglich ihrer Zielrealisierung verifizieren.
Darüber hinaus werden die zentralen Punkte der Wahlsystematik, die für die empirische Untersuchung unerlässlich sein werden, im theoretischen Teil erörtert. Im Bezug auf die Vorstellung einzelner technischer Elemente sind die Arbeiten von Sartori und Nohlen ausschlagegebend. Das Ziel ist der Aufbau eines Basiswissens vor allem im Bezug auf den
Page 7
hoch komplexen Aspekt der Stimmenverrechnung und Wahlkreiseinteilung. Präzises Detailwissen ist innerhalb dieser Materie von besonderer Bedeutung, um die einzelnen Reformschritte im polnischen Wahlrecht im Hinblick auf die Motivationen der beteiligten Akteure beurteilen zu können.
Ausgehend von der, dieser Arbeit zugrunde liegenden, theoretischen Rahmensetzung wird im Folgenden der chronologische Aufbau dieser Untersuchung im Querschnitt präsentiert. Im zweiten Kapitel werden zunächst die technischen Aspekte der Wahlsystemforschung dargestellt. Dann wird der theoretische Rahmen für die Analyse der Auswirkungen des Wahlsystems auf das Parteiensystem abgesteckt. Im Anschluss daran wird ein Abschnitt über die Verschiebung des Erkenntnisinteresses in den Politikwissenschaften hin zu den Phänomenenconstitutional designundelectoral engineeringpräsentiert. Es folgt ein Überblick über relevante Erklärungsansätze zu Wahlrechtreformen in OME. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die von Grotz (2005) zusammengestellten Analysevariablen gelegt. Ausgehend von seinen Prämissen folgt im nächsten Punkt des zweiten Kapitels die Darstellung der theoretischen Konzepte des „Neoinstitutionalimus“ anhand des „Vetospielertheorem“ sowie des „akteurszentrierten Institutionalismus“. Mit diesem Punkt endet die Vorstellung der theoretischen Grundlagen, die zur Analyse der
Entstehungsbedingungen und Motivationen der Wahlrechtreformen nützlich sein werden. Im letzten Punkt des zweiten Kapitels wird eine kurze Zusammenfassung dargestellt, um daran anknüpfend die Verortung dieser Arbeit im aktuellen Forschungsdiskurs vorzunehmen und die Hypothese vorzustellen.
Im dritten Kapitel folgt nun der umfangreichste Teil, der sich mit der empirischen Untersuchung der einzelnen Wahlrechtreformkontexte in den Jahren 1989 bis 2007 beschäftigt. Ausgehend von den semikompetitiven Vorgründungswahlen von 1989 und der damit verbundenen Einführung der absoluten Mehrheitswahl rücken danach die Gründungswahlen von 1991 mit der fast reinen Verhältniswahl in den Fokus der Arbeit. Es folgt die Analyse der Reform von 1993 und der daraus folgenden Wahl unter entschärftem proportionalem Wahlrecht. Die gescheiterte Reform von 1997 wird mit gleichem Aufwand untersucht, da sie vor allem im Bezug auf die geglückte Reform von 2001 eine enorme Rolle spielt. Die letzte erfolgreich durchgeführte Wahlrechtreform im Jahr 2002 stellte den Ausgangspunkt für eine wachsende institutionelle Stabilität, die sich in einem identischen Wahlrecht bei den Wahlen 2005 und 2007 manifestierte.
Page 8
Der schematische Aufbau der sechs Untersuchungsepisoden enthält jeweils eine Analyse des vorhandenen Status Quo der Akteurskonstellation und des im Einzelnen untersuchten Entstehungsvorgangs der jeweiligen Reform sowie der Wahlergebnisse. Im anschließenden Diskussionskapitel werden die im empirischen Teil gesammelten Erkenntnisse systematisiert und im Bezug auf die Auswirkungen sowie die Motivationen überprüft. Die daraus hervorgehenden Untersuchungsergebnisse werden im weiteren Verlauf in Zusammenhang mit der gestellten Hypothese verifiziert.
Die Arbeit endet mit einer Beurteilung der bisherigen Reformen und einem Ausblick auf mögliche weitere Entwicklungen, mit direktem Bezug zu einem 2008 vorgestellten Wahlrechtprojekt.
Doch zunächst gilt unsere Aufmerksamkeit der Klassifikation von Wahlsystemen im Allgemeinen und den damit verbundenen technischen Elementen im Speziellen sowie ihren Auswirkungen auf die Parteiensysteme in der klassischen Wahlsystemforschung.
Page 9
2. Wahlsystemforschung und Theorien des institutionellen Designs
2.1 Wahlsysteme und ihre Auswirkungen
2.1.1 Typen von Wahlsystemen
Eine Untersuchung über die Entstehungsbedingungen und Auswirkungen von Wahlsystemen basiert auf der Grundlage von Kenntnissen über deren systematische und technische Details. Eine eindeutige Klassifikation von Wahlsystemtypen erscheint aufgrund von fehlender Einheitlichkeit in den Begrifflichkeiten schwierig. Die im Folgenden vorgestellte Unterscheidung basiert auf den Arbeiten von Nohlen (2007) und Sartori (1996). Ausgehend von der Mehrheits- und Verhältniswahl als den zwei Haupttypen ergibt sich die grundlegende Frage nach der Klassifikation im Bezugauf die Definitionskriterien. „Sollen die beidenGrundtypen nach den technischen Elementen, nach dem Repräsentationsziel oder gar nachden empirischen Auswirkungen definiert werden […].“1Sartori, der das technische Element der Wahlkreisgröße als ausschlaggebend für die Einteilung hält, definiert ein System als majoritär, wenn es in Einerwahlkreisen stattfindet und der Sieger alles gewinnt, entsprechend
demfirst-past-the-post-system.Im Gegensatz dazu ist ein System, das in Wahlkreisen mit zwei oder mehr Kandidaten stattfindet und zwei oder mehr Sieger auf der Basis des höchsten Stimmenanteils hervorbringt, proportional.2Nohlen hält eine solche Klassifizierung für falsch und nennt als Beispiel die deutsche Verhältniswahl mit Einerwahlkreisen. Er entscheidet sich für die Repräsentationsprinzipien in der Definitionsfrage der Grundtypen und damit für die Funktion des Systems.3„Es gibt zwei Prinzipien politischer Repräsentation, die je eigeneZielvorstellungen politischer Repräsentation aufweisen[…] Bei derMehrheitswahl ist es das Ziel, eine parlamentarische Regierungsmehrheit einer Partei oder eines Parteienbündnisses hervorzubringen; bei der Verhältniswahl ist es dagegen die weitgehend getreue Wiedergabeder in der Bevölkerung bestehenden sozialen Kräfte und politischen Gruppen im Parlament.“4Neben der Unterscheidung zwischen Majorz und Proporz als Repräsentationsprinzip existiert die Entscheidungsregel als zweite Einteilungskategorie. Betrachtet man nach Nohlen die
1Nohlen, Dieter, 2007: Wahlrecht und Parteiensystem. Zur Theorie und Empirie der Wahlsysteme.
Verlag Barbara Budrich. S. 132
2Sartori, Giovanni, 1996: Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures,
Incentivess and Outcomes. New York University Press. S. 3-4
3Nohlen, Dieter, 2007: Wahlrecht und Parteiensystem... S. 132-135
4Nohlen, Dieter, Kasapovic Mirjana, 1996: Wahlsysteme und Systemwechsel in Osteuropa. Leske
und Budrich. S. 18
Page 10
Mehrheitswahl als Entscheidungsregel, so ist der Mandatsgewinn eines Kandidaten oder einer Partei an den Gewinn der Stimmenmehrheit gebunden. Dabei kann es das Kriterium der relativen oder absoluten Stimmenmehrheit in einem Wahlkreis geben. Dagegen ist die Mandatsvergabe innerhalb der Entscheidungsregel der Verhältniswahl von den jeweiligen Stimmanteilen der Wahlbewerber abhängig. „Eine Partei erhält so viele Mandate zugesprochen, wie die entsprechende Wahlzahl in der von ihr erreichten Stimmenanzahl enthalten ist oder wie viele Höchstzahlen sie vorweisen kann.“5Daraus folgt, dass die Entscheidungsregel den Mechanismus der Übersetzung von Stimmen in Mandate definiert. Das Repräsentationsprinzip bezieht sich, wie bereits dargestellt, auf die nationalen Ergebnisse einer Wahl. Die Erkenntnisse können wie folgt zusammengestellt werden.
Abbildung 1: Grundlegende Klassifikation von Wahlsystemen
Quelle: nach Nohlen (2007: 142)
von Vorteil, weil sich in der wahlpolitischen Realität viele Möglichkeiten der Kombination ergeben. Sie können aber unabhängig von gegenseitigen Anleihen, gemäß der Maximetertium non datur,immer einem der Repräsentationsziele zugeordnet werden. Betrachtet man jedoch die klassische Variante der Wahlsysteme, so kann man konstatieren, dass bei der relativen Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen mit der Majorzregel gewählt wird und das Repräsentationsziel der Mehrheitsbildung verfolgt wird. In umgekehrter Logik dazu wird bei der Verhältniswahl in großen Wahlkreisen nach Proporz und dem Bestreben nach proportionaler Repräsentation gewählt. Daraus folgt, dass sich in der klassischen Ausführung Entscheidungsregel und Repräsentationsprinzip entsprechen.6
Im Kontext politischer Auswirkungen der Majorzregel bleibt grundsätzlich festzustellen, dass nur die für den Sieger abgegebenen Stimmen in der Folge auch politisch zählen. Bei der Verhältniswahl ist im Gegensatz dazu die sogenannte „Erfolgswertgleichheit der Stimmen“ hergestellt. Es geht also nicht nach dem Prinzip des Siegers, der alles gewinnt. Darüber hinaus wird der Verhältniswahl der Vorzug des breitgesellschaftlichen Meinungsspiegels gegeben,
5Nohlen, Dieter, 2007: Wahlrecht und Parteiensystem... S. 141
6Ebenda. S. 143
Page 11
während die Mehrheitswahl vor allem als ein Mittel gegen die Parteizersplitterung gesehen wird.
Im Allgemeinen lassen sich anhand von zwei Bewertungskriterien Funktionen der Einzelnen Wahlsystemtypen darstellen. Das erste Kriterium bezieht sich auf die Repräsentation, wobei zum einen die Vertretung aller relevanten gesellschaftlichen Gruppierungen gemeint ist und zum anderen der Grad an Proportionalität im Bezug auf das „Stimmen-Mandate-Verhältnis“. Das zweite Kriterium der Konzentration und Effektivität bezieht sich zum einen auf die Reduzierung der Parteien im Parlament, ausgehend von allen zur Wahl angetretenen und zum anderen auf die Schaffung stabiler Mehrheiten im Parlament.
Abbildung 2: Wahlsystemtypen und ihre Funktionserfüllung
Quelle: modifiziert nach Nohlen/Kasapovic (1996: 187)
Im Kontext realpolitischer Wahlsystemsubtypen sind letztendlich aber vor allem die speziellen Einzelregelungen für die Auswirkungen verantwortlich. Während es bei der Majorzregel nur zwischen der absoluten und relativen Mehrheit zu unterscheiden gilt, kommen beim Proporz viele Gestaltungsmöglichkeiten in Frage. Im polnischen Kontext sind es jedoch vor allem die Einzelnen technischen Elemente der Verhältniswahl, die zum politischen Spielball der Entscheidungsträger und ihrer parteipolitischen Interessen werden. Im Folgenden sollen deshalb die wichtigsten Elemente wie Wahlkreiseinteilung und Stimmenverrechnung sowie ihre Auswirkungen dargestellt werden.
2.1.2 Technische Elemente in Wahlsystemen
Auf dem ersten Platz der politischen Agenda vonelectoral engineerssteht i.d.R. die Wahlkreiseinteilung. Der Streit über die Festlegung von Anzahl und Größe der Wahlkreise basiert auf der bewiesenen Kausalität zwischen der Wahlkreiseinteilung und Proportionalität
Page 12
bzw. Disproportionalität des Wahlsystems. Neben den Einerwahlkreisen gibt es die Mehrpersonenwahlkreise, die je nach Struktur verschiedene Effekte in der Übersetzung von Stimmen in Mandate produzieren können. Dabei geht es im Detail um die Bestimmung der in einem Wahlkreis zu gewinnenden Mandate. Die Mehrpersonenwahlkreise lassen sich „in kleine (2-5 Mandate), mittlere (6-9 Mandate) und große (10 und mehr)“7unterscheiden. Diese Einteilung ist sowohl bei Sartori als auch bei Nohlen anzutreffen. Staaten mit kleinen bzw. mittleren Wahlkreisen besitzen die geringste Proportionalität.8Damit wird der Kern der damit verbundenen Problematik aufgezeigt. Der Repräsentationsschlüssel bzw. die „Erfolgswertgleichheit der Stimmen“ als demokratischer Grundsatz wird je nach Wahlkreisgröße verändert. Wird demnach die Entscheidungsregel des Proporz verwendet, gilt im Bezug auf das „Stimmen-Mandate-Verhältnis“ die Regel, dass „je kleiner der Wahlkreis, desto geringer ist der Proportionalitätseffekt des Wahlsystems - und desto geringer sind gewöhnlich auch die Chancen kleiner Parteien ins Parlament zu gelangen. Hinter dieser Regel steckt ausschließlich Mathematik: Der prozentuale Stimmenanteil, den eine Partei benötigt, um ein Mandat zu erhalten, ist rein mathematisch umso größer, je weniger Mandate in einem Wahlkreis zu vergeben sind.“9Die sich daraus ergebenden Folgen der Walkreiseinteilung für die politische Repräsentation und das damit zusammenhängende
Parteiensystem werden noch deutlicher, wenn man die unterschiedlichen Kennzahlen, abhängig von der Wahlkreisgröße, für Mandatsgewinn betrachtet. Braucht eine Partei oder ein Kandidat in einem Dreierwahlkreis 18% der Stimmen, um ein Mandat zu erreichen, so sinkt diese Kennzahl um genau 50% in einem Neunerwahlkreis, bei dem der gleiche Kandidat bzw. Partei nur noch 9% der Wählerstimmen auf sich vereinigen muss, um an ein Mandat zu gelangen.10Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus der geraden bzw. ungeraden Mandatszahl in Wahlkreisen. „Tendenziell begünstigen kleine Wahlkreise gerader Mandatszahl die stimmenmäßig unterlegene, Wahlkreise ungerader Mandatszahl die stimmenmäßig überlegene Partei.11
Mit dieser Simulation wird deutlich, welche Rolle die Wahlkreiseinteilung in der politischen Debatte deselectoral engineeringspielen kann. Der Anstieg der Disproportionalität in Einerwahlkreisen bzw. kleinen Wahlkreisen kann durch die Einführung von nationalen Wahlkreisen bzw. Listen reduziert werden.
7Nohlen, D., Kasapovic M., 1996: Wahlsysteme und Systemwechsel in Osteuropa… S. 23
8Sartori, Giovanni, 1996: Comparative Constitutional Engineering... S. 8
9Nohlen, D., Kasapovic M., 1996: Wahlsysteme und Systemwechsel in Osteuropa… S. 23
10Nohlen, Dieter, 2007: Wahlrecht und Parteiensystem... S. 93
11Ebenda. S. 97
Page 13
Neben dem Einfluss der Wahlkreisgröße auf das „Stimmen-Mandate-Verhältnis“ kommt es zu einer weniger mathematischen als psychologischen Konsequenz im Bezug auf das Verhältnis zwischen Wähler und Abgeordneten. Im Gegensatz zu den Parteilisten der Mehrpersonenwahlkreise wird beim Einerwahlkreis ein bestimmter Kandidat gewählt. Dabei kommt es auf einen starken Einzelkandidaten an, der im Gegensatz zu „Insidern“ sicher „durchgebracht“ werden kann. Sartori vergleicht die unbekannten Gesichter aus Mehrpersonenwahlkreisen mit „Pferden Calligulas“.12Vorweggreifend kann man sagen, dass vor allem die Regierungskoalition bei der „Vorgründungswahl“ 1989 dieses für sich auszunutzen um mit medial bekannten Persönlichkeiten die Opposition in den kompetitiv zu erwerbenden Sitzen auszuschalten bzw. zu begrenzen versuchte. Warum diese Rechnung nicht aufging wird am Anfang des dritten Kapitels analysiert (> Kap. 3.1). Neben der Wahlkreiseinteilung wird die Wahlbewerbung hier als zweites wahlsystematisches Element beschrieben. Wie bereits angesprochen ist dabei zwischen einer Einzelkandidatur und der Liste zu differenzieren. Die Listen, die nach Nohlen als Parteilisten zu begreifen sind, erlauben dem Wähler, seine Favoriten nicht zwingend innerhalb einer Partei anzukreuzen. Dabei gibt es drei Arten von Listen. Innerhalb der „starren Liste“ ist die Reihenfolge der Kandidaten vorgegeben und der Wähler kann lediglichen blocseine Stimme für eine





























