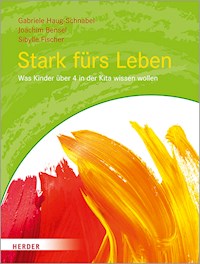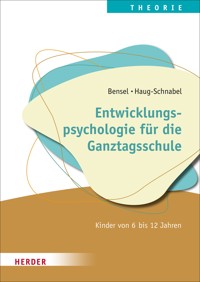
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch finden pädagogische Fachkräfte in Grundschule und Ganztag alles, was man über die Entwicklung von Großen Kindern wissen muss: Die renommierten Wissenschaftler:innen Gabriele Haug-Schnabel und Joachim Bensel beschreiben die neuesten Erkenntnisse aus Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und der Verhaltensbiologie. Außerdem zeigen sie die Einflussfaktoren auf die kindliche Entwicklung auf und erläutern, wie auf die speziellen Entwicklungsbedürfnisse von Kindern im Alter von 6–12 Jahren eingegangen werden kann. Ein Must-have für pädagogische Akteur:innen im Grundschulbereich und darüber hinaus!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Qualität in Ganztagsschule, Hort und Schulkindbetreuung
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE
Aus Umweltschutzgründen wurde dieses Buch ohne Folie produziert.
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Gesamtgestaltung und Satz: Sabine Ufer, Leipzig
Annett Jana Berndt, Radebeul
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN (Print) 978-3-451-39456-0
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-83315-1
ISBN E-Book (PDF): 978-3-451-83314-4
Inhalt
Vorwort
1 Kindheit: eine Begriffsbestimmung
2 Übergangsbegleitung und die Chancen des Ganztags
2.1 Schulbeginn – ein erneuter Übergang
2.2 Schulfähigkeit der Kinder oder Kindfähigkeit der Schulen?
2.3 Hort und Ganztagsbetreuung – Chance auf Entwicklungsbegleitung jenseits von Lernunterstützung
3 Das siebte bis zehnte Lebensjahr: Die Sechs- bis Neunjährigen
3.1 Körperliche und motorische Entwicklung
3.2 Das Denken von Grundschulkindern
3.2.1 Exekutive Funktionen
3.2.2 Metakognition – Das Denken über das Denken
3.2.3 Kategorisieren und räumliches Denken
3.2.4 Zeitverständnis
3.2.5 Zeichnen
3.2.6 Das Lernen lernen
3.3 Sprache wird zum Informationsträger
3.4 Aneignung von Kulturtechniken
3.4.1 Schreiben
3.4.2 Lesen
3.4.3 Rechnen
3.5 Kindgemäße Angebote der Schule
3.6 Beziehung und Lernen
3.7 Die soziale Entwicklung im Grundschulalter – Bedeutung von Peergruppen und Freundschaften
3.8 Selbstwert und Umgang mit Emotionen
3.8.1 Entwicklung des Selbstkonzepts
3.8.2 Kontrollüberzeugungen
3.9 Jungen und Mädchen in der Grundschule
3.9.1 Geschlechtstypische Unterschiede im Verhalten und deren Ursachen
3.9.2 Geschlechterstereotype und Infragestellung binärer Geschlechterkategorien
3.9.3 Transidentität
3.9.4 Psychosexuelle Entwicklung
3.10 Förderung von Resilienz und Partizipation
3.11 Die Bedeutung von Bewegung und Naturerfahrung
3.12 Die Bedeutung von Geheimnissen und wildem und gewagtem Spiel
3.13 Entwicklungsstörung als Abweichung von der Norm
3.13.1 Die BELLA- und die COPSY-Studie
4 Das elfte bis dreizehnte Lebensjahr: Die Zehn- bis Zwölfjährigen
4.1 Auseinanderdriften von körperlicher und psychosozialer Reife in der Moderne
4.2 Beginn und Verlauf der Pubertät
4.3 Säkularer Trend und verfrühte Pubertät
4.4 Kognitive Entwicklung bei Jugendlichen
4.5 Soziale Entwicklung und Selbstkonzept bei Jugendlichen
4.6 Soziale Medien und Selbstwert
4.7 Identitätsentwicklung und inklusive Pädagogik
4.8 Moralisches Denken und soziales Wissen
4.9 Lust auf intensive Gefühle und Risikobereitschaft
4.10 Gleichaltrige und Freunde werden noch wichtiger
4.11 Der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule
Literatur
Autoren
Register
Vorwort
Eine gute Entwicklungs- und Bildungsbegleitung kann nur dort stattfinden, wo pädagogisches und erzieherisches Geschick mit ausreichend gutem Wissen über anstehende Entwicklungsaufgaben, altersentsprechende Interessen und Themen der Kinder und der Normalität von Entwicklungsvielfalt einhergeht. Dieses Wissen sollte auf einem aktuellen Stand sein, da das Auseinanderklaffen körperlicher und psychosozialer Reife noch nie so stark war, wie heutzutage. Gleichzeitig hat der Einfluss und die Bedeutung sozialer Medien insbesondere auf die Identitätsentwicklung von Kindern einen neuen Höhepunkt erreicht, der bereits bei älteren Grundschulkindern sichtbar wird.
Die Jahre zwischen 6 und 12 sind die ersten Jahre mit formalen unterrichtsgebundenen Bildungsangeboten, aber auch weiterhin Lebenszeit, in der das meiste Lernen informell, außerhalb des Unterrichts stattfindet. Der Begriff des informellen Lernens wird auf jedes Selbstlernen bezogen, das sich in unmittelbaren Lebens- und Erfahrungszusammenhängen außerhalb des formalen Bildungswesens entwickelt, wobei selbst bei Erwachsenen etwa 70 Prozent der Lernprozesse außerhalb von Bildungsinstitutionen – nicht nur durch Handy- und Computernutzung – stattfinden!
Natürliches Lernen ist selbstinitiiertes, selbstgesteuertes und bedürfniszentriertes Lernen, das in Begegnungen und Erfahrungen wurzelt und in direktem Bezug zum persönlichen Erleben steht. Damit einhergehende Lernprozesse sind sehr individuell, effektiv und nachhaltig und oftmals mit Begeisterung verbunden. Der Anspruch moderner Entwicklungsbegleitung liegt nicht mehr allein auf dem Aneignen von Kulturtechniken, wie Schreiben, Lesen oder Rechnen oder der zunehmenden Beherrschung exekutiver Funktionen der Aufmerksamkeitssteuerung und Selbstkontrolle, sondern vor allem auf der Förderung von Lebenskompetenzen wie Selbstwirksamkeit(serwartung), Konflikt- und Problemlösekompetenz, der Förderung von Resilienz und Partizipation und der Infragestellung – kindliche Lebensperspektiven einschränkender – binärer Geschlechterkategorisierungen.
Die Bedeutung der schulfreien Zeit hat einen weit unterschätzten Anteil an der entwicklungsprägenden Umgebung für heranwachsende Kinder. Informelles Lernen trägt wesentlich zu den Lernerfahrungen von Kindern und Jugendlichen bei. Jetzt muss die Bedeutung altersgemischter Peererfahrungen – am besten in Bewegung und in der Natur – in den Blick genommen werden. Durch die zunehmend verbrachte Zeit im Ganztag, egal ob in Hort, Hort an der Schule oder andere Formen der Schulkindbetreuung, findet Kindheit immer mehr unter Aufsicht in öffentlichen Räumen statt. Unbeaufsichtigte Draußen- und Straßenkindheit mit der viele von uns noch groß geworden sind, scheint dagegen vom Aussterben bedroht. Diese Form der selbst organisierten und eigen gestalteten Zeit ist jedoch ein wichtiger Bestandteil günstiger Entwicklungsbedingungen der mittleren und späten Kindheit. Darum stellt sich hier nicht nur für Eltern, sondern auch für Lehrer:innen und Schulkindbetreuer:innen die Frage: „Wie können wir unbehütete eigenverantwortete Reservate der Freiheit in schulischen und anderen öffentlichen Räumen für die Kinder schaffen, damit sie davon nachhaltig für ihre persönliche und soziale Entwicklung profitieren können?“.
In den Grundschuljahren geht es vor allem um die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen. Wenn sich in dieser Zeit alles nur um kognitive Inhalte, Wissen und Leistung dreht, tut sich später eine große Lücke im Erleben der Schüler:innen auf. Schon jetzt bedauern Vertretende der Wirtschaft, dass 20-jährige Bachelor-Absolvierende beim Berufseinstieg sozial unerfahren und unmotiviert sind. Diese jungen Menschen haben nicht genügend vielfältige Lebenswelten kennengelernt. Sie haben ihre Motivation einschränkende Kindergarten-, Schul- und Ausbildungsjahre hinter sich gebracht und nicht herausfinden können: Wer bin ich eigentlich? Was schlummert in mir? Und wie kann ich die Welt verändern?
Die Jahre bis zur Pubertät sind die salutogenetisch wichtigen Jahre: Sie entscheiden darüber, wie stark sich ein Kind später fühlt und wie gut es auch in anspruchsvollen Lebenslagen zurechtkommt. Damit das gelingt, muss man einem Kind fehlerfreundlich selbst verantwortete Aktivitäten zutrauen und es – auch riskante – Erlebnisse machen lassen. Wenn die Schulkindbetreuung professionell gestaltet ist, dann kann sie hier viel bewirken. Ganztagsangebote sollten bewusst vielfältig und unterschiedlich gestaltet werden. Es muss gemeinsame Zeiten mit Erwachsenen geben, aber auch Zeiten, in denen Kinder alleine oder zusammen mit wenigen Freundinnen und Freunden frei agieren dürfen. Auf diese Weise können Kinder am Nachmittag zusätzlich neuartige Lernerfahrungen machen, die sie in ihren dynamischsten Zeiten der Entwicklung spürbar wachsen lassen.
1 Kindheit: eine Begriffsbestimmung
In diesem Buch geht es um die Jahre von 6 bis 12, also um die Lebensphase, in der die Kinder in Deutschland vier bis acht Stunden am Tag in der Grundschule verbringen. In der Entwicklungsforschung unterteilt man die ersten Jahre in die frühe (0/3–6 Jahre), mittlere (6–10 Jahre) und späte (10–14 Jahre) Kindheit. Die mittlere Kindheit, also die Jahre 6–10, wird in einem Großkapitel mit 13 Unterkapiteln thematisiert und der sichtbar werdende Entwicklungsverlauf in geistiger, sozialer und emotionaler Hinsicht deutlich gemacht.
Bei Mädchen beginnt die Pubertät und damit auch die Adoleszenz, das Jugendalter, bereits mit 10 (frühestens bereits mit 8 Jahren), bei Jungen etwa zwei Jahre später, also mit 12 (frühestens bereits mit 9 Jahren). Dieser Lebensabschnitt zeigt noch einmal ganz besondere Eigenheiten, darum widmen wir den Jahren 10–12, dem Beginn der späten Kindheit und gleichzeitig Eintritt ins Jugendalter, ein eigenes Großkapitel mit elf Unterkapiteln.
2 Übergangsbegleitung und die Chancen des Ganztags
2.1 Schulbeginn – ein erneuter Übergang
Der Eintritt in die Schule bringt für das Kind eine umfassende Erweiterung und Neustrukturierung seiner Erlebenswelt mit sich. Viele Regeln bestimmen seinen neuen Tagesablauf. Der unstrukturierte Raum zum Träumen oder freien Spielen wird zunehmend weniger. Stattdessen wird eine feste Zeitstruktur fürs Aufstehen und Zubettgehen, fürs Essen, den Schulweg, das Zusammensein mit Gleichaltrigen, für Hausaufgaben sowie für Zeiten, in denen man sich bewegen darf und in denen man still sitzen muss, sichtbar. Die Kinder befinden sich in einem Spannungsfeld: Auf der einen Seite sind sie noch ganz Kind, leben in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, erleben alles sehr intensiv, können völlig im Spiel aufgehen und die Zeit vergessen. Auf der anderen Seite entwickeln sie viele neue geistige und soziale Kompetenzen und erproben in Schule und Spiel mit anderen Kindern Kooperation, aber auch Wettbewerb. Moralische Prinzipien wie Gerechtigkeit, Gleichheit und die Verpflichtung auf gemeinsam erarbeitete Regeln werden zunehmend wichtiger. Kinder sind durchaus motiviert, in die Schule zu gehen. Sie wollen ernst genommen werden, wollen zeigen, dass sie etwas können, Neues erfahren wollen und bereit sind, sich an Verbindlichkeiten zu halten. Grundschulkinder gestalten ihre Lebenswelt zunehmend selbstständiger, erobern sich dadurch immer größere Freiräume. Das heißt, sie stehen weniger unter der Kontrolle von Bezugspersonen, was automatisch mit einem Rückgang an individueller Aufmerksamkeit ihnen gegenüber einhergeht.
„Übergänge, wie der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, stellen vielfältige Anforderungen an die Bereitschaft und Fähigkeit zur Anpassung an die neuen Gegebenheiten. Die unbekannten Situationen bieten gleichzeitig wichtige Entwicklungsanreize und mobilisieren Kräfte zu ihrer Bewältigung. Forscher sprechen von ,verdichteten Entwicklungsanforderungen‘, auf die Kinder mit verstärkter Lernbereitschaft reagieren. Optimal ist es, wenn die neuen Anforderungen pädagogisch so gestaltet werden, dass sie den individuellen Kapazitäten entsprechen, um eine Überforderung, aber auch eine Unterforderung zu vermeiden“ (Niesel 2015).
Zur erfolgreichen Bewältigung der aus den Entwicklungsübergängen resultierenden Anforderungen bedarf es kindeigener Potenziale, wie soziale Kompetenz, sowie der Unterstützung durch „alte“ und „neue“ Bezugspersonen. Bei Entwicklungsübergängen, wie der Einschulung, werden bestehende Beziehungen und Gewohnheiten gelockert oder verschwinden, während eine Reihe von Entwicklungsanforderungen gemeistert werden müssen, wie zum Beispiel die Eingliederung in ein neues Umfeld oder in eine neue Peergruppe.
Portfolioarbeit, die bereits in den Kindertageseinrichtungen begonnen und mit dem Kind in der Grundschule fortgeführt wird, unterstützt die Kooperation zwischen alter und neuer Bildungseinrichtung sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern. An den Interessen des Kindes anzusetzen hilft bei der Übergangsbegleitung, da die Themen und Projekte, die das Kind bereits in der Kindertageseinrichtung erfahren hat, im Portfolio dokumentiert sind. Über alte und neue Portfoliobeiträge kann ein Dialog zwischen Fachkraft und Kind und unter Kindern entstehen. Das Festhalten der individuellen Stärken und Interessen der Kinder und das Wissen über ihre Lern- und Bildungswege stärken die positive Selbstwahrnehmung der Kinder und fördern die dialogorientierte Arbeit mit dem Portfolio, was zur Selbsteinschätzung befähigt.
Die Transitionsforschung zeigt uns, dass Übergänge durchaus auch entwicklungsfördernd sein können. Entscheidend ist hierbei, wie der Übergang vorbereitet und begleitet wird. Das gilt auch schon für den vorherigen Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung.
Ein gelungener Übergang stärkt das positive Selbstbild und die Lernmotivation des Kindes sowie sein Interesse am lebenslangen Lernen. Ein problematischer Übergang wird hingegen zu einem bedeutenden Stress- und Risikofaktor mit meist langfristigen Folgen für die Bildungskarriere. Insbesondere der Verlust der Lernmotivation kann als Indikator für vorausgegangene Schwierigkeiten beim Übergang gewertet werden (Sturzbecher & Schmidpeter 2020). Antworten zu Beginn der Grundschulzeit noch fast drei Viertel aller Schüler:innen mit „Ja“ auf die Frage, ob „Lernen oft Spaß macht“, sind es am Ende der Grundschulzeit nur noch ein Drittel (s. Abbildung 2)! Dieser Absturz an Lernmotivation ist nach Sturzbecher und Schmidpeter (2020, S. 5) auch darauf zurückzuführen, dass bereits beim Übergang entscheidende Punkte von Seiten der beteiligten Erwachsenen nicht beachtet wurden:
• „Kennen wir die individuellen Ansprüche und Ressourcen der Kinder beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ausreichend?“
• „Werden Kinder zu ihren Vorstellungen, Erwartungen und Sorgen befragt?“
• „Sind sie bei ihrem Übergang einfluss- und handlungsfähig oder ausschließlich fremdbestimmt?“
• „Tauschen sich die Eltern, die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen und die Lehrkräfte über diese Themen aus oder werden die Ansprüche und Ressourcen der Kinder wie auch ihr subjektives Kontroll- und Belastungserleben nur punktuell und erst im Falle von Lernschwierigkeiten wahrgenommen und thematisiert?“
Abb. 2: Verlauf der Lernmotivation in der Grundschulzeit (nach: Sturzbecher & Schmidpeter 2020, S. 5)
Klassische Schnupperbesuche in der Schule oder einen Tag der offenen Tür für angehende Schulstartende und Eltern zeigen keine positiven Effekte auf einen leichteren Schuleintritt (Kordulla 2021). Die mentale Schulbereitschaft, soziale und Konfliktlösekompetenz (Selbstkontrolle) und Wohlbefinden waren dagegen wichtige Prädiktoren für eine positivere Übergangsbewältigung. Ein vielversprechender Ansatz für einen gelingenden Übergang von der Kita in die Grundschule stellt das sogenannte Peer-Learning im Übergang dar. Statt klassischer vorschulischer Angebote von Kooperationslehrkräften im Kindergarten, in denen 5- bis 6-jährige Kitakinder auf die Schule vorbereitet werden sollen, indem mit unterrichtsähnlichen Einheiten „spielerisch“ Schule „geübt wird“, lernen Kita- und Grundschulkinder zusammen (altersübergreifendes Lernen). In kooperativen Lernsettings wie dem „Paderborner Modellprojekt Kinderbildungshaus“ arbeiten Kindergartenkinder (im letzten Jahr) gemeinsam mit Schulanfängern in rhythmisierten, fest in den pädagogischen Alltag verankerten Lernwerkstätten.
Studien (ebd.) zeigen, dass dabei zu gleichförmige Angebote für Kindergarten- und Schulkinder von den Kindern negativ beurteilt wurden. Die Schulkinder fanden vieles zu leicht und die Kitakinder hatten das Bedürfnis nach Bewegung und einer spielerischen Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen. Unterschiedliche Kinder benötigen unterschiedliche Herausforderungen. Die projektbeteiligten Kinder forderten selbst differenziertere Aufgaben (Zitat: „Für die Kindergartenkinder leicht und für die Kinder in der Schule schwer!“). Einige Kinder äußerten sich positiv über die Zusammenarbeit (Zitat: „Wir haben uns gegenseitig geholfen … ich hatte Spaß dran, den anderen zu helfen.“). Die Beziehungsqualität und Kleingruppenarbeit hatten dabei einen wichtigen Einfluss auf die Qualität der aufgabenbezogenen Zusammenarbeit.
Selbstwirksamkeit kann als Schlüsselfaktor für die Bewältigung des Übergangs in die Grundschule betrachtet werden. Kinder mit hohen Selbstwirksamkeitserwartungen setzen sich beispielsweise realistische, aber hohe Ziele, mit denen sie sich identifizieren, entwickeln hohe Ergebniserwartungen, zeigen größere Motivation, Anstrengung und Ausdauer beim Lernen und können mit Rückschlägen konstruktiver umgehen (Bandura 1997).
Nach dem Erwartungswertmodell für die Leistung (Eccles & Wigfield 2002) sind Kinder besonders leistungsmotiviert in den Gebieten, in denen sie Erfolge erwarten (Selbstwirksamkeitserwartung) und die sie wertschätzen (z. B. intrinsisches Interesse oder wahrgenommene Wichtigkeit eines Themas). Wenig bekannt ist jedoch, inwiefern sich Kinder in der Kindertageseinrichtung und Grundschule tatsächlich als selbstwirksam erleben und ob und wie sie hierbei Freiräume für persönlich bedeutsame Handlungen wahrnehmen. Insbesondere Spielsituationen ohne Beteiligung von Erwachsenen und das Freispiel oder die Spielpause erwiesen sich in einer aktuellen Studie von Velten (2020) als zentral für die Selbstwirksamkeit von im Übergang befragten Kindern.
Kinder suchen nach Beständigkeit und Voraussagbarkeit. Aber sie haben auch ein Recht darauf, zu spüren, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie bewusst zu Neuem übergehen, wo noch Unbekanntes ansteht. Sie haben ein Recht darauf, dass ihnen mehr zugetraut wird. Es geht also darum, Diskontinuitäten als Herausforderung und Entwicklungsanreiz zu akzeptieren, Übergänge als notwendiges Element von Lebensgeschichten zu begreifen. Mehr noch: Ein gut begleiteter Übergang kann die seelische Widerstandskraft eines Kindes, seine Resilienz, stärken (Griebel & Niesel 2013). Doch dieses Modell verlangt von Kindergarten und Schule sowie den Eltern viel: Der herausfordernde Charakter der neuen Situation muss erhalten bleiben, gleichzeitig muss aber durch Vertrautes und Verlässliches Überforderung vermieden werden. Und genau darauf muss man vorbereiten, aber nicht mit Vorschulmappen und Still-Sitz-Übungen. Es geht darum, Lernfreude zu schaffen, indem man den Kindern Kompetenz- und Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht, indem man mit differenzierten Lernstrategien, die Räume für Erkunden, Experimentieren, Staunen, Entdecken, Fragen, Sammeln, Ordnen, Planen, Dokumentieren und Präsentieren öffnet (Haug-Schnabel et al. 2020).
Es geht in den letzten beiden Kindergartenjahren nicht um die Förderung von Vorläuferfähigkeiten für den Schulbereich, wie erste mathematische Fähigkeiten oder den Einstieg ins Schreiben. Schrift und Zahlen spielen zwar bereits eine große Rolle, aber in einem selbstbestimmten Zugang. Es geht nicht darum, die Kinder möglichst gut auf die Schule, sondern auf das Leben vorzubereiten. Die „social life skills“, also die sozialen Lebenskompetenzen, entscheiden darüber, wie Kinder in ihrem späteren Leben zurechtkommen, wie sie mit sich selbst und anderen kooperieren, letztendlich auch, wie sie den Übergang in die Schule meistern und dort bestehen. Entscheidend für den Schulerfolg ist nicht die kognitive Kompetenz, sondern ob Kinder die Motivation aufbringen, dem Unterricht zu folgen, sich auf Inhalte einzulassen und wie sie mit den anderen Kindern und den Lehrpersonen zurechtkommen. Und dafür sind Fähigkeiten wie Stressbewältigung, Selbstregulation, Beziehungsfähigkeit, Erfahrungshunger und Denkfreude entscheidend (ebd.). Kindertageseinrichtungen wollen den Kindern etwas fürs Leben mitgeben. Vorschulpädagogik ist dagegen ein Begriff, den man nicht mehr verwenden sollte. Die Elementar- oder Frühpädagogik hat eine eigene Wertigkeit und Wichtigkeit; sie muss sich positionieren, denn die frühen Jahre sind aus neurophysiologischer Sicht die prägenden Jahre.
Oggi Enderlein fasst die entwicklungsrelevanten Bedürfnisse der „Großen Kinder“ (6–13 Jahre) in einer anschaulichen Grafik zusammen (s. Abbildung 3). Im Zentrum der Darstellung steht das Bedürfnis „nützlich zu sein“, was klarmacht, dass Grundschulkinder keineswegs mit einer anspruchslosen Spaß- und Kuschelpädagogik, die sie nicht in ihren selbstbestimmten Entwicklungsbemühungen herausfordert, zufrieden wären. Sie haben den inneren Antrieb, einen wertvollen Beitrag für die sozialen Gruppen, in denen sie leben, zu leisten (Teilgabe).
Kinder, die nicht selbst wirksam sein können, werden bequem und anspruchsvoll. Kinder mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung interessieren sich für fast alles. Es geht darum, etwas zu erreichen, mitzugestalten und durch das Mitgestaltete wieder selbst berührt zu werden (Rosa & Endres 2016).
Die von psychologischer und pädagogischer Seite formulierten Bedürfnisse werden auch von Seiten der Kinder in verschiedenen Befragungsstudien geäußert. Die kindlichen Aussagen machen gleichzeitig deutlich, dass viele von den Kindern geäußerte Wünsche in der Schulrealität noch nicht genügend berücksichtigt werden (Enderlein 2015, S. 49):
„Mit ihren Wünschen drücken Kinder jene Bedürfnisse aus, die mit einer guten gesunden Entwicklung zusammenhängen, die aber viele von ihnen nicht ausreichend befriedigen können: Der in allen Befragungen an vorderer Stelle platzierte Wunsch nach mehr Bewegung und Sport belegt eindrucksvoll, dass zu viele Kinder im Alter vor der Pubertät ihren alterstypischen Bewegungs- und Aktivitätshunger offenbar nicht mehr ausreichend stillen können. Gesunde Entwicklung erfordert immer genügend Raum und Zeit für Rückzug, Entspannung und Erholung. Im Wunsch nach Arbeit in Projekten spiegelt sich das Bedürfnis, die Welt zu entdecken und zu erforschen. Bei Projektarbeiten können Kinder freier mit anderen Kindern zusammen sein und sich untereinander austauschen. Die Ergebnisse von Projekten haben meistens auch einen konkreten Wert und geben eine unmittelbare Rückmeldung über die Qualität der geleisteten Arbeit. Lernen und Üben sollen am ‚Arbeitsplatz Schule‘ stattfinden und nicht in die Freizeit verlagert werden. […] Aus Kindersicht liegt es also nahe, Schule als zweiten Lebensmittelpunkt so zu gestalten, dass Kinder dort nicht nur (aber auch!) kognitiv gebildet werden. Vielmehr sollte Schule ein Ort sein, an dem sich Jungen und Mädchen auch sozial, emotional und körperlich gesund weiterentwickeln können, weil ihre altersspezifischen Themen und Bedürfnisse respektiert werden. Dafür braucht Schule Zeit und Platz.“
Abb. 3: Entwicklungsrelevante Bedürfnisse der „Großen Kinder“ (6–13 Jahre) (nach: Enderlein 2023b, S. 60)
Verschiedenste von Enderlein (ebd., S. 51) zitierte Befragungsstudien mit Schülern und Schülerinnen zeigen, auf welche Weise Schule zum Wohlbefinden der Kinder beitragen kann:
• Wenn die Beziehung zur Lehrkraft positiv erlebt wird,
• wenn sich Kinder beteiligt und in Entscheidungen einbezogen fühlen, dabei geht es nicht nur um Mitbestimmung, sondern auch um die Möglichkeit zur Mitwirkung (Enderlein 2023a),
• wenn der Unterricht gut ist,
• wenn die Anforderungen weder zu hoch noch zu niedrig sind,
• wenn das Klassenklima positiv bewertet wird und sich die Kinder von den Gleichaltrigen unterstützt fühlen,
• und wenn sich die Eltern für die Schule interessieren.
2.2 Schulfähigkeit der Kinder oder Kindfähigkeit der Schulen?
„Das Konzept ‚Schulreife‘ ist überholt. Eine allgemeingültige Definition von ,Schulfähigkeit‘ gibt es nicht. Vielmehr kommt es darauf an, wie die Kompetenzen des Kindes und die Erwartungen der Schule zusammenpassen. Schulfähigkeit ist demzufolge nicht nur eine Eigenschaft des Kindes, sondern entwickelt sich im Zusammenwirken der Beteiligten: Kind, Kindertageseinrichtung, Schule und Eltern. Kommunikation, Partizipation und Kooperation sind Voraussetzungen“ (Niesel 2015).
Tests, um schulfähige von nicht schulfähigen Kindern unterscheiden zu können, sind nach wie vor unzuverlässig, da die daraus abgeleiteten Prognosen nachweislich unsicher sind. Sie messen lediglich den Entwicklungsstand eines Kindes zum Testzeitpunkt. Jede Schule hat ihr eigenes Profil, auch was die Gestaltung der Schuleingangsphase anbelangt. „‚Schulfähigkeit‘ soll auch nicht heißen, dass Kinder schon zu allem fähig sein müssen, was in der Schule verlangt wird. Ein Schulkind wird das Kind in der Schule“ (ebd.). Stattdessen müssen sich Eltern, pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte darüber verständigen, ob das Kind bereits fähig und bereit ist, ein Schulkind zu werden. Zu den Anforderungen, die mit „Schulfähigkeit“ im Allgemeinen verknüpft werden, gehören geistige Fähigkeiten, soziale Kompetenzen und nicht zuletzt die Motivation und die Bereitschaft, sich anzustrengen.
Der Schulfähigkeit des Kindes stellt Niesel (2015) provokant die „Kindfähigkeit“ der Schule gegenüber: „Damit ist gemeint, dass die Schule als aufnehmende Bildungseinrichtung die Übergangsbewältigung jedes Kindes so unterstützen sollte, dass kein Kind ‚zurückgestellt‘ werden muss. Kinder werden nicht eingeschult (im passiven Sinne), sondern sie müssen den Übergang aktiv bewältigen und haben Anspruch auf eine pädagogische Übergangsbegleitung, die in Kindertageseinrichtung und Familie beginnt und in der Schule fortgeführt wird.“ Die Kindfähigkeit der Schule bemisst sich in erster Linie an ihrer Kompetenz, der gegebenen, immer wieder andersartigen Diversität der Kinder angemessen zu begegnen (s. Kap. 4.7). Ein identischer Entwicklungsstand ist selbst bei identischem Geburtstag genauso wenig gegeben wie gleiches Temperament, gleicher kultureller und sozialer Familienhintergrund oder gleiche Muttersprache.
Abb. 4: Das Entwicklungsalter kann vom Lebensalter stark abweichen. Bei 20 untersuchten Kindern im Alter von sieben Jahren entsprach der Entwicklungsstand in den Bereichen Körpergröße, IQ, Lesen, Rechnen, Zeichnen und Singen nur bei circa einem Drittel der Kinder ihrem chronologischen Alter. Die anderen zwei Drittel waren in ihrem Entwicklungsstand bis zu 1,5 Jahre voraus bzw. hinterher (nach: Largo 2019, S. 33).
Gleichaltrige Schulstarter zeigen bezüglich ihres Entwicklungsstands und ihrer bereits entwickelten Fähigkeiten nicht nur deutliche interindividuelle Unterschiede (interindividuelle Variabilität, s. Abbildung 4) sondern auch beträchtliche intraindividuelle Variabilität (s. Abbildung 5). Die Zürcher Längsschnittstudien zeigen, dass ein dissoziiertes Entwicklungsprofil der 6-jährigen Schulstartenden, aber auch der 10-Jährigen, die auf weiterführende Schulen wechseln, nicht die Ausnahme, sondern die Regel darstellen (Jenni 2021, Largo 2019). Kaum ein Kind ist in allen Entwicklungsbereichen gleich begabt. Dies zeigt sich bereits darin, dass auch das Entwicklungstempo einzelner Entwicklungsaspekte desselben Kindes in der Regel unterschiedlich sind. Verbildlicht sich man die verschiedenen Entwicklungsbereiche eines Kindes als Fuhrpark der Deutschen Bahn, stehen neben Entwicklungs-ICEs der neuesten Generation und einigen mittelschnellen Entwicklungs-Interregios immer auch einige Entwicklungs-Regionalbahnen (Bensel & Haug-Schnabel 2016a).
Abb. 5: Entwicklungsprofil des 6-jährigen Ramon (nach: Jenni 2021, S. 344)
Jenni (2021, S. 343f.) beschreibt das Auseinanderklaffen kindlicher Fähigkeiten sehr anschaulich am Beispiel des 6-jährigen Ramon (s. Abbildung 5), dessen sprachliche und logische Kompetenzen auf dem Niveau eines 10-Jährigen lagen, während sein motorisches Entwicklungsalter und seine emotionalen Bedürfnisse dem eines 3- bis 4-Jährigen entsprachen. Trotz seines hohen intellektuellen Leistungsstands wurde entschieden, den Jungen erst ein Jahr später einzuschulen, um das Kind, aber auch die Lehrer:innen sozioemotional nicht zu überfordern und einen Misfit (vgl. Largo 2019) zwischen Kind und Umwelt zu vermeiden.
Eine hohe intraindividuelle Variabilität ist jedoch nur dann eine nicht zu bewältigende Herausforderung für ein Schulsystem, wenn es keine ausreichend individuelle Förderung innerhalb einer Gruppe von Gleichaltrigen bereitstellen kann. Ein inklusiverer Ansatz (s. Kap. 4.7) wäre es, den Schulkindern mehr pädagogische Fachkräfte zur individuelleren Bildungsbegleitung an die Seite zu stellen, den Unterricht differenzierter zu gestalten und nicht von vornherein davon auszugehen, dass alle Kinder dieselben Fähigkeiten und Bedürfnisse bei Schulstart mitbringen. Dies ist in altersgemischten Schulmodellen selbstverständlich, wenn beispielsweise 4- bis 8-Jährige oder 8- bis 12-Jährige gemeinsam beschult werden und die Kinder ihre individuellen Leistungsaufgaben immer wieder selbst (mit)bestimmen dürfen (s. Kap. 3.5). Eine Rückstellung eines 6-jährigen Kindes für ein weiteres Jahr produziert auch für viele Kindergärten eine Misfit-Situation, da das Kind vielleicht seine sozioemotionalen Bedürfnisse in der Kita besser befriedigen kann als in der Schule, es kognitiv aber möglicherweise unterfordert wird, weil es bereits alle Abläufe kennt und die gebotenen Spielmöglichkeiten bereits ausgeschöpft hat.
Bereit für die Schule ist ein Kind, wenn es bei zahlreichen Gelegenheiten erfahren hat, dass es selbstständig entscheiden und handeln kann, wenn es mit Erfolg und dem Bewusstsein eigener Fertigkeiten ebenso umgehen kann wie mit Situationen des „dosierten Scheiterns“. Auch wenn es über Gruppenfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Rücksichtnahme, verbale Ausdrucksfähigkeit, Spielkompetenz und Frustrationstoleranz verfügt.
Die kindlichen Lebens- und Lernbedingungen haben sich geändert, unser Entwicklungswissen hat sich vermehrt, also muss sich auch unser „vorschulisches“ und schulisches Angebot entsprechend ändern. Wir haben die Aufgabe, jedem Kind einerseits unsere kulturtypischen Fertigkeiten beizubringen, den Umgang mit vielfältigen Materialien und Werkzeugen zu ermöglichen. Dabei muss es sich auf Vorerfahrungen mit vergleichbaren Anforderungen beziehen und hierbei auf Wissen über seine Handlungsmöglichkeiten zurückgreifen können (epistemische Kompetenz). Auf der anderen Seite ist es auch Aufgabe, ein stabiles Selbstbewusstsein beim Kind entstehen zu lassen, was offensichtlich die wichtigste Voraussetzung ist, damit ein Kind im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten neue Situationen bewältigt und bislang noch nicht aufgetretene oder noch nie in Angriff genommene Probleme löst (heuristische Kompetenz).
2.3 Hort und Ganztagsbetreuung – Chance auf Entwicklungsbegleitung jenseits von Lernunterstützung
Kinder im Ganztag verbringen viele Jahre in Einrichtungen – täglich nach der Schule und oft auch in den Ferien. Hier durchlaufen sie mehrere Entwicklungsstufen mit sich verändernden Bedürfnissen. Es ist eine Zeit, in der die Kinder jeweils altersgemäß aktive Entwicklungsbegleitung, pädagogische Verlässlichkeit und höchste didaktische Vielfalt erleben müssen. Die Schulkinder brauchen bei ihrer täglichen Aufgabe, drei Lebenswelten (Familie, Schule, Ganztag/Hort) zu meistern, Unterstützung. Sie sollten den Ganztag als akzeptierten Raum mit vielfältigem Lebensbezug erfahren. Im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren müssen pädagogische Angebote kindliche Lebenskompetenzen steigern und Selbstwirksamkeitsgefühle aufkommen lassen. Nur so werden Denk- und Lernfreude gefördert – die Voraussetzung für Leistungsfähigkeit.
Die Jahre bis zur Pubertät sind die wichtigen salutogenetischen Jahre, die darüber entscheiden, wie stark sich ein Kind später fühlt und wie gut es auch mit komplizierten Lebenslagen zurechtkommt. Damit das glückt, muss man einem Kind immer mehr an Aktivitäten zutrauen und es herausfordernde Erfahrungen machen lassen. Wenn die Schulkindbetreuung gut durchdacht ist, dann kann sie hier viel ausrichten (Haug-Schnabel & Bensel 2015).
Freiräume im Tagesablauf sind für die Entwicklung der Kinder wichtig. Das heißt, die Zeiteinteilung darf nicht komplett durch die Erwachsenen vorgegeben sein, und die Hausaufgaben dürfen nicht dominieren (keine Fortsetzung der Vormittagsschule am Nachmittag!). Nur dann entstehen Freiräume, die den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden. Kinder brauchen selbst gestaltete Räume (zeitlich und örtlich), in denen sie längere Zeit ihre Ideen verfolgen können, auch mit verringerter oder nur sporadischer Aufsicht durch die Erwachsenen.
Erwachsene Entwicklungs- und Bildungsbegleiter:innen sind dabei als Möglichmacher:innen gefordert und nicht als Macher:innen. Basierend auf der Beobachtung der kindlichen Themen und Interessen geht es um die Bereitstellung anregungsreicher Umgebungen. Erwachsene müssen so flexibel sein, sich auch auf Themen einzulassen, mit denen sie noch nicht gearbeitet haben, und ihre positive Professionalität behalten, auch wenn das Neue nicht sofort funktioniert (ebd.).
Ein Beispiel: In einer Einrichtung hatten Kinder selbst eine Geisterbahn aufgebaut. Die pädagogischen Fachkräfte stellten nur das Material zur Verfügung. Die Kinder hatten miteinander die Konstruktion und audiovisuelle Untermalung überlegt und realisiert. Sie waren Feuer und Flamme, weil die Idee von ihnen selbst ausging. So entstand etwas ganz anderes, als wenn die Fachkraft gesagt hätte: „Wir haben jetzt das Projekt ‚Geisterbahn‘!“
In der deutschen Ganztagsbetreuung ist eine stärkere Qualitätsdiskussion notwendig: Was macht die Qualität von Bildungs- und Entwicklungsbegleitung in diesem Alter tatsächlich aus?1 (vgl. Plehn 2023, Pesch et al. 2023, Enderlein 2023b).
Auf welche Weise kann die Schulkindbetreuung die Entwicklungspotenziale der Schulkinder zur Entfaltung bringen? (s. Abbildung 6). Wie können wir diese Qualität erreichen und sichern? Dazu braucht es qualifizierte Fachberater:innen, eine veränderte Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen sowie eine bessere Vernetzung der verschiedenen Betreuungsangebote innerhalb und außerhalb des Unterrichts: eine Vernetzung von Lehr- und Hortfachkräften, die auf Augenhöhe stattfindet. Auch Impulse aus der Elementarpädagogik können dabei tragfähig sein, das Wissen über Selbstbildungsprozesse, Entfaltung von Lebenskompetenzen, Kenntnisse darüber, was Kinder stark macht (Resilienzansatz, s. Kap. 3.10), und wie man einen kreativen Boden zum vielfältigen Denken bereitet.
Abb. 6: Entwicklungspotenziale in der Schulkindbetreuung (aus: Enderlein 2023a, S. 126)
Ein unverzichtbarer Baustein guter Qualität im Ganztag ist die Orientierung an den globalen Kinderrechten (Maywald 2024). Auch die Kultusministerkonferenz hat sich dazu bekannt, die Grundsätze der UN-Kinderrechtskonvention zur Grundlage ihrer Arbeit zu machen und spricht sich dafür aus, dass die Berücksichtigung der Rechte des Kindes auf Schutz und Fürsorge sowie auf Partizipation essentiell für die Schulkultur ist. Die Wirkung dieser Erklärung aus dem Jahr 2006 lässt jedoch bis heute auf sich warten. Der an den Kinderrechten orientierte Ansatz ist bislang nicht konkretisiert und auf sämtliche Aspekte des Schullebens bezogen (ebd.).
Zu den Kinderrechten zählt auch das Recht auf Schutz vor körperlicher, emotionaler und sexualisierter Gewalt. „Aus dem Recht des Kindes auf eine Erziehung ohne Gewalt ergibt sich ein Schutzauftrag des Ganztags (s. Abbildung 7). Dieser Schutzauftrag bezieht sich sowohl auf Gefährdungen des Kindes im Bereich der Familie (individueller Kinderschutz) als auch auf Beeinträchtigungen und Gefährdungen des Kindeswohls im Ganztag (institutioneller Kinderschutz). Während der Ganztag im Bereich der Familie bei gewichtigen Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung zum Handeln verpflichtet ist, besteht die Eingriffspflicht im Bereich des Ganztags bereits bei der Beeinträchtigung des Wohls von Kindern“ (ebd., S. 48).
Abb. 7: Gesetzliche Grundlagen des Kinderschutzes im Ganztag (aus: Maywald 2024, S. 48)