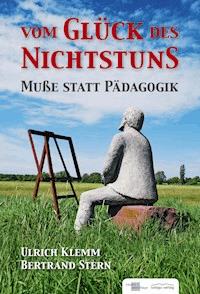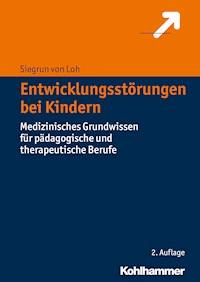
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist als Arbeitshilfe für Pädagogen und Therapeuten konzipiert, die sich mit Kindern beschäftigen, deren Entwicklung nicht "normal" verläuft. Es vermittelt in verständlicher Sprache medizinisches Basiswissen über gesunde und gestörte Entwicklung, beschreibt Ursachen und Folgen von Krankheit und Behinderung und erklärt diagnostische und therapeutische Verfahren. Besonderes Augenmerk gilt den Auswirkungen von Krankheit, Störung oder Behinderung auf das Befinden des Kindes, seine seelische Entwicklung und sein Verhalten. Das Buch gibt Hilfestellungen für eine kompetente Begleitung kranker und behinderter Kinder und liefert Grundwissen, um entstehende Entwicklungsstörungen rechtzeitig zu erkennen. Neben medizinischem Grundwissen werden dabei auch soziale, kulturelle, psychologische Erkenntnisse und pädagogische Erfahrungen einbezogen und in Beziehung zur Lebenswelt der Kinder gesetzt. Fragen aus dem pädagogischen Alltag, einschließlich der Elternarbeit, werden aufgegriffen und beantwortet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siegrun von Loh
Entwicklungsstörungen bei Kindern
Medizinisches Grundwissen für pädagogische und therapeutische Berufe
2., erweiterte und überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
2., erweiterte und überarbeitete Auflage 2017
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-021384-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-029638-1
epub: ISBN 978-3-17-029639-8
mobi: ISBN 978-3-17-029696-1
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vorwort zur 2. Auflage
Teil 1: Biologische Grundlagen von Wachstum und Entwicklung
1 Die ersten Jahre – eine besonders wichtige Zeit
2 Wachstum und Differenzierung
3 Besonderheiten frühkindlicher Entwicklung
4 Krankheit, Kranksein, Entwicklungsstörung und Behinderung
Teil 2: Ursachen für Entwicklungsstörungen
1 Sauerstoffmangel O2-Mangel
2 Störungen von Genen, Chromosomen
3 Stoffwechselstörungen
4 Entzündungen
5 Störungen des Abwehrsystems des Körpers (Immunsystem)
6 Tumoren und Krebs
7 Vererbung von Krankheiten
Teil 3: Diagnostische Verfahren
1 Röntgen
2 Computertomografie (CT)
3 Magnetische Resonanz-Tomografie (MRT)
4 Nuklearmedizinische Untersuchungen: Szintigrafie, PET, SPECT
5 Ultraschall-Diagnostik (Sonografie)
6 EEG (Elektroenzephalografie)
7 Pränatale (vorgeburtliche) Diagnostik
Teil 4: Therapien für Kinder mit Entwicklungsstörungen
1 Medizinische Therapien
2 Pädagogische Fördermethoden
Teil 5: Chronische Krankheiten als Ursachen von Entwicklungsstörungen
1 Allergien (Asthma, Heuschnupfen, Neurodermitis)
2 Anfallskrankheiten (Epilepsie)
3 Blutungskrankheiten (Hämophilie)
4 Leukämie (Blutkrebs)
5 Duchenne Muskeldystrophie (DMD)
6 Chronisches Nierenversagen
7 Stoffwechselkrankheiten (Mukoviszidose, Zuckerkrankheit)
Teil 6: Angeborene und frühkindlich entstandene Entwicklungsstörungen des Gehirns und der Sinnesorgane
1 Cerebralparese (»CP«)
2 Umschriebene Entwicklungsstörungen der Wahrnehmung (UESW)
3 Das ungeschickte Kind: Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen (UEMF)
4 Hörstörung – Hörminderung – Schwerhörigkeit, samt auditiver Wahrnehmungsstörung (AVWS)
5 Sprachentwicklungsstörungen, samt USES der Sprache
6 Sehstörungen, samt visueller Wahrnehmungsstörung (VVWS)
7 Intelligenz; Intelligenzminderung; Hochbegabung
8 Teilleistungsschwächen (Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten), LRS, Dyskalkulie
9 Gestörte Händigkeitsentwicklung
Teil 7: ADHS; Autismus
1 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-Störung (ADHS)
2 Autismus
Teil 8: Genetische Syndrome; angeborene Fehlbildungen
1 Genetische Syndrome (Down-Syndrom; Trisomie 21)
2 Angeborene Fehlbildungen (angeborene Herzfehler, Hydrocephalus, Spina bifida)
Teil 9: Krankheitswahrnehmung und -verarbeitung bei Kindern und ihren Eltern; Resilienz
Literaturverzeichnis
Vorwort
»Anna ist immer so müde…« Die Erzieherin macht sich Sorgen. »Ist sie krank? Guckt sie zu lang fern?« Ein halbes Jahr später wird eine verzögerte Entwicklung festgestellt, vielleicht wird Anna eine Schule für Lernbehinderte besuchen. Anna war vom Tagesablauf im Kindergarten einfach überfordert. Die Erzieherin denkt: »Schade, dass ich die Diagnose nicht eher wusste. Was ist die Ursache? Wie kann ich Anna fördern? Muss ich mehr Pausen einlegen? Braucht Anna zusätzlich eine Therapie?«
Vielleicht ist die Diagnose beim Arzt aber auch eine beginnende Leukämie, und Anna muss erst mal ins Krankenhaus. Sie kommt nach zwei Monaten wieder, blass, ruhig, aber sehr glücklich, alle wiederzusehen. Sie spricht gar nicht über ihre Krankheit. Umso mehr Fragen hat die Erzieherin: »Ist Anna jetzt gesund? Wie belastbar ist sie? Darf sie alles mitmachen – auch zum Schwimmen gehen? Wofür oder wogegen sind die Tabletten, die sie mittags nehmen muss? Sie ist so still, soll ich versuchen, sie mehr zum Mittelpunkt zu machen, oder soll ich sie lieber in Ruhe lassen?«
Sie kennen sicherlich auch eine kleine oder große Anna, einen Michael oder eine Kristin – sie haben Asthma, eine Muskelerkrankung oder eine Lernstörung, reden viel oder gar nicht darüber, nehmen Medikamente oder halten Diät und sind besonders frech oder ganz still. Sicher haben Sie sich auch gefragt, ob und wie man die Eltern anspricht und den anderen Kindern was erzählt, und dann sind da noch tausend andere Fragen, die sich auftun: vor, mit und nach der medizinischen Diagnose, besonders, wenn es sich nicht nur um eine kurze Krankheit handelt. Diese tausend Fragen sind Anlass für dieses Buch.
Die Fragen ließen sich gruppieren, egal, ob der Gymnasiallehrer mit Überraschung feststellt, dass er einen Schüler mit einer künstliche Niere vor sich hat, ob ein bisher gesundes Grundschulkind an Diabetes erkrankt, ob sich Pädagogen gezielt auf die erweiterte Tätigkeit der »inklusiven Betreuung« vorbereiten oder ob sich eine Einrichtung einfach bewusst macht, dass »Früherkennung von Entwicklungsstörungen« eine wesentlich beglückendere Aufgabe ist, als die Augen zuzumachen und dann ein Fünftel ihrer Zöglinge an der Schuleingangsuntersuchung scheitern zu sehen.
Die Fragengruppen wurden Grundlage dieses Buches, es will:
• Medizinische Diagnosen definieren, Krankheitsbegriffe für Nichtmediziner verständlich machen und mitsamt dem Vokabular erklären.
• Störungsursachen, biologische Entwicklungsprobleme, Krankheitsbilder und Verläufe darstellen.
• Alltagsrelevante Fragen behandeln: Wie belastbar ist das Kind? Was muss beachtet werden? Gibt es Alarmzeichen oder Komplikationen und wie wirkt sich die Störung auf die Gesamtentwicklung des Kindes aus?
• Medizinische Diagnostik und Therapien erklären.
Und vor allem will das Buch antworten auf die Fragen:
• Wie geht es dem Kind? Wie fühlt es sich? Welchen Einfluss haben Krankheit, Störung, Behinderung auf sein Befinden, seine seelische Entwicklung? Wie nimmt es sich selbst wahr? Ist sein Verhalten daraus zu erklären?
• Welche unmittelbaren Empfehlungen leiten sich daraus ab für den pädagogischen oder therapeutischen Alltag? Wo finde ich noch Ansprechpartner, zusätzliche Information, Bücher?
In stets gleicher Gliederung finden Sie die häufigsten chronischen Krankheiten sowie typische angeborene und frühkindlich entstandene Entwicklungsstörungen beschrieben. Das nötige Hintergrundwissen wird in Teil 1 und 2 dargelegt, etwa Ursachen und Entstehungsmechanismen von Krankheiten und Entwicklungsstörungen. Teil 3 und 4 beschreiben medizinische Diagnostik- und Therapieverfahren. Der letzte Teil geht ausführlich auf die Krankheitswahrnehmung und -verarbeitung von Kind und Eltern ein.
Dieses Konzept entfernt sich von der Schulmedizin, ohne sie fallen zu lassen, bezieht soziale, kulturelle, psychologische Erkenntnisse und pädagogische Erfahrungen mit ein und setzt sie in Bezug zu der Lebenswelt von Kindern, die mit speziellen Problemen fertig werden müssen, egal ob Vorschul-, Grundschulalter oder Adoleszenz. Es ist ein Versuch, Anna und ihre Situation »ganzheitlich« zu verstehen, so wie jeder Mensch verstanden werden will – mit seinen Problemen, aber nicht nur anhand seiner Probleme, wie Ursula Haupt sagt: »Das Kind definiert sich nicht durch seine Krankheit, sondern durch seine Persönlichkeit.«
Allerdings formen Krankheit, Schmerzen und Alltagserschwernisse wie Therapien, Medikamente und die Reaktionen der Umwelt sehr wohl die Persönlichkeit mit. Besonders in den letzten Jahrzehnten fand das Thema der Krankheitsverarbeitung zunehmend Interesse bei Ärzten und Psychologen, und Pädagogen profitierten von den Erfahrungen in der Frühförderung und der Inklusion entwicklungsgestörter, chronisch kranker und behinderter Kinder in Kindergärten und Schulen. Parallel dazu blicken wir auf Jahrzehnte intensiver Entwicklung verschiedener Therapieformen für Kinder sowie psychologischer und psychotherapeutischer Methoden, um Kinder und Familie zu stützen und zu beraten.
Von wissenschaftlichen Erkenntnissen bis zu ihrer Umsetzung im Alltag oder in Ausbildungsinhalte ist es schon immer ein weiter Weg gewesen. Hier kann Ihnen das Buch als Handreichung dienen, egal, ob Sie im Kindergarten arbeiten, ob Sie ein Fachschulstudium absolvieren, Sonderpädagogik studieren oder Therapeutin werden. Komplexe Fragestellungen, wie sie sich aus der Arbeit mit kindlicher Entwicklung ergeben, erfordern eine offene Sichtweise, möglichst über den Tellerrand der jeweiligen eigenen Ausbildungsrichtung hinaus, denn man kann ein Kind nicht in pädagogische oder medizinische Scheiben schneiden. Daher ist interdisziplinäre Team-Arbeit zunehmend gefragt. Sie erfordert sowohl eine starke eigene (berufliche) Identität als auch die Bereitschaft, angestammte bzw. erlernte Standpunkte zu verlassen – nicht aufzugeben –, um in offener Lernbereitschaft prozesshaft neue Erkenntnisse zu gewinnen. Es hat sich erwiesen, dass diese Arbeitsweise sehr effektiv ist, dass »zwischen den Ritzen der Systeme neue Wahrheiten quellen« (K. Wiederkehr), dass das Ergebnis derartiger Zusammenarbeit immer mehr ist als nur die Summe seiner Teile.
Abschließend danke ich allen, die mir bei diesem Werk geholfen haben. Da diese Arbeit von meiner täglichen sozialpädiatrischen Tätigkeit nicht zu trennen ist, kann ich nur wenige hervorheben: Frau U. Eisele, die mich als Psychologin im damaligen Modellprojekt zur ersten Broschüre ermunterte; meinem sozialpädiatrischen Lehrer Professor J. Pechstein; Professor Dr. H. Reiser des Frankfurter Instituts für Sonder- und Heilpädagogik für eine entsprechende Lehrtätigkeit; Frau Prof. E. Wilken, die mich zu diesem Buch ermutigte. Zahlreiche Dialogpartner in Eltern-Selbsthilfegruppen haben mir wertvolle Erfahrungsberichte geliefert.
Schließlich wäre ohne die äußerst konstruktive und geduldige Unterstützung durch meinen Lektor im Kohlhammer Verlag, Herrn Dr. K.-P. Burkarth, das Buch wohl nie fertig geworden; ihm gilt mein besonderer Dank – sowie last not least meiner Familie, die auf so viele Abendessen mit mir verzichtete.
Leipzig, im September 2003
Dr. Siegrun von Loh
Vorwort zur 2. Auflage
Nach dem erfreulichen Ausverkauf der ersten Auflage, gab mir die erforderliche Neuauflage Gelegenheit, den Text zu aktualisieren. Das war nötig, denn alle 5 bis 10 Jahre verdoppelt sich das Wissen in der Medizin.
Manches haben Sie bestimmt schon gelesen, etwa die rasante Entwicklung genetischer Forschung, die erkennen lässt, dass die Mehrzahl angeborener Entwicklungsstörungen genetisch verursacht ist. Für Eltern ist es enorm entlastend, die Ursache der Entwicklungsstörung ihres Kindes zu kennen.
Vielleicht haben Sie auch gelesen, dass medizinischer Fortschritt weit mehr krebskranken Kinder zum Überleben verhilft als noch vor 10 Jahren? Das bedeutet allerdings auch, dass Sie mehr Kindern begegnen könnten, die als »bedingt geheilt« im Schulalltag Ihre besondere Aufmerksamkeit brauchen…
Natürlich wirkt sich nicht alles von dieser Wissensflut direkt auf den ärztlichen oder pädagogischen Alltag aus.
Bei der Auswahl praxisrelevanter Erkenntnisse helfen im medizinischen Bereich »Leitlinien« der Fachgesellschaften, etwa der Gesellschaft für Kinderheilkunde oder für Epileptologie. Sie enthalten Handlungsanweisungen für bestimmte Themen, z. B. für »Wahrnehmungsstörungen«, »Diabetesbehandlung« oder »medikamentöse Behandlung von Entwicklungsstörungen«, und sind etwa 5 bis 10 Jahre lang gültig. Manchmal geht es dabei nur um neue Vokabeln, manchmal um völlig neue Konzepte.
Die deutschen Leitlinien sind dabei eingebunden in europäische, oft internationale Fassungen. Wenn Sie also – so wie ich – nicht immer froh sind über eine neue Wortwahl, wie etwa über das Wortungetüm »Umschriebene Entwicklungsstörung - UES«, Teil 6: Sie ist das Produkt redlichen Bemühens deutscher, österreichischer und schweizer Kollegen, diese noch immer schwer einzugrenzenden Hirnfunktionsstörungen genauer zu definieren, zu »umschreiben«, und gilt nun erst einmal fürs deutschsprachige Europa.
Die veränderte Epilepsie-Einteilung wiederum entstand aufgrund neuer Erkenntnisse durch die fortgeschrittene Bilddiagnostik des Gehirns und ist nun international gültig.
Schließlich ist der Begriff »Krankheit« selbst in die Diskussion gekommen, siehe Teil 2: Dem Konzept »krank« als Gegensatz zu »gesund« wird der Begriff »Gesundheitsstörung« gegenübergestellt, der Übergänge von gesund zu krank beinhaltet. Gerade chronisch kranke Kinder kennen diese Fluktuationen (»mal besser, mal schlechter«) sehr gut; und Kinder mit Entwicklungsstörungen fühlen sich oft überhaupt nicht »krank«. Das wissen wir zwar schon, aber in unserer Sprache fand sich das noch nicht wieder. Deshalb wurde in dieser Auflage auch aus der »Krankheitswahrnehmung« die »Selbstwahrnehmung des Kindes«.
Nach dem Kinder-und Jugendgesundheitssurvey KIGGS (2007) sind seelische und soziale Probleme zunehmend Ursache für eingeschränkte Kindergesundheit. Das fordert zu interdisziplinärer Zusammenarbeit auf, zu der auch das Vokabular der »ICF« (WHO) ermuntert. Diese begrüßenswerten Konzepte ganzheitlicher Erfassung kindlicher Gesundheit und Entwicklung sind – wie das Konzept »Inklusion« – noch sehr unterschiedlich weit akzeptiert und realisiert.
Dieses Buch ist ein ergänzender Text zu all diesen Entwicklungen, denn sein Konzept ist unverändert die ganzheitliche Erfassung des Kindes von seiner biologisch-medizinischen Verfassung her bis zu seinen seelischen, sozialen und alltagspraktischen Aspekten wie Belastbarkeit und Selbstwahrnehmung (Befinden und Verhalten). Es soll Ihnen – wie bisher – helfen, Kinder mit verschiedensten Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen in Kindergarten, Schule und Therapie zu verstehen und zu begleiten.
Und bleiben Sie gelassen, es kann sein, dass Sie noch lange Zeit bei Ihren Gesprächen mit Ärzten und Psychologen die alten Vokabeln hören; Hauptsache, Sie verstehen einander!
Zu guter Letzt: Das Buch entstand nicht nur am Schreibtisch. Zahlreiche Gespräche – auch außerhalb des Berufsalltags – mit betroffenen Kindern und Eltern, mit Kindergartenerziehern und Lehrern, mit Kollegen, Therapeuten, Psychologen, Sozial- und Heilpädagogen haben mir dabei geholfen, den Text alltagsnah zu gestalten. Ihnen allen herzlichen Dank!
Machern bei Leipzig im Sommer 2017
Siegrun von Loh
Teil 1: Biologische Grundlagen von Wachstum und Entwicklung
1 Die ersten Jahre – eine besonders wichtige Zeit
Bei Geburt bringt das Menschenkind bereits Millionen Jahre menschlicher Entwicklung mit, beispielsweise die Anlage zum aufrechten Gang oder das Bedürfnis, sich sprachlich mitzuteilen. Aus jüngerer Erbfolge erinnern Sie sich an Familienmerkmale wie die Nase des Vaters, die Intelligenz der Mutter – leider auch manchmal deren erbliche Krankheiten oder Lernstörungen.
Auf diese genetischen Faktoren wirken unmittelbare Einflussfaktoren aus der Schwangerschaft: die mütterliche Gesundheit, die sozioökonomische und seelische Lage der Familie. Trotz großer Fortschritte in der vorgeburtlichen Diagnostik bleiben die meisten Entwicklungsbedingungen des Kindes im Mutterleib auch heute noch im Dunklen, bis das Kind selbst das Licht der Welt erblickt.
Erst nach dem risikoreichen Ereignis »auf Leben und Tod« von Mutter und Kind, der Geburt, zeigt sich, zumindest äußerlich: Ist das Kind gesund? Ist »alles dran«? Ob alles drin ist, besonders im Gehirn, wissen wir, bis auf Ausnahmen, auch dann noch nicht: Wird es alle Blüten seiner mitgebrachten Fähigkeiten entfalten können oder nur einige und gerade die, die es sich selbst wünscht? Das hängt in starkem Maße auch von seinen äußeren Lebensumständen ab, die wir alle mitgestalten.
In grafischer Vereinfachung zeigt der »Entwicklungsbaum« (s. Abb.1, S. 18) auf der linken Seite biologische und gesundheitliche, rechts soziokulturelle Einflüsse, deren intensivster und erster die Familie des Kindes ist – im Guten wie im Schlechten. Der Baum illustriert auch die bio-psycho-soziale Komplexität kindlicher Entwicklung, denn alle diese Einflüsse verflechten sich während der kindlichen Entwicklung untrennbar miteinander zu einem komplexen Gewebe und beeinflussen einander. Gute oder schmerzhafte Erfahrungen werden später wie körperliche oder seelische Knoten oder Narben zu spüren sein. Andere verschwinden oder bleiben im Unbewussten verborgen, dennoch zeitlebens unser Handeln mitbestimmend.
Konzepte für Betreuung frühkindlicher Entwicklungsstörungen müssen diese Komplexität berücksichtigen und »ganzheitlich« sein.
1. Merksatz: In der frühen Kindheitsentwicklung sind alle Funktionen biologisch miteinander verbunden und voneinander abhängig.
Eine gerade Linie zwischen einem bestimmten Ereignis und einer Blüte des »Entwicklungsbaums« gibt es sehr selten, denn unzählige Faktoren wirken auf den kindlichen Organismus ein, der selbst in höchster Geschwindigkeit wächst und sich verändert. Während der Erwachsene einzelne Funktionen wie Denken, Bewegung und Emotion weitgehend unabhängig voneinander aktivieren, bremsen oder fördern kann, ist es eine biologische Besonderheit des Kleinkindes, dass alle Funktionen noch miteinander verbunden sind. Beispielsweise gerät beim Baby der ganze Körper in Bewegung, wenn es sich freut. Leider können sich deshalb Störungen auch komplex auf die gesamte Entwicklung auswirken.
Die Komplexität kindlicher Entwicklung erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fachleuten, die ihr Spezialwissen zu einer ganzheitlichen Sicht kindlicher Entwicklung zusammenzufügen.
2. Merksatz: Das Gehirn wächst am Die Hirnforschung nennt die strukturelle und funktionelle Vernetzung von Nervenzellen im Gehirn »Konnektivität«. schnellsten in den ersten 3 Lebensjahren
Bei Geburt besteht das menschliche Gehirn schon aus mehr als 100 Milliarden Zellen. Es wächst dann sehr schnell: Am Ende des 3. Lebensjahres hat es bereits 80 % des Erwachsenen-Volumens erreicht. Aber nicht die Hirnzellen (= Neuronen) vermehren sich, sondern es sind ihre Verzweigungen (Dendriten), die enorme Netzwerke untereinander durch Aussprossung bilden und sich in ca. 100 Billionen Schaltstellen (Synapsen) verknüpfen. Dieses Netz funktioniert in komplexen Regelkreisen, die lange Zeit variabel bleiben, um stets neue Eindrücke verarbeiten zu können.
Dendriten sprossen immer dann aus, wenn das Hirn Informationen aus der Außen- und Innenwelt des Säuglings als Nervenimpulse erhält und sie in den ihnen genetisch zugedachten Zentren eintreffen: Um einen Seheindruck zu verwerten, wird dieser beispielsweise im Sehzentrum, aber auch im Zentrum für Personengedächtnis verarbeitet. Bei wiederholter Benutzung dieser »Leitung« werden aus Einzeleindrücken bleibende Erinnerungsbilder, die sich – z. B. als das stets wiederkehrende Gesicht der Mutter – durch Dendriten und Synapsen biologisch fixieren. Nervenaussprossungen, die nicht weiter genutzt werden, verschwinden wieder.
3. Merksatz: Die biologische Fixierung von Lerneindrücken ist einzigartig für die frühe Kindheit
Die Zahl der Nerven-Aussprossungen im Gehirn ist abhängig von der Zahl der Impulse, die im Gehirn ankommen. Dadurch ist die Gehirnentwicklung von Mensch zu Mensch verschieden, wobei natürlich das menschliche Gehirn in der Grundausstattung bei jedem gleich ist. In der Computersprache könnte man das anatomische Gerüst mit »Hardware« beschreiben, die variablen Lernmöglichkeiten und ihre Vernetzungswerke mit »Software«.
4. Merksatz: In früher Kindheit zeigt die Hirnentwicklung umweltabhängige Variabilität, d. h. »Plastizität«.
Die umweltabhängige Variabilität des Hirnwachstums nennt man »Plastizität«. Sie birgt Gutes wie Schlechtes. Wenig Informationszufuhr lässt wenig sprossen: Hirn und Kopfumfang bleiben klein, die Hirnleistung bleibt begrenzt. Zu wenig Information erhalten Kinder, die in psychosozialen Problemsituationen »vernachlässigt« aufwachsen, etwa
• durch überforderte oder minderjährige allein erziehende Mütter,
• in anhaltender Familiendisharmonie,
• mit depressiven, abgelenkten Eltern in Situationen wie Armut, Arbeitslosigkeit, in Krisen wie Katastrophen, Krieg,
• in langen Krankenhausaufenthalten und
• als Frühgeburt in Inkubatoren (Maschinen statt Mutterleib).
Abb. 2: Schnell zunehmende Vernetzung der Nervenzellen im Gehirn
Entwicklungsrisiken durch mangelnde Zuwendung können aber innerhalb der ersten Lebensjahre gerade aufgrund der biologischen Plastizität durch gezielte Stimulation und Zuwendung nachweislich auch wieder ausgeglichen (kompensiert) werden. Dieses Aufholen ist nur in den ersten 3–4 Lebensjahren möglich!
Auch therapeutisch wird Plastizität genutzt: Hirnzellen können durch gezielte Stimulation zu kompensierender Aktivität angeregt werden. Viele Therapiearten, besonders »auf neurophysiologischer Grundlage«, wie Bobath, Vojta oder Basale Stimulation, nutzen diese Fähigkeit seit 30–40 Jahren.
Aber: Viel hilft nicht einfach viel! Die richtige Anregung muss in der richtigen Qualität zur richtigen Zeit kommen: Das Gehirn muss entwicklungsmäßig in der Lage sein, die Anregung verarbeiten zu können.
5. Merksatz: Jede Funktion hat eine optimale Zeit höchster biologischer Lernfähigkeit, die »Sensible Phase«, auch »Lernfenster« genannt. Nutzen Sie diese förderpädagogisch und therapeutisch!
Abb. 3: Beispiele für sensible Phasen, in denen diese Fähigkeiten besonders leicht erworben werden (Graphik mod. n. L. Wagner).
Diese Phasen gehen vorbei und kommen nicht wieder. Je später ein Förderangebot in Bezug auf die sensible Phase einsetzt, desto weniger effektiv und desto zeit- und kostenaufwändiger wird es verlaufen, von den seelischen Folgestörungen (Störungsbewusstsein bei Kind und Familie, soziale Stigmatisierung) ganz zu schweigen.
Plastizität, umweltabhängige Hirnentwicklung, sensible Phasen sind der wissenschaftliche Boden, auf dem die Maßnahmen von Früherkennung, Frühförderung, Frühtherapie und früher sozialer Integration wachsen.
Sie können nicht ohne den Hauptfaktor frühkindlicher Entwicklung wirksam werden, der das Medium jedes Lernens und jeder Stimulation ist: die liebvolle zwischenmenschliche Beziehung. Liebe und Zuwendung öffnen die emotionale Lernbereitschaft.
6. Merksatz: Gefühle bestimmen die Architektur des Gehirns.
VokabelnDeprivation: Entbehrung Deprivationssyndrom: leiblich-seelischer Entwicklungsrückstand durch Zuwendungsmangel, fehlendes Geborgenheitsgefühl
Ohne Liebe blockiert Angst die Neuronenaussprossungen und verursacht körperlich-seelische Schäden, das sog. Deprivationssyndrom, das schon nach mehrwöchigem Krankenhausaufenthalt auftreten kann, falls die Eltern nicht beim Kind bleiben können und die Kinder dauernde Verlustangst erleiden. Daher sind Kinder auch Hauptleidensträger in Belastungssituationen wie Krieg, Katastrophen und innerfamiliärer Gewalt. Liebevolle Interaktion kann sich nur in konstanter Beziehung entwickeln!
So stehen in der kindlichen Entwicklung biologisch-genetische Voraussetzungen und Umweltanregung in ständiger Wechselwirkung. Wann jeweils was dominiert, lässt sich nicht präzise nachweisen. Der amerikanische Kinderneurologe Harry T. Chugani sagte dazu: » Wir können wenig daran ändern, was vor der Geburt passierte, aber wir können stark beeinflussen, was danach geschieht.«
2 Wachstum und Differenzierung
Die Entwicklung des menschlichen Organismus beruht auf zwei biologischen Vorgängen: Wachstum durch Zellvermehrung und Entfaltung verschiedener Zellfunktionen (Differenzierung).
Zellvermehrung
Wachstum geschieht nicht durch Vergrößerung einzelner Zellen, sondern durch Vermehrung ihrer Zahl: Eine Maus hat beispielsweise nicht kleinere Zellen als ein Elefant, sondern weniger. Für den Körper jedes Lebewesens ist die Anzahl seiner Zellen genetisch festgelegt. Die Zellvermehrung, die nach der Befruchtung einsetzt, verläuft dieser »inneren genetischen Uhr« gehorchend. Die Umwelt, beim Menschenkind zunächst der Mutterleib, muss allerdings die Grundbedingungen zum Gedeihen, nämlich einen geschützten Keimort und Nahrung, bereitstellen.
Der Körper besitzt verschiedene Steuerungszentren, die dafür sorgen, dass der genetische Auftrag auch ausgeführt wird. Mittels Botenstoffen, z. B. Hormonen, regulieren sie die chemischen Vorgänge, die Ernährung und den Energiebetrieb der Zellen und garantieren damit ihr Wachstum. Die Gesamtheit aller chemischen Vorgänge nennt man den »Stoffwechsel« des Körpers.
Der Stoffwechsel benötigt bestimmte Rohstoffe, z. B. Nahrungsmittel oder Sauerstoff, um den Wachstumsauftrag erfüllen zu können (vgl. Kapitel »Stoffwechselstörungen«).
Wachstumsstörungen beruhen hauptsächlich auf vier Störungsmechanismen:
1. genetische Störung,
2. hormonelle Störung,
3. Mangel an Rohstoffen,
4. Einwirkung durch äußere Schädigung, z. B. durch krankmachende Faktoren.
Wachstumsstörungen können einzelne Zellen, einzelne Organe, Organsysteme oder den ganzen Körper betreffen.
Differenzierung
bedeutet die nach einem erblichen Muster angelegte Entwicklung zu einer typischen Form und spezialisierten Funktion. Auch das Potenzial zur Differenzierung ist bei jeder Art genetisch festgelegt: So vermag der menschliche Körper etwa 300 verschiedene Zelltypen zu entwickeln. Zu Beginn der Embryonalzeit sind die Körperzellen eine kurze Zeit lang noch »pluripotent«, d. h. sie können durch entsprechende Umweltbeeinflussung verschiedene Entwicklungsrichtungen nehmen. Diese Besonderheit beschäftigt gegenwärtig die »Stammzellforschung« in der Hoffnung, pluripotente (Stamm-) Zellen für »Organreparaturen« nutzen zu können. Nach wenigen Zellteilungen setzt dann aber die funktionsspezifische Differenzierung ein, und eine Herzzelle bleibt beispielsweise eine Herzzelle und passt nicht mehr in den großen Zeh.
Ein Teil der menschlichen Zellen differenziert sich allein gemäß des ihnen innewohnenden genetischen Bauplans aus. Andere Zellen benötigen zur vollen Entfaltung ihres Entwicklungspotenzials zusätzlich einen »Anstoß« durch die Nachbarschaft oder durch die Außenwelt: Darmzellen etwa produzieren Verdauungssäfte erst nach Kontakt mit entsprechenden Nahrungsmitteln, Hirnzellen entwickeln ihre Denkfähigkeit erst durch Aufnahme von Information über die Sinnesorgane. Ohne diese Arbeitsaufgaben (Stimulation) bleiben diese Organe relativ primitiv und undifferenziert, sie können sogar verkümmern.
Störungen der Differenzierung können jederzeit während der kindlichen Entwicklung durch unterschiedlichste Einwirkungen – wie unter Wachstumsstörungen beschrieben – verursacht werden. Die Folge ist eine verzögerte, veränderte (manchmal verminderte, manchmal überschießende) oder gestörte kranke Organfunktion.
Wachstum und Differenzierung
sind nicht in gleichem Maße möglich. Je höher differenziert ein Organ ist, desto mehr verlieren seine Zellen die Möglichkeit zur Vermehrung. Die Haut, die in den äußersten Zellschichten ein ziemlich undifferenziertes Organ ist, kann sich an der Oberfläche ständig durch Abschilfern und Zellwachstum erneuern. Alle Hirnzellen hingegen »leben« nur einmal: eine zerstörte Hirnzelle bleibt verloren.
Es gibt aber die Möglichkeit, dass sich benachbarte Hirnzellen neu vernetzen und in dieser Zusammenarbeit die verlorene oder gestörte Zelle in ihrer Funktion »ersetzen«. Mehr darüber im Kapitel » Besonderheiten frühkindlicher Entwicklung«.
3 Besonderheiten frühkindlicher Entwicklung
Während der frühkindlichen Entwicklung verändern sich Körper, Intellekt und Persönlichkeit fast von Tag zu Tag. Störeinflüsse treffen beim Kind daher auf sehr unterschiedliche Verhältnisse. Ihre Auswirkungen sind dementsprechend variabel, je nachdem, in welchem Entwicklungsalter sich Körper, Psyche oder Intellekt befinden.
Wegen ihrer besonderen hohen Entwicklungsintensität und -geschwindigkeit fasst man die ersten Lebensjahre als »frühkindliche Zeit« zusammen, eine recht grobe Orientierung, vergleicht man das neu geborene Kind mit einem 2-Jährigen. Gemeinsam ist beiden, dass die meisten Entwicklungsprozesse noch nicht abgeschlossen sind und deshalb jede Störung die weitere Entwicklung mitbeeinflussen könnte. Es gibt einige biologische Besonderheiten, die typisch sind für »die frühen Jahre«:
Besondere Anfälligkeit
Je jünger ein Organismus ist, desto störanfälliger ist er, da die eigene Körperabwehr erst im Entstehen ist.
Besondere Heilungsfähigkeit
Durch die für Wachstum und Entwicklung besonders große Bereitschaft zur Zellvermehrung und Differenzierung heilen viele Störungen und Krankheiten schneller und besser als beim Erwachsenen.
Auswirkungen vorgeburtlicher Störung
Je früher eine Störung den kindlichen Organismus trifft, desto vielfältiger und variabler sind die Auswirkungen, denn es werden nicht nur die augenblicklich vorhandenen Zellen, sondern auch das noch in ihnen schlummernde Entwicklungs- und Differenzierungspotenzial getroffen. Dies gilt besonders für die vorgeburtliche Zeit (Embryonalzeit). Wie Abbildung 4 zeigt, entstehen
• Störungen des Wachstumspotenzials besonders zu Zeiten der frühen Zellteilungsphasen (1.–3. Embryonal-Monat), sodass etwa Gliedmaßen nicht ausgebildet werden (wie es beispielsweise durch Contergan geschah) oder Körperteile nicht zusammenwachsen, was Spaltbildungen zur Folge hat, etwa des Rückenmarkskanals (siehe Kapitel Spina bifida) oder die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte.
• Störungen des Differenzierungspotenzials bedeutet, dass die Zell- oder Organfunktion »primitiv« bleibt. Falls Gehirnzellen betroffen sind, können sie Umweltreize nicht aufgaben- und altersentsprechend verarbeiten. Der Zelle sieht diese Funktionsstörung von außen oft nicht an, sodass Bilddiagnostik vom Gehirn »normale« Bilder zeigen kann.
• Vorgeburtliche Störungen des psychischen Potenzials des Kindes sind sowohl neurobiologisch wie entwicklungspsychologisch in den letzten Jahrzehnten intensiv beforscht worden: Ihre Ergebnisse zeigen übereinstimmend, dass Bewusstsein und Erinnerungsvermögen betreffs emotionalen Wohl- oder Miss-Empfindens sehr früh entstehen und die Ausgestaltung der vorgeburtlichen Hirnstruktur hinsichtlich der Persönlicheitsbildung mitbeeinflussen ( Abb. 4).
Zur Bedeutung frühkindlicher Störeinflüsse
Die Wissenschaft hat sich in den letzten 40 Jahren sehr eingehend mit den vorgeburtlichen Entwicklungsbedingungen und ihren Risiken und Störungen beschäftigt. Zunächst wurden große Tabellen mit so genannten »Risikofaktoren« zusammengestellt, dann die spätere Entwicklung der Kinder verfolgt und daraus verschiedene Schlüsse gezogen:
• Eine Schwangerschaft und Geburt eines Kindes ohne Risikofaktoren gibt es nicht.
• Es ist nicht möglich, eine gerade Linie von einem bestimmten Risikofaktor zu einem typischen späteren Störungsbild zu ziehen, einzelne Risikofaktoren sollen daher nicht überbewertet werden.
• Entwicklung ist ein multifaktorielles Geschehen. Man kann nie alle Faktoren erfassen oder gar kontrollieren.
• Dennoch sollte man sich darum bemühen, dem Kind schon vor der Geburt bestmögliche Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Ungünstige Entwicklungsbedingungen für ein Kind sind immer ein Risiko für mögliche Entwicklungsstörungen.
• Die vorgeburtliche Entwicklung ist eingebettet in das körperliche, seelische und soziale Wohlergehen der Mutter in ihrem sozialen Umfeld.
• Für Mutter und Kind gilt zu jedem Zeitpunkt, dass im Falle einer Erkrankung oder einer Entwicklungsstörung möglichst frühe Hilfe die besten Chancen für eine Besserung mit sich bringt.
Abb. 4: Vorgeburtliche Risikofaktoren und einige ihrer Auswirkungen
4 Krankheit, Kranksein, Entwicklungsstörung und Behinderung
Was ist »Krankheit«?
Krankheit ist ein medizinischer Begriff und bezeichnet Störungen körperlicher oder geistig-seelischer Funktionen. Ein Krankheitsname, etwa »die Masern«, fasst eine definierte Gruppe von Krankheitszeichen (Symptome) zusammen, die für diese Störung in dieser Kombination typisch sind – hier u. a. die Art der roten Pünktchen, der Fieberverlauf. Mit eingeschlossen sind definierte
• Störungsursachen (Ätiologie)
• Krankheitsentstehung- und Entwicklung (Pathogenese)
• Struktur- und Funktionsveränderungen, einschließlich Labor- und Röntgenbefunden (Pathologie)
• Verlauf und Krankheitsfolgen (Prognose).
Im ärztlichen Alltag regeln diese Basisbegriffe das Vorgehen bei der Frage, welche Krankheit gerade vorliegt und wie sie zu behandeln ist.
Gegenstand der Medizin als Heilkunde sind Krankheiten, nicht Gesundheit.
Soziale Einflussfaktoren
Das o. g. Konzept passt zu vorübergehenden »akuten« körperlichen, biologisch verursachten Krankheiten. Und wir Krankenversicherte vergessen manchmal, dass auch bei den Masern die sozialen Begleitumstände den Krankheitsverlauf und das Befinden (= Leiden) des Kindes beeinflussen: Wer pflegt das Kind wie? Wer bringt ihm die Hausaufgaben während der versäumten Schulstunden? Wird es häufig genug zum Arzt gebracht, um Komplikationen, wie bleibende Hörstörungen, zu verhindern? Wer kümmert sich um seine Ängste und Schmerzen?
Die Kinder- und Säuglingssterblichkeit ist in sozial schwachen Familien doppelt so hoch wie in der obersten Sozialschicht.
Diese Faktoren beeinflussen den Schweregrad, Dauer, Komplikationen und Heilungsverlauf der Erkrankung.
Weitere Definitionen von Krankheit
• Im Arbeits- und im Versicherungsrecht werden diejenigen Personen als »krank« bezeichnet, die pflegebedürftig sind und deren Zustand Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben kann.
• Im Rentenversicherungsrecht bedeutet »Krankheit« eingeschränkte Erwerbsfähigkeit.
Was ist »Chronische Krankheit«?
Chronisch heißt: Die Krankheit entwickelt sich langsam, besteht mindestens schon 6 Wochen,
• verläuft schleichend,
• dauert an, oft lebenslang,
• ist meist unheilbar.
Typisch ist ein phasenhafter Verlauf mit besseren und schlechteren Zeiten, manchmal krisenhafter Zuspitzung. Die Behandlung umfasst:
• Förder- und Therapiemaßnahmen,
• Vorsorge vor Komplikationen, Begleit- und Folgeerkrankungen,
• Heilung oder Rehabilitation,
• Pflege.
Körperliche Störungen beeinträchtigen die seelische Befindlichkeit: Kinder mit chronischen Krankheiten wie Asthma leiden fast doppelt so häufig wie körperlich gesunde Kinder an psychischen Störungen wie Angst- und Depression.
Die Betreuung chronisch kranker Kinder erfordert daher eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit der medizinischen, pädagogischen und psychosozialen Fachkräfte, die Hand in Hand mit den Eltern, ihren Selbsthilfegruppen und Förderkreisen arbeiten sollten.
Die Zahl chronisch kranker Kinder hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Pro Jahr befinden sich 1,5 Millionen Kinder in Deutschland mit chronischen Krankheiten in Krankenhäusern. Hinzu kommen mehr und mehr Kinder, die aufgrund medizinischer Fortschritte vormals tödliche Krankheiten überleben, etwa Leukämie, oder durch Transplantationen neue Lebensabschnitte genießen. Diese Kinder gehen in Kindergärten und Schulen, sobald es ihnen möglich ist und Sie sie willkommen heißen.
Was ist »Kranksein«?
Kranksein entspricht einem persönlichen (subjektiven) Krankheitsgefühl, dem Befinden. Etwa 50 % der Patienten der Allgemeinärzte in Deutschland fühlen sich krank, leiden beispielsweise an Schlaf-, Ess- und Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen oder depressiven Gefühlen ohne nachweisbare körperliche Störungen, aber auch ohne psychiatrisch krank zu sein.
Kranksein ist in Entstehung und Art kulturabhängig: »Stress« z. B. ist in manchen Kulturen anerkannt krankmachend, anderswo überhaupt nicht bekannt. In anderen Kulturen hingegen wirken spirituelle Einflüsse, z. B. »der böse Blick«, krankmachend und leiten entsprechende Therapie ein.
Ein Kranksein begleitet viele Krankheiten, Entwicklungsstörungen und Behinderungen, wobei das Ausmaß der persönlichen Beeinträchtigung unabhängig vom objektiven Grad der Störung, ihrem Schweregrad ist. Das liegt an der individuellen Ausstattung der kindlichen Persönlichkeit mit ihrer jeweiligen seelischen Widerstandskraft (Resilienz) sowie am psychosozialen Umfeld mit seinen Schutz- und Unterstützungsmöglichkeiten und Werten. Deshalb ist in diesem Buch bei jeder Krankheit und Entwicklungsstörung unter dem Abschnitt »Selbstwahrnehmung« das Erleben und Empfinden des Kindes mitberücksichtigt worden.
Was ist eine »Entwicklungsstörung«?
Die Entwicklung eines Kindes geht stetig, manchmal unmerklich, dann wieder mit großen Schritten voran. Bei den meisten Kindern laufen diese Vorgänge wie von allein ab, solange die Grundbedingungen, wie etwa Essen, Schlafen und liebevolle Zuwendung, vorhanden sind. Innerhalb dieses Prozesses gibt es einige Zeitmarken, die allgemein bekannt sind, etwa, wann das Kind laufen oder »Mama« sagen soll. »Zur rechten Zeit« sagen wir dazu, dem Gefühl nach. Das kann natürlich trügen und ist insgesamt sehr ungenau. So kann der Kinderarzt plötzlich feststellen: Hier ist leider etwas nicht in Ordnung, das Kind hat eine
• Entwicklungsauffälligkeit oder -abweichung, und meint damit, das Kind erreicht bestimmte Funktionen, etwa das Sprechen oder Laufen, nicht zu dem normalen Zeitpunkt wie andere Kinder. »Normal« umfasst hier eine Zeitspanne, innerhalb welcher 90 % – 95 % aller gleichaltrigen Kinder diese Fähigkeit erreicht haben. Abweichungen davon sind noch kein Grund zur Panik – aber zur Aufmerksamkeit! Der Arzt muss jetzt schauen, ob es einen Grund für diese Auffälligkeit gibt. Findet er keine Krankheit oder Störung, handelt es sich wahrscheinlich um eine Variante der Entwicklung, und die nächste Entwicklungsuntersuchung nach etwa 1/4 Jahr kann abgewartet werden.
Bleibt das Kind weiterhin entwicklungsauffällig, müssen fachärztliche Untersuchungen klären, ob die Entwicklung des Kind verzögert oder gestört oder beides ist.
• Entwicklungsverzögerung (»Retardierung«) bezieht sich auf die Geschwindigkeit der Entwicklung: Sie ist zu langsam – entweder einzelne Fähigkeiten betreffend oder das ganze Kind. Bei dieser Diagnose geht der Kinderarzt davon aus, dass die Verzögerung mit geeigneter Förderung oder Therapie aufholbar ist, besonders wenn sie frühzeitig entdeckt und betreut wird. Immer muss regelmäßig nachuntersucht werden, wie sich das Kind weiter entwickelt.
»Entwicklungsrückstand« oder »psychomotorische Retardierung« sind ähnliche Bezeichnungen, die von Fachleuten aber eher vermieden werden.
• Entwicklungsstörung betrifft die Qualität der Entwicklung: Einzelne oder mehrere Funktionen oder das ganze Kind sind deutlich gestört oder krank; eine ungestörte, normale Entwicklung ist ihm verwehrt. Entwicklungsstörungen können leicht oder schwerwiegend sein und natürlich auch die Entwicklungsgeschwindigkeit beeinträchtigen. Sie müssen immer behandelt werden. Störung einzelner Funktionen heißt heute »Umschriebene Entwicklungsstörung« (UES).
Die Ursachen von Entwicklungsstörungen?
Diese sind äußerst vielfältig. Viele Störungen sind schon angeboren, manchmal vererbt, manchmal Folge einer schweren Krankheit. In etwa 50 % bleibt die Ursache ungeklärt. Bei jedem Kind sollte dennoch versucht werden, die Ursache herauszufinden, weil sie zur Genauigkeit der Diagnose, damit zur Therapie beiträgt und die Eltern von Schuldgefühlen befreit.
Wie erkennt man eine Entwicklungsstörung?
Das entwicklungsgestörte Kind handelt oder verhält sich »anders« als altersgleiche Kinder. Manchmal sieht es auch anders aus oder hat eine körperlich sichtbare Störung, wie etwa einen Klumpfuß. Bei leichten Störungen ist es oft schwierig zu unterscheiden: Ist das noch »normal« oder nicht? Der Kinderarzt kann hierüber Auskunft geben.
Eine weitere wichtige Frage ist: » Kann das Kind das nicht oder will es nicht?« Vielleicht will es nicht, weil es nicht kann, und hilft sich, indem es
• Ihre Aufforderung verweigert,
• sich zurückzieht,
• kaspert, ausweicht,
• oder sich aggressiv verhält.
Viele »Verhaltensstörungen« verbergen die seelische Not eines Kindes, das einfach nicht mithalten kann. Seelische Not, die sich in Verhaltensstörungen äußert, kann aber auch rein seelische Gründe haben und ihrerseits der Grund dafür sein, dass ein Kind seine ganz normale Begabung nicht zum Tragen bringen kann – etwa aus Angstgefühlen heraus, aus Schüchternheit oder aufgrund von innerer Unruhe durch unverarbeitete Probleme wie Trennungen, Misshandlungen u. v. m.
Wenn Sie sich solchen Fragen gegenüber sehen, lassen Sie sich bitte beraten (Fachberater, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Psychologe usw.) bzw. bitten Sie die Eltern, ihr Kind untersuchen zu lassen (Adresse bereithalten!). Eine umfassende Entwicklungsdiagnostik schließt neben dem kinderärztlichen körperlichen Befund immer auch die neurologische und psychologische Untersuchung (Intelligenz, Verhalten) mit ein. Lassen Sie sich die Untersuchungsbefunde schriftlich mitgeben und achten Sie darauf, welche Testverfahren angewandt wurden, und lassen Sie sich das Ergebnis erklären.
Kann man Entwicklungsstörungen heilen?
Manche Entwicklungsstörungen entstehen durch verborgene Krankheiten, mit deren Heilung das Kind gute Chancen einer zukünftig ungestörten Entwicklung hat. Andere Entwicklungsstörungen kann man zwar nicht heilen, aber durch Förderung und Therapie aufgrund der Plastizität des kindlichen Gehirns wesentlich bessern. Eine gute Behandlung schließt den Lernprozess ein, dass Kind und Familie trotz einer Einschränkung das Leben »normal« finden. Dieser »Selbstfindungsprozess« hängt nicht unwesentlich von der Reaktion des unmittelbaren sozialen Umfelds und den gesellschaftlichen Werten ab. Deshalb haben Kindergarten und Schule immer einen wesentlichen Anteil am Entwicklungsverlauf – ob sie wollen oder nicht.
»Behinderung«
Was ist Behinderung?
Definition nach Sozialgesetzbuch IX, §2 Abs.1: Menschen werden als »behindert« bezeichnet, wenn ihre »körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von ihrem alterstypischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist«. Sie sind »von Behinderung bedroht«, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. »Behinderung« beschreibt also
• Funktionsbeeinträchtigungen eines Menschen (medizinische Dimension) und
• deren Auswirkungen auf das tägliche Leben (soziale Dimension).
Das Wort »Behinderung« wird oft diskutiert (s. u.), weil es bisher den Anteil des Menschen benennt, der nicht so gut funktioniert und daher als negative Gesamtwertung des Betroffenen empfunden werden kann. Gegenwärtig kommt man an diesem Wort aber noch nicht vorbei, weil die deutsche Sozialgesetzgebung ihre finanzielle und praktische Hilfe auf dieser Definition begründet. Hier hat die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, s. u.) noch keine direkte Auswirkung.
Praktische Hilfen der Sozialgesetzgebung umfassen beispielsweise Pflegedienst, Frühförderung, heilpädagogische Förderung, integrative Förderung in der Regelschule, Sonderbeschulung, Berufsausbildung, Studium, Beschäftigung und Sozialintegration. Finanzielle Hilfen sind unter »Nachteilsausgleich« beschrieben.
Diese Hilfen verbessern die Entwicklungs- und Ausbildungschancen des Kindes. Nicht alle Familien kennen ihre Rechte, andere haben Hemmungen, zum Amt zu gehen. Ermutigen Sie Eltern immer, sich über ihre Rechte zu informieren und sie wahrzunehmen; Sozialarbeiter und Sozialpädiatrische Zentren helfen hier gerne.
Arten der Behinderung
Medizinisch werden Behinderungen eingeteilt in die großen Kategorien
• Körperbehinderung,
• Sinnesbehinderung (Blindheit, Schwerhörigkeit, Taubheit, usw.),
• Sprachbehinderung,
• Lern- und geistige Behinderung,
• Seelische (psychische ) Behinderung.
Ca. 10 % der Menschen in Deutschland leben mit einer Behinderung. Ca. 25 % davon sind Kinder und Jugendliche (Statistisches Bundesamt 2007)
Kombinationen nennt man »Mehrfachbehinderung«.
Am bekanntesten sind Körperbehinderungen, weil sie am leichtesten erkennbar sind; es gibt aber insgesamt 55 Behinderungsarten. Ihre Benennung geht nicht von der medizinischen Diagnose aus, sondern von ihrer Erscheinungsform und der durch sie verursachten Funktionseinschränkung z. B. »Funktionsminderung einer Gliedmaße«.
Ursachenkonzepte von Behinderung
Das Wort »behindert« kann abhängig vom Blickwinkel angewendet werden:
• Jemand ist behindert – dies entspricht dem medizinischen Modell der Funktionseinschränkung.
• Jemand wird behindert – dies entspricht dem sozialen Modell von Behinderung.
Finanzielle Hilfen durch das Sozialhilfegesetz
Familien mit einem behinderten Kind geraten leicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten, weil die Pflege und Betreuung des Kindes so viel Zeit kostet, dass die Möglichkeiten elterlicher Berufstätigkeit eingeschränkt sind. Gleichzeitig erhöhen sich die Lebenshaltungskosten durch besondere Pflegemittel, Nahrungsmittel oder Kleidungsstücke und durch die zahlreichen Wege zu Ärzten, Ämtern und Therapien. Deswegen sorgt die deutsche Sozialgesetzgebung für »Nachteilsausgleiche«, beispielsweise durch
• Steuererleichterungen,
• Vergünstigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch für Begleitpersonen,
• Unfallversicherung der Begleitperson,
• Vergabe von behindertengerechten Wohnungen,
• Zuschüsse für besondere bauliche Maßnahmen,
• ermäßigte Eintrittspreise bei vielen Veranstaltungen, u. v. m.
Berechtigungsnachweis hierfür ist der »Behindertenausweis«, der formlos beim Sozial- oder Versorgungsamt beantragt werden kann. Berichte der behandelnden Ärzte unterstützen das Verfahren, das den Grad der Behinderung (GdB) feststellt, womit in erster Linie die Auswirkung einer Behinderung gemeint ist. Der von 10–100 gestufte GdB misst nicht in Prozent! Ein GdB von 100 entspricht einem hohen Grad erforderlicher Hilfeleistung, sagt aber nicht, dass jemand 100 % behindert ist! Als »schwerbehindert« gilt ein Mensch, dessen GdB mehr als 50 beträgt.
Zusätzlich gibt es bestimmte »Merkzeichen« betreffs der individuellen Einschränkung, wie gehbehindert (G) oder blind (Bl), die auch in den Behindertenausweis eingetragen werden.
Auch wenn wir Kinder anders sehen möchten als in Zahlen für einzelne Gliedmaßen zerteilt, sind diese Befunde unentbehrlich als Berechnungsgrundlage finanzieller Unterstützung und können zu Förder- und Schullaufbahnempfehlungen beitragen.
Der Behindertenausweis ist i. a. fünf Jahre gültig, der Inhalt kann bei Bedarf jederzeit korrigiert werden. Dabei kann das Ausmaß einer Behinderung bei gleichem Störungsbild sehr unterschiedlich sein. Die Beurteilungen können auch durchaus im Kontrast zum persönlichen Leidensgrad stehen oder nicht zum sozialen Stigma einer bestimmten Behinderung passen.
»Mein Millionenkind«, sagte eine Mutter über ihr behindertes Kind zur Autorin
Die Beurteilung einer »Behinderung« im Behindertenausweis sagt nichts aus über die nichtbehinderten Fähigkeiten und Werte eines Kindes und kann deshalb für andere Lebensbereiche unmaßgeblich sein.
Pflegebegutachtung in 6 Lebensbereichen 1-Mobilität 2-Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 3-Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 4-Selbstversorgung 5-Umgang mit krankheits- oder therapiebedingte Anforderungen 6-Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte
Deutschland unterstützt wie kaum ein anderes Land Eltern behinderter Kinder umfassend, dennoch greift diese Unterstützung nicht immer. »Familien mit Kindern mit Behinderung haben in Deutschland ein doppelt so hohes Armutsrisiko wie Familien mit Kindern ohne Behinderung« (Ehemalige Behindertenbeauftragte K. Evers-Meyer, 2011)
Familien behinderter Kinder sollten daher unbedingt herausfinden, ob sie Pflegegeld beantragen können. Seit Januar 2017 wird kindliche Pflegebedürftigkeit mit dem »Pflegestärkungsgesetz II« genauer und ausführlicher begutachtet: Statt Pflegestufen stehen jetzt kindliche Selbständigkeit und Fähigkeiten – was kann es, was kann es nicht – im Mittelpunkt, im Vergleich mit dem altersgleichen, gesunden Kind. Hierfür ermitteln eigens geschulte »Kinderbeauftragte« die kindlichen Fähigkeiten umfassend in 6 Lebensbereichen und ordnen sie 5 Pflegegraden zu. Für Kinder gibt es altersbezogene Tabellen, da ein Baby mehr Pflege bedarf als ein 12-jähriges Schulkind.
Tab. 1: Vergleich des medizinischen und sozialen Modells der Behinderung (nach Amorosa, 2011).
Medizinisches ModellSoziales Modell
Einstellung zum Begriff »Behinderung«
Terminologie: Viele Betroffene empfinden und erfahren den Ausdruck »Behinderung« als stigmatisierend. Sprachliche Verbesserungen sind daher ein wichtiger Versuch, anderes Denken und Handeln zu initiieren. Man bemerke den Unterschied der Formulierungen: »An den Rollstuhl gefesselt sein« vs. »Einen Rollstuhl benutzen«.
Kritiker dieses Sprachwandels meinen, der Begriff »Behinderung« sei wertneutral und erst durch abwertenden Gebrauch negativ geworden, etwa »Du bist ja behindert!« als Schimpfwort. Daher solle der gewünschte Denkwandel nicht am Wort, sondern an der Einstellung des Sprechenden ansetzen.
Konzeption: Zeitgleich zu diesen Diskussionen um die Wortwahl erarbeitete die WHO (Weltgesundheitsorganisation) eine umfassende Änderung der Konzeption von Behinderung, deren erster Schritt 1999 die Änderung der ICIDH (Internationale Klassifizierung von Behinderungen) in die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 2005) war.
Neu an der ICF ist, dass sie Erkrankungen, besonders die chronischen, und Behinderung als ein Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren beschreibt und die betroffene Person und nicht ihre Störungen in den Mittelpunkt stellt. 2011 erschien in Deutschland die angepasste und übersetzte Version für Kinder und Jugendliche: die ICF- CY.
Sie berücksichtigt die Besonderheiten kindlicher Entwicklung mit ihren sich verändernden Funktionen, Wichtigkeit des Spielens und speziellen kindlichen Lebensbereichen etwa im Haushalt oder im Lernen.
Abb. 5: Bio-psycho-soziales Gesundheitskonzept der WHO in ICF-CY (modifiziert nach Schlack & Hollenweger)
Die ICF-CY fasst das medizinische und das soziale Modell von Behinderung zusammen und betont die gegenseitige Wechselwirkung aller Faktoren auf
Sie dient der Dokumentation, auf Basis jeweiliger Fachdiagnostik, zur Erfassung der Fähigkeiten und Bedürfnisse eines Kindes in seinem Lebensraum. Sie ermöglicht – ja fordert – berufs- und länderübergreifend einen Rahmen, eine Struktur und eine Sprache in ganzheitlicher Sicht für Ärzte, Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter, Amtsvertreter und Patienten zugunsten Verständnis, Beschreibung, Strukturierung und Dokumentation von Hilfsmaßnahmen für unsere Kinder. Sie fördert eine ganzheitliche Sicht des Kindes.
Die ICF- CY umfasst 1400 Kategorien. Dies erlaubt eine differenzierte Dokumentation, aber nicht jeder braucht alles: im Frühförderbereich etwa wurde bereits eine verkürzte Liste erarbeitet. Jeder Benutzer aber braucht Training in der Anwendung, entsprechend ersten Erfahrungsberichten zahlt es sich aus.
Kontakt
• www.behindertekinder.de
• www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html Disabilities and rehabilitation: World report on disability
Zum Weiterlesen
Detering, S.: Sozialrechtliche Aspekte: Wann kann ein Behindertenausweis beantragt werden? Wann kann Pflegegeld beantragt werden? Kipra 78, 94-103 (2007) Nr. 2: Kirchheim Verlag Mainz
Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O.: ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Bern 2011
http://www.kinderpflegenetzwerk.de/aenderungen-in-der-pflegeversicherung-ab-01-01-2017
Teil 2: Ursachen für Entwicklungsstörungen
1 Sauerstoffmangel (O2-Mangel)
VokabelnO2: chemische Bezeichnung für Sauerstoff
Sauerstoff brauchen wir zum Leben. Jede Zelle unseres Körpers braucht Sauerstoff für ihren Stoffwechsel. Wir atmen ihn mit der Luft ein; der Körper nimmt ihn durch die Lunge auf und leitet ihn durch die Blutgefäße in alle Zellen. Sauerstoffmangel stört, schädigt oder zerstört unsere Zellen.
Ursachen für O2-Mangel
sind beispielsweise:
• O2-Mangel in der Atemluft: z. B. während einer Narkose oder bei Rauchvergiftung;
• behinderte Atemwege: Babies können während oder nach der Geburt Schleim in den Lungen haben oder ihre Lungen entfalten sich nicht;
• kranke Atemorgane: Lungenentzündung, Bronchitis, Asthma oder Muskelschwäche machen dem Kind das Atmen schwer;
• die Verteilung des sauerstoffhaltigen Bluts ist gestört: durch ein schwaches Herz, durch verstopfte Blutgefäße;
• die Zelle kann den angebotenen Sauerstoff nicht verwerten, weil ihr Stoffwechsel nicht funktioniert.
Die Folgen von O2-Mangel
sind sehr unterschiedlich. Sie hängen ab von der Dauer und Intensität des Mangels, zum anderen von der Empfindlichkeit der Zelle gegenüber O2-Mangel.
Aktive Zellen brauchen mehr Sauerstoff und haben geringere Toleranz gegenüber O2-Mangel. So nehmen Gehirnzellen schon nach 3 Minuten O2-Mangel Schaden, Nierenzellen erst nach 20–30 Minuten. Wachsendes Gewebe hat besonders hohen Sauerstoffbedarf. Deshalb können wenige Minuten O2-Mangel im Mutterleib oder während der Geburt bleibende Hirnstörungen des Kindes verursachen. Glücklicherweise ist aber gerade auch das junge Gehirn sehr erholungsfähig.
2 Störungen von Genen, Chromosomen
Chromosomen
VokabelnChromosomen: Erbkörperchen, enthalten die Erbsubstanz Gen: Erbeinheit für eine einzelne Eigenschaft
Chromosomen sind fadenartige Gebilde in einem jeden Zellkern unseres Körpers. Jedes Chromosom enthält ein langes, doppelsträngiges DNS-Molekül (Desoxyribonukleinsäure, engl.: DNA), dessen Stränge sich wie eine in sich gedrehte Strickleiter um Proteine winden. Einzelne Abschnitte des DNS-Moleküls sind die Gene. Ein Gen ist die kleinste Einheit der Übertragung von Erbinformationen, jedes Chromosom enthält zigtausend Gene aneinandergereiht.
Jede Körperzelle besitzt 23 Chromosomen in doppelter Ausführung, insgesamt also 46, hingegen die Zellen der Keimbahn, also Samen- und Eizellen, 23 nicht-paarige Chromosomen. Dieser »Chromosomensatz« ist in Anzahl und Form in allen Zellen eines Organismus gleich.
Die Chromosomen stellen praktisch eine genetische Bau- und Betriebsanleitung für alle Zellen dar, wobei für die einzelne Zelle jeweils nur die für sie bestimmte Information wichtig ist, etwa wie groß eine Herzzelle werden soll oder wie viel Sauerstoff sie verbraucht.
Chromosomenanalyse
Jedes Chromosom einer Art besitzt einen individuellen Bau, anhand dessen es eindeutig identifiziert werden kann. Mit einem Elektronenmikroskop kann man Chromosomen als stäbchenförmige Gebilde erkennen; um einzelne Gene zu erkennen, benötigt man kompliziertere Methoden.
Anlass zu einer Chromosomenuntersuchung sind in der Kinderheilkunde
• Ursachen-Diagnostik bei Kindern mit Fehlbildungen, Syndromen oder unklaren Entwicklungsverzögerungen,
• genetische Beratung betreffs des Wiederholungsrisikos einer erblichen Störung,
• die pränatale Diagnostik,
• die Tumordiagnostik.
Zur Chromosomenanalyse wählt man Zellen aus Geweben, die sich häufig erneuern, in der Regel weiße Blutzellen, legt Kulturen an und untersucht die Zellkerne zu einem bestimmten Zeitpunkt der Kernteilung, meist der Metaphase, wenn sie besonders gut mikroskopisch sichtbar sind. Die Chromosomen werden gezählt, nummeriert und hinsichtlich der Zahl und Struktur beurteilt.
Abb. 6: Ansicht eines Chromosomensatzes unter dem Mikroskop
Chromosomale Störungen
können vererbt sein, viel häufiger aber entstehen sie erst nach der Befruchtung im Laufe der unzähligen Teilungen des sich entwickelnden Organismus mit Resultat einer Veränderung
• der Chromsomenzahl: Verlust oder Vervielfachung von Chromosomen. Am bekanntesten die Trisomie 21 (Down- Syndrom) mit einer Verdreifachung des 21-er Chromosoms, die in 90 % nicht vererbt ist, sondern nach der Befruchtung entsteht;
• der Strukur, etwa durch Chromosomen-Brüche oder falsche Anlagerung von Chromsomenteilen;
• in der Chromosomen-Anordnung (»Translokation«).
Etwa 0,7 % aller lebend geborenen Säuglinge sind von Chromosomenschäden betroffen. Da sich auf einem Chromosom viele Gene befinden, verursachen Chromosomenstörungen immer komplexe Störungsbilder mit vielen verschiedenen Beeinträchtigungen. Viele Störungen sind so gravierend, dass das Kind nicht lebensfähig ist: Die Hälfte aller spontanen Fehlgeburten (Aborte) in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten ist auf chromosomale Störungen zurückzuführen.
Gene und Genetik
Der Chromosomensatz einer menschlichen Zelle besitzt etwa 30.000–50.000 Gene. Die Gesamtheit aller Gene eines Organismus wird »Genom«genannt. Es wurde der Form nach im Jahr 2000 für den Menschen erstmals entschlüsselt, die Funktion seiner Gene wird nun nach und nach analysiert.
Chromosomen und Gene, ihre Rolle bei der Vererbung
Vererbung bedeutet die Weitergabe genetischer Information an die Nachkommen.
Abb. 7: Doppelsträngiges DNS-Molekül, auch: »Doppelhelix«
Bei der Zellteilung für das Körperwachstum oder für die ständige Erneuerung von Organen wie Haut oder Blut handelt es sich um Vervielfältigung des genetischen Materials, aber nicht um Vererbung.
Die Weitergabe genetischer Information bei der Fortpflanzung geschieht auf andere Weise: Wenn sich im Befruchtungsvorgang Ei- und Samenzelle (»Keimzellen«) vereinigen, verschmelzen dabei väterlicher und mütterlicher Chromosomensatz. So ergibt sich eine Neukombination von Chromosomen mit einer Merkmalsmischung in den Nachkommen.
Diese Neukombination ist zufällig. Da die Anzahl von Genen jedoch nicht unendlich ist, lassen sich statistische Wahrscheinlichkeiten errechnen, mit denen bestimmte Merkmale bei den Nachkommen auftreten (»Mendelsche Gesetze«). Nach der Befruchtung trägt das neu entstandene Individuum in jeder Zelle seine artspezifische Erbinformation einschließlich evtl. gestörter Chromosomen oder Gene, die Krankheiten oder Fehlbildungen verursachen.
Genanalyse
Als Genanalyse (auch DNS- oder DNA-Analyse) werden molekular–biologische Verfahren bezeichnet, welche die DNS verwenden, um Rückschlüsse auf verschiedene Aspekte des Individuums ziehen zu können.
In der medizinischen Forschung etwa kann man anhand von Veränderungen (Mutationen) einzelner Gene einzelne Krankheitsbilder nachweisen. Hierbei löst man einzelne DNS-Abschnitte aus ihren Sequenzen heraus und identifiziert sie.
Diese Methode wurde nach 1970 entwickelt und leitete sowohl die Genklonierung (identische Vervielfachung eines Gens) als auch die Forschung für Gentherapie ein.
Gendefekte
Verändert sich ein einzelnes Gen, so kann das ohne Folgen für das Kind bleiben, es kann jedoch auch zu einer vererbbaren Erkrankung führen. Häufig sind Eltern, ohne es zu wissen, Träger eines defekten Gens; aber nur, wenn beide Eltern den gleichen Gendefekt tragen und das Kind beide defekten Gene erbt, tritt bei ihm die Erkrankung zutage. Dieses Risiko ist nicht sehr hoch.
Auch sind Krankheiten, die durch ein einzelnes krankes Gen verursacht werden, im Vergleich zu Chromosmenabweichungen relativ selten. Ca. 4000 dieser sogen. »monogenen Erbkrankheiten« sind bereits bekannt, und sie sind vielversprechende Kandidaten für die Gentherapie. Dazu gehören bestimmte Krebserkrankungen, besonders Leukämie im Kindesalter, Mukoviszidose, Muskeldystrophie und Hämophilie (Bluterkrankheit).
Gestörte Gene sind nicht nur für einzelne Krankheiten verantwortlich, sondern auch für die individuelle Ausprägung einer Störung, und sie greifen regulierend oder aktivierend in die meisten Krankheitsgeschehen ein. So erfordert die körpereigene Bekämpfung von Infektionen ein perfektes Zusammenspiel von bestimmten Genen.
Äußere Faktoren
Genetische Veränderungen können auch entstehen, wenn bestimmte äußere Faktoren, wie ionisierende Strahlen oder chemische Wirkstoffe wie Krebsmedikamente, auf das ungeborene Kind einwirken.
Multifaktorielle Erkrankungen
Dies sind Erbkrankheiten, die nicht allein durch verändertes Erbmaterial entstehen, sondern zusätzlich Auslöser durch Umweltfaktoren benötigen, damit die Erkrankung zutage tritt. Solche Umwelteinflüsse sind z. B.
• ungesunde Ernährung,
• Rauchen und Passivrauchen,
• Chemikalien, Strahlung (UV, Röntgenstrahlung).
Multifaktorielle Erkrankungen stellen sich daher oft erst im Laufe des Lebens ein. Sie sind häufiger als reine Chromosomen- oder Gendefekte: bei ca. einem von 100 Kindern können wir damit rechnen. Diabetes, Epilepsie und manche Krebsarten gehören zu den multifaktoriellen Erkrankungen.
Gentherapie
Als Gentherapie wird das Einfügen von gesunden Genen in Zellen oder Gewebe eines Menschen zur Behandlung von Krankheiten, die durch ein krankes Gen bedingt sind, bezeichnet. Dadurch sollen fehlende oder gestörte Funktionen wiederhergestellt werden.
In Deutschland werden zur Zeit nur schwerstkranke Menschen vereinzelt mit Gentherapie behandelt, während sich die Forschung zukünftig Heilung auch für die am weitest verbreiteten Krankheiten, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder AIDS verspricht. Bei einigen Blutkrankheiten hat man schon erfolgreich therapiert, bei anderen Krankheiten ist der gentherapeutische Ansatz noch in intensiver klinischer Erprobung.
Ob sich künftig auch Behinderungen des Kindes, vor allem geistige Behinderungen, durch Gentherapie heilen oder verhindern lassen, ist noch sehr ungewiss, da geistige Behinderung verschiedenste Ursachen haben kann und die Intelligenzentwicklung durch Hunderte von Genen bestimmt wird.
Insgesamt ist gegenwärtig die Gentherapie noch sehr umstritten, denn es ist noch nicht eindeutig, welche Risiken jeweils mit ihr einhergehen. Auch moral-ethische Fragen werden im Zusammenhang mit der Gentherapie immer wieder aufgeworfen.
Im Bereich der Arzneimittel hingegen hat die Gentechnologie unbestrittene und große Erfolge erzielt, etwa durch die Herstellung von nicht-tierischem Insulin für Diabetiker oder Blutgerinnungsfaktoren für Bluterkrankheiten.
Stigma
Im Hinblick auf Erbkrankheiten fühlen Eltern sich schuldig oder minderwertig, dass sie nicht nur das Schicksal ihres Kindes nicht verhindern konnten, sondern sogar ungewollt dessen Ursache sind. Mitleid hilft hier nicht weiter, sondern informiertes Wissen über die Alltagsherausforderungen der jeweiligen Krankheit oder Entwicklungsstörung mit der Bereitschaft, konkret Hand-in-Hand in der Betreuungsaufgabe zu arbeiten. Hierbei soll dies Buch helfen.
3 Stoffwechselstörungen
Was ist »Stoffwechsel«? Stoffwechsel nennt man zusammenfassend alle biochemischen Abläufe des Körper, die mit
• dem Auf-, Um- und Abbau von Stoffen innerhalb des Körpers oder
• dem Austausch von Stoffen zwischen Körper und Umwelt
und deren Koordinierung und Steuerung zu tun haben.
Für die Steuerung ist einerseits das Nervensystem zuständig, andererseits das Hormonsystem des Körpers. Während das Nervensystem bioelektrische Impulse über sie Nervenbahnen verteilt, versendet das Hormonsystem chemische Botenstoffe, die »Hormone«. Hormone verteilen sich auf dem Blutweg im Körper und regulieren lebenswichtige Funktionen wie Kreislauf, Atmung, Körpertemperatur, Wachstum, Sexualentwicklung, Fortpflanzung und Stoffwechsel.
Der Begriff »Hormon« meint wörtlich »antreiben, erregen«: Hormone setzen chemische Reaktionen in Gang, die ihrerseits durchaus auch bremsende Wirkung haben können, so wie Insulin etwa die Blutzuckerhöhe reguliert. Hormonstörungen können massive Stoffwechselstörungen auslösen, etwa Mangel an Schilddrüsenhormon verursacht Kleinwuchs und geistige Behinderung, Insulinmangel die Zuckerkankheit.
Ähnlich wichtig sind »Enzyme«. Enzyme finden sich in vielen Körperzellen und spielen dort eine wichtige Rolle für deren Funktion: Sie starten oder beschleunigen innerhalb der Körperzellen einzelne chemische Prozesse, und ihre Aktivität wird durch die Hormone gesteuert. Bekannt sind die zahlreichen Verdauungsenzyme, die für die Verarbeitung der Nahrung notwendig sind, beispielweise führt das Enzym Amylase im Speichel zur Umwandlung von Stärke in Zucker. Sind die Enzyme im Körper gehemmt (z. B. aufgrund von Vitaminmangel, Vergiftungen, Medikamenten), kommt es zu schweren Stoffwechselstörungen oder gar zum Tod.
Definition
Stoffwechselstörung bedeutet eine krankhafte Abweichung eines Stoffwechselvorgangs, entweder wird er vermindert oder geschwächt, z. B. durch Mangel eines Hormons oder Enyzms, oder er wird erhöht bzw. beschleunigt sein. Stoffwechselstörungen können einzelne Zellen betreffen, aber auch ganze Organsysteme, etwa wie das Muskelsystem, das Verdauungs- oder Atmungssystem, auch den ganzen Körper, wie der zu hohe Blutzuckergehalt bei Diabetes. Andere bekannte Stoffwechselstörungen sind Schilddrüsenüberfunktion oder Gicht. Dass Kinder schon mit Stoffwechselkrankheiten geboren sein können, ist weniger bekannt. Diese Krankheiten sind insgesamt auch selten, aber weil man heutzutage viele davon behandeln kann, machen stoffwechselkranke Kinder 20 % unter den chronisch kranken Kindern aus.
Ursachen
Stoffwechselstörungen sind:
• genetisch bedingt oder vererbt;
• erworben, beispielsweise durch Krankheit oder äussere Schädigungseinflüsse;
• von »Multifaktorieller Erkrankung« spricht man, wenn eine genetisch bedingte erhöhte Anfälligkeit eines Organs oder des ganzen Menschen gegenüber einer bestimmten Störung besteht, diese aber erst durch Umwelteinflüsse zum Tragen kommt.
Störungsbild
Abb. 8: Grundmechanismus Stoffwechsel und typische Störungsmechanismen
1. Zu wenig Enzymaktivität verursacht einen Stau von A.-
a) Das angesammelte A schädigt durch seine Masse oder durch seine chemischen Eigenschaften. Der Körper hilft sich, indem er A in Speicherzellen einverleibt. Diese Speicherzellen erfüllen keine weitere Funktion. Wenn sie sehr zahlreich werden, können sie gesunde Zellen erdrücken. So entstehen sogenannte »Speicherkrankheiten«.
b) Aus dem gestauten Stoff A können außerdem Stoffwechselnebenprodukte oder ungewöhnliche Abbauprodukte entstehen und ihrerseits Störungen verursachen.
c) Hinter dem Enzymblock entsteht ein Mangel an (vielleicht lebenswichtigem) Stoff B.
2. Zu hohe Enzymaktivität verursacht
a) zu schnellen Verbrauch von A.
b) Ansammlung von B, die den Stoffwechsel stört und »Speicherkrankheiten« erzeugen kann.
Therapie
Die meisten Stoffwechselkrankheiten sind nicht heilbar, aber viele sind behandelbar, indem das Hormon oder Enzym medikamentös ergänzt wird, wie das Insulin bei Diabetes.
Für das betroffene Kind und seine Familie sowie für seine Betreuer in Kindergarten und Schule bedeutet das allerdings auch: lebenslange regelmäßige Einnahme von Medikamenten und manche Einschränkung im Alltagsleben, trotzdem Gefahr von Krisenzuständen durch vergessene Einnahme oder auch einfach, weil der kindliche Körper wächst und sich verändert und nicht ständig eine lückenlose Kontrolle aller Begleitumstände gelingt.
Falls Sie ein stoffwechselkrankes Kind in der Gruppe oder Klasse haben, können Sie weitere Information bei Elternvereinigungen und Selbsthilfegruppen finden, z. B.
Kontakt
www.kindernetzwerk.de
4 Entzündungen
Entzündung ist eine »normale« Reaktion des Körpers auf schädigende Einwirkungen. Mit Entzündung wehrt sich der Körper gegen einen schädigenden Reiz. Entzündung bedeutet, dass das Gewebe in spezieller Weise reagiert, um den Reiz zu beseitigen und die entstandene Gewebsschädigung zu reparieren. Entzündungsauslösende Reize sind etwa
• mechanisch: Druck, Zug, Bruch, Riss,
• physikalisch: Kälte, Wärme, UV-Licht,
• chemisch: Säure, Lauge, Insektengifte,
• Krankheitserreger: Viren, Bakterien, Pilze, manche Stoffwechselprodukte,
• manche Tumorzellen,
• Fremdkörper, die in den Körper eindringen, z. B. Splitter, Schmutz.
Hauptmerkmale einer Entzündung
• Rötung,
• Schwellung,
• Wärme,
• Schmerz,
• Funktionseinschränkung.
Chemisch und biologisch laufen hierbei hochkomplizierte Kampfaktionen gegen den schädigenden Reiz ab, geführt von verschiedenen Blut- und Abwehrzellen. Wenn der gesamte Körper am Abwehrkampf mitbeteiligt wird, zeigt er das durch Fieber, veränderte Blutzusammensetzung und Krankheitsgefühl an. Nach erfolgreicher Entfernung des Reizes setzt eine Reparatur- und Heilungsphase ein.
Entzündungsarten
Je nach Art, Ort, Ausmaß usw. unterscheidet der Arzt verschiedenste Entzündungsarten:
nach zeitlichem Verlauf:
nach der Art der Gewebsflüssigkeit, die entsteht:
nach der Ausbreitung:
nach den betroffenen Organen: Lungenentzündung, Mittelohrentzündung usw.
nach der Art der Heilung: mit Narbenbildung oder ohne.
Sehr viele der recht bekannten Krankheiten beruhen auf entzündlichen Prozessen. Das zeigt dann der Name an, der auf »itis« endet: Bronchitis, Otitis (Ohrentzündung) usw.
Erste Hilfe bei kleinen Entzündungen, etwa eines Fingers, eines Auges:
• sauber (steril) abdecken, • still halten • kühlen.
Entzündungen können unbemerkt vorüber gehen und ohne Folgen bleiben, sie können jedoch aber auch einzelne Zellen oder ganze Gewebe zerstören oder Organe durch Narben in ihrer Funktion beeinträchtigen. Narbengewebe besteht aus einfachen Fasern, die für keinerlei spezielle Funktionen geeignet sind. Deswegen kann es in sehr aktiven Geweben auch Ursache einer Störung oder Behinderung sein, etwa im Auge die Sehfähigkeit herabsetzen, im Gehirn Funktionsausfälle, z. B. nach Hirnhautentzündung (= Meningitis), verursachen.
Chronische Entzündungen wie Tuberkulose oder rheumatisches Fieber führen unbehandelt zu zunehmender Funktionsbeeinträchtigung und können die Lebens- und Leistungsqualität auch schon bei Kindern sehr behindern.
5 Störungen des Abwehrsystems des Körpers (Immunsystem)
Das Immunsystem verteidigt den Körper gegen Fremdeinflüsse wie Krankheitserreger oder unbelebte Stoffe (z. B. Teer im Tabakrauch, Metalle). Dabei muss es Eigenes von Fremdem unterscheiden können, denn den eigenen Körper muss es schützen, Fremdkörper dagegen bekämpfen.
Es besteht aus drei Funktionskreisen:
• dem Knochenmark, das ständig Abwehrzellen bildet;
• den »primären« Abwehrorganen wie der Thymusdrüse, wo Abwehrzellen funktionsspezifisch geprägt werden;
• den »sekundären« Abwehrorganen wie den Lymphknoten, wo der Abwehrkampf stattfindet.
Stark vereinfacht unterscheidet man zwei Hauptarten der Abwehr des Körpers Abwehr
Diese »spezifische Immunität« ist nicht angeboren, sondern wird im Laufe des Lebens durch den jeweiligen Feind-Kontakt erworben. Daher haben Kinder in den ersten Lebensjahren viele Infektionskrankheiten: Sie entsprechen dem Erstkontakt, der etwa wie die typische »Kinderkrankheit« Masern eine lebenslange spezifische Immunität hinterlässt. Ein Grippevirus hingegen prägt die Abwehrzellen nur für einige Monate.
Störungen im Immunsystem verändern dessen Reaktionen, z. B. als
6 Tumoren und Krebs
Krebs ist keine einheitliche Krankheit, sondern ein Oberbegriff für mehr als hundert verschiedene bösartige Erkrankungen. Krebs bedeutet, dass Körperzellen sich so verändern, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können und andere Zellen zerstören.
Krebs kann jederzeit in jeder Körperzelle entstehen: Eines Tages verändert sich ihr genetischer Auftrag und sie beginnt, sich planlos zu teilen und zu vermehren. Zwar teilen und vermehren sich auch normalerweise viele Zellen unseres Körpers, etwa in Fingernägeln, Haut oder Darm. Dabei folgen sie aber genauen genetischen Gesetzen und ordnen sich in Größe und Lebenszeit dem Gesamtorganismus in sinnvoller Weise ein.
Krebszellen hingegen vermehren sich in ungeordneten Zellhaufen, die weder eine eigene Gewebeform bilden noch die der Nachbargewebe beachten.
Abb. 9: Wachstum bösartiger Tumorzellen
Anfangs sind diese Zellhaufen nur mit dem Mikroskop zu entdecken, später auch mit dem bloßen Auge zu sehen. Oder man fühlt sie als Knoten, Verhärtung oder Geschwulst (lateinisch: Tumor). Ein Tumor muss aber nicht unbedingt bösartiger Krebs sein: Es gibt auch gutartige Tumoren, die durchaus Schmerzen verursachen können, wenn sie auf Nachbarorgane oder Nerven drücken, manche bleiben auch ein Leben lang unbemerkt.
Als bösartig bezeichnet man Zellen, die drei Eigenschaften aufweisen:
• sie verdrängen, durchwachsen und zerstören Nachbarorgane, verschließen Hohlräume wie Luftröhre oder Darm oder verursachen plötzliche Blutungen durch zerstörte Blutgefäße;
• sie stören die normale Funktion der betroffenen Gewebe, denn die Krebszellen sind primitiv und können keine spezifischen Gewebsaufgabe wahrnehmen;
• sie breiten sich im ganzen Körper aus und bilden Tochtergeschwülste (»Metastasen«). Nach einer Krebs-Operation genügt eine einzige Krebszelle, um eine neue Geschwulst hervorzubringen (»Rezidiv«).
Treffen alle drei Eigenschaften zu, spricht man von einer Krebserkrankung.
Ursachen
Was genau eine Zelle bösartig entarten lässt, ist im Einzelnen noch nicht geklärt. Genetische Faktoren tragen nachweislich zur Krebsentstehung bei, hinzu kommen Umweltfaktoren. Weil fast immer mehrere Faktoren beteiligt sind, nennt man die Entstehung »multifaktoriell«.
Interessanterweise scheinen im Körper ständig bösartige Zellen zu entstehen, werden aber vom körpereigenen Abwehrsystem (Immunsystem) erkannt und beseitigt. Bestimmte Faktoren können diese Balance beeinträchtigen:
VokabelnCancer (lat.): Karzinom: Krebs kanzero-, karzino-: Krebs betreffend Karzinogen: Substanz oder Faktor, der eine bösartige Geschwulst auslöst Kokanzerogen: unspezifischer Faktor, der die Krebsbildung begünstigt
• Chemische Stoffe, die im Körper bösartiges Wachstum anregen, sog. »kanzerogene Stoffe«: Blei, Arsen, Pestizide, Teerstoffe (z. B. im Tabakrauch), Nitrosamine (z. B. in Rauch- und Pökelfleisch);
• Strahlen: Röntgenstrahlen, radioaktive Strahlen und Stoffe, auch UV-Strahlen;
• einige Viren, einige Hormone;
• Stoffe, die Krebs nicht auslösen, aber sein Wachstum beschleunigen (»Kokanzerogene«), z. B. Phenole, manche Hormone;
• genetische Faktoren: Krebs ist nicht direkt erblich; aber die genetische Information für ein gut funktionierendes Abwehrsystems kann durch verschiedene Einflüsse verändert werden, sodass die Krebsabwehr gestört wird;
• andere Faktoren, die das Immunsystem verändern, sodass es entweder die Krebszellen nicht mehr erkennt oder nicht mehr bekämpfen kann, wie Krankheiten, auch AIDS;
• »disponierende Faktoren«: »Disposition« nennt man die erhöhte Anfälligkeit des Körpers, auf bestimmte Schädigungen mit einer bestimmten Krankheit zu reagieren. Manche Familien zeigen bestimmte Dispositionen ohne typisches Vererbungsmuster, etwa für Diabetes oder Asthma, und das gibt es auch für bestimmte Krebsarten;
• äußere Lebensumstände werden in stärkerem Maße als bisher angenommen als »disponierender Faktor« für Krebs wirksam: das Lebensalter, der Beruf, vor allem die Lebensweise: Stress, Tabak, Ernährung.
Krebs ist im Kindesalter nicht so häufig wie bei Erwachsenen. Immerhin aber gibt es in Deutschland jedes Jahr etwa 2000 Neuerkrankungen, davon etwa die Hälfte an Leukämie.