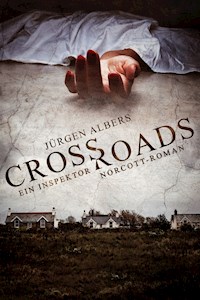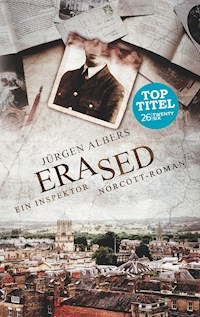
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Charles Norcott-Roman
- Sprache: Deutsch
März 1947: Nach einem der härtesten Winter in der britischen Geschichte, bahnt sich endlich ein warmer Frühling an. Sehnsüchtig erwartet von einem Land, das immer noch vom Krieg gezeichnet ist. Superintendent Charles Norcott von New Scotland Yard hofft ebenfalls auf ein wenig Erholung vom Alltag: er wird als Dozent an die Universität Oxford ausgeliehen. Eigentlich soll Norcott dort Verwaltungsfachkräfte ausbilden, aber schon bald erreicht ihn ein zusätzlicher Auftrag. Im Physikalischen Institut der Universität reißt eine Serie von Zwischenfällen nicht ab. Will jemand die geheime Forschung sabotieren oder handelt es sich nur um eine Verkettung unglücklicher Umstände? Kaum hat der Superintendent die ersten vorsichtigen Ermittlungen angestellt, zerreißt eine Bombe die Stille der friedlichen Universitätsstadt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Epilog
Nachwort
Prolog
Oxford, Physikalisches Institut des St. Rupert Colleges Freitag, 28. März 1947, später Nachmittag
Der Hass bewegt sich langsam, vorsichtig. Zögerlich zuerst, fast behutsam gleiten die Fingerspitzen über ein großes Notizboard neben dem Schreibtisch, berühren die kleinen Erinnerungszettel. Wuterfüllte Blicke streifen über Gesichter auf Fotos, über das Streichholzbriefchen eines noblen Londoner Clubs, alte Premierenkarten aus dem Royal Opera House. Und Fotos, immer wieder Fotos. Die Finger bewegen sich weiter, über immer mehr Fotos von Jack. Dem genialen Jack de Vercenne, dem glänzenden Wissenschaftler, dem jüngsten Physikprofessor in Oxford, einem gutaussehenden Jack. Dem Sieger Jack beim Polo, Jack mit seinem geliebten Coupé, Jack mit seiner Rudermannschaft, einem gesunden, lachenden Jack, einem siegreichen Jack. Jack! Plötzlich scheint er überall zu sein, wird allgegenwärtig, nimmt die Luft zum Atmen. Es ist wie ein riesiges Spinnennetz, das einen einschließt, einen erwürgen will. Wie ein Spiegelkabinett, in dem aus allen Richtungen Jack erscheint, man ihm nicht entkommen kann, sich nicht verstecken kann vor diesem lächelnden Jack.
Die Hand zuckt zurück, als wenn sie sich plötzlich verbrannt hat. Der Atem wird schneller. Zischend, abgehackt wird die Luft ein- und ausgestoßen. Jacks immerzu lächelndes Gesicht brennt sich in die Augen, die es betrachten. Es brennt sich bösartig ein und weckt einen ebenso brennenden Hass, der wild auflodert. Da fällt der erste Schlag. Noch zögerlich landet die Faust in dem Gesicht, das weiter so unerträglich lächelt. Die Fäuste öffnen sich. Schließen sich. Krampfhaft. Wissen nicht, wohin mit all der Wut, mit all der Feindseligkeit. Finden kein anderes Ziel als diese elenden Bilder. Wieder ein Faustschlag. Fester diesmal, gezielter, bewusster. Ein Schlag, der töten will, der auslöschen will.
Noch ein Schlag.
Noch einer.
Immer fester.
Blutig sind inzwischen die Fingerknöchel, hinterlassen rote Spuren, Schlieren auf den Bildern. Zitternde Finger reißen, zerren an den Bildern. Finger, Hände, angetrieben von hell loderndem Hass, zerfetzen das ewige Lächeln, zerreißen diese Erinnerungen. Kleiner, viel kleiner, es muss kleiner zerrissen werden. Fieberhaft, voll unbändiger Abscheu verwandeln die Finger Erinnerungen in unkenntliche kleine Schnipsel, unlesbar, unbekannt. Ausgelöscht. So sollen sie sein, seine Erinnerungen: Ausgelöscht. Nie dagewesen. Ich vergesse dich, Jack! Vergesse dich, wie du noch nie vergessen wurdest.
Vergessen. Auslöschen. Die Gedanken legen sich wie kühlendes, beruhigendes Balsam über eine zitternde, verletzte Seele. Erst zaghaft, dann immer machtvoller durchströmt der Gedanke das Blut, beruhigt und gibt gleichzeitig Kraft. Es wird wieder still im Büro, der Atem geht ruhiger. Momente verstreichen, die Kraft kehrt zurück in einen gepeinigten Körper, in einen erniedrigten, entwürdigten Geist.
Auf dem Schreibtisch liegt ein Stapel handschriftlicher Notizen, alle gefüllt mit einer arroganten, hoch aufschießenden Handschrift. Einer Schrift, die sich scheinbar nicht in die Linien einpassen will, kein Maß kennt. Seite um Seite füllt sie, ungeduldig, herrisch die Seiten. Die Hände nehmen einige der Blätter auf und beginnen, sie säuberlich und methodisch zu zerreißen. Die Arroganz der Schrift wird entzweigerissen, die Allgegenwart, die Selbstsicherheit des Jack de Vercenne verschwindet Seite um Seite, Linie um Linie, Gedanke um Gedanke. Zerrissen mit einem Zorn, der kalt und hart geworden ist, schneidend wie ein Sturm aus Eis.
Als das Werk getan ist, sich der Sturm gelegt hat, befriedigt im Zerstörungswerk, hebt eine Hand den Deckel eines großen Blecheimers. Mit raschen, fließenden Bewegungen schiebt sie alles zerrissene Papier, jeden kleinen Schnipsel über den Rand des Schreibtisches in den Eimer. Sorgfältig wird dieser wieder mit dem Deckel verschlossen. Er trägt die Aufschrift: Vertraulich - zur Verbrennung bestimmt!
Ein Lächeln spielt um die Lippen.
Kapitel 1
London NW8, 126 Hamilton Terrace
Montag, 31. März 1947, Vormittag
Er rückte die Krawatte gerade und warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel. Bewegte den Oberkörper, um zu sehen, wie die Farben bei unterschiedlichem Lichteinfall zusammenpassten. Dann musste er über sich selbst schmunzeln und lockerte die Krawatte absichtlich wieder ein wenig.
»Du hättest Model werden sollen, Darling. Du liebst den Spiegel so sehr.« Vicky lehnte lässig in der Küchentür, nippte an einer Teetasse und betrachtete ihn lächelnd.
»Sir Harold will mich heute Nachmittag sehen und es wird auch irgendjemand vom Justizministerium da sein.« Was als Erklärung gedacht war, missriet zur Rechtfertigung. Er musste lachen. »Und wir? Wofür haben wir uns so sportlich schick gemacht?«
Vicky sah an sich herunter. »Was? Dieser alte Hosenanzug? Das ist doch nur ...« Sie rieb sich über die Nasenflügel. »Das ist doch nur ...« Sie suchte erfolglos nach dem passenden Begriff.
»Ein absolut harmloser Hosenanzug, in dem deine ohnehin umwerfende Figur noch vorteilhafter zur Geltung kommt.« Er tippte sacht an ihre Schulter, wie um seine Worte zu unterstreichen.
Sie umfasste seine Wangen zärtlich mit beiden Händen und küsste ihn lange. Lächelnd löste sie sich wieder von ihm, strich sich den Hosenanzug glatt. »Ich treffe mich gleich noch mal mit diesem Marcus Ottersby, Ossersly, Orsingly oder wie dieses schleimige Wesen nun heißt. Ich kann mir diesen Namen doch partout nicht merken. Wahrscheinlich instinktive Abneigung.« Sie sah den skeptischen Blick ihres Mannes und beeilte sich zu sagen: »Keine Sorge, Max begleitet mich. Mir passiert schon nichts mit Mister Schleimig-Oversby.«
Norcott lachte. »Der arme Mann. Mit Maxine in deinem Schlepptau hat er keine Chance.«
Vicky tat so, als würde sie schmollen. »Max war drei Jahre Motorradkurier beim ATS, sie weiß wirklich Bescheid über Motorräder. Und ich habe keinerlei Neigung, mich von Mr. Oggelsby übers Ohr hauen zu lassen.« Sie sah ihn mit einem prüfenden Blick an. »Du hältst das immer noch für kindisch mit dem Motorrad, oder?«
»Ach, Unsinn.« Er lächelte. »Du willst dieses Motorrad und ich kann dich auch verstehen. Wenn ich den ganzen Tag mit dem Wagen unterwegs bin, bist du hier quasi wie angenagelt zu Hause. Du brauchst für deine Arbeit die Freiheit, jederzeit Licht und Wetter auszunützen und dafür eben auch ein Fortbewegungsmittel. Und, nebenbei bemerkt, angesichts der Benzinrationierungen ist ein Motorrad doch ein guter Kompromiss.«
Vicky musste es sich eingestehen. Sie wollte dieses Motorrad. Sie liebte den Rausch der Geschwindigkeit, ein Grund, warum sie im vergangenen Jahr fliegen gelernt hatte. Und, auch das musste sie sich eingestehen, sie liebte - fast noch mehr - ihre Unabhängigkeit. Sie stupste Charles an. »Okay, Superintendent, dann schwing du dich jetzt mal in dein schrecklich schönes Angeberauto und sorge für Sicherheit im Königreich. Und ich begnüge mich mit meinem kleinen Motorrad.«
Charles Norcott verzichtete darauf, seine Frau darauf hinzuweisen, dass eine Scott Flying Squirrel eine ausnehmend schnelle und ausnehmend kostspielige Maschine war und nicht das Erste, was man sich unter einem kleinen Motorrad vorstellte. Er nahm seine Aktenmappe, griff den Hut von der Garderobe und öffnete die Haustür. Grinsend schob ihn Vicky ein Stück beiseite und deutete mit ihrer leeren Teetasse auf das vor dem Haus stehende, dunkelrot leuchtende Monster.
»Es ist einfach dekadent, Charles. Dieses Auto ist eine neue Definition von Dekadenz.« Sie lachte. »Warum lässt du mich dich nicht vor dieser Monstrosität malen?«
Er seufzte. »Seinem Vorbesitzer mangelte es sichtlich an dieser typischen Form von Understatement, die wir Briten ...«
»Engländer! Nur ihr liebt das Understatement. Wir Waliser halten davon nichts. Wir lieben es schreiend.« Sie grinste.
»Wir Briten, wollte ich gerade sagen, bevor ich auf impertinente Weise unterbrochen wurde, wir Briten lieben das Dezente und Zurückhaltende.« Er hüstelte. »Nun, das ging dem Besitzer dieses Autos offenbar ab.« Sie betrachteten den Alvis 25, eine schon in der Grundversion opulent wirkende Sportlimousine, die sein Vorbesitzer mit einem Sportfahrwerk und teuren Speichenrädern hatte ausstatten lassen.
»Du weißt doch, wie an allen Ecken und Enden gespart wird. Ich kann mich glücklich schätzen, überhaupt diesen Wagen aus der Beschlagnahme bekommen zu haben. Andere Superintendents fahren einen zehn Jahre alten Hillman Mix aus Armeebeständen. Da ist mir mein rotes Monster schon lieber.«
»Ach, lass dich doch nicht hochnehmen, Charles. Er ist schon ein Schmuckstück.« Sie küsste ihren Mann zärtlich auf die Wange. »So, und nun ab. Und spiel schön mit den anderen Kindern.« Lachend duckte sie sich unter seiner drohend erhobenen Hand weg und verschwand im Haus.
Norcott blieb noch einen kurzen Moment stehen, genoss den endlich aufkeimenden Frühling. Nach diesem elenden Winter sog man jeden einzelnen Sonnenschein gierig in sich auf.
Schließlich stieg er in den Alvis und startete den Motor. Er musste den Wagen wenden, was auf der breiten Hamilton Terrace mühelos gelang. Wir wohnen nicht gerade in einem sozialen Brennpunkt, dachte er bei sich, während er die umliegenden Häuser ihres neuen Wohnsitzes betrachtete. Alles atmete großbürgerliche Eleganz. Saubere, gediegene Fassaden, Alleebäume, die nach einem unmenschlichen Winter mit ihrem frischen Grün dem Frühling geradezu entgegenzufiebern schienen. Norcott bremste den Alvis leicht ab, als er an die Kreuzung Carlton Hill kam. Schon halb eingebogen, blieb er abrupt stehen. Er betrachtete das Eckhaus und dessen cremefarbene Fassade. Quer über die Hauswand hatte jemand Häuser für Helden? gepinselt. In riesigen Buchstaben. Norcott stieg aus, ging ein paar Schritte auf das Haus zu. Go home und das durchgekreuzte Wort Homo konnte man jetzt erkennen. Alles in Rot gepinselt. Die ehemals schöne, lindgrüne Haustür war mit einem Galgenmännchen beschmiert und einem weiteren Homo.
»Wollen Sie nur etwas gaffen oder soll ich Ihnen auch noch einen Pinsel geben?« Im gepflegten Vorgarten des Hauses stand ein Mann, die Hände in die Hüften gestemmt, und funkelte seinen Besucher aus dunklen Augen an.
Norcott löste sich aus einem Moment der Überraschung und ging auf den Mann zu, der Hose und Weste eines dunkelgrauen Nadelstreifenanzugs trug. Nur eben ohne Jackett, so als wäre er mitten beim Ankleiden gestört worden. Der Mann wich einen Schritt zurück, blieb dann aber wieder stehen.
»Bitte entschuldigen Sie, ich wollte nur ... ich war im Begriff ...« Norcott machte eine halbherzige Geste zum Wagen. Er räusperte sich und ging dann noch ein paar Schritte ruhig auf den Mann zu. »Verzeihen Sie. Ich wohne seit Kurzem auch hier, Nummer 126b.« Er griff in seine Jacketttasche und hielt dem unbekannten Nachbarn seinen Dienstausweis hin. »Darf ich fragen, Mr. ...?«
»Karatzas. Constantin Karatzas«, antwortete der Mann, blieb aber ansonsten auf Distanz. Keine Hand wurde angeboten.
»Mr. Karatzas, darf ich fragen, ob Sie schon die lokale Polizeiwache informiert haben?«
Er schüttelte den Kopf, hob dann hilflos die Arme, drehte sich zum Haus. »Ich hab’s versucht. Aber ...«
Norcott sagte nichts, legte nur den Kopf leicht schräg und sah Karatzas aufmunternd an.
»Ja, ich hab im Revier in der Chichester Road angerufen.« Es folgte eine Pause. »Ihre Kollegen waren mäßig interessiert und ich ...« Karatzas rieb sich die Nasenwurzel, wie es Brillenträger tun. Er wirkte ernüchtert und der anfänglichen Aggressivität war eine Art eingeübte Resignation gewichen.
»Warten Sie bitte einen Moment.« Norcott ging zum Wagen, fuhr ihn auf den Bordstein und kehrte dann zu Karatzas zurück.
»Was haben Sie vor?«
Norcott lächelte. »Nur ein paar Kleinigkeiten klarstellen. Wenn ich dazu vielleicht Ihren Telefonapparat benutzen dürfte?«
Karatzas schien für einen Moment nachzudenken. Der stattliche Mann mit einem dichten, gut gepflegten Vollbart wirkte auf einmal verletzlich. Er seufzte. »Also gut. Bitte kommen Sie.«
Der Eingangsbereich des Hauses setzte die Farbgebung der Front fort. Cremetöne harmonierten mit sanften Pastellfarben. Karatzas bat seinen Gast in einen Raum, der halb Bibliothek, halb Büroarbeitsplatz zu sein schien. Er wies auf ein Telefon und rückte Norcott zugleich einen Stuhl zurecht. Als er sich anschickte, den Raum zu verlassen, hielt ihn der Kriminalbeamte zurück. »Bitte bleiben Sie.« Er wählte.
»Polizeirevier Kilburn Park, Constable Burgess.«
»Superintendent Norcott, New Scotland Yard.« Er ließ die übliche kurze Schrecksekunde verstreichen. »Constable, wie weit sind Sie vom Wachbuch entfernt?«
»Ich sitze davor, Sir. Ich vertrete gerade den wachhabenden Sergeant. Er ... macht gerade eine kurze Pause, Sir.«
»Heute Morgen hat ein Mr. Karatzas bei Ihnen angerufen und eine Sachbeschädigung gemeldet. Ist das richtig?« Die folgende Stille beantwortete die Frage nicht vollständig. »Constable?«
»Entschuldigung, ich glaube, den Anruf hat Sergeant MacInnes entgegengenommen. Sir, er kommt gerade. Ich übergebe an den Sergeant.« Die Erleichterung des Constable war überdeutlich. Kurzes Getuschel folgte.
»Polizeirevier Kilburn Park, Sergeant MacInnes. Was kann ich für Sie tun, Sir?«
»Superintendent Norcott. Sergeant, ich habe nur eine einfache Frage. Sie haben mit Mr. Karatzas telefoniert?«
Einem minimalen Zögern folgte: »Jawohl, Sir, hab ich. Um 7.37 Uhr lief der Anruf hier ein.«
»Und wie viel Uhr haben wir jetzt Sergeant?«, fragte Norcott mit sanfter Stimme.
»Es ist 8.22 Uhr, Sir.«
»Zeit genug für die dreiviertel Meile hierher, denken Sie nicht, Sergeant?«
»Hierher, Sir? Sie sind jetzt ...«
»Ja, Sergeant. Mein Nachbar, Mr. Karatzas, war so freundlich, mich in seinem Haus telefonieren zu lassen.« Er holte Atem. »Sergeant. Ich fahre jetzt zum Victoria Embankment. Wenn ich dort angekommen bin, werde ich noch einmal mit Mr. Karatzas telefonieren. Und ich würde mir wünschen, er ist bis dahin mit den von Ihnen veranlassten Maßnahmen zufrieden.«
»Jawohl, Superintendent, Sir. Wir werden, wir sind ...«
»Sehr schön, Sergeant. Ich weiß, ich kann mich ganz auf Sie verlassen.« So sanft, wie er gesprochen hatte, so sanft legte er den Telefonhörer zurück auf die Gabel. Er lächelte seinem Gegenüber zu. »Seien Sie ruhig anspruchsvoll in Ihrer Meinung zu unseren Diensten, Mr. Karatzas.« Norcott griff in die Brusttasche seines Jacketts und präsentierte eine Visitenkarte. »Falls Sie Gelegenheit finden, rufen Sie mich doch heute im Laufe des Tages einmal im Büro an, ja?«
Norcott wählte für die Fahrt zum Embankment einen weiten Bogen, umrundete den Regents Park nördlich und bog dann in den Outer Circle. Am Ende ordnete er sich hinter dem Royal College of Physicians rechts in Richtung Hyde Park ein und nahm damit einen weiteren Umweg in Kauf. Er steuerte die schwere Alvis-Limousine durch die winkligen Straßen von Marylebone und Mayfair und genoss es, durch diese zwei der buntesten Viertel Londons zu rollen. Wenn auch der Bombenkrieg hier im Zentrum seine sichtbaren Spuren hinterlassen hatte. Der Autoverkehr hielt sich durch die Benzinrationierung immer noch stark in Grenzen und er hatte es nicht eilig. Norcotts neue Position, direkt dem Commissioner of Police of the Metropolis, also dem faktisch leitenden Polizeioffizier für das gesamte Königreich, unterstellt, erlaubte eine Menge Freiheiten. Heute standen vor der Besprechung mit dem Polizeichef, Sir Harold Scott, am frühen Nachmittag keine Termine an. Was andererseits nicht bedeutete, dass Norcott nicht genügend Arbeit auf seinem Schreibtisch vorfinden würde. Sir Harold setzte ihn als eine Art Feuerwehr an den Brennpunkten der Polizei ein und davon gab es jetzt, zwei Jahre nach Kriegsende und mitten in einer absoluten wirtschaftlichen Krise genug. Die Arbeitslosigkeit lag, ebenso wie die Staatsverschuldung, in schwindelnden Höhen. Blanke Not befeuerte alle Arten von illegalen Geschäften, von Schwarzmarkt, über Prostitution bis Einbruchs- und anderen Diebstahlsdelikten.
Am Embankment angekommen, fuhr Norcott den Wagen in die Tiefgarage und nahm dann den Fahrstuhl in den 6. Stock. In der gemächlich schwebenden Kabine hatten seine Gedanken Zeit, abzuschweifen. Der Superintendent war neugierig, worum es in der Nachmittagsbesprechung beim Chef gehen würde. Er hoffte inständig darauf, dass es kein neuer, der ohnehin zahllosen, Arbeitskreise sein würde.
Die Fahrstuhlkabine hielt mit einem kurzen Glockenton. Norcott schob die schmiedeeisernen Schutzgitter beiseite und trat auf den Flur. Wie an jedem Tag grüßte er mit einem Kopfnicken das Portrait Sir Robert Peels, welches gegenüber dem Fahrstuhl prangte. Sir Robert galt als Gründer der ersten uniformierten britischen Polizeitruppe.
Nach nur wenigen Schritten hatte er die Tür zu seinem Vorzimmer erreicht.
»Guten Morgen, Steph! Guten Morgen, Trish!«
»Guten Morgen, Chef«, antworteten die beiden in einem fast perfekten Chor. Steph, eigentlich Alexandra Stephens, seine Sekretärin, sah wie an jedem Morgen makellos aus: in frühlingshafte Grüntöne gekleidet und eine moderne Frisur. Sie gestattete sich einen Blick auf die winzige Uhr, die am Revers ihres Blazers hing. Ihre Genauigkeit hatte ihr den Beinamen rollender Wecker eingetragen.
»Keine Kritik, Steph«, beschwerte er sich, noch bevor sie etwas sagen konnte. »Ich war schon dienstlich tätig heute früh.« Und mit einem jungenhaften Grinsen fügte er hinzu: »Außerdem ist es ein zu schöner Morgen, um durch die Stadt zu rasen.« Er zwinkerte ihr zu. »Kriege ich trotzdem meinen Kaffee?«
Trish Cooper, ein Constable, sprang auf. »Alles schon bereit, Chef.« Sie hielt das Tablett bereits in der Hand.
»Lass nur, Trish, ich nehme das gleich mit«, sagte Steph und rollte hinter ihrem Schreibtisch hervor. »Ich muss jetzt sowieso meine Liste mit ihm durchgehen. Stell es einfach vorn drauf.« Mit einer geübten Handbewegung klappte sie eine Art Minitisch von der Seite des Rollstuhls über ihre Knie und arretierte ihn.
Trish platzierte das Kaffeetablett auf der entstandenen Fläche und strahlte Steph nun erwartungsvoll an. »Kann ich dann ... ich meine, brauchst du mich ...?«
Steph lächelte. »Na, hau schon ab. Aber in fünfzehn Minuten bist du wieder hier, klar?«
»Klar, Boss.« Trish salutierte und war im nächsten Moment, flink wie ein Wiesel, durch die Bürotür verschwunden.
Die Sekretärin sah ihr einen Moment lang nach, dann griff sie entschlossen an die Räder und rollte in Richtung ihres Chefs. Die beiden Büros lagen hintereinander und waren beide länglich geschnitten. So hatte jeder Besucher den Eindruck, einen fast unendlich langen Flur zu durchlaufen, bis man an Norcotts Schreibtisch angekommen war. Steph stellte das Kaffeetablett auf den Tisch und schenkte ein. Kaffee und ein kleiner Schuss Milch.
Norcott sah von einem Stapel Papiere auf. »Wollen Sie keinen?«
Seine Sekretärin schüttelte den Kopf. »Danke, aber ich bin heute sehr früh wach geworden und hab mir aus Langeweile Kaffee gekocht, bis George wach wurde. Jetzt revoltiert mein Magen.« Sie zuckte mit den Schultern.
Ihr Chef warf den Stapel Papiere auf einen weit größeren Stapel auf seinem Schreibtisch. »Okay. Zwei Fragen von mir, dann können Sie loslegen. Erste Frage: Wohin ist Trish so schnell verschwunden? Und die zweite Frage: Von wem sind die Blumen auf Ihrem Schreibtisch? Hab ich etwas vergessen? Hochzeitstag?«
Alexandra Stephens lächelte. »Trish ist runter in den 3. Stock. Sie ist doch mit einem Constable aus dem Dezernat 4 befreundet. Die beiden sind wie die Kletten. Und sie wissen ja, wie es da unten zugeht. Sie haben wenig Zeit. Abends sind die Leute vom Dezernat 4 oft dienstlich unterwegs. Da lass ich ihr manchmal die Freiheit ...« Es hing ein ganz kleines Fragezeichen an ihrer Bemerkung, aber Norcott nickte. »Etwas Ernstes?«
»Nein, sie sind nur Freunde. Sowas soll es geben.« Sie grinste. »Und die Blumen sind von Commissioner O’Leary.«
»Hat der alte Luchs das immer noch nicht aufgegeben, Sie mir auszuspannen? Da kann er lange drauf warten, bevor ich Sie ziehen lasse.« Er wusste, wie sehr Steph die Abwerbungsversuche genoss. Ebenso sehr, wie er es genoss, eine der mit Sicherheit kompetentesten Sekretärinnen des Yard zu haben. Ihre Arbeit war perfekt, Ihre Persönlichkeit eine Bereicherung. Der Neid seiner Kollegen war da nur noch das Tüpfelchen auf dem i.
Die beiden arbeiteten die anstehenden und laufenden Fälle durch, diskutierten und entschieden gemeinsam, wann was von wem zu tun war. Trish war irgendwann, zufrieden und pünktlich, wieder erschienen und hatte sich an ihre Arbeit gemacht.
* * *
»Es ist 13.50 Uhr, Chef.« Stephs Erinnerung riss Norcott aus Überlegungen, wie man die Schmuggler an der schottischen Nordküste noch effektiver bekämpfen könnte. Er notierte seine letzten Gedanken und machte sich dann auf den Weg in die heiligen Hallen des 7. Stockwerks. Das Büro des Polizeichefs, Sir Harold Scott, war allerdings wenig beeindruckend. Im Grunde war es eine fast identische Kopie von Norcotts eigenem Büro. Da es jedoch ein Eckbüro war, verfügte es über eine Fensterfront mehr, strahlte aber ansonsten eher nüchterne Effektivität aus.
Sir Harold Scott war der erste britische Polizeichef, der vor seiner Ernennung nicht bei der Polizei oder dem Militär gewesen war. Aber er galt als hervorragender Verwaltungsfachmann und hatte sich nach seiner Ernennung vor zwei Jahren sehr erfolgreich eingearbeitet. Ihm war das Kunststück gelungen, einerseits Kosten einzusparen und gleichzeitig für bessere Ausrüstung und Versorgung der Polizeibeamten zu sorgen. Scott legte viel Wert auf die Meinung seines Mitarbeiterstabes und ermutigte alle, bis hinunter zum Constable, offen ihre Sicht vorzutragen. Auch Norcott brachte dem ruhigen Mann mit der charakteristischen runden Brille großen Respekt entgegen.
Norcott wurde von Scotts Sekretärin gleich weitergebeten. Sir Harold trug, wie fast immer, die dunkelblaue Polizeiuniform.
»Hallo, Charles, schön, dass Sie da sind. Da kann ich Ihnen gleich Rupert Jernigan aus dem Justizministerium vorstellen.«
Die beiden Männer begrüßten sich und Norcott nahm an dem kleinen Besprechungstisch Platz. Scott griff nach einer vor ihm liegenden Akte.
»Mr. Jernigan ist Mitarbeiter einer Projektgruppe aus Justiz-, Innen- und Kriegsministerium. In dieser Projektgruppe geht es um die Erarbeitung von Regeln und Vorschriften, welche die Verwaltung der britisch besetzten Zone Deutschlands betreffen. Sie arbeiten dem Militärgouverneur, Sir Sholto Douglas, direkt zu.«
Norcott konnte bereits die erdrückende Last von Aktenbergen ahnen und sah endlose Stunden im Kampf um Verwaltungsformulierungen drohend an sich vorbeiziehen.
»Aber Verwaltungsvorschriften sind eines, eine vernünftige pragmatische Verwaltung etwas anderes. Und deshalb hatte man daran gedacht ...« Sir Harold wandte sich an Jernigan: »Vielleicht möchten Sie selbst Ihre Idee vorstellen? So wie ich Sie im Vorgespräch verstanden habe, war es Ihre persönliche Idee?«
Der bisher so blass wirkende Jernigan erwachte wie durch ein geheimes Stichwort zum Leben. »Oh ja, Sir Harold, ich darf das, bei aller Bescheidenheit, für mich reklamieren.« Er rückte seine schmale Stahlbrille zurecht. »Wissen Sie, Superintendent, ich selbst habe vor dem Krieg ein Semester in Deutschland studiert, Verwaltungswissenschaften. Und auch wenn dies nur eine kurze Zeit war, habe ich in den letzten Monaten bemerkt, wie viel Vorsprung ich gegenüber meinen Kollegen habe, die bisher nichts mit deutscher Verwaltung oder Justiz zu tun hatten. Kurz und gut, ich habe dem Militärgouverneur vorgeschlagen, praxiserfahrene Fachleute zu gewinnen, die ihr Wissen und ihre Erfahrung an diejenigen Kollegen weitergeben, die bald nach Deutschland versetzt werden. Und da Sie, als einer der ganz wenigen britischen Polizeibeamten längere Zeit mit deutschem Militär und Verwaltung zusammenarbeiten mussten, wären Sie als Ausbilder prädestiniert.«
Jernigan sah Norcott mit einem Leuchten in den Augen an, ganz als erwarte er ein Lob für seinen Plan. Tatsächlich machte die Idee durchaus Sinn. Die britische Militärverwaltung konnte unmöglich die gesamte deutsche Verwaltung und Justiz auf den Kopf stellen. Selbst kleinste Eingriffe hatten manchmal unvorhersehbare Folgen. Norcott musste nur an die, damals ganz selbstverständlich getroffene, Entscheidung der deutschen Besatzungstruppen denken, auf den Kanalinseln den Rechtsverkehr einzuführen. Und er musste an seine eigene Verzweiflung denken, als Polizeichef der Kanalinseln diese und andere Vorschriften umzusetzen. Er seufzte tief bei dieser Erinnerung an 1940.
»Sie sind nicht überzeugt?«, fragte Sir Harold überrascht, der das Seufzen missdeutet hatte.
Norcott sah in das enttäuschte Gesicht von Mr. Jernigan und beeilte sich, den Irrtum aufzuklären. »Oh, ganz und gar nicht, Sir Harold. Mr. Jernigan, ich muss mich entschuldigen. Ich hatte bei Ihrer Beschreibung nur plötzlich wieder alte Bilder von 1940 vor Augen. Nein, ich halte Ihre Idee für brillant. Absolut. Darf ich fragen, wie und wo diese Erfahrungsweitergabe stattfinden soll?«
Jernigan hatte erleichtert aufgeatmet. »Wir stellen derzeit eine Gruppe von Juristen und Verwaltungsfachleuten zusammen, die wir gern in den kommenden drei Monaten schulen würden. Da dort auch andere Vorbereitungskurse stattfinden, haben wir an das All Souls College in Oxford gedacht.«
Sir Harold schaltete sich wieder ein. »Ich denke, ich habe im letzten halben Jahr genug Arbeit aus Ihnen herausgepresst, Charles. Ich würde Sie also für die komplette Zeit bis Ende Juli oder meinetwegen auch Ende August an die Universität Oxford ausleihen und Ihre einzige Aufgabe würde es sein, Vorlesungen zu geben. Der Kurs wird offiziell bis zum Freitag, den 1. August, gehen. Danach können Sie Urlaub dranhängen, genug Tage haben Sie ja noch. Also? Machen Sie es? Die genauen Details können Sie alle mit Mr. Jernigan in Ruhe klären. Soweit Sie zustimmen. Ich möchte Ihnen das nicht befehlen.«
Norcott war wirklich überrascht. Sein eigenes Jurastudium in Edinburgh lag dreißig Jahre zurück. Oxford, eine der ältesten Universitäten Europas. Und noch dazu am All Souls College, einer so altehrwürdigen Institution, das hatte seinen ganz eigenen Reiz. Er holte sich zu rein praktischen Erwägungen aus seinen Gedankenspielen zurück. »Bitte entschuldigen Sie, Sir Harold und auch Mr. Jernigan, das ist eine gewiss hoch interessante Aufgabe. Aber, wie Sie wissen, Sir Harold, habe ich vor einem Dreivierteljahr geheiratet ... nach, nun, einigen Turbulenzen, und wir haben erst vor einem halben Jahr unser Haus hier in London bezogen. Verstehen Sie mich, wenn ich das zuerst mit meiner Frau besprechen möchte?« Norcott bemerkte, wie Jernigan kurz zuckte, als wollte er etwas sagen, aber der Polizeichef hatte schon genickt.
»Natürlich, Charles. Ich verstehe das vollkommen. Sie sind da sicher in einer besonderen Situation. Könnten wir das trotzdem zügig erledigen?« Er blickte damit zu Rupert Jernigan.
Der nickte eifrig. »Leider hat es sehr lange gedauert, die Zustimmung des Militärgouverneurs zu bekommen, vieles geht in Deutschland noch drunter und drüber. Nun, jedenfalls, um ehrlich zu sein, wir würden Ihre erste Vorlesungen gern schon ... übernächste Woche sehen.«
Kapitel 2
London NW8, 126 Hamilton Terrace
Montag, 31. März 1947, Nachmittag
Norcott zuckte zusammen. Das Klopfen an seiner Seitenscheibe hatte ihn aus seinen Gedanken gerissen. Er kurbelte das Fenster herunter.
»Alles in Ordnung, Superintendent?«, fragte der Polizist, der Wache an der Ausfahrtsschranke hatte. »Ich wollte Sie nicht erschrecken.«
»Keine Sorge, Constable.« Norcott lächelte. »Ich war nur in Gedanken. Kann losgehen.«
Der Wachposten nickte und drückte die Schranke nach oben. Sie wechselten noch einen kurzen Gruß und schon tauchte der rote Alvis in den Londoner Nachmittagsverkehr ein.
Fast zwei Jahre lag das Kriegsende nun schon zurück. Wirklich ruhig war aber auch die folgende Zeit nicht. Weder für Großbritannien noch für die Norcotts. Wenn das letzte Kriegsjahr schon stürmisch für sie gewesen war, so hatte 1946 noch einmal mit ganz neuen Spezialitäten aufgewartet. Einer dieser apokalyptischen Reiter war der Winter 1946/47 gewesen. Mit seiner, Monate andauernden, arktischen Kältewelle hatte er das ganze Land fest in seinem Würgegriff gehalten. Bis in die Londoner Ministerien und auch in die Führungsetage des Yard im 7. Stock war die Rationierung gedrungen. Auch der Polizeichef hatte mit Wintermantel, Schal und Handschuhen im Büro gesessen. Norcott erinnerte sich gut an einen Tag, an dem er es nur mit Hilfe eines Armeefahrzeugs überhaupt ins Büro geschafft hatte. An der Kreuzung Westminster Bridge/Victoria Embankment war am Vorabend ein Doppeldeckerbus liegen geblieben. Bis zum Morgen war die Schneewehe am Bus bis auf das Dach in über vier Meter Höhe gewachsen. An diesem Tag, dem 23. Januar 1947, hatten die Schlagzeilen die Reduzierung der Brotration verkündet.
Dann, vor einigen Wochen, war schlagartig der Frühling ausgebrochen. Und was zunächst mit kollektiver Erleichterung aufgenommen worden war, offenbarte sich schnell genug als Geschenk des Teufels. Die ungeheuren Schneemassen schmolzen zu schnell und halb England verwandelte sich in eine Lagunenlandschaft. Norcott seufzte am Steuer. In jenen Tagen die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten, war fast schwieriger gewesen, als während der Bombennächte des berüchtigten London Blitz, den massiven Angriffen der deutschen Luftwaffe Ende 1940. Langsam erholte sich aber nun das Land. Das Wasser ging mehr und mehr zurück. Es trat etwas ein, was man ohne größeren Zynismus als eine Art von Normalität bezeichnen konnte. Wenngleich London in einigen Stadtteilen immer noch einem Trümmerfeld glich und Lebensmittel, Strom und Kohle nach wie vor streng rationiert waren.
Es war für Vicky und Charles Norcott, die erst im Herbst 1946 geheiratet hatten, daher wie ein verspätetes Hochzeitsgeschenk, als sie von der Wohnungsbehörde das beschlagnahmte Haus eines Schwarzmarkthändlers angeboten bekamen. Ein intaktes Haus mit viel Platz, nahe der City – sie hatten ihr Glück nicht fassen können.
Ein Hupen weckte Charles Norcott aus seinen Gedanken, er stand bei Grün an einer Ampel. Er bog nach rechts in die St. John’s Wood Road ein und grübelte dabei weiter, wie Vicky wohl die Nachricht zu Oxford aufnehmen würde. Eines war klar, nach allem, was sie gemeinsam durchgestanden hatten: Ohne ihre Zustimmung würde er nicht nach Oxford gehen. Zu Hause angekommen, fand er Vicky und Maxine im Garagenhof des Hauses.
»Du hast sie also tatsächlich gekauft.« Die beiden Frauen waren so mit dem Motorrad beschäftigt gewesen, dass sie ihn erst jetzt bemerkten. Vicky sprang auf ihn zu, nahm sein Gesicht in die Hände und küsste ihn stürmisch.
»Oh, Darling, ja! Max war fantastisch! Sie hat diesen schleimigen Mr. Ottersby auf Hundert Pfund heruntergehandelt. Inklusive Ersatzteilen! Ups!« Sie hatte seinem Gesicht ein paar ölige Fingerabdrücke verpasst.
»Das steht dir ungemein«, sagte Maxine lakonisch und küsste ihn ungerührt auf beide Wangen. »Deine Frau hat einen wirklich guten Fang gemacht. Die Scott-Motorräder sind exzellent verarbeitet und sehr durchzugskräftig.«
»Was für ein Baujahr ist es?« Norcott hockte sich dabei neugierig neben seine Frau. Die war gerade dabei, mit atemberaubender Geschwindigkeit Bauteile ineinanderzusetzen.
»1937«, antwortete Maxine. »Einer der letzten Jahrgänge, bevor die Fabrik auf Flugzeugmotoren für den Krieg umgestellt wurde. Noch echte Friedensware. Wenn Vicky sie ordentlich pflegt, kann sie damit auch noch in zehn Jahren durch die Gegend fliegen.«
Vicky sah die gerunzelte Stirn ihres Mannes und winkte ab. »Mach dir keine Gedanken, Darling. Ich habe nicht die Absicht, Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen.«
Norcott entschied, jetzt lieber keinen Kommentar abzugeben. »Könnt ihr dieses Baby einen Moment allein lassen? Ich hätte da auch noch etwas zu verkünden. Maxine, hast du noch Zeit für eine Tasse Tee?« Mit einem Schmunzeln fügte er hinzu: »Oder einen Gin Tonic?«
»Und führe mich nicht in Versuchung. Nein, ernsthaft, ich kann nicht, Charles. Ich bin um fünf mit meiner Tochter in der Stadt verabredet. Wir wollen in die London Metropolitan Archives. Ich hab versprochen, ihr bei der Literaturrecherche für eine Uni-Arbeit zu helfen. Und das«, sie schaute auf ihre Armbanduhr, »werde ich gerade noch schaffen.«
Sie verabschiedeten sich und Max bestieg ihr eigenes Motorrad, eine ehemalige Armeemaschine.
In der Küche angekommen, fragte Vicky: »Was möchtest du trinken, Darling? Schrecklich langweiligen britischen Tee oder etwas Dekadenteres?«
Er strich sich nachdenklich über den Nacken. »Soll ich dir erst einmal etwas erzählen und dann entscheiden wir, was wir Passendes dazu trinken?«
»Okay. Deal.« Seine Frau lehnte sich in einer typischen Geste an den Küchentisch und verschränkte die Arme. »Ich bin bereit, Superintendent.«
Norcott erzählte von dem Angebot in knappen Zügen. Und er endete mit dem Hinweis darauf, dass er sich Bedenkzeit erbeten hatte, um mit ihr darüber zu sprechen. Als Vicky nicht antwortete, zog er einen Ring mit zwei Schlüsseln aus der Tasche. »Mr. Jernigan war so freundlich, mir diesen Schlüssel zu überlassen. Wir könnten uns unser ›Ausweichquartier‹ also ansehen, wenn du willst.«
»Wann?«
»Wann du willst«, antwortete er leichthin und bereute es im selben Augenblick. Zu spät hatte er das charakteristische Strahlen in ihren meerwasserblauen Augen bemerkt.
»Oh nein ...«
»Oh doch!« Sie sah ihn mit diesem umwerfenden Blick an, dem er nie widerstehen konnte. »Ach komm, Charles. Sei kein Hasenfuß. Ich kann mein Motorrad ausprobieren und wir sehen uns gleichzeitig das Haus an. Ich verspreche, ich gebe dir direkt danach eine Antwort.« Als sie seine zerfurchte Stirn sah, lachte sie. »Wir könnten uns ein Restaurant suchen und die Nacht über dort bleiben. Oder hast du morgen früh dringende Termine?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, keine Termine bis Mittag.« Norcott atmete tief durch. »Also gut. Pack ein paar Sachen zusammen, ich suche mir inzwischen etwas Passendes zum Anziehen für deinen Feuerstuhl.«
* * *
»Was darf ich Ihnen zu trinken bringen?« Die ältere Kellnerin lächelte sie erwartungsvoll an. Sie war sichtlich froh über das Paar, das so spät noch hereingeschneit war. Die anderen Gäste des gemütlichen kleinen Hotelrestaurants ließen sich an den Fingern abzählen. Hier wie überall warf die schlechte Wirtschaftslage ihre dunklen Schatten. Dazu noch an einem Montag, da konnte sich das Öffnen kaum lohnen.
Norcott reichte das erwartungsvolle Lächeln an Vicky weiter. »Nun, was werden wir trinken, Darling? Champagner oder Wasser?«
Sie lachte und griff nach seiner Hand. Ihre Augen hatten nichts von dem Strahlen verloren, das sie bei der Ankunft in Oxford gehabt hatten. »Selbst wenn«, sie machte eine bühnengerechte Pause und wurde leiser, »selbst wenn ich nicht schon rettungslos verliebt wäre in unser wunderschönes kleines Traumschloss hier, selbst dann hättest du etwas Besseres als Wasser verdient. Allein dafür, dass du es so tapfer die hundert Kilometer auf meinem Rücksitz ausgehalten hast. Dafür verdienst du wenigstens einen anständigen Weißwein.« Sie wandte sich der wartenden Bedienung zu. »Was für Weißwein haben Sie? Einen leichten, französischen? Vielleicht können Sie etwas Gutes empfehlen?« Sie schenkte der Frau ein freundliches Lächeln.
»Oh sicher, Madam. Sie wollten das Fasanenragout, nicht wahr? Wir haben einen schönen Sauvignon Blanc aus der Gascogne, der wird sehr gern dazu getrunken.«
Vicky nickte zustimmend und die Bedienung verschwand scheinbar zufrieden.
»Also, du bist einverstanden?«, hakte Norcott noch einmal nach. »Kein Problem mit: Noch einmal alles packen und einen Riesenaufwand für knapp fünf Monate?«
Sie lachte. »Es ist nicht gerade mein drängendster Wunsch, frisch nach dem Umzug wieder zu packen. Aber es ist doch eine Riesenchance. Du kommst mal aus der Tretmühle im Yard heraus, ein bisschen Veränderung wird dir vielleicht ganz gut tun. Und ich gebe offen zu, es reizt mich auch. Oxford ist ja nicht irgendeine Universität. Hier berührt dich der Atem von achthundert Jahren Geschichte. Ich bin da wirklich egoistisch, die Umgebung ist herrlich, es gibt hier Motive für mich auf Jahre hinaus.« Sie griff nach seiner Hand und streichelte sie. »Und du? Möchtest du es denn? Oder tust du es nur, weil Sir Harold es will?«
»Nein, das ist es sicher nicht.« Energisch schüttelte er den Kopf. »Es ist eher die Möglichkeit, Irrtümer aufzuklären und dafür zu sorgen, dass diese Männer und Frauen gut vorbereitet nach Deutschland gehen. Der Krieg hat schon so viel Hass und so viele Vorurteile hervorgebracht, ich fürchte, diese Spirale geht weiter, wenn wir nicht versuchen ... nun, das Bild zumindest in ein, zwei Punkten geradezurücken.« Er lächelte. »Und ja, ich fühle mich auch geschmeichelt. Wie du schon so treffend festgestellt hast: Oxford ist ein besonderer Ort.«
Die Kellnerin brachte den Wein und nach einer kurzen Probe waren sie wieder allein.
Vicky hob das Glas. »Dann trinken wir auf ein ruhiges Semester in Oxford.«
»Auf Oxford. Und darauf, dass ich die Rückfahrt morgen überstehe.«
Kapitel 3
Oxford, Physikalisches Institut
Montag, 7. April 1947, Vormittag
Das Gebäude des Physikalischen Instituts fiel vor allem durch seine wuchtigen Außenmauern auf. Ein Londoner Händler, durch den Handel mit Indigo zu unverschämten Reichtum gekommen, hatte das Gebäude 1860 gestiftet. Ein klassizistisches Portal, von massigen Säulen im dorischen Stil getragen, bildete den Mittelpunkt. Rechts und links vom Portal erstreckten sich zwei symmetrische Flügel, deren Enden wiederum in symmetrischen Quergebäuden endeten. Alles atmete gepflegte Opulenz, zumal eine Stiftung des Kaufmanns die Erhaltung des Gebäudes sicherte.
Wenngleich aufgrund der Benzinknappheit immer noch viele Pferde benutzt wurden, fiel dieses Pferd doch auf. Einerseits, weil Pferde hier im Herzen des Universitätsviertels doch eher selten waren. Andererseits, und noch viel mehr, durch seine Reiterin. Unmittelbar vor dem Portal des Physikalischen Instituts hielt die schlanke, junge Frau ihr Pferd an. Sie saß mit Schwung ab und band ihr Reittier an der Tatze einer Löwenstatue fest. Weder Pferd noch Löwe schienen damit Probleme zu haben, im Gegensatz zu dem grauhaarigen Männchen, welches eilig aus dem Portal gelaufen kam. Ohne auch nur im Ansatz den Vorhaltungen des Männchens zuzuhören, marschierte die hochgewachsene junge Frau zielsicher durch die hohen Türen des Portals. Die Absätze ihrer Reitstiefel hallten durch die Rotunde, bevor sie sich nach rechts wandte und mehrere Schwingtüren durchschritt. Endlich hatte sie ihr Ziel erreicht und bog mit Schwung in ein Büro ein.
»Halt. Miss Carsdale ... Halt! Bitte.« Eine üppige Sekretärin versuchte, schnell genug hinter dem Schreibtisch hervorzukommen und sich der jungen Frau in den Weg zu stellen. »Sie können da jetzt nicht ... Er hat eine Besprechung ...«
Ohne zu klopfen oder die Sekretärin irgendwie zu beachten, riss Janna Carsdale eine weitere Tür auf. Die vier im Raum sitzenden Personen sahen sie an, wobei nur drei überrascht schienen.
»Wo, in drei Teufels Namen, bist du gewesen?« Die junge Frau richtete ihre Reitgerte auf einen etwa fünfunddreißigjährigen Mann. Der strich sich als einzige Antwort mit einer blasiert wirkenden Geste über das gewellte braune Haar.
»Wo du gewesen bist, hab ich dich gefragt!« Carsdales blaue Augen funkelten.
Als der Angesprochene keine Anstalten machte, zu antworten, erhob sich eine der anderen Personen halb, eine unscheinbare junge Frau in einem Laborkittel. »Möchten Sie ...? Wollen Sie lieber allein ...?« Niemand beachtete sie.
»Ich hatte zu arbeiten.« Es war eine Feststellung, in dem leicht schleppenden Tonfall teurer Privatschulen getroffen, die sich an niemand Speziellen zu richten schien. »Wie auch jetzt.«
Janna Carsdale machte einen Schritt auf den Mann zu und hielt ihm das Ende ihrer Reitgerte unter das Kinn. »Ich bin nicht deine kleine Cecily. Ich lass mich nicht wie eine Puppe in den Schrank stellen, wenn du keine Lust zum Spielen hast.« Ihr Tonfall war leiser, aber nicht weniger bedrohlich geworden.
Der Mann schob die Spitze der Reitgerte von seinem Hals. »Ich wäre dir dankbar, Janna, wenn du Miss Morley aus dem Spiel lassen könntest. Sie ist eine Dame.«
Sehr langsam stützte sich die junge Frau auf den Konferenztisch und beugte sich zu ihm hinüber. »Miss Morley ist eine Dame. Und dabei so sterbenslangweilig tugendhaft, dass du lieber mich besteigst, wenn du es brauchst.« Sie lächelte jetzt, aber der Klang ihrer Stimme war noch eisiger geworden. Fast flüsterte sie nun: »Eine Frau, deren einzige Fähigkeit im Bett darin besteht, sich auf den Rücken zu legen und die beim Ficken wahrscheinlich das Ave Maria betet. So etwas willst du?« Ihr Gesicht verriet, wie sich ganz langsam Wut in Hohn verwandelte. Und wie sehr sie diese Verwandlung genoss. »Ist das so eine spezielle Art von ... adliger Perversion?«
Einer der anderen Männer unterdrückte mühsam ein Prusten und versuchte, es mit einem Hustenanfall zu kaschieren. Die junge Frau im Laborkittel dagegen hatte sich wieder gesetzt und fixierte mit starrer Kopfhaltung den Fußboden, bedeckte ihren Mund scheinbar schamhaft mit der Hand.
Der Mann mit dem gewellten Haar seufzte. Dabei wirkte er weiterhin eher gelangweilt als beunruhigt. Er blickte in die kleine Besprechungsrunde und machte eine lahme Handbewegung. »Es tut mir unfassbar leid, aber würden Sie uns einen Moment entschuldigen? Ich denke, wir können in zehn Minuten fortfahren.« Mit einer weiteren lässigen Handbewegung waren die Besprechungsteilnehmer entlassen.
»Janna, was willst du?« Jetzt, nachdem seine Kollegen den Raum verlassen hatten, wirkte der Mann eher gereizt denn gelangweilt. »Was in aller Welt denkst du dir, hier einfach aufzutauchen?« Er sah sie das erste Mal direkt an und wiederholte: »Was willst du?«
Die Frau setzte sich halb auf den Konferenztisch. »Viele Leute behaupten, du seist ein brillanter Wissenschaftler. Das kann ich nicht beurteilen. Aber manchmal, Liebling, bist du wirklich schwer von Begriff.« Carsdale beugte sich zu ihm hinüber. Ihre Stimme war leise, aber voller Selbstsicherheit. »Ich will dich, Jack Vercenne. Dich.«
Der Mann mit dem gewellten Haar dagegen schwieg. Blieb eine Antwort schuldig.
Schließlich richtete sich die Frau wieder auf und seufzte. »Eines scheint mir offensichtlich. In einfachen Dingen des Lebens entgeht dir leicht das Wesentliche.« Carsdale stieß sich vom Konferenztisch ab und machte einen langsamen Schritt auf die Tür zu. Neigte dann aber bedächtig den Kopf und wandte sich doch wieder um. »Vergiss mich nicht noch einmal, Jack.« Leise Worte.
Mit entschlossenen Schritten marschierte sie danach an zwei Personen vorbei, die im Flur warteten: einem pickelgesichtigen Jüngling und der Unscheinbaren im Laborkittel.
Der Pickelgesichtige sah Janna Carsdale einen Moment nach. Sein Blick spiegelte Neugier wider. Gemischt mit der Spur eines hämischen Lächelns.
Jack de Vercenne lehnte sich aus der Tür seines Büros. »Daphne, holen Sie bitte die anderen wieder herein.«
»Dr. Fraser-Collins ist schon wieder im Labor, Professor.« Sie machte eine hilflose Geste.
De Vercenne bedachte sie mit einem Blick, der ihr ein Frösteln über den Nacken trieb. Er schloss die Tür zu seinem Büro wortlos und ließ sie hilflos zwischen den Stühlen zurück. Die Bürotür öffnete sich. Die Unscheinbare und der Pickelgesichtige kamen herein. Beim Anblick der ratlosen Daphne seufzte die Frau mitfühlend.
»Soll ich dann mal Dr. Fraser holen?«
Eine erneute hilflose Geste war die Antwort.
»Schon in Ordnung.« Sie schlüpfte aus der Tür und ließ eine erleichterte Sekretärin zurück.
»Sie ist wirklich nett«, bemerkte Mitch Firking, der Pickelgesichtige. »Und selbst mit unserem kleinen Inder wird sie spielend fertig.« Er grinste abschätzig.
»Sag nicht immer Inder, Mitch. Wenn Dr. Fraser das mitbekommt ...«
Der Laborassistent winkte achtlos ab und starrte weiter auf die Tür, hinter der seine Kollegin Gene Rackshaw verschwunden war. Die füllige Daphne wünschte sich, er möge ihr einmal so hinterherstarren. Aber dann änderte sich plötzlich sein Gesichtsausdruck.
»Alles dasselbe arrogante, hochnäsige Pack. Adlige und Ausländer. Alles Pack, die meinen, hier herumkommandieren zu können ... verdammte Schinder, die uns kleinen Leute ...« Er kam sichtlich in Fahrt und presste die Worte heraus. »Wir haben gegen die Falschen gekämpft. Die Nazis haben es schon ...«
Bevor Daphnes ängstliche Geste ihn zum Schweigen bringen konnte, trat Dr. Fraser-Collins, gefolgt von Gene Rackshaw, ins Vorzimmer. Der dunkelhäutige Wissenschaftler lächelte sarkastisch.
»Ja, Firking, was haben die Nazis?« Als der Laborassistent nicht gleich antwortete, machte Dr. Fraser einen Schritt auf ihn zu und tippte ihm auf die Brust. »Glauben Sie ja nicht, ich wüsste nicht, dass Sie hinter meinem Rücken gegen mich hetzen. Machen Sie mir doch die Freude und hetzen noch ein bisschen mehr.« Seine gleichmäßigen Züge formten ein Lächeln. »Dann kann ich Sie endlich feuern lassen.« Mit seinem ausgestreckten Zeigefinger drückte er Firking beiseite und ging in Professor Vercennes Büro weiter.
Kapitel 4
Oxford, All Souls College
Dienstag, 8. April 1947, früher Abend
Professor Richard Peake, der Rektor des All Souls College, war nur ungefähr einen Meter fünfzig groß und hatte dazu noch lediglich einen schmalen Kranz strubblig abstehender grauer Haare. Durch die ehrfurchtgebietenden Räume des Colleges bewegte sich der koboldhafte Mann jedoch mit der gelassenen Selbstsicherheit eines unumschränkten Herrschers. Eine kleine Prozession folgte ihm durch Flure und Gänge.
»Wir befinden uns hier im Warden’s Lodging, also meinen Räumen, in einem der jüngeren Teile des Colleges«, sagte Peake, der neben Charles Norcott ging. Norcott, fast fünfzig Zentimeter größer als der Rektor, versuchte aus Höflichkeit, möglichst kleine Schritte zu machen. Ihnen folgten Vicky Norcott und Rupert Jernigan, der Verantwortliche für das Schulungsprogramm, in dem Norcott lehren sollte. »Mein Amtsvorgänger George Clarke ließ das Haus für sich Anfang des 18. Jahrhunderts bauen. Wenn sich ein Besucher«, dozierte Peake weiter, »von hier aus durch die Treppenhäuser am südlichen Innenhof und die große Halle bis zu den Hawksmoor Towers bewegt, so wie wir es nun tun, dann bewegt er sich baugeschichtlich vom 18. bis ins 15. Jahrhundert und zurück.«
Vicky und Charles wechselten Blicke und er seufzte innerlich auf. Bei aller Ehrfurcht vor der Geschichte der Universität hätten sie auf einen Großteil dieser Geschichtsvorlesung verzichten können. Zumal Professor Peake in seinem Vortrag so viel Enthusiasmus versprühte wie eine Beerdigung im Regen. Charles lächelte seiner Frau aufmunternd zu und nahm sich fest vor, seine eigenen Vorlesungen deutlich spannender zu gestalten. Norcott war für einen Moment wieder so ergriffen von der Vorstellung, hier bald selbst lehren zu dürfen, dass er fast mit Peake zusammengestoßen wäre. Der war stehen geblieben, um seinen Besuchern eine große Durchgangstür aufzuhalten. »Die Zwillingstürme hier gehören zu einem großen Bauabschnitt um den nördlichen Innenhof, der 1733 fertiggestellt wurde. Der Architekt, Nicholas Hawksmoor, hat sie an den Stil einer gotischen Kathedrale angelehnt.« Wieder blieb der Rektor stehen und wies aus einem der hohen Fenster. »Die Codrington-Bibliothek wurde zwar nach seinen Plänen gebaut, aber erst nach Hawksmoors Tod fertiggestellt.« Er seufzte. »Der ursprüngliche Entwurf wurde mehrfach geändert und im 19. Jahrhundert dann durch allerlei architektonische Eingriffe ... nun ... nicht eben verbessert.« Nach einem stillen Moment griff er dann entschlossen nach der schweren eisernen Türklinke.
Sie betraten den langgestreckten Hauptsaal der Bibliothek. Auf der einen Seite öffnete sich eine breite Fensterfront zum Innenhof, auf der anderen Seite wurde der Saal durch zweigeschossige Bücherregale mit durchgehender Balustrade bestimmt. Der langgestreckte Bibliotheksraum selbst war mit nur wenigen zierlichen Arbeitstischen möbliert und wirkte steif und kühl. Nur knapp zwanzig Meter vom Eingang entfernt jedoch sprang der untere Teil der Bücherwand nach innen. Auf den dahinter liegenden Raum strebte Professor Peake nun zu. Je näher sie kamen, umso mehr warmes Licht drang heraus, begleitet von den Wortfetzen leiser Unterhaltungen. Die kleine Gruppe betrat den Raum, der sich nach dem niedrigen und eher engen Durchgang sofort wieder in Höhe und Breite öffnete. Im Gegensatz zu den in zurückhaltendem Creme und Dunkelblau gehaltenen Wänden der Hauptbibliothek war hier nicht mit Blattgold gespart worden. Die oval angelegte Bibliothek wurde durch eine in sich verschlungene Doppeltreppe dominiert, die den Besucher scheinbar emporzuheben schien, hinauf in einen Olymp voll Gelehrsamkeit. Norcott war auf den ersten Blick hin fasziniert von der Mischung aus geschwungener Leichtigkeit einerseits und der opulenten Farbigkeit aus Gold und dunklem Rot andererseits. Ins Hundertfache verstärkt wurde dieser Eindruck durch die scheinbar zahllosen Kerzen, die den Ort beleuchteten. Pittoresk verziert schließlich wurde der Eingangsbereich durch einen auf einem Holzstuhl sitzenden älteren Mann, dessen rechter Arm auf einer Pumpspritze ruhte und der einen Helm des Zivilschutzes trug.
Professor Peake hüstelte leise. Er war Norcotts Blicken gefolgt, die an dem sitzenden Mann hängengeblieben waren. »Bitte verzeihen Sie uns die etwas