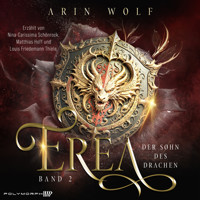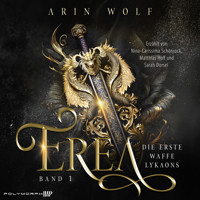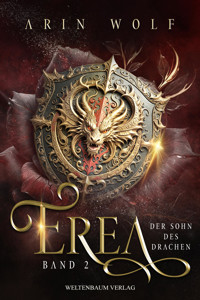
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Weltenbaum Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Land der Schwarzen Flut, wo Monster sich laben an Menschenblut. Der Tod, der wird dich dort binden. Wenn die Götter dich hier nicht finden. An Pheros’ Seite trotzte Mira der Todesarena, blutrünstigen Dunkelelfen, Nekrophagen und boshaften Geistern. Wo einst Vorurteil und Feindschaft zwischen ihnen standen, wuchsen tiefe Zuneigung und Vertrauen. Doch kann Liebe genug sein in einer Welt, die zutiefst zerrüttet ist? Erneut stellen die Götter Pheros und Mira vor die Wahl. Pflicht oder Liebe? Wahrheit oder Lüge? Sehr bald schon müssen sie sich für einen Weg entscheiden, denn im Herzen des Kaiserreichs schwelt ein altes Übel. Tief verborgen und fest verwoben mit einem Geheimnis, das das Potenzial birgt, nicht nur ihre Liebe, sondern auch ganz Erea zu erschüttern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
WELTENBAUM VERLAG
Vollständige Taschenbuchausgabe
06/2025 1. Auflage
Erea – Der Sohn des Drachen
© by Arin Wolf
© by Weltenbaum Verlag
Egerten Straße 42
79400 Kandern
Umschlaggestaltung: © 2025 by Magicalcover
Lektorat: Julia Schoch-Daub / Feder und Flamme Lektorat
Korrektorat: Michael Kothe
Buchsatz: Giusy Amé
Autorenfoto: Privat
ISBN 978-3-69067-006-7
www.weltenbaumverlag.com
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
Arin Wolf
Erea
Der Sohn des Drachen
High Fantasy Romance
Band 2
Für alle, die sich trauen
hinter die Maske zu blicken
…und auch dann nicht weg sehen.
Vorwort
Liebe*r Leser*innen,
ich freue mich dich in das nächste Kapitel dieser Reise entführen zu dürfen. Diesmal geht es nach Lykosura und damit direkt ins Herz des Imperiums. Ein Ort, der lange Schatten wirft, die altverborgene Geheimnisse hüten und unsere Helden vor schwierige Entscheidungen stellen. Dunkelheit wohnt nicht nur an Orten, sondern auch in Herzen, die nie erfahren haben, was Vergebung und Liebe bedeutet. Masken helfen die Schatten zu verbergen, die darunter lauern, dennoch folgen sie uns bei Tag und auch bei Nacht. Denk daran, bevor du das Land der Schwarzen Flut betrittst und stell dir selbst die Frage:
Wie tief willst du blicken?
- Content Notes findest du am Ende des Buches.
1
Makhai, Fürstentum Kaukon
Festung Himmelswacht
SAMAS
In der großen Halle herrschte helle Aufregung. Würdenträger, Soldaten und Bedienstete huschten umher, aufgescheucht wie ein tobender Bienenstamm. Beinahe wäre Samas in einen der Heiler hineingerannt. Der schien es ziemlich eilig zu haben, von hier weg zu kommen.
Die Hafenstadt Kaukon befand sich direkt an der Kriegsfront zu Lykosura. Folglich kam es immer wieder zu Angriffen und Scharmützeln auf beiden Seiten, was dann für viel Aufregung in der Festung sorgte. Also alles wie immer, aber auch nur eigentlich.
Stirnrunzelnd lenkte Samas seinen Blick zum Himmel, der deutlich über das große runde Dachfenster der Haupthalle zu erkennen war. Dunkle Wolken zogen sich zusammen. Sich erhebende Winde und ein plötzlich einsetzender Platzregen? Kam ihm bekannt vor. Oft genug hatte er miterlebt, was geschah, wenn Mira die Kontrolle über ihr Element verlor. Neben ihr gab es nur noch eine weitere Sturmgeborene in ganz Makhai: Die Fürstin Kaukons persönlich und Miras ältere Schwester. Cailin.
Raschen Schrittes durchquerte Samas die Halle und nahm gleich zwei Stufen auf einmal. Der Saal, in dem man Kriegsrat hielt, befand sich im Zentrum des Hauptgebäudes. Dank der Magie, die durch seine Adern floss, konnte er Cailin genau ausmachen. Magie erkannte Magie. Noch bevor er die Flügeltüren des Saals erreichte, erschütterte lauter Donner die Feste und Blitze zerrissen den Himmel.
Cailin war nicht nur stinksauer, sie war vollkommen außer sich. Das löste auch in ihm ein beklommenes Gefühl der Sorge aus. Schließlich gab es nur eine Nachricht, die der Sturmfürstin derart zusetzen konnte, dass sie jedwede Beherrschung verlor: die Kunde über Miras Schicksal.
Seit Monaten warteten sie auf Neuigkeiten der Spione. Bisher hatten diese nur in Erfahrung bringen können, dass Mira – zusammen mit der Ersten Waffe Lykaons – von dunkelelfischen Sklavenhändlern entführt wurde. Direkt nach Oblyvar verschleppt, ohne die geringsten Forderungen zu stellen. Deshalb gingen sie davon aus, dass Mira ihre Identität für sich behalten hatte.
»Dieser verdammte Bastard hat sie!« Cailin schritt am Kopfende des Kriegstisches auf und ab.
»Und wer ist dieser Bastard?«, fragte Samas. In solchen Momenten wirkte Cailin wie der fleischgewordene Schrecken aus der Anderswelt. Dabei galt sie allgemeinhin als Schönheit unter den Fürsten Makhais, besaß sie doch das typische blonde Haar und die blaugrünen Augen der Cornoviers. Ein einziges Mal nur hatte er sie in einem Kleid gesehen. Ansonsten traf man sie ausschließlich in der Kluft einer Kampfmagierin an, die sie auch vor ihrem Erbantritt gewesen war. Wenig anmutig, aber funktionell. Viel Leder und robuste Stoffe. Hosen natürlich und hohe trittfeste Stiefel. Alles in den Farben weiß und blau gehalten – bis auf das Leder. Manchmal kam es ihm sogar so vor, als würde sie sich an ihrer Schönheit stören, weshalb sie oft bemüht wirkte, dem entgegenzuwirken. Nicht nur durch ihre Kleidung oder im Auftreten, sondern vor allem durch das kurz gehaltene Haar, welches ihr im Augenblick wirr zu allen Seiten hin abstand. Silberne Blitze tanzten in ihren Augen. Er hatte schon miterlebt, wie sie mit ihren Händen einige dieser todbringenden Ladungen abgefeuert hatte. Blieb nur zu hoffen, dass ihre Blicke davon ausgeschlossen waren.
»Lykaon hat sie!«
Lykaon? Der Imperator persönlich? Hatte er sich verhört? Oblyvar lag am nördlichsten Punkt des südlichen Kontinents und Lykosura weit im Süden. Makhai befand sich dazwischen. Wie also konnte es sein, dass Mira binnen dieser paar Monate vom nördlichsten Punkt zum südlichsten gelangte, ohne dass die Spione Makhais es mitbekamen?
Samas’ Gedanken rasten und ihm wurde schlecht. Lykaon persönlich? Seit Jahrhunderten beherrschte Erea die Furcht vor der Schwarzen Streitmacht und nun sollte Mira die Gefangene des größten Feindes aller freien Völker sein?
Kopfschüttelnd streifte er die Starre ab und trat an den Tisch heran. »Bist du sicher?«
Sie warf ihm die Schriftrolle entgegen, in der sie eben noch gelesen hatte. Das zerbrochene Siegel war ihm unbekannt. Stirnrunzelnd rollte er das Pergament auf und flog rasch über die Zeilen. Dabei sank er langsam auf den nächstbesten Stuhl. Der Verfasser dieses Berichts schien davon überzeugt zu sein, dass man Mira nach Lyksoura brachte. Langsam ließ Samas die Schriftrolle sinken und hob den Blick zu Cailin. »Wer ist Garm?«
»Ein Anführer der Jägergilde«, antwortete Lucan, der soeben den Saal betrat.
»Wo warst du? Ich habe dich gesucht!«
Wenn der Sturm über ihren Köpfen und Cailins gesamte Erscheinung nicht ausreichten, um Lucan wenigstens den Hauch einer Gefühlsregung zu entlocken, dann wusste Samas wirklich nicht, was es überhaupt konnte.
Vollkommen beherrscht, als käme er von einem netten Spaziergang im Garten, schritt er um den Tisch herum, direkt auf Cailin zu. Dieser Mann trug ausschließlich dunkle Farben. Auch seine Haare, Augen und sogar die Aura schienen von Dunkelheit umwabert zu sein.
Hieß es nicht, er sei ein Sumrung? Den Formwandlern haftete eigentlich immer eine animalische Aura an. Seltsam, dass Samas erst jetzt all diese Ungereimtheiten auffielen. Dabei diente Lucan schon so viele Jahre in der Königsgarde seines Vaters. Man fragte sich, welche Art Sumrung unter seiner menschlichen Erscheinung lauerte und ob beide womöglich mehr waren als Mentor und Schülerin. Und wie konnte es eigentlich sein, dass ein Sumrung und eine Magierin diese Rollen einnahmen? Formwandler mochten magiebeseelte Wesen sein, aber Magie aktiv wirken, zählte nicht zu ihren Talenten. Eine Frage, die Samas schon länger beschäftigte. Vor allem in Momenten wie diesen, wenn er beide miteinander agieren sah. Sie gingen sehr vertraut miteinander um.
»Du musst dich beruhigen, Cailin«, wiederholte der Dunkle Gardist mahnend, ohne auf ihre Farge einzugehen. Sie ignorierte seine Mahnung. »Wie lange soll ich noch passiv bleiben? Wie viele Verluste müssen wir noch erdulden, bis die Krone einsieht, dass wir angreifen müssen?!«
Lucan fasste nach ihren Händen und legte sie sich auf die Brust. »Beruhige dich. Dein Sturm verursacht Schäden in der Stadt. Tote wirst du nicht verantworten wollen.«
Das schien Wirkung zu zeigen, denn Cailin schloss die Augen und übte sich in Mäßigung.
Samas fehlte leider die Geduld, darauf zu warten, bis Cailin sich wieder gefangen hatte. Also fragte er: »Wer oder was ist die Gilde der Jäger?«
»Genau das, wonach es klingt«, antwortete Lucan und sprach dann – wie immer – nicht weiter. Diesen Mann musste man regelrecht zum Sprechen zwingen. Wenigstens wirkte, was auch immer er mit Cailin tat. Nach und nach erhellte sich der Saal und Tageslicht drang durch die Fenster.
»Sag es ihm«, murmelte die Fürstin.
Was hatte man ihm vorenthalten? Dass Mira nach Lykosura gebracht wurde, musste Cailin auch erst jetzt erfahren haben. Andernfalls wäre der Sturm über Kaukon schon vor Wochen ausgebrochen.
Sieben Monate.
So lange verweilte er nun schon in der Hafenstadt. Ursprünglich mit Mira hier her versetzt worden, um Cailins Kampf gegen des Kaisers Schwarze Flut zu unterstützen, war er auch nach ihrer Entführung geblieben. Ebenfalls auf Befehl des Königs, der Samas als Botschafter in Kaukon einsetzte. Die royale Version eines Hausarrestes, denn seinem Vater musste klar gewesen sein, dass er sich auch allein auf den Weg nach Oblyvar gemacht hätte, um Mira zu suchen. Nicht einmal der Einsatz an der Front war ihm erlaubt, denn ein verdammter Botschafter hatte dort nichts zu suchen. So verbrachte er seit Monaten seine Tage damit, Briefe zu schreiben, in denen er Machon über die neuesten Entwicklungen an der Front auf dem Laufenden hielt. Abgestellt, während um ihn herum alles aus den Fugen geriet. Daraufhin hatte Cailin ihm die Aufgabe übertragen, die Wachfestung zu den Schwarzlanden wiederaufzubauen und mit mehr Männern zu bestücken. Mit dieser Beschäftigung und den gelegentlichen Begegnungen mit der schönen Bardin aus Imrit hatte er die letzten Monate irgendwie den Kopf über Wasser gehalten.
»Die Gilde besteht vor allem aus Zwergen«, erklärte der Gardist, womit er Samas wachsende Ungeduld fürs Erste zum Schweigen brachte.
»Spione des Reichs unter Tage. Sie haben ihr Hauptlager in Raquia und kontrollieren diese Stadt seit Jahrzehnten aus dem Schatten heraus. Garm ist zufälligerweise ein ...«, er schien nach dem richtigen Wort zu suchen, »... alter Freund von mir.« Der Gardist hielt inne, als Cailin ihre Augen wieder öffnete und dabei langsam die Hände zurückzog. Nun übernahm sie die Erklärung: »Durch ihn haben wir erfahren, dass Mira und die Erste Waffe Lykaons Zuflucht in Garms Gaststätte gefunden haben. Sie sind wohl ... mehr als Verbündete.«
Samas stutzte. Diese Information drang nur verzögert zu ihm durch und als sie das tat, entfachte es ein Inferno in seinem Inneren. Sämtliche Gesichtszüge entglitten ihm. »Du machst Witze!«
»Sehe ich aus wie jemand, der darüber Witze machen würde?«
»Mira und eine Waffe Lykaons?« Nein! Die Erste Waffe Lykaons auch noch. »Das ist absurd!«
Mira war eine treue Kampfmagiern der Vereinten Fürstentümer Makhais. Ihre Loyalität hatte sie dazu verleitet, frühzeitig den Ritus zum Sturmfürsten zu begehen und dann sollte ausgerechnet sie sich auf eine Tändelei mit dem Feind eingelassen haben? Vielleicht sogar die Seite gewechselt haben? Was für ein schlechter Witz!
Samas schüttelte mehrfach den Kopf. »Ein Zweckbündnis? In Ordnung, aber das? Dieser Garm hat das bestimmt falsch verstanden. Wie sicher können wir uns sein, dass das nicht Teil einer ausgeklügelten Manipulation ist?«
Viele nachfolgende Herzschläge lang herrschte eine sehr ungemütliche Stille im Raum. Jedem musste klar sein, was das als Konsequenz nach sich zog, sollte dieser Bericht der Wahrheit entsprechen. Begriffe wie Hochverrat und Schafott kamen ihm in den Sinn. Schlimmer noch. Wenn das stimmte, dann bekam Miras Anwesenheit in Lykosura einen völlig neuen Beigeschmack. Einen, bei dem es Samas eiskalt den Rücken hinab lief.
»Wer weiß noch davon?«
Cailin sank auf den nächstbesten Stuhl. »Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ganz Makhai davon spricht.«
Der Gardist winkte ab. »Gerüchte lassen sich nicht verhindern. Absolut gewiss ist auch nur, dass Mira nach Lykosura gebracht wird. Ob freiwillig oder nicht, ist im Augenblick nur von zweitrangiger Bedeutung.« Er suchte eindringlich Cailins Blick. »Du solltest dich auf Forderungen gefasst machen.«
2
Sturmmeer
MIRA Nur das leise Knarzen des Holzes, welches sich unter der Last des Wellengangs bog, durchbrach die anhaltende Stille. Lange konzentrierte sich Mira allein auf diesen Klang, um wenigstens für eine Zeitlang ihren Gedanken zu entfliehen. Erwacht war sie schon vor einiger Zeit, doch stellte sie sich noch immer schlafend, weil sie nicht bereit war, sich dem Unvermeidlichen zu stellen. Langsam näherte sie sich aber dem Punkt, an dem weiteres Ausharren lächerlich wurde. Schließlich wusste sie, dass er anwesend war. Genauso wie er wissen musste, dass sie längst nicht mehr schlief.
Und doch füllte Schweigen den Raum zwischen ihnen. Was sollte es auch zu sagen geben? Sie wusste, wo sie sich befand. Auf einer Fregatte der Schwarzen Flotte und damit auf dem Weg in die nächste Gefangenschaft.
Pheros, Erste Waffe Lykaons und oberster General der Schwarzen Streitmacht, hatte sie gefangengenommen.
Bedingungslos, mit Leib und Seele, hatte sie sich auf ihn eingelassen, obwohl sie es hätte besser wissen müssen. Zu gut erinnerte sie sich an die vielen kostbaren Momente mit ihm. An sein Lachen, das er so selten mit anderen teilte. An all die Gespräche über Erea und die Götter. An seine Nähe, die sich so tief in ihr Herz gebrannt hatte, dass allein die Erinnerung daran Schmerz auslöste. Mira wusste noch zu gut, wie es sich anfühlte, mit dem Klang seines Herzschlags an ihrem Ohr einzuschlafen. Wie mühelos er das Gefühl der Sicherheit in ihr zu wecken vermochte. Wie leicht es gewesen war, Pflicht und Vernunft in seinen Armen zu vergessen.
Allen Vorurteilen zum Trotz war Zuneigung zwischen ihnen erwachsen. Deshalb suchte ihr Herz so verzweifelt nach einer Erklärung, warum er sie dennoch nach Lykosura brachte. Sie fand aber nur jede Menge Zweifel und eine namenlose Angst, die bereits tiefe Wurzeln schlug. Geschürt von dem immer wiederkehrenden Alptraum, in dem grausame Drachenaugen sie verfolgten.
Ewig konnte sie hier aber nicht liegen und in ihrem Kummer baden. Am Ende ertrank sie noch darin. Dabei lag es nicht in ihrer Natur, sich der Ohnmacht einer ausweglosen Situation zu ergeben. Sich darauf besinnend, öffnete Mira ihre Lider und richtetet sich langsam auf. Erst als sie saß, lenkte sie den Blick in seine Richtung.
Schwarze Stiefel, von denen sie wusste, dass sich immer ein Dolch darin verbarg. Übergehend in eine ebenso schwarze Hose, Waffengurt und Weste. Die maßgefertigte, leichte Panzerung einer Waffe Lykaons. Vornübergebeugt, die goldrot glühenden Drachenaugen auf sie gerichtet.
Verderben.
Das Wort hallte endlos wider in ihren Gedanken. Mira fiel das Atmen schwer. So weh tat es, ihn auch nur anzusehen. Schmerz und Wut rangen um die Oberhand, doch beides brachte sie nur dem Rand der Verzweiflung nahe. Also wandte sie sich ab, verschloss ihr Herz und ihre Seele vor der Dunkelheit, die sie ohne jeden Zweifel erwartete.
Wie weit sie inzwischen vom Festland entfernt sein mochten?
Wie lange ruhte sie schon hier in dieser Kajüte, betäubt von dem Pfeil, der sie in die Knie gezwungen hatte? Wer hatte ihn abgefeuert? Einer seiner Geschwister?
Bei den Fenstern angekommen, hob sie die Hand, um eines davon zu öffnen. Auf halbem Weg hielt sie jedoch inne, da ihr das neue Armband auffiel. Obsidian-Fesseln.
Nicht schon wieder ...
»Wie lange war ich bewusstlos?«, fragte sie in gefasstem Tonfall und ohne ihn dabei anzusehen. Dann öffnete sie das Fenster. Salzige Meeresluft schlug ihr entgegen und offenbarte einen grauen Morgenhimmel. Einen Moment lang spielte sie mit dem Gedanken zu springen. Ohne ihre Magie kam sie nur nicht sehr weit und so eine gute Schwimmerin war sie nicht, um es darauf ankommen zu lassen. Welche Route nahmen sie eigentlich? Das Sturmmeer konnte es nicht sein, oder wagten sie es doch? Während der Wintermonate galt diese Passage als reinste Todesfalle.
»Ein paar Stunden«, antwortete er, was ihr Herz stolpern ließ. Gerade so unterdrückte sie den Impuls, sich nach ihm umzudrehen.
»Mira –«, setzte er an, doch sie fiel ihm direkt ins Wort.
»Nein!«
Wut und Schmerz schwangen in jeder Silbe mit, noch bevor sie es hätte aufhalten können. Schon waren ihre Pläne über den Haufen geworfen. Nur, weil er ihren Namen sagte. Es versetzte ihr einen Stich und sie ließ es ihn sehen, weil sie nicht stark genug war, ihm mit Kälte zu begegnen.
»Sag mir nicht, du hättest keine Wahl gehabt. Erspar mir diese Lüge und lass uns doch lieber bei den Tatsachen bleiben.« Zur Verdeutlichung hob sie ihr Handgelenk mit dem Obsidian. »Naive Idealistin. So hast du mich genannt. Jetzt sehe ich, was du immer in mir sahst. Jetzt verstehe ich, wie recht du damit hattest. Danke für diese wertvolle Lektion, General!«
So viel mehr wollte sie ihm sagen, doch nun drohte ihre Stimme zu versagen. Also wandte sie sich wieder ab und starrte hinaus auf das Wasser. Raue Fingerkuppen umfassten ihr Kinn, sachte und dennoch bestimmend, um ihr Gesicht zu sich zu drehen. Jetzt blickten ihr keine Drachenaugen entgegen, nur das schmerzlich vertraute Dunkelblau. Mira bekämpfte mit aller Willenskraft, was seine bloße Nähe, diese Berührung und seine Stimme in ihr auslösten.
»Du hast jedes Recht, mich zu hassen, aber glaube nicht auch nur einen Augenblick lang, dass irgendetwas davon gespielt war. Es war echt, Mira. Und ... das ist es noch immer.« Er atmete einmal tief durch und fügte leiser hinzu: »Für mich ist es das noch immer.«
Sie entzog sich ihm und trat kopfschüttelnd zurück. »Für mich nicht. Nicht mehr.«
Er sah sie an, als hätte sie ihm ins Gesicht geschlagen. Sie ließ nicht zu, was das mit ihr machte. Nie wieder dürfte sie ihrem Herzen nachgeben, das sich trotz allem so unbedingt in seine Arme stürzen wollte.
Nie wieder!
Lange sahen sie einander einfach nur an. Für Mira fühlte es sich an, als stünde sie auf scharfkantigen Glasscherben. Jede einzelne davon schnitt schmerzlich tief in ihre Haut. Was auch immer sie gewesen sein mochten, blieb zurück in Raquia. Jetzt standen sie wieder am Anfang, als Feinde.
3
PHEROS
Lykaja reichte Pheros einen Schlauch mit Wein, bevor sie sich zu seiner Rechten niederließ. Sie befanden sich im Bug des Schiffs. Genetor lehnte ihm gegenüber an der Reling, die geliebte Axt in seinen Armen haltend. Inzwischen hielt die Nacht Einzug über dem Sturmmeer und die Zwillinge schienen hell am Himmel. Wenigstens versprach es eine ruhige Nacht zu werden mit nur leichtem Wellengang.
»Sprich mit uns«, bat Lykaja leise, wobei sie dafür bewusst das Arkad wählte.
»Was wollt ihr von mir hören, dass ihr nicht längst wisst?«, erwiderte er. Sie waren doch dabei gewesen und hatten gesehen, wie sehr es ihm zugesetzt hatte, Mira auf das Schiff zu bringen. Jeder Schritt hatte sich angefühlt wie der Gang zum Schafott. Nun saß er hier, stundenlang schweigend, nachdem er bei Mira gewesen war.
»Liebst du sie?«, fragte Genetor. Ein Schlag ins Gesicht wäre gnädiger gewesen als diese Worte.
Lykaja stieß Genetor mit der Stiefelspitze an. »Gen!«
Der räusperte sich unbeholfen. »Ja, ich meine ja bloß ... Du bist doch ... Also ... Ich habe dich nie so ...« Die Worte stolperten nur so aus ihm heraus. Lykajas tadelnder Blick brachte den Zorn Lykaons schließlich zum Schweigen.
Von klein auf kannten sie ihn als unerschrockenen Anführer. Als großen Bruder, der nie schwankte. Der Pragmatist, der immer einen Plan hatte. Jetzt saß er hier, tief in sich versunken und etwas bedauernd, das keiner von ihnen jemals für möglich gehalten hätte. Am allerwenigsten er selbst.
Für mich nicht. Nicht mehr ...
Ihre Worte hallten in ihm nach und hinterließen ein Brennen in seinem Herzen. Er hatte sie wirklich verloren. Wie sollte sie ihm das jemals verzeihen? Wie ihm jemals wieder vertrauen?
»Es spielt keine Rolle mehr«, sprach er mit dem typischen Pragmatismus eines Feldherren, der wusste, wann eine Schlacht verloren war. Er legte den Kopf in den Nacken, um ziellos zu den Sternen hinaufzublicken. »Es war von Anfang an zum Scheitern verurteilt.«
Das sagte er sich selbst immer wieder, doch im Grunde glaubte er nicht daran. Dafür empfand er zu viel für sie. Er wollte sie nicht aufgeben. Der Krieger in ihm akzeptierte diese Niederlage nicht und so drehten sich seine Gedanken ewig im Kreis, auf der Suche nach einem Weg, doch noch zu siegen.
Lykajas Hand fand unvermittelt seine Wange. Eine sanfte Berührung, die ihm die Bitte vermittelte, Einlass in seine Gedanken zu gewähren. Pheros nickte knapp. Diesmal waren es keine Worte, die sie flüsternd von Geist zu Geist transportierte, sondern Bilder. Seine Schwester zeigte ihm ihre Reise durch Oblyvar. Durch ihre Augen sah er erneut die Arena und den Palast. Diesen verhassten Ort der Grausamkeit. Auch ohne ihr Zutun konnte er den kratzigen Sand auf seiner Haut spüren und das viele Blut, das an seinen Händen klebte ...
Lykaja erlaubte ihm nicht, allzu lange in diesen Erinnerungen zu verweilen, denn sie führte ihn bereits weiter. Fragmente von Gefühlen und Worte, die jetzt seine Gedanken füllten, waren seine eigenen. Bruchstücke seiner Reise, die sie durch die Berührung ihrer Hände aufgelesen hatte. Pheros erkannte den Divan im Palast der Herrscherin. Hier hatte sich ihr offenbart, dass die Beziehung zu Mira sich zu verändern begann.
Es war in jener Nacht passiert, als Mira seine Narben entdeckt und verstanden hatte, dass die Waffen Lykaons einen hohen Preis für ihre Kampfkunst bezahlten. Da hatte sie ihre ersten Vorurteile ihm gegenüber abgelegt und begonnen, den Mann zu sehen und nicht nur die Legende, zu der die Bardenlieder ihn gemacht hatten. Wenn er sich an dieser Stelle nur anders verhalten hätte, wären sie heute nicht in dieser Situation. Würde er alles anders machen, wenn er das Rad der Zeit zurückdrehen könnte?
Nein. Würde er nicht, denn dann hätte er nie erfahren, wie es war, mit Mira zusammen zu sein. Er hätte nie gewusst, wie gut es sich anfühlte, wenn ihre Finger liebevoll durch sein Haar strichen. Wie süß ihr Kuss schmeckte. Wie viel Wärme in einem einzigen Lächeln von ihr lag und wie sehr er es vermisste, sobald es schwand. Er hätte auf all die humorvollen, unerschrockenen, unerwarteten, ihn herausfordernden und so überaus kostbaren Augenblicke verzichten müssen.
Zeigte ihm Lykaja deshalb all diese Momente? Damit er Klarheit darüber erlangte, ob ein Kampf sich lohnte? Bevor er tiefer in diese Überlegungen eintauchen konnte, zog Lykaja ihn weiter. Zurück zum Tal am Fuße eines Gebirges. Weiter noch bis zu jenem Moment, als Genetor und Lykaja hinzugekommen waren, während die eigenen Soldaten Mira umkreist hatten. Die Bogenschützin ließ ihn wissen, dass sie den Betäubungspfeil, den sie auf die Magierin abgefeuert hatte, nicht bedauerte. Nicht die Tat, denn sie hatte damit Schlimmeres verhindert. Was sie bedauerte, war sein Kummer.
Sacht schüttelte Pheros den Kopf, um ihr die Sorge zu nehmen, er könne es ihr übelnehmen. Er war es, der zugelassen hatte, dass Mira derart tief in sein Herz vorgedrungen war. Er war es, der sich leichtsinnig verhalten hatte und nun den Preis dafür bezahlte. Etwas an diesem Gedanken, den er ungefiltert mit seiner Schwester teilte, schien ihr jedoch zu missfallen.
Er kam nicht mehr dazu, diese Regung zu hinterfragen, da schlagartig ein unnatürlich starker Wind an ihnen zerrte. Irritiert löste Lykaja die Verbindung, indem sie die Hand von seiner Wange nahm. Alle drei Waffen Lykaons erhoben sich gleichzeitig.
»Vielleicht hätten wir doch eine andere Route nehmen sollen«, murmelte Lykaja, den Kopf in den Nacken legend. Pheros folgte ihrem Blick. Direkt über ihnen zogen sich dunkle Wolken zu einem Knoten aus Regen und Wind zusammen. Er erkannte es am schwindenden Licht der Zwillinge. Es war, als stürzten sie in eine tiefe Finsternis. Haltlos und bodenlos. Ein ohrenbetäubender Donner eilte den Blitzen voraus, die ungezähmt über den Himmel zuckten.
»Holt die Segel ein!«, rief Keenan irgendwo im Hintergrund. Im Augenwinkel sah Pheros ihn über das Deck auf sie zu schreiten. Der Drake in ihm erwachte und manifestierte sich sichtbar in seinen Augen. Etwas stimmte nicht. Das alles ging viel zu schnell. Eben noch friedlich dahingleitend, befanden sie sich jetzt mitten im Chaos. Da war Magie im Spiel, aber die einzige Magierin an Bord ... war Mira.
Das Obsidian verhinderte die Anwendung ihrer angeborenen Kräfte. Das galt jedoch nicht für den Sturm.
Eine hohe Welle brachte das Schiff zum Schwanken. Pheros taumelte gegen die Reling und sah sich schon ins Wasser stürzen, als sich das Schiff doch wieder in die Gerade erhob. Dicht gefolgt von einer weiteren Welle, die über das Deck spülte.
»Wir werden angegriffen!«, rief Genetor, der sich ein Seil schnappte, um sich daran festzuhalten. Rufe wurden laut, während die Mannschaft versuchte, Herr der Lage zu werden. Genetor hatte recht. Sie wurden von irgendetwas oder irgendjemandem attackiert, aber das konnte nicht Miras Werk sein. Mehr als sein Herz verriet ihm das seine Nase. Nach all der Zeit mit der Sturmfürstin als Verbündete und Geliebte war ihm ihr Geruch in Mark und Bein übergegangen. Auch der ihrer Magie.
Es lag immer eine bestimmte Duftnote in der Luft, wenn Magie gewirkt wurde. In Miras Magie steckte etwas sehr Reines und Ursprüngliches. Es erinnerte ihn an ein Sommergewitter.
Die Magie, die jetzt in der Luft hing, stank hingegen faulig nach Moder und Verderben. Auch dieser Geruch war ihm nicht fremd. Nicht mehr, denn während ihrer langen Flucht aus Oblyvar hatten sie es ein paar Mal mit den Magiern der Namenlosen zu tun gehabt. Einem längst ausgelöscht geglaubten Orden von Fanatikern, die glaubten, dass der Weltenbrand allein die Welt retten konnte.
»Bei allen Höllen!«, fluchte Pheros. Das hier trug deren Handschrift. Da war er sich absolut sicher.
»Wer greift uns an?!«, rief Lykaja über den Lärm der tosenden Wellen hinweg.
»Es stinkt!«, brüllte Genetor.
Lykaja schickte sich an, zu ihm zu gelangen, wodurch sie ihren Halt an der Reling aufgab. Genau in diesem Moment bemerkte Pheros im Augenwinkel die nächste hohe Welle.
»Lya nicht!«
Doch das Wasser hatte sie längst erreicht. Pheros musste hilflos mitansehen, wie seine Schwester erst gegen ein paar festgebundene Fässer taumelte und dann mit der Wucht über Bord gespült wurde. Etwas hielt sie jedoch zurück. Als zöge eine unsichtbare Macht an ihr, flog sie direkt in Genetors Reichweite, der sie sofort an sich zog. Gemeinsam klammerten sie sich an den Hauptmast.
Ein Sommergewitter inmitten eines Seesturms mischte sich in den modrigen Geruch des Todes und Pheros’ Herz setzte einen Schlag aus.
Mira!
Sein Blick flog zum Oberdeck und tatsächlich stand sie dort. In ihren Augen tanzte der Sturm. Verbissen kämpfte sie gegen das an, was auch immer das Schiff angriff. Pheros wollte gar nicht erst so tun, als verstünde er, was hier geschah und auf welche Weise sie dagegen anging. Er wusste nur, dass sie es tat. In den Augen seiner Soldaten musste es jedoch ganz anders wirken. Verunsichert starrten sie ihn an.
»Sollen wir irgendwas umbringen?«, donnerte Genetors Stimme über das Krachen der Wellen hinweg.
Pheros schüttelte entschieden den Kopf. »Festhalten und Mira nicht in die Quere kommen!«
Vereinzelt fing er ein Nicken ein. Er musste sich darauf verlassen, dass sein Befehl die Runde machte. Mehr als irgendwo Halt zu finden, erschien ohnehin nicht möglich. Nicht bei diesem Wellengang. Er selbst machte sich auf den Weg zu ihr. Nur sehr langsam kam er voran, doch als er sie endlich erreichte, konnte er erkennen, was sie tat. Ihre Hände bewegten sich unaufhörlich, in einstudierten Bewegungsabläufen, die abwechselnd einen Schild oder Windstoß erzeugten. Für den Schild hob sie drei Finger hoch. Mit der anderen formte sie eine flache Hand, die sie zurückzog, parallel zur anderen, als würde sie einen Bogen spannen. Die Technik der Kampfmagier, defensiven und aktiven Energien eine Form zu verleihen. Pheros erinnerte sich. In der Abgeschiedenheit des Drachengebirges, als sie damit begonnen hatten, einander zu trainieren, dürfte er zum ersten Mal ein paar dieser Techniken sehen.
Direkt neben ihr stehend fragte er: »Was soll ich tun?«
Sie sah ihn nicht an und schüttelte nur den Kopf. Beiläufig musste sie den Haftzauber erweitert haben, der sie an Deck hielt. Pheros erkannte die magischen Silberfäden, die sich um ihre Fußknöchel rankten, sich jetzt auch um seine Beine schlängelten.
Wasser und Wind peitschten ihnen erbarmungslos entgegen. Er schmeckte Salz auf den Lippen und verfluchte die Untätigkeit, zu der er verdammt war.
Eine Mischung aus Stolz und Sorge flammte in seiner Brust auf. Vollkommen beherrscht und konzentriert wirkte sie mehr denn je wie eine Sturmfürstin aus den Legenden. Nur unterlag die Macht einer solchen Naturgewalt einem empfindlichen Gleichgewicht und Mira war noch zu jung, um diese Magie gefahrlos zu lenken. Mit wachsender Angst beobachtete er, wie ihre Haut an den Händen und Armen feine Risse bekam. Wie immer, wenn sie zu viel aus dieser uralten Quelle schöpfte.
»Mira!«
Sie ignorierte ihn.
»Du musst aufhören!«
Sie beachtete ihn auch weiterhin nicht, weshalb er nach ihren Schultern fasste, um sie notfalls dazu zu zwingen, damit aufzuhören.
Einen Herzschlag später durchbrachen sie eine Art unsichtbare Barriere. Pheros spürte den Ruck, der das gesamte Schiff erfasste, bevor es schlagartig auf ruhiger See weitertrieb. Als wäre nie etwas gewesen, ragten jetzt Sterne und Monde wieder über ihnen auf. Ihr Licht spiegelte sich auf der ruhigen Wasseroberfläche. Fast schon sanft strich der Wind über sein Gesicht. Prüfend warf er einen Blick über die Schulter, wo der Sturm noch immer tobte und ein sehr bizarres Schauspiel darbot. Als hätten sie eine große, wütende Glaskugel verlassen, in der noch immer dieser Wirbel aus Wasser und Wind wütete, der sie beinahe zerrissen hätte.
Was bei allen neun Höllen?!
Plötzlich fiel der Haftzauber von ihm ab. Miras Schultern entglitten ihm und sie sank kraftlos auf die Knie. Pheros folgte ihr, erneut nach ihr greifend, aber sie entzog sich ihm. Klemmte sich beide Hände unter die Achseln und schloss die Augen, während sie sich in den Schneidersitz begab. Auch diese Übung beobachtete er nicht zum ersten Mal an ihr. Daher wusste er, dass sie gerade all ihre Konzentration darauf aufwendete, den Sturm zurückzurufen, bevor es sie zerfetze. Stellenweise glühte ihre Haut noch und sie zitterte am ganzen Leib.
»Sie wissen, dass wir Raquia verlassen haben«, sprach sie unvermittelt, die Augen noch immer geschlossen.
»Wer?«, fragte Genetor, der zusammen mit Keenan und Lykaja das Oberdeck betrat.
»Die Kinder des Namenlosen«, antwortete Pheros, wobei er Mira nicht aus den Augen ließ. Höllen! Er wollte sie so unbedingt in seine Arme ziehen und halten. Erst, als das Glühen unter ihrer Haut verschwand und sie endlich ihre Augen aufschlug, wich die Anspannung auch aus seinem Körper.
»Glaubst du immer noch, dass es ihnen nur darum geht, die Führung unserer Reiche zu destabilisieren? Weißt du, was es braucht, um einen solchen Zauber zu wirken?« Sie schnaufte und atmete dann wieder ruhiger weiter. »Diese Angriffe sind persönlich orientiert, Pheros. Ich habe den Hass in diesem Zauber gespürt.«
Keenan rieb sich mit dem Daumen über die Stirn. »Aber wer könnte es persönlich auf euch abgesehen haben?«
Genetor grunzte und kreuzte die Arme vor der Brust. »Wer nicht?«
»So meinte ich das nicht«, korrigierte sich der Hauptmann rasch. »Wenn der politische Aspekt ausgeschlossen ist, was bleibt dann noch? Wer von den Namenlosen könnte es auf euch persönlich abgesehen haben? Und warum?«
Pheros konnte den Blick nicht von Mira abwenden. »Mira hat eine Basis der Namenlosen zerstört. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das sehr persönlich genommen haben.« Ob das Grund genug war, einen solchen Angriff auszuführen, konnte er nicht sagen.
»Sie ist verletzt«, merkte Lykaja an.
Mira schnaufte nur und deutete auf den Obsidian an ihrem Handgelenk. »Sie hätte das auch ohne die Macht des Sturms hinbekommen, aber das Imperium versteht sich bestens auf unliebsame Willkommensgeschenke.«
Genetor räusperte sich rasch, um sein Auflachen zu kaschieren. Lykaja verzog hingegen keine Miene und Pheros schluckte die Schuldgefühle herunter, die ihn zu ersticken drohten.
Suchend wanderte sie mit den Augen über das Deck, bevor sie ihn gezielt ansah. Sie warnte ihn. Es war noch nicht vorbei.
Zwei Herzschläge später erklang ein gespenstisches Flüstern. Der Singsang von tausend Stimmen, die sich zu einem Chor verdichteten. Pheros versuchte, genauer hinzuhören, aber die Laute ergaben keinen Sinn.
»Was für eine Scheiße!«, rief Genetor. Fest umschloss er den Griff seiner Streitaxt. »Versteht das einer? Was kommt jetzt?«
Auch Lykaja wirkte alarmiert. »Die Stimmen klingen ... verzweifelt.«
»Als würde man in einem Grab stehen«, sprach Keenan leise, mehr an sich selbst gewandt. Genetor sah sich gehetzt um. »Geister?« Die Tonlage eine ganze Oktave höher.
Pheros legte die Stirn in Falten, bevor er Miras Blick wieder einfing. Er musste die Frage nicht erst formulieren, die ihm auf der Zunge lag. Leicht neigte sie den Kopf zur Seite, um den Stimmen besser lauschen zu können. Ein erneutes Aufblitzen des Sturms in ihren Augen verriet ihm, dass ihr nicht gefiel, was sie da hörte. Ein tiefer Atemzug folgte, bevor sie übersetzte: »Du wirst im Blut deiner Sünden ertrinken ... Tod ... Tod der Ersten Waffe Lykaons.«
4
Zwei Wochen später
Lykosura, Hauptstadt
MIRA
Die Tage nach dem Angriff verstrichen ereignislos. Da man ihr ein gewisses Maß an Wohlwollen entgegenbrachte, nachdem sie allen das Leben gerettet hatte, dürfte sie an Deck spazieren gehen. Nur hielt sich Pheros meistens dort auf, weshalb sie der Kajüte den Vorzug gab. Das Atmen fiel ihr schwer in seiner Nähe. Egal, was sie sich einzureden versuchte und wie hart sie sich um mehr Gleichgültigkeit bemühte, der Schmerz blieb ihr ständiger Begleiter. Ebenso wie diese leise, verräterische Sehnsucht, die immer dann erwachte, wenn sie an ihn dachte. Jetzt kam auch noch die Sorge um sein Leben hinzu. Die Namenlosen hatten es ganz persönlich auf ihn abgesehen. Gleichzeitig schalt sie sich selbst eine Närrin. Sich Sorgen um den Feind zu machen, hatte sie überhaupt erst in diese Lage gebracht.
Nachts schmerzte die Sehnsucht am schlimmsten, da sie so sehr an seinen Herzschlag an ihrem Ohr gewöhnt war. Bei Tag gab es wenigstens Ablenkungen und nach dem dritten vergeblichen Versuch gab Pheros es auf, das Gespräch zu suchen. Nach diesem letzten Vorstoß kam nur noch Keenan zu ihr, der Hauptmann mit den freundlichen braunen Augen. Oder Daria, die sich als seine Stellvertreterin vorgestellt hatte. Dunkelbraune Haut, schwarzes Haar und eisblaue Augen verliehen der Soldatin ein höchst seltenes Aussehen, exotisch sogar. Jedenfalls für jemanden, der aus Makhai stammte.
Mira sah keinen Grund, unfreundlich zu werden, da beide ihr respektvoll begegneten. Daria lieh ihr sogar ein Buch, damit sie die Zeit unter Deck totschlagen konnte. Offenbar waren beide Soldaten gerngesehene Besucher der Palastbibliothek Lykosuras. Den Zugang dazu hatten sie Pheros zu verdanken. Generell sprachen beide Soldaten immer sehr respektvoll von ihm.
Nachdem Mira das Buch ganze zweimal gelesen hatte – es handelte sich um einen Märchenband – ging sie dazu über, in den Truhen zu stöbern, die im Raum herumstanden. Eine davon beinhaltete alle Habseligkeiten aus dem Haus in den Bergen. Von den gestohlenen Kochtöpfen bis zu den Fellen und sogar dem Kartenspiel, für das sie Pheros hatte begeistern können. Lange konnte sie nur nicht darin kramen. Es erinnerte sie zu sehr an die gemeinsame Zeit.
Nun stand sie am Fenster und blickte der Stadt entgegen, die immer größer wurde. Das Zentrum jenes Reichs, dass so viele Königreiche Ereas unterworfen hatte.
Was den Zustand der Hauptstadt anging, kursierten sehr viele Gerüchte und die wenigsten waren schmeichelhaft gemeint. Das galt aber auch für die berühmtberüchtigten Sieben Waffen Lykaons.
Bald schon würde sie Wahrheit von Lüge trennen können. Damit kam sie auch zurecht. Womit sie weniger gut zurechtkam, war der Imperator selbst. Insgeheim fürchtete sie ihn. Unmöglich einzuschätzen, waser mit ihr vorhatte, oder ob sie diese Begegnung überhaupt überleben konnte ...
Miras Gedanken verstummten, als die Erste Waffe Lykaons sich der Kajüte näherte. Seine Schritte erklangen vor der Tür. Sie wusste immer, wenn er sich näherte. Nach all der Zeit hatte sie so etwas wie ein Instinkt für ihn entwickelt.
»Cailin wird nicht einlenken. Lykaon wird mit mir nur seine Zeit verschwenden«, sprach sie aus, was ihr als Erstes in den Sinn kam, nachdem er eingetreten war. Dabei behielt sie die Augen auf das Wasser gerichtet.
»Das erste Wort, das du nach Tagen an mich richtest und dann gilt es dem Imperator?«
Mira zuckte mit den Schultern. »Erscheint mir angemessen, wenn man bedenkt, für wen du mich zur Schlachtbank führst.«
Er erwiderte nichts darauf. Dafür berührten raue Fingerspitzen ihre Hand. In vertrauter Weise fuhr sein Daumen über die dünne rote Linie auf ihrem Handrücken. Die Risse waren inzwischen zum Großteil verheilt, aber dieser eine würde bleiben und zu einem Schatten auf ihrer Haut verschmelzen. So wie seine, die sich so zahlreich auf seinem Körper befanden. Mira erinnerte sich an jede einzelnen davon.
»Sei nicht impulsiv. Provozier ihn nicht«, raunte er leise, fast schon sanft.
Seine Hand fuhr in ihren Nacken. Mira schloss die Augen und hielt den Kopf gesenkt, um wenigstens die Illusion von Ablehnung aufrecht zu erhalten.
»Sieh mich an«, sagte er leise, mit dieser unter die Haut gehenden Stimme, die sie wahnsinnig machte. Er erhöhte sanft den Druck seiner Hand, so dass sie nachgeben musste. Bedauern und Sehnsucht lauerten im Dunkel seiner Augen, aber auch Entschlossenheit. Mira musste sich daran erinnern zu atmen, als sie die Hände hob und um seine Handgelenke schloss.
»Cailin wird auf nichts eingehen, was der Imperator fordert. Selbst, wenn er droht, meine Überreste in einer Kiste zu ihr zu schicken.«
Er schüttelte den Kopf. »Niemand wird dich verletzen, Mira.«
Sie schwieg und hielt seinem Blick stand, während sie seine Hände langsam, aber bestimmend von ihrem Nacken löste. Es fühlte sich falsch an, mit ihm auf diese Weise umzugehen und doch war es unumgänglich.
Die Hafenglocke erklang und kündigte ihr Einlaufen an. Pheros Hand fand ihren Oberarm, um sie hinauszuführen. Seine beiden Geschwister flankierten sie während des Weges zu den Pferden. Kaum aufgesessen, zog Pheros sie vor sich in den Sattel. Offenbar eine unübliche Handlung, denn die Soldaten tauschten verwunderte Blicke aus. Auch Mira war überrascht. Da sie nicht wusste, wie man hier sonst mit Gefangenen verfuhr, beschloss sie, lieber den Mund zu halten. Schlimmer ging schließlich immer.
Die drei Waffen trieben ihre Pferde an, woraufhin der restliche Trupp aufsaß und ihnen mit Abstand folgte.
In Makhai behauptete man gerne, die Hauptstadt des Feindes sei verwahrlost. Ein Ort, an dem das Chaos wohnte und ein Alptraum den nächsten jagte. Wo Lykaons Waffen wie Monster durch die Straßen streiften und sich am Blut Unschuldiger labten. Schmutzig und von allen guten Göttern verlassen.
Wahrscheinlicher war, dass keiner dieser Geschichtenerfinder jemals hier gewesen sein konnte, denn die Hauptstadt des Reichs erstrahlte als blühendes Juwel der Ordnung. Fast schon zu akkurat angeordnete Gebäude und Gassen. Als habe jemand eine Skizze der Stadt angefertigt und diese dann genau so, Stein für Stein, in die Welt gesetzt. Alles ordnete sich in regelmäßigen rechteckigen Rastern auf.
Der Imperator verachtete Makel jeder Art. Die Ordnung und Sauberkeit, die hier vorherrschten, passten also in das Profil des Mannes, der selbst bei seinen Waffen die offensichtlichsten Narben verschwinden ließ.
Auffallend oft wiederholten sich die blauen Dächer mancher Gebäude. Rund und kuppelartig wie bei den Elfen, nur gab es hier deutlich mehr Ecken und Kanten zu entdecken. Zahlreiche Gärten und Bauten aus massivem, hellem Stein dominierten das Stadtbild. Zur Landseite hin wurde die Stadt komplett von einer hohen Mauer umschlossen. Entlang dieser Mauer gliederten sich in regelmäßigen Abständen Wachtürme ein, die gewaltige Trommeln beherbergten, um einen raschen Informationsfluss zu gewährleisten. Trommeltürme gab es überall in Erea, aber die Größe dieser hier beeindruckte selbst sie. Wie auf Befehl erklangen die Trommeln in einem sich wiederholenden Rhythmus.
»Ha!«, stieß Genetor hervor, der zu ihrer Linken ritt. Er grinste zufrieden vor sich hin.
»Willkommen zu Hause«, übersetzte die Bogenschützin.
»Hat ja auch lang genug gedauert«, ergänzte Genetor.
Mira musste zugeben, doch ein wenig fasziniert zu sein. In diesem Teil der Welt achtete man die Waffen Lykaons. Man machte ihnen Platz, wenn sie kamen und neigte sogar das Haupt zum Gruß. Keine Furcht in den Augen der einfachen Leute. Nur Respekt und Anerkennung.
Miras Gedanken verstummten, als der Blaue Palast vor ihnen aufragte. Das wohl eindrucksvollste Gebäude der gesamten Stadt. Von hohen Säulen getragen und einer weiteren Mauer umgeben. Jeweils ein Turm an jeder Kante des rechteckigen Grundrisses. Mira erinnerte sich an Pheros’ Beschreibung. Demzufolge teilte sich das Innere des Palastest in vier Bereiche auf, das von einer Quer- und Längsstraße getrennt wurde. Im Zentrum erhob sich die große blaue Kuppel, in dem sich der Hauptwohntrakt befinden musste.
Kein einziges schwarzes Banner, weder in der Stadt, noch am Palast. Nicht mal über dem gewaltigen Torbogen, der zum Innenhof führte.
»Haben die Farben der Adelshäuser hier ebenso eine Bedeutung wie im restlichen Erea?«
»Es gibt hier keine Adelshäuser wie in Makhai. Also auch keine Farben«, antwortete ihr Pheros.
Das ergab Sinn. Sie wollte ihn etwas anderes fragen, aber dann überkam sie ein eigenartiges Gefühl der Vertrautheit und sie hielt unwillkürlich inne, um tief in sich hineinzuhören. Einen Moment später erkannte sie es. Noch ein Sturmfürst! Aber wie konnte das sein? Wie konnte es in Lykosura Sturmfürsten geben? Das war unmöglich! Und doch ... spürte sie ... ihn. Irgendwo in der Nähe.
Mira ...
Er flüsterte in ihre Gedanken und etwas in dieser Stimme löste eine Gänsehaut bei ihr aus. Sie erschauderte, was Pheros dazu animierte, den Kopf zu neigen, als würde er auf eine weitere Frage warten.
... Willkommen, Himmelstochter.
Unwillkürlich versteifte sie sich. Himmelstochter?
Das leise Knarzen von Leder lenkte ihre Aufmerksamkeit auf Pheros' behandschuhte Hand. Seine Finger schlossen sich um ihre, Sicherheit und Beistand vermittelnd. Einst hatte es ihr alles bedeutet, seinen Schutz zu genießen. Nur befanden sie nicht mehr in Oblyvar und er war nicht länger ihr Anker in einer Welt voller verrückter, intriganter Dunkelelfen, die sie entweder töten oder versklaven wollten.
Den Hof des Palastes erreicht, sprang Pheros vom Pferd, bevor er auch sie aus dem Sattel hob. Jemand kam und nahm ihnen die Pferde ab.
»Komm.« Pheros nickte in Richtung Palast. Mira folgte, während ihr Blick schweifend die Umgebung einsog. Genetor und Lykaja schritten voran. Pheros ging dicht neben ihr, immer eine Hand auf ihrem Rücken. Zunächst steuerten sie eine kunstvoll mit Ornamenten verzierte Flügeltür an. Palastwachen in weißen Roben und silbernen Masken nickten ihnen zu. Über eine lange Straße ging es weiter bis zum Hauptgebäude im Zentrum dieses Kunstwerks von einem Palast. So viel Grün! Und Blumen. Gärten und Brunnen! So viele Gerüche. Erst süß, dann fruchtig und dann wieder herber. Kräuter? Gab es hier etwa auch Kräutergärten? In einem Palast! Das leise Plätschern von Springbrunnen drang an ihr Gehör. Gedämpfte Stimmen und leises Lachen.
Pheros’ Finger schlossen sich um ihren Oberarm, während er sie mit sachter Bestimmtheit lenkte. Hier und da traten Leute in einfacher Kleidung an ihnen vorbei. Mira bemerkte keine Sklavenhalsbänder.
Innerhalb des Hauptgebäudes betraten sie einen langen Flur. Feuerschalen thronten auf niedrigen Säulen. Mehrere Flügeltüren verbargen sich dazwischen. Keine Wachen. Vor keiner der Tür.
Anders als erwartet brachte Pheros sie nicht in den Thronsaal. Stattdessen betraten sie einen weitläufigen Raum, der Schriftrollen und allerhand von der Decke hängende Modelle barg. Bücher stapelten sich an manchen Stellen menschenhoch. Der zarte Duft von Lavendel und Orangen hing in der Luft. Irgendwo musste eine Tür offenstehen, denn ein leichter Durchzug zupfte an ihren Haaren.
»Er erwartet euch im Garten«, erklang eine Frauenstimme, was Miras Blick von den Objekten weg und zu einer jungen Frau hinlenkte, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Soldatin Daria aufwies. Dieselbe Hautfarbe, Augen und Haare. Ähnliche Gesichtszüge. Genetor blieb bei ihr stehen, während Pheros sie an ihnen vorbeiführte. Mira gab sich alle Mühe, auch weiterhin eine Miene des Gleichmuts aufrecht zu erhalten. Sie war nicht gerade in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, doch wenn man so lange von der Dunkelheit Lykosuras hörte, begann die Fantasie ganz eigene Wege zu gehen und nichts von der Schönheit, die sie bisher erblickte, passte zu dem, was sie sich ausgemalt hatte.
Plötzlich beschleunigte Lykaja ihre Schritte. Ein Mann mit schwarzem Haar und blauen Augen schloss sie fest in die Arme.
»Du hast dir ganz schön Zeit gelassen, ihn zu finden«, beschwerte er sich.
Dank Pheros verfügte sie über eine wahrheitsgetreue Beschreibung seiner Geschwister. Dieser Mann musste Tegeates sein. Dann dürfte der andere Schatten nicht weit sein. Asea. Die kleinste von ihnen, mit schwarzen, glatten Haaren, die ihr bis zum Kinn reichten, trat nun ebenfalls dazu. Sie schälte sich einfach aus dem Schatten einer Hecke.
»Nur noch einen Tag länger und wir hätten uns aufgemacht, euch alle zu suchen«, erklärte Asea. »Du hast uns so gefehlt!«, fügte sie an Pheros gewandt hinzu. Dieser löste seine Hand von Miras Arm, um seine Schwester zu begrüßen.
Mira ...
Wieder diese Stimme. Sie lenkte ihren Blick fort von den vieren.
... komm zu mir.
Ohne jede Eile, betrat sie einen gepflasterten Pfad und folgte diesem. Blaue Blumen säumten ihren Weg. Abrupt blieb sie stehen, als sich nur wenige Schritte vor ihr ein kunstvoll verzierter Pavillon auftat. Ein Mann mittleren Alters saß darin. Braunes, kurz geschnittenes Haar hatte er und freundliche blaue Augen. Vornehme Gesichtszüge. So groß wie Pheros, aber deutlich schmaler. Offensichtlich kein Krieger.
»Das sind blaue Lilien«, beantwortete er ihre Frage, ohne dass sie eine gestellt hätte.
Der Mann erhob sich und kam direkt auf sie zu. Verunsichert warf Mira einen Blick hinter sich, aber da war niemand. Wenige Schritte vor ihr pflückte er eine von diesen blauen Lilien und hielt sie ihr hin.
Sie sind nicht giftig, sprach er in ihre Gedanken. Da fiel es ihr wie Schuppen von den Augen und sie wich augenblicklich einen Schritt zurück.
Er war der andere Sturmfürst. Plötzlich schmeckte sie Salzwasser und Gischt auf ihrer Zunge. Ein wassergeborener Sturmfürst auch noch! Aber ... seit Jahrhunderten hatte es keinen solchen gegeben.
Mira tat noch einen Schritt rückwärts und prallte dabei gegen Pheros Brust. Kurz hob sie den Blick in seinen, aber der Mann vor ihr reizte jeden ihrer magischen Sinne, sodass ihre Augen sofort wieder zu ihm zurückkehrten. Dieser lächelte jetzt entspannt und schob sich in lässiger Manier eine Hand in die Hosentasche, während er in der anderen noch immer die Blume hielt. Die blauen Augen richteten sich auf Pheros.
»Sohn.«
Mira wollte am liebsten noch einen Schritt zurückweichen. Die Erste Waffe verhinderte dies, indem er sich nicht vom Fleck bewegte. Sie spürte, wie er den Kopf zum Gruß neigte. »Lykaon.«
Ihr Herz sank. Hatte er gerade Lykaon gesagt?! Der Lykaon, wie in Imperator Lykaon?
Ihre Augen weiteten sich, während ihr Verstand ungewohnt schleppend die volle Tragweite dieser Offenbarung erfasste.
Das war also der Imperator und der Imperator war ein ... Sturmfürst.
Weder erschienen die Waffen als die Monstren, die man sie zu hassen gelernt hatte, noch stand hier ein von Narben entstellter Eroberer vor ihr, der aus den Schädeln seiner Feinde trank.
Wie gebannt musterte sie ihn. Dieser Mann strahlte eine einfangende Freundlichkeit aus. Er plauderte mit Pheros, als wären sie alte Freunde, die sich lange nicht mehr gesehen hatten. Dabei erinnerte Mira sich noch zu gut an die Narben auf Pheros' Rücken. Narben, die dieser Mann ihm zugefügt hatte. Ob nun durch die eigene Hand oder auf dessen Befehl hin, spielte keine Rolle. Dieser Mann brachte seit beinahe sieben Jahrhunderten Krieg über Erea. Mira dürfte sich nicht von seinem freundlichen Äußeren täuschen lassen. Ein Monster stand vor ihr, kein freundlicher Geist!
Lykaon tat einen Schritt auf sie zu. Vorsichtig, als wäre sie ein wildes Tier, das scheuen könnte, hob er beide Hände und deutete dann mit einem Finger auf ihre Fesseln. »Ich nehme dir den Obsidian ab.«
Misstrauisch beäugte sie ihn.
»Ich weiß, wie schmerzhaft Obsidian wirken kann, wenn er zu lange getragen wird.«
Mira versteifte sich merklich, was Pheros dazu animierte, die Hände auf ihre Oberarme zu legen. Auf jeden anderen musste diese Geste wirken, als wolle er sie festhalten. Dabei versuchte er erneut Beistand zu vermitteln. Leider half das nur kein bisschen, denn sie war hier.
In Lykosura.
Direkt vor dem Imperator.
Genau der kam jetzt näher. Mit jedem weiteren Schritt baute sich in ihr ein Druck auf, der sich ihrer Kontrolle entzog. Sämtlicher Schmerz und Frust der letzten Wochen türmten sich in ihrem Inneren zu einem Berg auf. Das Atmen fiel ihr schwer.
Und dann war es plötzlich, als würde die Zeit sich verlangsamen. Genau in jenem Moment, als der Obsidian von ihr abfiel, brach es ungefiltert aus ihr heraus.
All die Kämpfe der vergangenen Monate. Der Schmutz und das Blut der Arena. Die Verletzungen durch die Nachtkreaturen Oblyvars. Die Befreiung ihrer Freunde. Die Namenlosen. Die Sehnsucht nach der Heimat und ihrer Familie, die sie permanent unterdrückt hatte, um nicht daran zu zerbrechen. Der Schmerz, verursacht durch Pheros’ Verrat. Seinen Verlust.
Ihr eigener Herzschlag dröhnte ihr laut pochend in den Ohren, während die Welt um sie herum in einem Wirbel aus Energie und Wind versank. Dunkelheit kratzte an den Ecken ihres Sturms, doch er war zu stark, zu übermächtig.
Ihr Sein verselbstständigten sich, dem Flüstern der Elemente folgend. Die Luft über ihr erfasste sie zuerst. Die Wirbel, die sich über ihr bogen und mehrfach die Richtung änderten. Sie teilte den Wind, bewegte sich mit ihnen und auch wieder nicht. Mehr als jedes andere Element standen ihr der Wind und der Himmel am nächsten. Aber auch mit der Erde unter ihren Füßen war sie verbunden, die sich sacht bewegte und grünes Leben hervorbrechen ließ. Dieses Flüstern war sanft und leise. Das Wasser des Meeres buhlte brausend um ihre Gunst. Wellen, die gegen die Klippen brandeten, zupfte an ihren Sinnen. Fließend und rein, aber voll roher Gewalt. Das Feuer brannte heiß in ihr. Versengend, zerstörerisch und wütend, aber auch reinigend und neuen Nährboden schaffend. Leben und Tod. Alles war miteinander verbunden.
Miras Sinne wanderten weiter. Begierig, mehr zu erforschen und zu verstehen. Angezogen von etwas, das sie nicht benennen konnte, tastete sie sich voran. Der Geist, das fünfte Element, welches in allem steckte und die vier Elemente miteinander verwob, durchströmte sie jetzt. Da erfasste sie auch die vielen, wild schlagenden Herzen um sich herum. In heller Aufregung und Panik. Nur eines nicht. Dieses eine Herz schlug ruhig und ausgeglichen.
Lykaons Herz.
Am Rande ihrer Wahrnehmung konnte sie seine Aura spüren. Nur leicht, wie die hauchzarte Berührung von Fingerspitzen auf der Haut. Sie entzog sich ihm, lenkte ihren Geist fort und in eine weite Ferne, denn da war ein Licht, dass sie kannte. Liebte.
Cailin.
So unendlich weit entfernt von ihr, aber Mira spürte sie. Beinahe war es, als könnte sie nach ihr tasten, sie vielleicht sogar berühren. Wenn sie ihre Sinne nur weit genug aussandte, konnte sie womöglich ... Nein!
Etwas hielt sie zurück.
Mira.
Jemand rief ihren Namen, aber es war unmöglich, sich vom fünften Element zu lösen. Der Geist fesselte sie an diese andere Sphäre.
Mira.
So vertraut. Der Klang seiner Stimme. Ein Raunen erhob sich am Rande ihres Bewusstseins.
Mira ...
Immer lauter.
Mira ...
Lykaon?
Mira...
Nein. Nicht der Imperator.
Mira!
»Pheros!«
Erschrocken schnappte sie nach Luft und sah sich um. Sie brauchte einen Moment länger, um die Realität zu begreifen. Wilde, ungezügelte Winde, die alles verwüsteten und den Himmel über ihr verdunkelte. Ein Sturm?! Pheros? Sie wollte sich nach ihm umsehen, doch jemand zog an ihrem Arm.
Lykaon!
Er stand noch immer vor ihr und hielt ihre Hände jetzt fest in seinen. »Besser, du hältst mich fest, Sturmgeborene.«
Da verstand sie es. Sein Sturm war mit ihrem verbunden und gemeinsam standen sie in einer geschützten Sphäre, während außerhalb davon das Chaos tobte.
Pheros! Wo. War. Pheros!?
Sie fand ihn mitten im Sturm stehen und sich zusammen mit Lykaja an einer Säule festhaltend, damit sie nicht davongerissen wurden. Mit erschreckender Klarheit erkannte sie, dass es seine Stimme gewesen war, die sie in die Realität zurückgebracht hatte.
Panik erfasste ihr Herz. Sie wusste nicht, wie sie den Sturm zum Schweigen bringen sollte. Also wandte sie sich an den einzigen, der die Macht besaß sie aufzuhalten. »Hilf ihnen!«
»Das tue ich bereits.« Der Imperator deutete mit Kopf nach oben. Mira sah hinauf. Da war ein Schild, der wie eine Kuppel die tatsächliche Gewalt ihres Sturms fernhielt. Sie sah mächtige Blitze dagegen schlagen, während darunter nur der Wind wütete.
»Es ist dein Sturm. Nur du kannst ihn beherrschen.«
Sie schüttelte atemlos den Kopf, wobei sie nicht verhindern konnte, immer wie nach Pheros zu sehen. »Ich weiß nicht, wie.«
»Doch.« Sein Blick bohrte sich eindringlich in ihren. »Konzentration und Fokus auf die Elemente. Eines nach dem anderen und dann zwing ihnen deinen Willen auf. Bring sie zum Schweigen!«
Ihr blieb keine andere Wahl, wenn sie nicht wollte, dass Pheros im Sturm zerrissen wurde. Zu ihm flohen ein letztes Mal ihre Augen, bevor sie diese fest schloss, um sich ausschließlich auf ihr Innerstes zu konzentrieren.
»Verbanne alle Gedanken und Gefühle, Mira. Man lehrte dich die Technik. Wende sie an!«
Sie folgte seiner Anweisung und begann mit der Luft. Ihre Sinne drangen vor zu den Wolken, wo sie die Bewegung der Wirbel erfasste und nach ihnen griff. Doch sie entglitten ihr. Immer wieder. Die Anstrengung, die es sie kostete, allein dieses eine Element zu beugen, ließ sie kaum noch Atem holen, aber sie blieb stur.
Mira bezwang den Wind und tastete sich dann weiter zum Wasser, um die Wolken zu teilen. Ebene für Ebene arbeitete sie sich vor, bis es endlich vorbei war. Nur das Feuer gehorcht nicht, aber da spürte sie, wie der Einfluss des anderen Sturmfürsten auf sie einwirkte. Was auch immer Lykaon tat, er verhinderte, dass die Flammen sie verbrannten.
Als sie die Augen wieder öffnete und Luft holte, erhellte strahlender Sonnenschein den Tag von neuem. Kraftlos sank sie in die Knie, wobei Lykaon ihre Hände wieder freigab. Im Augenwinkel sah sie Pheros aufrecht stehen, was sie vor Erleichterung fast weinen ließ. Erstaunt darüber, dass ihre Hände keinerlei Risse aufwiesen, betrachtete sie diese. Hatte der Imperator gerade wirklich verhindert, dass sie vom Sturm vernichtet wurde?
Als sie den Kopf hob, ging er vor ihr in die Hocke. Geduld und Belehrung sprachen aus seiner Miene. Wie ein Vater, der seinem zornigen Kind eine Lektion darüber erteilte, welche Konsequenzen sein Handeln nach sich zog.
»Du könntest Lykosura in Stücke reißen, wenn du willst. Aber dann solltest du dir vorher im Klaren darüber sein, ob du die Klagelaute tausender sterbender Seelen ertragen kannst.«
Es schien, als spreche er aus Erfahrung. Hatte er den Krieg denn nicht auf diese Weise ausgelöst? Sie erinnerte sich nur schwach an die Geschichtsstunde. Heute fragte sich keiner mehr, wie der Krieg begonnen hatte, sondern nur noch, wer ihn beenden würde und wann. Jetzt verstand sie es. Nur mit der Macht eines Sturmfürsten war ihm diese unglaubliche Auslöschung gelungen. Nur ... lebte er noch. Der Sturm hatte ihn nicht zersetzt. Anders als ihren Vater.
Schallendes Gelächter durchbrach den Moment der Anspannung und Miras Blick huschte zur Seite. Genetor saß zusammen mit Tegeates am Brunnen und lachte diesen herzhaft aus. Von Kopf bis Fuß durchnässt, zupfte sich die Schattenklinge Blätter aus Haar und Kleidung.
Hinter ihr begab sich Pheros in die Hocke und legte beide Hände auf ihre Arme. Er zog sie wieder auf die Beine, parallel zum sich erhebenden Imperator. Miras Beine fühlten sich an wie durchgeweicht, weshalb sie sich mit dem Rücken gegen Pheros lehnen musste, um nicht wieder einzuknicken.
»Du bist zu Gast in meinem Reich, Mira aus dem Hause Cornovier«, sprach der Imperator sein offizielles Machtwort aus. »Es wird kein Obsidian nötig sein. Entschließt du dich, deine Magie einzusetzen, um anderen zu schaden, wird man dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Entschließt du dich, uns zu verlassen, bist du auf dich allein gestellt und genießt nicht länger den Schutz des Kaisers und ...« Sein Blick galt Pheros. »... seiner Waffen.«
Sie wollte spöttisch auflachen, verkniff es sich aber gerade so. Würde sie gehen, müsste sie erstmal das gesamte Feindesland durchschlagen. Jeder, der scharf auf das Wohlwollen des Imperators war, würde sie jagen. Verletzte sie jemanden mit ihrer Magie – und sei es nur zur Verteidigung – dürfte sie sich vermutlich zum Auspeitschen irgendwo hintenanstellen.
»Hast du das verstanden?«, fragte Lykaon.
Pheros drückte sacht ihre Oberarme und sie verstand die Botschaft.
Also nickte sie. »Ich habe verstanden.«
Schweigend lief Mira neben Pheros her, während er sie in ihre Räume führte.
Sie würde eher Käfig dazu sagen. Ein hübscher, goldener Pferch, mit mehr oder weniger Komfort. Vermutlich etwas mehr Komfort, als sie in den letzten Monaten hatte erfahren dürfen, aber Käfig blieb Käfig. Natürlich plante sie, aus diesem Käfig auszubrechen, aber dazu musste sie klug vorgehen. Ausgeruht und fokussiert.
»Hier.« Pheros blieb vor einer Flügeltür stehen. Helles Holz, fast so weiß wie der Marmor zu ihren Füßen. Er schob die Tür auf und bedeutete ihr, voranzugehen. Sie trat ein und fand sich in einem lichtdurchfluteten Raum wieder mit großen Fenstern und hohen Säulen, deren Zwischenräume vereinzelt mit seidenen Vorhängen bestückt waren. Viel Blau, Silber und Weiß. Einen Kamin gab es auch und ein großes Bett mit einem durchscheinenden, bestickten Baldachin. Ein Tisch mit Spiegel und einen Waschzuber erspähte sie in der Ecke, halb verdeckt durch einen Paravent. Truhen an der einen Wand und zwei große Schränke an der anderen.
Komfortabel war dieser neue Käfig, das musste sie zugeben, mit einem Balkon, der sich zur Südseite neigte und auf das offene Meer blicken ließ. An der Schwelle zum Balkon blieb sie stehen und berührte einen der seidenen Vorhänge. Sie wusste, dass Pheros noch immer dastand. Mira begegnete dem Blick eines mit sich kämpfenden Drachen, dessen dunkelblaue Augen den Schimmer von Gold reflektierten. Er war also wütend.
»Was war das, Mira?«
Ihr Sturm, entfacht in seinem Vorgarten. Das also stachelte seinen Zorn an, was wiederum ihren schürte. Was glaubte er denn, was das gewesen war? Beinahe hätte sie die Kontrolle verloren und wäre ausgebrannt! Was erlaubte er sich, wütend zu sein? Er, der sie überhaupt erst hierher gebracht hatte!
Natürlich könnte sie ihm jetzt erklären, wie wenig erpicht sie darauf gewesen war, sich derart schwach und unfähig vor dem Kaiser zu präsentieren, aber das gestand sie ihm nicht zu. Erst recht nicht, nachdem er ihr den Eindruck vermittelte, sie habe es absichtlich getan.
Daher zuckte sie nur mit den Schultern und starrte ihn nicht weniger zornig an. »Ich fand den Garten hässlich.«
Er schnaubte und kam auf sie zu. »Das ist nicht witzig.«
»Siehst du mich lachen?« Sie kreuzte die Arme vor der Brust. »Was erwartest du eigentlich? Offiziell betitelt Lykaon mich als Gast, aber wir beide wissen, dass ich das nicht bin. Willst du, dass ich die Gehorsame spiele? Soll ich mich als Sklavin anbieten? Das ist doch besser, als in seiner eigenen Scheiße sitzend den letzten Atemzug zu tun, oder wie war das?«
So nah, wie er jetzt vor ihr stand, stolperte ihr Herz wiederholt. Er öffnete die Lippen, um etwas zu erwidern, aber dann klopfte es unvermittelt an der Tür.
Eine unfassbar schöne Frau mit langem, goldenem Haar und warmen braunen Augen stand jetzt im Zimmer. Dicht auf dem Fuße folgte ihr einer Schar Diener, die jede Menge Truhen und anderen Kram hereinbrachten.
»Ich finde auch, dass der Garten einen neuen Anstrich braucht«, kommentierte diese. Bei näherer Betrachtung kam ihr diese Frau auch irgendwie bekannt vor.
»Tia, nicht jetzt«, knurrte die Erste Waffe, wobei er die Augen nicht von Mira nahm. Moment! Er hatte sie Tia genannt. Dann musste das hier Titana sein. Der Schöne Tod. Nun, zumindest bei ihr logen die Bardenlieder nicht. Alles an ihr verkörperte Symmetrie, als wäre sie ein fleischgewordenes Kunstwerk.
Dieses Kunstwerk legte eine Hand auf Pheros Unterarm. »Tut mir leid, aber Vater besteht darauf. Er will mit dir sprechen, aber vorher brauchst du dringend ein Bad.« Mit einer Kraft, die man ihrem zierlichen Körper so gar nicht zutraute, schob sie ihn raus. »Du riechst nämlich nach abgestandenem Flusswasser. Los jetzt!«
Auch die Dienerschaft scheuchte sie hinaus, nachdem die alles abgestellt hatte. Mira blieb an Ort und Stelle stehen und sah dabei zu, wie diese kleine Person alle herumkommandierte.
»Und du brauchst auch ein Bad!«
Die Magierin nahm es nicht persönlich, denn es stimmte ja auch. Titana schritt zielstrebig auf die Truhen zu, wobei ihre goldenen Locken zum Takt ihrer Schritte wippten. Da wusste sie es plötzlich. »DU bist die Bardin aus Imrit!«
Titana schmunzelte, während sie eine der Truhen aufschlug. »Ich bin vieles.«
»Du hast das Feuer in der Wachfestung gelegt.«
Titana hob zwei Kleider hoch. »Ein bedauernswerter Unfall. Die Fässer mit dem Schwarzpulver haben auch mich eiskalt erwischt. Kommst du bitte etwas näher?«
Mira tat, was sie verlangte, während Puzzlestück für Puzzlestück in ihren Gedanken ein Bild ergaben. Demnach musste sie die Spionin gewesen sein, die Pheros auf ihre Spur gelenkt hatte.