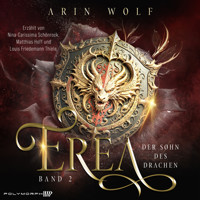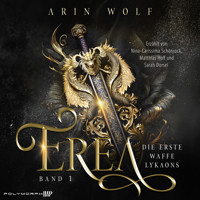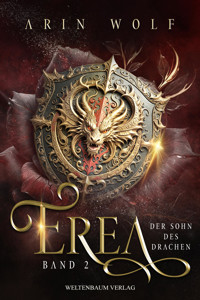6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Weltenbaum Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zwischen den Menschenreichen Makhai und Lykosura tobt seit Jahrhunderten ein erbitterter Krieg. Unaufhaltsam rückt die Schwarze Streitmacht Lykosuras vor, angeführt von den Sieben Waffen des Kaisers. Die Barden besingen sie als blutrünstige Bestien, die sich an den Seelen ihrer Feinde laben. Doch wie viel Wahrheit verbirgt sich hinter ihrem Lied? Mira weiß nur eines: Ihre Heimat muss der Schwarzen Flut Einhalt gebieten, und ihre Familie muss stets den höchsten Preis dafür bezahlen. Auf königlichen Befehl kehrt sie nach langer Abwesenheit zurück, um ihrer Schwester beizustehen. Doch die Götter haben andere Pläne mit ihr. Plötzlich sieht sie sich nicht nur mit der Ersten Waffe Lykaons, dem Obersten General der Schwarzen Streitmacht, konfrontiert, sondern auch mit dem brüchigen Fundament einer Wahrheit, die sie selbst zu lange für unumstößlich hielt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
WELTENBAUM VERLAG
Vollständige Taschenbuchausgabe
02/2025 1. Auflage
Erea – Die Erste Waffe Lykaons
© by Arin Wolf
© by Weltenbaum Verlag
Egerten Straße 42
79400 Kandern
Umschlaggestaltung: © 2023 by Magicalcover
Lektorat: Julia Schoch-Daub / Feder und Flamme Lektorat
Korrektorat: Kai C. Moore
Buchsatz: Giusy Amé
Autorenfoto: Privat
ISBN 978-3-949640-98-8
www.weltenbaumverlag.com
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
Arin Wolf
Erea
Die Erste Waffe Lykaons
High Fantasy Romance
Band 1
Für Will.
Kein Ort ohne dich.
Vorwort
Liebe*r Leser*in,
ich freue mich sehr, dich nach Erea entführen zu dürfen. Du wirst hier tapferen Kriegern, grausamen Herrschern, mutigen Helden und schwierigen Konflikten begegnen. Wenn du wagst, genauer hinzusehen, wirst du bald feststellen, dass sehr viel mehr zwischen den Zeilen steht. Falls du nur das Abenteuer suchst, wirst du auch das hier finden. Dies ist nur der Anfang einer langen Reise, die dich bis zu den entlegensten Winkeln Ereas führen wird. Natürlich nur, wenn du ausdauernd genug bist, unseren Helden zu folgen.
Content Notes:Explizit dargestellt oder erwähnt werden: Vorurteile, Hass, Rassismus, derbe Sprache, sexuelle Handlungen, Krieg, Tod, Sklaverei, Mord und körperliche Gewalt.
EREA
Im Zeitalter des siebten Sterns
Jahr 6725
1
Fürstentum Kaukon
Festung Himmelswacht
MIRA
Kalt fühlte sich der Stein unter ihren Fingerspitzen an. Deutlich gezeichnet von den Jahrtausenden seiner Existenz, aber stark in der Substanz. Mira war sich absolut sicher, dass die Himmelswacht auch noch in weiteren tausend Jahren stehen würde. Selbst wenn die Schwarze Flut gegen diese Mauern brandete, der Stein würde standhalten. Ein tröstlicher Gedanke, der sofort wieder verblasste. Verdrängt von schwarzen Rauchschwaden, die sich gen Himmel hoben.
Ein Vorbote des Todes, der seine dunklen Schwingen ausbreitete. Geboren aus grausamer Magie, die dem Krieg als Instrument diente und die zu bekämpfen sie ausgebildet war. Dennoch stand Mira abseits des Schlachtfeldes wie ein ungeliebtes Schwert in der Waffenkammer. Dazu verdammt, Staub anzusetzen.
Umgeben von der Sicherheit alten Steins kam sie sich so nutzlos vor wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Es nagte an ihr, denn dafür war sie eigentlich nicht nach Hause gekommen. Sie sollte an der Front sein, an der Seite ihrer Schwester.
Obwohl so viel Macht – das reine Element des Himmels in sich bergend – durch ihre Adern floss, blieb sie eine Gefangene ihres Standes. Ebendieser verlangte von ihr, auf den Befehl ihrer Schwester zu hören, denn Cailin war die Fürstin Kaukons und Mira ihre jüngere Schwester.
Der Wind trug den beißenden Geruch von Blut, Metall und verbrannter Erde heran. Obgleich sich das Schlachtfeld viele Trommelschläge weit weg befand, eine ganze Stadt und viel offenes Feld zwischen ihnen lag, erreichte der Krieg sie sogar hier.
Der Rabe am Himmel verkündete das Ende der Kämpfe. Mira kannte diesen Zauber und wusste, dass der schwarze Rauch, der die Form eines Vogels annahm, Gift für alles und jeden bedeutete, der sich darunter aufhielt.
Nur, welche Seite hatte dieses magische Ungetüm erschaffen?
Beinahe die gesamte Nacht über stand sie nun schon auf den oberen Wehrgängen und starrte auf den breiten Streifen der Kriegsfront. Wie eine große, nie zur Gänze verheilte Narbe auf dem Ereas Erdboden. Auch der Rabe schwoll nicht weiter an, noch ließ sich der Rauch durch den Wind zerstreuen. Wie ein drohendes Mahnmal harrte die Schwärze unbewegt am Himmel aus.
Mira schob den Saum ihres Ärmels hoch, um das darunterliegende Armband freizulegen. Zwei kleine Edelsteine, eingelassen in ein zartes Gebilde aus weißem Gold, die für die Farben des Hauses Cornovier standen – Weiß und Blau. Der blaue Stein symbolisierte zeitgleich das Lebenslicht ihrer Schwester und barg stets ein sachtes Glühen in seinem Inneren. Es war noch immer da. Cailin war also noch am Leben. Ihre tapfere, stolze Schwester, die als Erbin des Hauses Cornovier die Bürde trug, den Vormarsch Lykosuras aufzuhalten. Erleichterung wallte in Mira auf, doch nur für kurze Zeit. Cailin mochte noch am Leben sein, aber was war mit all den Soldaten, die sie in die Schlacht geführt hatte? Wie viele Leben waren heute Nacht erloschen?
Das Klirren von Metall lenkte Miras Aufmerksamkeit auf den Innenhof der Festung. Eine Schar Soldaten huschte an ihr vorbei, um sich dort zu sammeln. Würden sie ausrücken, um den Rückzug der Verwundeten zu sichern? Sobald Cailins Hauptmann zu ihnen stieß, trieb er sie mit ziemlicher Sicherheit in Richtung Krieg – und damit in den mehr oder weniger sicheren Tod. Ein düsterer Gedanke, der sonst so gar nicht zu ihr passte.
Mira wusste, wie sich der Krieg anhörte. Wie er aussah und wie er roch. Wie bitter er schmeckte. Vor allem aber wusste sie, dass Krieg nichts als Elend und Tod hervorbrachte. Jedes Mal, wenn Soldaten an die Front zogen, füllte sich das Waisenhaus Kaukons. Auch die Anzahl der Bittsteller an das Fürstenhaus wuchs, da die Gefallenen keinen Sold mehr nach Hause bringen konnten, um ihre Familien zu ernähren. Mira hatte das alles schon von klein auf beobachtet. Vermutlich sollte sie sich glücklich schätzen, den Großteil ihres Lebens abseits von Kaukon verbracht zu haben. Doch nun, da sie wieder zu Hause war, kehrten all die dunklen Eindrücke zurück in ihre Erinnerung. Wenn der vertraute Klang von klirrendem Metall und einem belebten Lazarett voller Schmerzensschreie wieder zur Tagesordnung gehörte, wessen Gedanken verdunkelten sich da nicht?
»Kein Wunder, dass dein Vater dich nach Helix geschickt hat. Kaukon ist kein schöner Ort für Kinder.«
Die Worte ihres Begleiters veranlassten sie dazu aufzublicken. Direkt in Samas’ Augen.
Gemeinsam, als Kinder von kaum zwei Jahren das Studium der Magie beginnend, standen sie heute noch immer Seite an Seite. Vom ersten Tag an unzertrennlich gewesen, konnte sich Mira keinen wertvolleren Wegbegleiter vorstellen als ihn. Ein Kampfmagier und ganz nebenbei auch der jüngste Spross des Königshauses Makhais, dem ehrenhaften Haus Vydar.
»Vermutlich nicht«, stimmte sie ihm zu. »Aber es ist nicht alles schlecht. Die Törtchen, die die Köchin macht, sind ganz famos. Nur klau den Soldaten niemals ihre Hosen. Das könnten sie dir übelnehmen.«
Mit gehobenen Brauen sah er sie an. Er war einen halben Kopf größer als sie, weshalb sie aufblicken musste.
»Du hast Soldaten die Hosen gestohlen? Warum erfahre ich erst jetzt davon?«
Ihre Mundwinkel zuckten. »Ich war noch ein kleines Mädchen und wollte nicht, dass sie in den Kampf zogen. Vater meinte einst zu mir, ohne Kleidung dürfe man nie sein Zimmer verlassen. Also dachte ich, ich tue ihnen einen Gefallen, indem ich sie um ihre Hosen erleichtere. Denn dann müssen sie ja nicht in den Krieg ziehen und sterben.«
Belustigung tanzte in den hellen Augen ihres Freundes. Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem breiten Lächeln, was sein aristokratisches Gesicht nur noch attraktiver machte.
»Warum musste dein Vater dir sagen, dass man nie ohne Kleidung sein Zimmer verlässt? Und – ist dein Plan aufgegangen?«
»Naja, der Sommer kann hier ziemlich heiß werden. Und: nein, leider nicht. Die Männer bekamen sogar ziemlichen Ärger, da sie sich ohne Hosen auf dem Übungsgelände einfanden.«
Einen Moment noch sah Samas sie mit gehobenen Brauen an, doch dann mussten beide lachen. Dabei wanderte ihr Blick hinab zur Stadt, wo vor allem der Hafen deutlich hervorstach. Ohne diesen wäre die berühmt-berüchtigte Grenz- und Hafenstadt Makhais, die dem unerbittlichen Vormarsch Lykosuras Einhalt gebot, nur ein trostloser Ort des Krieges. Bekannt für seine zahlreichen Handelsbeziehungen, ankerten Händler aus allen Winkeln Ereas an seinen Docks.
Im Zentrum der Stadt residierte die gewaltige Festung Himmelswacht, deren Grundriss an einen achtzackigen Stern erinnerte. Mit Stein so weiß wie die schneeverwehten Berge Nevas. Überall zierten die blauweißen Banner des Fürstenhauses das alte Bauwerk.
Samas stieß sie sacht mit der Schulter an. »Cailin hält die Grenze sehr erfolgreich. Mein Vater spricht stets sehr achtungsvoll von ihr.«
Jedem anderen wäre der leise Sarkasmus in Samas’ Stimme entgangen, doch Mira hörte den Unmut deutlich heraus. So sehr das Volk Makhais seinen König liebte, sein jüngster Sohn tat das nicht.
Der eine ein Kriegerkönig und Feldherr, wie er im Buche stand. Der andere die Verkörperung eines Gelehrten. Intelligent und belesen. Wortgewandt und voller Wissensdurst. Der wohl größte Unterschied zwischen Vater und Sohn bestand jedoch in ihrer Gattung. Als feuergeborener Drakestai trug Samon das Erbe der Götter in sich. Mit langem Leben gesegnet und mit außergewöhnlichen Fähigkeiten ausgestattet. Samas hingegen besaß das magische Blut seiner Mutter.
Sogar im Aussehen hätten Vater und Sohn nicht unterschiedlicher sein können. Samas erbte das goldblonde Haar seiner Mutter und ihre blauen Augen, während der König schwarzes Haar und ebenso dunkle Augen sein Eigen nannte.
»Wir sind nicht unsere Väter und wir müssen das auch nicht sein«, erinnerte Mira ihn an jene Worte, die sie einander zusprachen, wenn die Schatten ihrer Väter wieder länger wurden. Samas schenkte ihr dafür ein warmes Lächeln.
Das Tor zur Kaserne öffnete sich kreischend und Hauptmann Malon betrat den Hof der Festung. Ein hochgewachsener Mann mittleren Alters, dessen Augen stets wachsam, aber auch von dunklen Augenringen umrandet waren. Regelmäßiger Schlaf zählte nicht zu den Dingen, die ein Soldat in Kaukon im Übermaß genießen konnte.
»Die Fürstin befindet sich auf dem Rückweg!«, rief er zu ihr hinauf. »Die Linie konnte gehalten werden.«
Mira nickte. Einen Herzschlag später bemerkte sie ein Knistern in der Luft. Der feine Hauch von Energie zupfte an ihren Sinnen. Elektrizität baute sich im Hof auf und Dunst breitete sich rasant aus. Samas und Mira erkannten sofort, dass Cailin im Begriff war, ein Portal zu öffnen. »Räumt den Hof!«, riefen beide gleichzeitig.
Karren und Säcke wurden zur Seite geschoben, Hühner eingefangen und Pferde in die Ställe zurückgeführt. Soldaten säumten die Innenwand der Mauer und Bogenschützen postierten sich auf den Wehrgängen darüber. Die Bögen gespannt und auf den Hof gerichtet. Da niemand wissen konnte, warum Cailin dieses Portal öffnete, mussten sie mit allem rechnen. Beide Kampfmagier postierten sich an verschiedenen Enden des Wehrgangs, um den Hof von zwei Seiten überschauen zu können.
Nur wenige Atemzüge später spürte Mira auch schon die Magie ihrer Schwester, die sich in einem Wirbel aus Energie und Wind manifestierte. Das Portal öffnete sich und spuckte einen Schwall verletzter Soldaten aus, die sich gegenseitig in Sicherheit schleppten, humpelnd und teilweise kriechend. Flammende Pfeile folgten ihnen. Samas wirkte einen unsichtbaren Schutzwall, um die Pfeile davon abzuhalten, die Fliehenden zu treffen. Die Soldaten wurden augenblicklich von Heilern in Empfang genommen und zum Lazarett geführt. Samas und Mira tauschten über den Hof hinweg Blicke aus.
Wo bleibt Cailin?, dachte Mira grimmig. Unruhig ging sie auf ihrer Seite des Wehrgangs auf und ab.Geduld, hörte sie Samas’ Stimme in ihren Gedanken flüstern, wie es unter Magiern möglich war. Die Anspannung musste ihr deutlich ins Gesicht geschrieben stehen. Nur noch mit Mühe kontrollierte sie ihr Element. Tanzende Blitze zuckten um ihre Fingerspitzen.
Diese Passage zu erschaffen, zählte zur höchsten Kunst des magischen Handwerks und war schwierig aufrecht zu erhalten. Das Portal schwankte bereits, weshalb Mira dabei half, es zu stabilisieren. Ihre Fingerkuppen kribbelten protestierend, als sie ihre Blitze zurückrief und stattdessen mit magischen Sinnen nach der Energie ihrer Schwester tastete. Sie fand sie. Stark und unerschütterlich. Mira streckte beide Arme in Richtung des Portals aus. Kleine Lichtkegel formten eine Brücke, ausgehend von ihren Handflächen, die sich zusätzlich über den Umriss des Portals legten. Wie eine Rüstung schlossen sich die einzelnen Lichtfragmente zu einer festen Platte zusammen.
Weitere, unzählbare – alles von ihr abverlangende – Herzschläge später tauchte endlich der blonde Haarschopf ihrer Schwester auf. Dicht gefolgt von Lucan, dem Dunklen Gardisten. Mit einem sausenden Klang verschwand der kurze Weg zum Schlachtfeld wieder. Das Knistern in der Luft erstarb schlagartig und der Wind legte sich. Zielsicher schweifte Cailins Blick über den Platz, bis sie Mira fand.
2
Kromoi
Imperiales Gebiet
PHEROS
Mit einem kaum hörbaren Surren wirbelte die Klinge der Ersten Waffe Lykaons durch die Luft, ehe sie in einer fließenden Bewegung zurück in die Scheide fand. Die geringe Distanz zwischen ihm und der Fürstin ermöglichte den Blick auf die Umrisse des Portals, selbst durch den dichten Rauch hindurch. Mit erhobener Faust gebot er seinen Männern Einhalt, damit sie nicht in die tödliche Falle liefen, die sich darüber erhob. Pheros’ Blick richtete sich gen Himmel, wo der aufsteigende Rauch die Gestalt eines Raben annahm. Cailin wusste einen Kampf mit viel magischem Tamtam zu beenden. Das musste er ihr lassen.
Das dürfte Kaukon einige Tage Frieden verschaffen, denn dieses Spielchen kannte er nur zu gut, wurde er doch zum Großteil von den Priestern Lykaons erzogen. Allesamt versierte Magier. Mit knirschenden Zähnen gab er den Befehl, sich zum Hauptlager zurückzuziehen.
Diese Runde ging an die Sturmfürstin.
Bevor er sich abwandte, um das Schlachtfeld zu verlassen, sah er noch einmal zurück zum Portal. Angezogen von etwas, das er nicht benennen konnte. Der Innenhof einer Festung zeichnete sich auf der anderen Seite ab. Die Fürstin mit ihrem hellen Haar stach dabei deutlich heraus. Er stockte und zog die Augenbrauen zusammen. Das war nicht Cailin Cornovier. Gab es noch eine andere Magierin?
Ihre Blicke fanden sich und etwas in ihren Augen ließ ihn innehalten. Der Moment dehnte sich aus, während eine Woge feuriger Funken zwischen ihnen emporstob. Begleitet von einer Windböe, die an seiner Haut zupfte. Diese Augen ...
»Bruder!«
Abrupt endete der Moment, als Lykaja ihre Hand auf seinen Unterarm legte. »Ist alles in Ordnung?«
Nein, wollte er antworten, doch stattdessen nickte er nur knapp. Unruhe war deplatziert auf dem Schlachtfeld. Die Disziplin forderte von ihm, sie abzuschütteln. Mit einer Kopfbewegung bedeutete er ihr mitzukommen. Gemeinsam verließen sie das rauchende Schlachtfeld, um wieder im Hauptlager der Schwarzen Streitmacht einzuziehen. Überall wehten die schwarzen Banner Lykosuras. Selbst die Zelte, Rüstungen der Soldaten und sogar das Zaumzeug der Schlachtrösser zeigten das typische Schwarz.
Kurze Zeit später betrat der General sein Zelt und steuerte geradewegs den langen Tisch an. Ein Sammelsurium an Karten türmte sich darauf, doch ihn interessierte nur die eine, die Kaukon und Kromoi abbildete.
Cailin war deutlich schlauer als jeder andere Gegner, dem er bisher das Zepter hatte entreißen können. Dabei war der Vormarsch der Streitmacht bis dahin ungebrochen geblieben. Zahlreiche Stadtstaaten waren dem Imperium hinzugefügt worden, seit er – vor zehn Jahren – das Kommando übernommen hatte. Selbst das widerspenstige Maru hatten sie erst kürzlich unter seiner Führung bezwungen. Es gab kaum ein Reich, welches der Schlagkraft der Schwarzen Streitmacht standhalten konnte.
Kaukon vermochte es.
Welche Strategie die Generäle vor ihm auch aufboten, die Sturmfürstin vereitelte sie alle. Vor ihr war es ihr Vater gewesen, der die Grenze erfolgreich verteidigte. Pheros mochte zwar erst seit wenigen Tagen hier sein, aber auch seine üblichen Methoden scheiterten. Das erfreute und verärgerte ihn im selben Maße. Lange war es her, dass ihn irgendetwas oder irgendjemand derart herausforderte.
Das leise Rascheln von Stoff kündigte die Ankunft einer weiteren Waffe Lykaons an. Niemand sonst betrat sein Zelt ungefragt. Erst recht nicht auf derart lautlosen Sohlen. Sofort wusste er, dass es sich um Lykaja handeln musste.
Die Bogenschützin.
Pheros hob gar nicht erst den Kopf, als er fragte: »Ist Titana schon zurück?«
»Nein. Es hat die Runde gemacht, dass die Sieben Bestien Lykosuras hier sind. Das Umland lichtet sich zusehends. Scharenweise flüchten sie nach Kaukon.«
Mehr als ein abfälliges Schnauben kam nicht über Pheros’ Lippen. Die Sieben mochten die unbestrittene Elite unter Lykaons Waffen sein, doch Bestien waren sie keine. Jedenfalls nicht per Definition der Gelehrten Ereas.
Die Halbmaske, die jede Waffe Lykaons trug, verdeckte Lykajas Gesicht von den Augen an abwärts, dennoch musste Pheros nicht erst ihr Schmunzeln sehen, um zu wissen, dass es da war. Eine Regung, die nur sehr wenige je zu Gesicht bekamen. In vielerlei Hinsicht war diese Schwester anders als jede andere unter den zahlreichen Waffen Lykaons. Sie mochten einander Bruder und Schwester nennen, doch begründete sich dies allein in ihrer Kameradschaft. Nicht in tatsächlicher Blutverwandtschaft. In den Augen ihrer Feinde galten sie als fleischgewordene Dämonen, die sich am Leib ihrer Feinde nährten und auf deren Schädel schliefen, oder wie hieß es in diesem Bardenlied nochmal?
Solange die Welt sie auch weiterhin fürchtete, spielte man ihnen nur in die Karten. Viele Dörfer hatten schon für weniger das Weite gesucht und der Schwarzen Flut damit den Einmarsch kampflos überlassen.
»Cailin Cornovier ist in der Tat eine Sturmfürstin.« Wenn ein Magier zum Sturmfürsten aufstieg, verbreitete sich diese Neuigkeit wie ein Lauffeuer in sämtlichen Königreichen.
»Sie ist eine der mächtigsten Magier Ereas, ich weiß, ich weiß.« Lässig schlenderte die Bogenschützin zum Tisch mit den Krügen Wein. Dabei streifte sie ihre Maske ab. »Sie kann ganze Landstriche mit nur ein paar Gedanken verwüsten und den Sturm beschwören. Vater war dies bezüglich immer sehr bildhaft.«
Vater.
Manchmal vergaß Pheros, dass Lykajas Generation Imperator Lykaon so nannte. Er selbst entsprang als einziger Überlebender der ersten Generation, die die Schmiede hervorgebracht hatte. Eben deshalb konnte er nicht ferner davon sein, diesen Mann als Vater zu bezeichnen. Lykaja und die restlichen Sieben waren jedoch einer anderen Methode der Schmiede unterzogen worden. Bei ihnen hatte man darauf geachtet, eine Bindung zu Lykaon aufzubauen, sodass die jüngeren Drakestai nicht länger nur zu lieblosen Waffen geschliffen wurden.
»Wann hast du das letzte Mal geschlafen?«, erkundigte sich Lykaja, während sie ihm einen Becher Wein reichte.
Pheros nahm diesen entgegen. »Gestern, oder vorgestern.« So genau wusste er das nicht mehr. Derzeit verschwammen die Tage. Die Schwarzlande, an dessen Grenze sie sich befanden, drückten auf sein Gemüt. Stärker als jeder andere Landstrich es vermochte.
»Du bist unruhig.«
Pheros nickte. Ihr gegenüber musste er keine Maskerade aufrechterhalten. »Die Schwarzlande sind sehr nahe«, erwiderte er ausweichend. Es war keine Lüge, aber auch nicht die volle Wahrheit.
Etwas in ihrem Blick verriet ihm, dass sie seine Halbwahrheit auch nur halb schluckte. Einen Moment länger noch hielt sie den Kontakt zu seinen Augen, abwägend, ob sie nachbohren sollte oder nicht.
»Ich fühle es auch. Wir sind anfällig für diese Gebiete. Haben das die Meister nicht immer gesagt? Es trübt unsere Sinne, weil dort die letzte Ruhestätte unserer Ahnen liegt. Wohnort zahlreicher Monster. Orks, Ghule, Trolle und allerhand anderer Bestien sollen dort ihr Unwesen treiben, wo die Drachenkriege einst nichts weiter als Brachland hinterlassen haben.«
Lykaja schob sich die Kapuze vom Kopf und ihr langes, braunes Haar, das am Oberkopf mehrfach geflochten war, fiel in Wellen über ihre Schultern. »Vieles von dem ist nichts weiter als Aberglaube, aber sagt man nicht auch, dass ein Funke Wahrheit in allem steckt?« Sie nippte an ihrem Wein. »Ich habe sehr seltsame Alpträume.«
»Ich auch«, gab er zu. »Bleib konzentriert und gib Bescheid, falls es schlimmer wird.«
Sie nickte knapp und beendete das Thema damit. Dass da noch mehr war, worüber sie sprechen wollte, zeigte sich überdeutlich an ihrer Haltung.
»Irgendwas Seltsames geht in Dasea vor.«
Pheros Stirn legte sich in Falten. Dasea war das angrenzende Flussdorf, nahe Kromoi.
»Es gibt zahlreiche unerklärliche Verschwinden. Die Leute haben Angst«, fuhr sie fort.
Pheros kreuzte die Arme vor der Brust. »Geht das auch konkreter?«
»Dazu müsste ich mich ohne Maske unter die Leute mischen.«
»Kommt nicht in Frage. Wir sind hier viel zu weit weg von Zuhause.«
Sie seufzte und lehnte sich mit der Hüfte gegen die Tischkante. »Einer Waffe Lykaons gegenüber würden sie alles behaupten, aber nicht die Wahrheit sagen. Ihre Furcht vor uns ist viel zu groß.« Ihr durchdringender Blick aus silberfarbenen Augen fixierte ihn. »Einer hat sogar gefleht, ich möge ihn bitte nicht auffressen, er habe Kinder. Dabei habe ich nicht ein Wort gesagt.«
Pheros lachte herzhaft. »Hast du ihm versichert, nur Sumrung zu verspeisen? Ich meine, die Gestaltwandler sind bekömmlicher.«
Sie schmunzelte. »Ehrlich, Pheros. Das ist ein Problem und keiner hilft den Leuten. Wir sind doch nicht nur hier, um zu erobern. Lass mich dem nachgehen.«
Tatsächlich dachte er einen Moment lang darüber nach. »Ich mache das.«
Überrascht hob sie die Augenbrauen. Das wiederum ließ ihn die Augen rollen.
»Was?«, fragte er und versuchte, dabei nicht allzu genervt zu klingen. »Cailins giftiger Rabe am Himmel versperrt uns den Zugang zur Front. Soll ich etwa nur herumsitzen und euch den ganzen Spaß überlassen?«
3
Fürstentum Kaukon Festung Himmelswacht
MIRA
Da war dieser Augenblick gewesen. Nicht länger als einen Herzschlag lang, aber ausreichend, um in Mira eine Erschütterung zu hinterlassen, die sie noch Stunden später spürte. Es fraß sich tief durch ihr Innerstes. Dieser kurze Blickkontakt mit dem Drakestai auf der anderen Seite des Portals.
Drachenaugen.
Rotgolden und bedrohlich, mit schmalen Pupillen. Noch nie hatte sie solche Augen gesehen.
Pheros.
Erste Waffe Lykaons.
Nun verstand sie auch den radikalen Schritt des giftigen Raben am Himmel. Cailin hatte diesen beschworen. Nur so war sie der direkten Konfrontation mit ihm entgangen.
Lykosuras Sieben fürchtete man in ganz Erea. Gleichgesetzt mit Bestien aus den dunkelsten Alpträumen eines jeden Mannes, einer jeder Frau und eines jeden Kindes, wünschte sich niemand eine Begegnung mit ihnen. Nun, da sie persönlich in diese Drachenaugen geblickt hatte, verstand Mira auch, warum. So viel grausame Macht hatte aus ihnen gesprochen. Selbst über die Distanz hinweg war ihr seine Aura bis unter die Haut gegangen.
»... Orks und Schattenwanderer überqueren immer wieder die Grenze. Die Wachfestung ist zu dünn besetzt, als dass sie jedem Ausbruch Einhalt gebieten können.«
Mira blinzelte bei den Worten des Kundschafters verwirrt. Seit Stunden saßen sie nun schon an Cailins Kriegstisch, um Berichte einzuholen und die Lage zu besprechen. Die Schultern straffend, zwang sie sich, den Gesprächen wieder zu folgen.
Meinte der Mann wirklich echte untote Skelette, wenn er von Schattenwanderern sprach? Sich aus der Erde grabende, rastlose Gerippe mit Schild und Schwert? Die gab es wirklich? Cailin musste ihren Gesichtsausdruck gesehen haben, denn sie rollte mit den Augen.
»Ja, Mira. Es gibt sie wirklich.«
Nicht ihr Ernst! Während des Studiums hatte Mira einiges über dunklen Kreaturen und Ungeheuer des Namenlosen gelesen. In den gebildeten Kreisen Makhais stritten sich die Gelehrten noch immer über die tatsächliche Existenz dieser Wesenheiten. Immerhin waren schon seit Jahrhunderten keine Untoten mehr gesichtet worden, geschweige denn Orks und ihre Stämme. So nahm man an, dass sie auf dem südlichen Kontinent ausgestorben seien. In anderen Kreisen galten sie als Mythos, den Schmuggler und Kriminelle streuten, um in den Schwarzlanden ihre illegalen Geschäfte betreiben zu können. Jetzt von ihrer Schwester zu hören, Untote seien real und Orks existierten noch immer, wirkte unwirklich auf Mira.
»Schön«, sagte sie.
Im nächsten Moment waren Monster und Untote schon wieder vergessen, denn die Heilerin drängte sich in Miras Blickfeld. Sie musste viel Geduld aufbringen, da Cailin ein sehr schwieriger Patient war. Besaß sie schließlich nicht mal den Anstand still zu halten, während sie verbunden wurde. Jeden anderen hätte die Heilerin längst verarztet. Die Frustration stand ihr inzwischen deutlich ins Gesicht geschrieben und Mira bekam Mitleid. Also packte sie kurzerhand ihre – auf- und ablaufende – Schwester und hielt sie an Ort und Stelle fest, damit die Heilerin ihr Werk vollenden konnte. Cailin nahm davon nicht wirklich Notiz, hielt aber wenigstens inne. In ganz Erea gab es niemanden, der so sturwar wie sie.
Hätte Lucan nicht darauf bestanden, dass ein Heiler kam, würde sie jetzt den Kriegstisch vollbluten und auch davon keinerlei Notiz nehmen.
Cailin wieder frei gebend, warf Mira einen raschen Blick aus dem Fenster, wo die Mittagssonne bereits hoch am Himmel stand. Aru! Saßen sie wirklich schon so lange hier?
Ihr rebellierender Magen bestätigte dies mit einem lesen Knurren. Nur schwer unterdrückte sie ein Seufzen, während sie sich zurück auf ihren Platz setzte. Dabei bemerkte sie Lucan, der – wie so oft – im Hintergrund stand und alles beobachtete. Jetzt taxierte er sie mit Blicken und Mira hätte schwören können, dass er sich amüsierte. Zumindest bildete sie sich ein, einen Mundwinkel in Bewegung ertappt zu haben.
Lucan war Cailins Mentor und engster Berater. Vom König selbst an ihre Seite berufen, kaum da sie das Ritual zum Sturmfürsten überlebt hatte. Unwillkürlich kehrten ihre Gedanken zurück zu jenem Tag, als ein Bote die Nachricht vom Tod ihres Vaters überbracht hatte. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren.
Im Kampf gefallen.
Wenn ein Sturmfürst all seine Macht entfesselte, um mit einem Schlag das gesamte feindliche Heer auszulöschen, bedeutete das auch den Tod des Sturmfürsten selbst. Man brannte von innen heraus aus und das war wörtlich zu nehmen. Die Macht des Sturms suchte seinesgleichen in der Welt. Gleichzeitig glich das Schöpfen aus dieser Quelle einer immerwährenden Gratwanderung. Die meisten Sturmfürsten benötigten Jahrzehnte, bis sie diese Macht kontrollieren und gefahrlos einsetzen konnten. Ihr Vater war längst an diesem Punkt angelangt, als er gefallen war. Er musste sich bewusst geopfert haben, um Makhai die nötige Atempause zu verschaffen. In die Fußstapfen eines Sturmfürsten und ausgezeichneter Kampfmagiers zu treten, erschien Mira damals schon unmöglich. Ihr Vater erreichte immerhin stolze 312 Jahre und blickte auf drei Ehen mit zwölf Kindern zurück. Abgesehen von ihrer Schwester kannte Mira jedoch keines ihrer Geschwister. Allesamt weit vor ihrer Geburt im Krieg gefallen.
Samon persönlich hatte beiden Cornovier-Schwestern das Angebot unterbreitet, den Ritus zu begehen, der einen Magier zum Sturmfürsten erhob. Die meisten standen in der Blüte ihrer magischen Fähigkeiten, wenn sie den Ritus durchliefen. Die wenigsten trauten sich und beinahe alle starben dabei. Darum brauchte es stets die Genehmigung des Königshauses und eine eingehende Prüfung des magischen Könnens, bevor man dafür zugelassen wurde.
In der Hoffnung, dass wenigstens eine der beiden Schwestern überlebte, entstiegen zum ersten Mal in der Geschichte Ereas gleich zwei Sturmfürsten dem Ritus.
Mira unterdrückte ein Seufzen. Der Kundschafter ratterte noch immer seinen Bericht herunter, oder war das schon wieder ein anderer?
Bei Aru! Wie viele Kundschafter hielt sich ihre Schwester eigentlich?!
Als hätte Cailin ihr stummes Fluchen bemerkt, beendete sie die Berichterstattung. Mit wenigen Worten delegierte sie ihre Leute hinaus, bis nur noch Samas, Lucan, Cailin und Mira im Raum zurückblieben. Eine verschwörerische Stille hielt Einzug, in der Cailin und Lucan sich lange ansahen.
»Soll ich jemanden umbringen für dich?«, fragte Mira geradeheraus.
»Nein«, versicherte Cailin ihr schmunzelnd. »Keine Morde. Nicht, wenn es sich vermeiden lässt.«
Samas, der neben Mira saß, schien etwas sagen zu wollen, aber dann trat Lucan aus seinem Schattenplatz ins Licht. »Seltsame Vorkommnisse entlang des Drachenarms fordern zunehmend unsere Aufmerksamkeit. Zwischen Imrit und Dasea verschwinden allerhand Leute.«
»Damit meinen wir auch nicht die üblichen Scharmützel zwischen beiden Flussdörfern«, ergänzte Cailin. Miras Blick wanderte unweigerlich zur Landkarte, die auf dem Kriegstisch ausgebreitet lag und Ereas Zwillingskontinente zeigte. Sie betrachtete den südlichen davon, auf welchem sie sich befanden und folgte dort dem breiten Drachenarm, der ins Drachenmeer mündete. Dicht an der Grenze zu den Schwarzlanden und der Kriegsfront befanden sich Imrit und Dasea.
Mira suchte Samas’ Blick. Sie waren als Duo hierhergeschickt worden, um Cailin zu unterstützen, die Heimatstadt zu beschützen. Egal wie unwirtlich Kaukon auf die meisten anderen wirken musste, für Mira war es noch immer ihr Zuhause. Sie würde kämpfen, um dessen Freiheit zu erhalten.
»Was sollen wir tun?«, fragte Samas.
»Das Verschwinden der Leute muss aufhören. Ich möchte, dass ihr euch nach Imrit begebt und der Sache auf den Grund geht.«
Gegenüber offiziellen Vertretern des Fürstentums oder gar des Königshauses verhielten sich die Leute anders. Zurückhaltender. Sie reisten mit leichtem Gepäck, auf Pferderücken und nicht in den Farben ihrer Häuser. So würde es einfacher sein, an die richtigen Informationen zu gelangen. Zwei unbedeutsamen Reisenden begegnete man offener. So trugen sie schlichte, aber praktische Kleidung aus einfachen Stoffen und Leder.
»Ermittlungen wegen seltsamer Vorkommnisse?« Samas’ Tonlage verriet seine Skepsis.
»Sie möchte uns aus der Schusslinie halten«, erklärte Mira. »Seit ich denken kann, versucht sie, mich zu beschützen und dafür liebe ich sie auch, aber jetzt bin ich einfach nur genervt davon. Ich bin kein Kind mehr, dass sich vor Spinnen fürchtet.«
Samas sah sie schmunzelnd an. »Du bist kein Kind mehr, das stimmt, aber vor Spinnen fürchtest du dich noch immer.«
Sie warf ihm einen bösen Blick zu, der ihn nur noch breiter schmunzeln ließ.
»Cailin muss klar sein, dass sie sich dem Befehl meines Vaters nicht ewig entziehen kann.«
Mira zuckte mit den Schultern. »Das ist meiner Schwester egal. Ich hatte derlei Diskussionen schon oft mit ihr. Cailin ist der Ansicht, dass unsere bisherigen Abenteuer wenig mit einer ordentlichen Vorbereitung für den Krieg zu tun hatten.« In gewisser Weise stimmte Mira ihr da auch zu. Sie war niemals inmitten eines Schlachtfeldes gestanden und Teil dieses wogenden Chaos aus Leibern und Metall gewesen. Dennoch hatte sie den Weg des Kampfes gewählt und diesen auch oft genug beschritten. Sie hatte getötet, verteidigt und verschont. Sie kannte den Preis, den man für genommene Leben bezahlte. Sie war eine Kampfmagierin, die im Militär von Makhai diente. Irgendwann musste diese Tatsache doch bei ihrer Schwester ankommen.
»Als Abenteuer würde ich das, was wir im Hexenwald erlebt haben, nicht gerade bezeichnen«, warf Samas ein. »Hast du ihr jemals davon erzählt?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Sie hat auch so genug Sorgen.«
»Verstehe ... Also beschäftigt sie uns mit Ermittlungen, die sie für harmlos hält.«
Mira stimmte nickend zu, während sie beiläufig den breiten Hals ihres Hengstes tätschelte.
»Dann hoffe ich einfach mal, dass die Schänken in Imrit gutes Bier haben.«
Kurz vor Sonnenuntergang erreichten sie Imrit. In der Taverne »Zumsingenden Fisch« abgestiegen, brauchte es keine zwei Krüge Bier, bis das Schankmädchen schon die ersten Details mit ihnen teilte. Eine Mahlzeit später waren sie schon mit der Hälfte der Gäste auf Handschlag Freunde geworden. Wie immer fing Samas alle mühelos mit seinem Charme ein, während Mira sich in Ruhe umsehen und Fragen stellen konnte.
Stunden vergingen und das Wirtshaus füllte sich zusehends. Eine Bardin mit goldgelockten Haaren und braunen Augen gab ihre schöne Singstimme zum Besten. Samas spielte inzwischen mit einer Gruppe Fischer Karten. Mira machte es sich in einer der Ecken gemütlich. Sie nippte an ihrem dritten Krug Kräuterbier und ließ den Blick scheinbar ziellos durch den Raum wandern. Tatsächlich folgte sie aufmerksam den hier stattfindenden Gesprächen.
Imrit war ein verschlafener kleiner Winkel am Rande des Fürstentums. Hier kannte jeder jeden und selbst der Hahn, der morgens krähte, hatte einen Namen.
Gelegentlich schwenkte Mira ihren Krug, sah gelangweilt hinein und tat so, als wäre sie müde und würde nur noch darauf warten, bis ihr Bruder – sie hatten sich als Geschwister ausgegeben – sein Kartenspiel beendete.
Rein optisch gingen sie definitiv als Geschwister durch. Wie Cailin besaß auch Mira das blonde Haar und die blaugrünen Augen des Hauses Cornovier. An sonnigen Tagen erinnerte es mehr an ein leuchtendes Türkis. Umrandet von einem Ring aus Silber.
Cailin, mit ihrem hellblonden Pagenschnitt und den scharf konturierten Gesichtszügen, schlug ganz nach ihrem Vater. Mira galt hingegen als Mischung beider Elternteile. Die Augen des Vaters und das dunkelblonde Haar der Mutter, die sie nie hatte kennenlernen dürfen, da sie sehr früh verstorben war. Es gab von Jea Cornovier auch nur ein einziges, recht verblasstes Gemälde. Darauf war zumindest das dunkelblonde Haar zu erkennen gewesen. Eigentlich bevorzugte Mira ihr Haar schulterlang. Das erforderte weniger Pflege und Aufmerksamkeit. In den vergangenen Wochen war das einfach zu kurz gekommen. Das viele Reisen zwischen den Fürstentümern forderte seinen Tribut. Heute trug sie einen Zopf, der am Oberkopf begann und ihr bis zur Mitte des Rückens reichte.
Lautes Klatschen und Lachen ließ Mira zu Samas sehen, der sich vermutlich wieder ausnehmen ließ. Sie wusste, dass ihr Freund auf diese Weise versuchte, sympathisch unbeholfen zu wirken. Niemand spielte gern mit jemandem Karten, der clever genug war, einem das Haus abzuluchsen. Erst recht freundete man sich nicht mit einem solchen Mann an. Jetzt warf er ihr einen kurzen Blick über die Schulter zu und zwinkerte. Rasch verbarg sie ihr Schmunzeln hinter dem Rand ihres Kruges. Dabei lenkte sie die Augen zu der Bardin, die ihr nächstes Lied anstimmte.
Sie sang von Lykaja, der Bogenschützin, deren Pfeile aus Blitzen bestanden und nie ihr Ziel verfehlten, und ihren Augen, die von einem reinen silbernen Farbton sein sollten. Zahlreiche Gerüchte rankten sich um diese Drakestai. Viel Gerede und keine Fakten.
Und davon gab es viel über jeden von ihnen.
Ion, das Schwert Lykosuras, der beste Schwertkämpfer ihrer Zeit. Angeblich unbesiegt.
Asea, der SchattenLykaons, der auf leisen Sohlen den Tod brachte.
Titana, der Schöne Tod, dem sie jedem bereitete, der dumm genug war, sich von ihr verführen zu lassen.
Genetor, der Zorn Lykaons, dessen Streitaxt schon tausend Soldaten auf dem Gewissen hatte und zu guter Letzt Tegeates, die Schattenklinge, die man nie kommen sah.
Trotz des fragwürdigen Inhalts war es ein schönes, rhythmisches Lied. Zumindest dem Takt nach. Abscheulichkeiten, die danach trachteten, die Welt zu unterwerfen, zählten nicht unbedingt zu den schönen Inhalten eines Liedes. Auch das Baden im Blut ihrer Feinde zeichnete ein wenig schmeichelhaftes Bild von den berüchtigten Sieben.
Als das Lied endete, runzelte Mira die Stirn. Es fehlte doch einer. Der Erste der Sieben kam in diesem Lied nicht vor. Kaum gedacht, sang die Bardin auch schon das nächste Lied. Diesmal handelte es von der Ersten Waffe Lykaons. Besungen, wenn auch nicht im lobenden Sinne, wurde seine Grausamkeit und Unerbittlichkeit. Unwillkürlich musste Mira an den Blickwechsel mit ihm denken. Erneut hielt ein unerklärliches Gefühl Einzug in ihrer Magengegend. So wie immer, wenn sie diesen empathischen Traum hatte, oder daran dachte. Zwar war sie nicht mit der Gabe des zweiten Gesichts zur Welt gekommen, doch manche Sturmfürsten entwickelten eine vergleichbare Sensibilität gegenüber dem Zukünftigen, so auch Mira. Sie sah immer nur Bruchteile ihrer möglichen Zukunft. Winzige Fragmente, die keinen Zusammenhang ergaben, weshalb sie sich auch selten dazu hinreißen ließ, irgendwelche Interpretationen anzustellen. Meist waren ihre Träume aber auch nur das: Träume.
Dass sie ausgerechnet von diesen Augen geträumt hatte, bevor sie ihm leibhaftig begegnet war, gab ihr jedoch zu denken. Es beschäftigte sie, egal wie sehr sich auch einzureden versuchte, dass es nichts zu bedeuten hatte ...
Samas’ Krug landete krachend auf dem Tisch, was Mira unsanft aus ihren Überlegungen riss. »Klingt für mich nach Schmuggleraustausch. Oder Sklavenhändler.«
Mira vertrieb die Gedanken an empathische Träume und Drachenaugen.
»Sklavenhändler in Makhai?«
»Niemand aus Makhai, schätze ich.«
»Lykosura?«
»Unwahrscheinlich. Die haben doch keinen Mangel an Sklaven.«
»Dann ist dieser Auftrag vielleicht doch nicht so langweilig, wie wir angenommen haben.«
Samas nickte. »Die Spur führt in die Nähe der Schwarzlande.«
Sofort verzog Mira das Gesicht. »Sumpfiges Brachland.«
»Und Untote. Vergiss die Untoten nicht!« Eine eigentümliche Mischung aus Unbehagen und Vorfreude zeichnete sein Gesicht, bevor er den Becher erneut an die Lippen hob.
Mira seufzte. »Ich hoffe immer noch, dass Cailin sich einen Spaß erlaubt hat.«
Samas zuckte nur mit den Schultern. »Du hast uns schon in schlimmere Schwierigkeiten befördert. Das hier wird uns nicht aus der Bahn werfen. Da bin ich mir sicher.«
»Hey!« Sie trat unter dem Tisch nach ihm, doch er stellte nur grinsend den Becher wieder ab.
»Komm!« Samas sprang auf und zog seinen Mantel an. »Holen wir uns eine Mütze voll Schlaf.«
Die Zwillingsmonde standen leuchtend hell am Nachthimmel, als beide Freunde das Wirtshaus verließen. Der Gesang der Bardin begleitete sie dabei bis auf die Straße hinaus. Das veranlasste Mira dazu, durch eines der Fenster zurück in das Innere der Taverne zu blicken. »Glaubst du, es ist wahr?«
Samas klappte den Kragen seines Mantels hoch, um die Nase darin zu verbergen. »Nein. Ich glaube nicht, dass sie Bestien sind.«
Monster, die auf den Leichenbergen ihrer Feinde schliefen und Blut aus ihren Schädeln tranken. Ja, Mira musste zugeben, dass es eine doch sehr bildhafte Beschreibung war. Obwohl das nicht ihre erste Begegnung mit einem Drachen war, hatte Mira noch nie miterlebt, wie die Macht eines solchen den Blick des Königs veränderte. Es war eine bekannte Eigenart aller magischer Wesen Ereas, dass sich ihre Macht und wahre Wesenheit in den Augen spiegelte. So wurden die Pupillen der Drakestai schmal. Umrandet von einem feurigen, glühenden Rotgold. Angeblich traten diese Drachenaugen schon zu Tage, wenn sie besonders starken Gefühlsregungen unterworfen waren. Mira war sich nicht mehr sicher, was sie darüber gelesen hatte. Allerdings veränderten sich auch ihre eigenen Augen, wenn sie den Sturm beschwor, oder viel Magie kanalisierte.
»Zerbrich dir nicht den Kopf darüber«, wiederholte Samas und legte ihr dabei einen Arm um ihre Schultern. »Lass uns in die Herberge gehen und morgen sehen wir uns an, was da an der Grenze zu den Schwarzlanden los ist.«
4
Fürstentum Kromoi Hauptlager der Schwarzen Streitmacht
PHEROS
»Du bist dir absolut sicher, dass sie sich in Imrit aufhält?«
Titana streifte Maske und Handschuhe ab. Auch die Kapuze zog sie sich vom Kopf, wodurch das lange, goldgelockte Haar befreit wurde. Warme braune Augen begegneten seinem Blick. »Absolut sicher. Ich habe sogar ein paar Silberlinge von ihr bekommen. Für meinen wundervollen Gesang natürlich.« Schalk tanzte in ihren Augen. Pheros wusste, wie sehr sie dieses Maskenspiel liebte und wie gut sie darin war. Er lehnte sich zurück in seinen Stuhl, der am Kopfende des Kriegstisches stand, seine Schwester abwartend ansehend.
»Sie war nicht allein. Niemand geringeres als der jüngere Prinz begleitet sie.«
Was diese Information in Pheros auslöste, wusste er bestens zu verbergen, denn er war schon sehr lange sehr gut darin, seine Emotionen hinter einer nichtssagenden Miene zu verbergen.
»Sie haben sich allerhand Informationen über das Verschwinden der Dörfler beschafft, ohne dass diese misstrauisch wurden. Gaben sich als Reisende aus, aber um mich zu täuschen braucht es etwas mehr als einen verstellten Akzent und schlichte Kleidung. Offenbar wurden beide mit der Aufgabe betraut, dem Verschwinden nachzugehen. Die Spur führt direkt in die Schwarzlande.
Auch unsere führt dahin, was man nur als praktische Fügung bezeichnen kann. Wenn wir die Fürstentochter holen wollen, müssen wir bald zuschlagen, Bruder.« In einer fließenden Bewegung setzte sie sich auf den nächsten freien Stuhl.
Inzwischen waren auch die restlichen der Sieben im Hauptlager eingetroffen. Alle saßen sie in seinem Zelt, aßen Pheros’ Essen und tranken ihm den Wein weg. Fast wie Zuhause. Diese sechs konnten ihm so unfassbar auf die Nerven gehen wie niemand sonst in ganz Erea. Gleichsam würde er für jeden von ihnen sterben. Bedingungslos.
Lykaja stieß sich vom Stützbalken ab, an dem sie eben noch gelehnt hatte. »Das bedeutet, wir müssen die Schwarzlande betreten.«
Sie sprach es nicht aus, aber jeder von ihnen wusste, dass das zum Problem werden könnte, denn die Schwarzlande bestand zum Großteil aus unerforschtem Brachland. Verseucht von zu vielen dunklen Kreaturen. Die mochten vielleicht keine Gegner für die Waffen Lykaons sein und daher für Pheros auch keinen Grund zur Beunruhigung darstellen, aber was darüber hinaus dort existierte, blieb unklarer. Es gab keine Karten, keine Aufzeichnungen, nichts.
Alle Waffen Lykaons waren dazu ausgebildet, gegen allerhand Gegner anzutreten und bestehen zu können. Sie kannten die Furcht vor Monstern nicht. Aufgeben war nie Teil ihrer Erziehung gewesen. Dennoch fiel es ihm zu, mögliche Risiken abzuwägen.
»Nicht, wenn wir schnell sind«, warf Asea ein, die das Polieren ihrer Dolche einstellte, um sich dem Gespräch anzuschließen. Sie klemmte sich eine widerspenstige Strähne des kurzen schwarzen Haares hinter die Ohren.
Titana stimmte ihr nickend zu. »Wir müssen die Fürstentochter nur rechtzeitig abfangen.«
Genetor gab ein raues Lachen von sich, während er seine Doppelaxt parallel zu Aseas Dolchen ablegte. Beide liebten es, ihre Waffen zu reinigen. Sie taten es bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Oft hatte Pheros den Eindruck, dass sie ein Spiel spielten, dessen Regeln nur ihnen allein bekannt war. Ebenso wie die brüderliche Rivalität zwischen Tegeates und Ion, die niemand außer diesen beiden nachvollziehen konnte.
»Und wie stellen wir das an?«, erkundigte sich Tegeates. Er schwenkte den roten Inhalt seines Bechers und warf nur kurz einen Blick in die Runde. »Ziehen wir hübsche Kleider an, verstecken unsere Waffen unter unseren Röcken und lernen singen wie Titana?« Die blonde Waffe zwinkerte ihm zu.
Darauf antwortete Pheros sofort: »Nein. Das machen wir nicht.«
Tegeates zuckte mit den Schultern und hob den Becher an den Mund. »Nicht wieder, meinst du.«
»Hast du eine bessere Idee?«, fragte Ion. Auch auf seinen Lippen lag ein Schmunzeln. »Wenn wir Cailin empfindlich treffen wollen, müssen wir handeln, und das noch heute Nacht.«
Lykaja wandte sich an Titana. »Wie gut ist der Wachposten besetzt? Sie werden doch bestimmt zuerst dorthin gehen.«
»Dürftig. So nah an der Kriegsfront werden die meisten Soldaten dafür eingesetzt.«
Ion rieb sich nachdenklich den Nacken. »Und wenn wir sie raus locken? Werfen wir einen Köder aus.«
Lykaja wirkte nicht überzeugt. »Und womit lockt man einen Sturmfürsten in die Schwarzlande?«
»Wenn es übel läuft, reißt sie uns den Hintern auf.« Genetor war also für diesen Vorschlag. Sein Blick wanderte zu Titana. »Sie ist doch ein Sturmfürst, oder? Die Gerüchte sind doch wahr.«
Der Schöne Tod bestätigt dies mit einem Nicken.
Lykaja seufzte.
»Sie ist noch jung«, gab Asea zu bedenken.
»Sie ist genauso alt wie wir!«, erklärte Titana.
Ion schüttelt den Kopf. »Wir sollten sie dennoch nicht unterschätzen.«
»Was ist mit Samas?«, fragte Tegeates. Auch diese Frage galt Titana. Wie immer wusste sie zuverlässig Gerücht von Wahrheit zu trennen.
»Der ist noch kein Sturmfürst, aber da seine Mutter einer ist, wird er irgendwann nachziehen.«
Pheros konnte die bittere Galle nur schwer herunterschlucken, die ihm hochkommen wollte. Den Grund dafür kannte nur eine weitere Seele in diesem Raum und sie würde eher sterben, als sein Geheimnis preiszugeben. Auch wenn sie untereinander sonst nichts verbargen, so gab es doch die ein oder andere Schattenseite, die sie lieber für sich behielten. Lykajas Blick lastete auf Pheros. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er sie niemals mit dieser Last behängt, doch das Schicksal hatte einst andere Wege eingeschlagen und nun war es, wie es war. Manchmal fiel es Pheros noch immer schwer, in diesen sechs nicht mehr die kleinen schutzbedürftigen Kinder zu sehen, deren Überleben er garantieren musste, sondern ebenbürtige Erwachsene. Waffenbrüder und Schwestern. Kaum fünf Winter jünger als er. Er wusste, dass sie ihn nicht mehr brauchten und doch fiel es ihm schwer, das Verantwortungsgefühl ihnen gegenüber gänzlich abzuschütteln.
»Wir holen uns Mira Cornovier und nur sie«, verkündete er.
Das stieß auf Unverständnis. Natürlich tat es das. Was wäre das für ein Triumph, wenn sie sogar den Prinzen gefangen nehmen könnten? Lykaja sprang jedoch unterstützend ein, bevor Fragen gestellt werden konnten, die zu beantworten er nicht in der Lage war.
»Wir wollen die Grenze sprengen. Dazu brauchen wir Mira. Nicht den Prinzen. Ich glaube nicht, dass der König auf ein Druckmittel reagiert. Immerhin hat er ein Reich zu verlieren, aber Cailin? Bei ihr könnte ich mir schon eher vorstellen, dass sie kleinbeigibt.«
»Fein.« Titana schien nicht in Stimmung für langatmige Diskussionen zu sein. Dem Rest der Gruppe reichte Lykajas Erklärung aus. Der Schöne Tod legte geduldig die Hände in den Schoß. »Was ist also der Plan? Wir folgen dir, Pheros. Wie immer.«
Wenige Stunden später betrat Pheros, mit Lykaja an seiner Seite, die Schwarzlande. Flankiert wurden sie von seinem persönlichen Elitetrupp.
Ein starkes Gefühl der Aggression überkam ihn. Pheros hasste diesen Ort und wusste nicht mal, warum. Sämtliche Urinstinkte erwachten und lockten den Drachen unter seiner Haut hervor, sichtbar in den Augen manifestiert. Die Pupillen formten sich zu einer schmalen Linie, wodurch sich sein Blickfeld veränderte und um ein Vielfaches verschärfte. Der dunkle Farbton seiner Iris schwand und machte einem glühenden Rotgold Platz. Es war, als wollte dieser Ort allein durch seine Existenz die Seele des Drachen in Ketten legen, doch das verstärkte nur den Widerstand in ihm.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Keenan, Hauptmann seines Trupps. Die Soldaten der Schwarzen Flut waren es gewohnt, stets souveräne Anführer zu sehen. Stolze Waffen Lykaons, die letzten Drachen, die sie in die Schlacht führten, um zu siegen. Dieses Bild galt es zu erhalten, um ihre Moral nicht ins Schwanken zu bringen. In Situationen wie diesen konnte der Glaube an eine Sache über Leben und Tod entscheiden und jetzt gerade konnte Pheros ihre Angst riechen. Jede Silbe der Erklärung wäre nur ein Eingeständnis an die Furcht gewesen.
So gab er lediglich das Handzeichen zum Vorrücken und die Soldaten schwärmten aus. Pheros’ nächster Blick galt Lykaja. Flammende Drachenaugen trafen auf kühles Blau.
»Ungebrochen«, sagte er leise. Allein für ihre Ohren bestimmt.
»Standhaft«, erwiderte sie ebenso leise.
Der Leitspruch der Sieben. Eine stetige Erinnerung daran, wer sie waren und was sie überlebt hatten.
Es roch nach modriger Erde und abgestandener Feuchtigkeit. Ganz so, wie die erste Waffe es erwartet hatte. Kein Dickicht gab es hier, da kein lebendes Grün Wurzeln schlagen konnte. Dafür aber jede Menge Dunst und Dreck. Kahler Fels oder verdorrte Baumstümpfe, wie auch Bruchstücke von Gebäuden, und über allem hing dieser dichte, dunkle Nebel. Wie ein Schleier, der den Blick in die Ferne unmöglich machte.
Nin, höchster und ehrwürdigster aller Götter, schien jedoch auf ihrer Seite zu sein. Nicht, dass Pheros auf den Zuspruch des Gottes angewiesen wäre, oder gar zu ihm betete. Immerhin mussten sie nicht lange durch die Schwärze wandern, um die Wachfestung zu erreichen. Hinter einem breiten Felsvorsprung bedeutete er seinem Trupp, in Deckung zu gehen.
Die hohen Türme ragten weit in den dunklen Nachthimmel hinein. Hier und da erkannte Pheros deutliche Mängel an der Fassade. Mehr als ein Dutzend Möglichkeiten, diesen Wächter in Schutt und Asche zu legen und dafür bräuchte es nicht mal einen Tribock.
Irgendwo in der Nähe trieben dunkle Kreaturen ihr Unwesen. Pheros spürte sie deutlich.
Sie näherten sich jedoch nicht. Vielleicht witterten sie die Drakestai, denn immerhin flüsterte ihm sein Instinkt auch von ihrer Existenz zu. Sollten sie tatsächlich über eine gewisse Form der Intelligenz verfügen, erkannten sie womöglich das größere Raubtier in Lykaja und ihm. Vielleicht waren sie klug genug, sich deshalb fernzuhalten.
Die erste Hälfte des Plans lief ohne Komplikationen ab. Sein Trupp war in Position. Nun galt es, auf das Signal zu warten. Eigens dafür hatte sich Titana erneut als Bardin verkleidet und sich zur Festung begeben. Sobald sie Mira lokalisierte, würde sie sich bemerkbar machen.
Sie kauerten noch nicht lange in der Dunkelheit, als die Trommeln der Festung Alarm schlugen. Zwar besaß jedes Reich seine eigenen Trommelkodes, doch das für Feuer war universal. Nur kurz danach waren die Flammen auch schon zu sehen.
Die Augenbraue der Ersten Waffe wanderte höher, während er auf das Inferno in der Ferne starrte.
»Ist das das Zeichen?«, hörte er einen seiner Männer flüstern.
Lykaja, die direkt neben ihm am Boden kauerte, nickte kaum merklich. »Subtil.«
»Ja«, kommentierte er trocken, ohne den Blick von dem Spektakel zu nehmen.
Einen Moment später riss eine Explosion ein riesiges Loch in die Mauer. Der schwarze Rauch der Flammen vermischte sich mit dem Nebel und erschwerte die Sicht zusätzlich.
Das Loch in der Mauer spülte reichlich Soldaten in die Schwarzlande. Blind umherstolpernd, gaben diese – offenbar schlecht ausgebildeten – Männer ein mehr als leichtes Ziel ab. Ihr Glück, dass Pheros nicht ihretwegen hier war. Es dauerte nicht lange und ein blonder Haarschopf mischte sich unter das Chaos. Sehr viel flinker, als er ihr zugetraut hätte, überwand sie das unebene Gelände und half auch anderen wieder auf die Beine. Ihr Blick wirkte konzentriert und weit davon entfernt, sich der allgemeinen Panik anschließen zu wollen.
»Bruder?«
Lykaja zog bereits einen Pfeil aus ihrem Köcher am Oberschenkel und legte diesen auf die Sehne ihres Bogens.
»Noch nicht«, wies er sie an.
»Nicht! Bleibt hier!«, rief Mira den davonstürmenden Männern zu, doch die wenigsten hörten auf sie.
Eine Männerstimme erklang. »Mira! Lass sie!«
Der Prinz.
Der Rauch war zu dicht, um ihn von Pheros’ Position aus richtig erkennen zu können, aber er war sich ziemlich sicher, dass es sich dabei um Samas handeln musste. Mira wirbelte herum.
»Wir können sie doch nicht in ihr Verderben rennen lassen!«
»Und wie wir das können!«
Mira wurde einige Schritte zurückgezogen, doch dann stemmte sie die Füße in den Boden und riss ihren Arm los. »Geh und führe die anderen raus aus diesem Loch!«
»Mira!«
»Nein, Samas! Diesmal nicht!«
»Ich lasse dich nicht –«
»Doch! Genau das wirst du tun!«
»Nein!«
Er packte sie am Arm und jetzt unterdrückte Pheros ein Augenrollen. An Samas’ Stelle hätte er sich nicht auf dieses Geplänkel eingelassen, sondern die Fürstentochter einfach über die Schulter geworfen, aber vielleicht gehörte das in Makhai ja zum guten Ton.