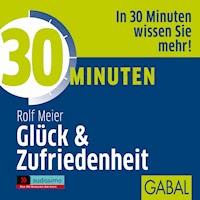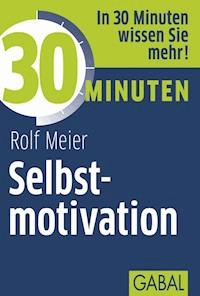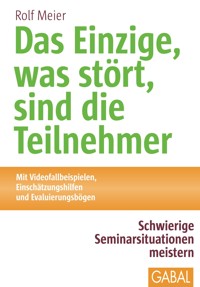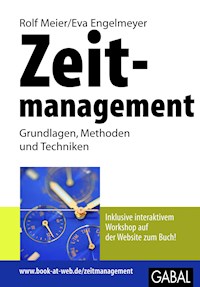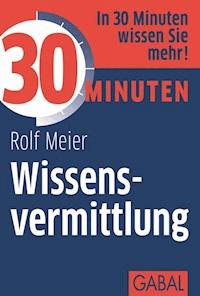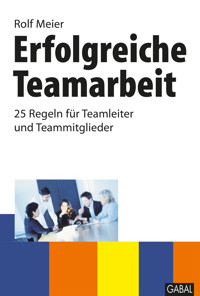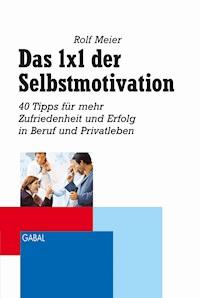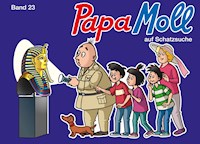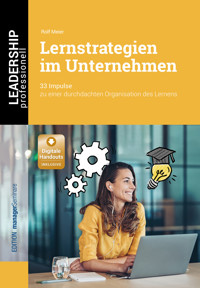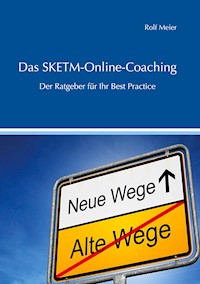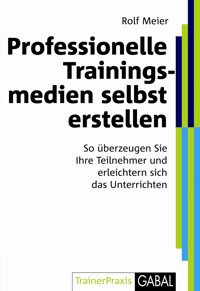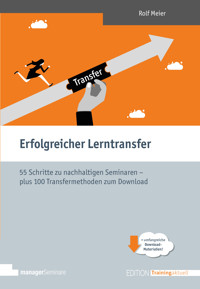
44,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: managerSeminare Verlags GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Lerntransfer erfolgreich gestalten – Als Trainerin oder Personalentwickler wissen Sie: Ein Seminar ist nur dann erfolgreich, wenn das Gelernte im Alltag angewendet wird. Doch oft scheitert genau das. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie Schulungen praxisnah gestalten, den Seminarerfolg steigern und Weiterbildung effizient nutzen. Erfahren Sie, welche Transferförderung im Unternehmen nötig ist, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Machen Sie Ihre Trainings wirksam – mit Methoden, die den Lerntransfer wirklich sichern! Ihr Download-Bonus: Eine Sammlung mit über 100 praxisnahen Transfermethoden.
Erfolgreicher Lerntransfer – So machen Sie Ihre Schulungen wirksam.
Wie oft erleben Sie es als Trainerin oder Personalentwickler, dass Teilnehmende nach einem erfolgreichen Seminar hochmotiviert sind – doch schon nach wenigen Tagen ist von den neuen Erkenntnissen im Arbeitsalltag kaum noch etwas zu sehen? Lerntransfer ist der entscheidende Faktor, der darüber bestimmt, ob eine Schulung echten Mehrwert bietet oder ob sie bloß eine kurze Inspiration bleibt. Doch die Realität zeigt: Ohne gezielte Maßnahmen bleibt der Seminarerfolg aus, und das Potenzial der Weiterbildung wird nicht ausgeschöpft.
Dieses Buch liefert Ihnen eine praxisnahe Anleitung, um den Lerntransfer aktiv zu fördern. Sie erfahren, wie Sie Schulungen praxisnah gestalten, Transferbarrieren erkennen und gezielt abbauen sowie Methoden einsetzen, die einen direkten Transfer in die Praxis ermöglichen. Es zeigt Ihnen, wie Sie Teilnehmende gezielt begleiten, damit das Gelernte nachhaltig im Arbeitsalltag verankert wird. Denn eine nachhaltige Weiterbildung zeigt sich nicht im Seminarraum – sondern an verbesserten Leistungen und einer gesteigerten Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden.
Ein erfolgreiches Training endet nicht mit der letzten Folie oder einer gelungenen Feedbackrunde. Damit Wissen tatsächlich zur Anwendung kommt, sollten Transferstrategien schon in der Planungsphase einer Schulung berücksichtigt werden. Das Buch stellt Ihnen konkrete Ansätze vor, um Weiterbildung effizient zu nutzen, und zeigt, wie Sie als Seminarleitung nicht nur inspirieren, sondern eine erfolgreiche Mitarbeiterentwicklung aktiv unterstützen. Lernen Sie, welche Transferförderung im Unternehmen nötig ist und wie Sie mit den richtigen Methoden sicherstellen, dass neue Fähigkeiten wirklich in die Praxis übergehen.
Ein besonderer Fokus liegt auf dem Lernen am Arbeitsplatz, denn der Transfer endet nicht mit dem Seminar, sondern beginnt erst richtig im beruflichen Alltag. Führungskräfte und Teams spielen eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung. Das Buch zeigt Ihnen, wie Sie diese Akteure gezielt einbinden, um einen Trainingseffekt mit langfristiger Wirkung zu erzielen.
Nutzen Sie die erprobten Strategien dieses Buches, um Schulungen nicht nur durchzuführen, sondern sie zu einem echten Erfolg für Teilnehmende und Unternehmen zu machen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rolf Meier
Erfolgreicher Lerntransfer
55 Schritte zu nachhaltigen Seminaren
© 2025 managerSeminare Verlags GmbH
Endenicher Str. 41, D-53115 Bonn (Deutschland)
Tel.: 0228-977910
www.managerseminare.de/shop
Der Verlag hat sich bemüht, die Copyright-Inhaber aller verwendeten Zitate, Texte, Abbildungen und Illustrationen zu ermitteln. Sollten wir jemanden übersehen haben, so bitten wir den Copyright-Inhaber, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
ISBN: 978-3-98856-400-9
Herausgeber der Edition Training aktuell:
Ralf Muskatewitz, Jürgen Graf, Nicole Bußmann
Lektorat: Sarah Bierbaum
Cover: Sabrin Khalaf
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Inhalt
Einleitung
Vorwort
Ihr Fahrplan
Ihre Bestandsaufnahme
Basics – Ohne Transfer ist alles nichts
Sehen Sie Lernen als Prozess
Denken Sie an Ihre Kundinnen und Kunden
Schaffen Sie Möglichkeiten zum Transfer
Unterscheiden Sie Situationen und mentale Konzepte
Fördern Sie die Entwicklung von Strategien
Nutzen Sie Wirkfaktoren
Bedarfssituation – Transfer beginnt vor der Schulung
1. Ermitteln Sie den Bedarf von Gruppen
2. Bestimmen Sie den individuellen Bedarf
3. Beziehen Sie die Führungskraft mit ein
4. Setzen Sie den Fokus auf Teammaßnahmen
5. Achten Sie auf die Rahmenbedingungen
6. Planen Sie zusammen mit den Teilnehmenden
Teilnehmeranalyse – Passende Angebote zur passenden Zeit
7. Achten Sie auf die Vorkenntnisse
8. Berücksichtigen Sie unterschiedliche Lernkompetenzen
9. Fördern Sie die Lernmotivation
10. Stärken Sie die Erfolgserwartung
11. Bringen Sie die richtigen Teilnehmenden zusammen
12. Achten Sie auf den richtigen Zeitpunkt
Lerndesign – Der richtige Rahmen für erfolgreiche Lernprozesse
13. Wählen Sie passende Lernwege und Lernformen
14. Setzen Sie auf Transferziele und Stoffreduktion
15. Nutzen Sie Workshops
16. Bilden Sie den Lernprozess nach
17. Setzen Sie auf Blended Learning
18. Nutzen Sie die Lernzeit effizient
Lernsetting – Schulungen von der Stange nützen wenig
19. Denken Sie an die Bedeutung der Trainerin oder des Trainers
20. Sorgen Sie für ein gutes Lernklima
21. Sichern Sie eine hohe Lerneffizienz
22. Setzen Sie auf eine strikte Teilnehmeraktivierung
23. Achten Sie auf einen strikten Praxisbezug
24. Fördern Sie entdeckendes Lernen
Transferförderung – Die Schulung muss auf die Umsetzung ausgerichtet sein
25. Vermitteln Sie Fachkenntnisse mit Alltagsnutzen
26. Fördern Sie die Aneignung von Fertigkeiten
27. Sichern Sie die Methodenkompetenz
28. Unterstützen Sie im kommunikativen Alltag
29. Helfen Sie bei Alltagsproblemen
30. Geben Sie Hilfe zur Selbsthilfe
Transfer in die Praxis – Die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit
31. Rechnen Sie mit Hemmnissen
32. Bereiten Sie die Umsetzung vor
33. Arbeiten Sie mit medialen Transferhilfen
34. Fördern Sie den Austausch
35. Achten Sie auf positive Lernerfahrungen
36. Arbeiten Sie mit einem Umsetzungsworkshop
Individuelle Transfersicherung – Mit der Schulung ist das Lernen noch nicht zu Ende
37. Sorgen Sie für eine gute Unterstützung
38. Setzen Sie auf die Unterstützung der Führungskraft
39. Stärken Sie die Umsetzungsmotivation
40. Verringern Sie Umsetzungsrisiken
41. Stellen Sie Routinen und Gewohnheiten in Frage
42. Sichern Sie die Nachhaltigkeit
Umfeld-Transfersicherung – Nicht nur Teilnehmende sollen profitieren
43. Schaffen Sie ein gutes Transferklima
44. Lassen Sie das Team von den Erkenntnissen profitieren
45. Stoßen Sie Teamprozesse an
46. Arbeiten Sie mit Multiplikatoren
47. Installieren Sie Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung
48. Schaffen Sie im Team ein Bewusstsein für Qualitätsfragen
Qualitätssicherung – Für die Evaluation bedarf es eines neuen Ansatzes
49. Setzen Sie den Fokus auf die Transferevaluation
50. Fragen Sie nach den Zielen
51. Stützen Sie sich auf präzise Daten
52. Werten Sie den Umsetzungsplan aus
53. Ermitteln Sie die Umsetzungshemmnisse
54. Überprüfen Sie den Nutzen von Unterstützungsmaßnahmen
55. Nutzen Sie Transfergespräche
Service
Was für Sie sonst noch interessant sein könnte
Jetzt sind Sie dran
Literatur
Stichwortverzeichnis
Einleitung
Vorwort
Ihr Fahrplan
Ihre Bestandsaufnahme
Ihr Fahrplan
Sie kennen die Transferproblematik, die Schwierigkeit, Gelerntes in die Praxis zu überführen. Wenn Sie von diesem Buch viel profitieren wollen, stellt sich die gleiche Herausforderung: möglich viel an Erkenntnissen in die Schulungspraxis herüberzuretten.
Teilnehmende an Schulungen benötigen Unterstützung und das gleich von mehreren Seiten:
von einer Führungskraft, die den Lernprozess begleitet,
vom Bildungsexperten, der sich Mühe mit einem transferorientierten Lerndesign gibt,
von dem Trainer, der seinen Fokus auf praxistaugliche Inhalte setzt und eine erfolgreiche Umsetzung vorbereitet.
Lernprozesse unterstützen
Alle Fachleute, die direkt oder indirekt an Lernprozessen beteiligt sind, sollten wissen, wie sie den Transfer unterstützen können, bei der Planung, in der Schulung, aber auch durch Maßnahmen nach der Schulung.
Um einen erfolgreichen Lerntransfer zu sichern, müssen die Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse der Teilnehmenden eng verzahnt sein mit einer praxisorientierten Gestaltung des Trainings und einer Transferförderung, die diesen Namen verdient.
Sieht man genauer hin, zeigen sich acht Bereiche, die Einfluss nehmen auf einen gelungenen Transfer.
Die acht Bereiche eines gelungenen Transfers
Erste, wichtige Aufgaben sind die Klärung der Bedarfssituation und eine präzise Teilnehmeranalyse. Auf dieser Grundlage lässt sich dann das Lerndesign entwickeln.
Achten Sie darauf, dass die Bedarfsanalyse nicht automatisch zu einer Teilnahme an einem Training führt. Denn Trainings sind nur eine Möglichkeit des Lernens und nicht für alle Menschen immer die passende Wahl.
Leider kann auch die beste Schulung nicht verhindern, dass Teilnehmende Schwierigkeiten haben, die Lerninhalte sofort anzuwenden oder umzusetzen. Aber Sie können sie auf die Umsetzung vorbereiten und dazu beitragen, dass Ihren Teilnehmenden diese leichter gelingt. Diesbezüglich bietet es sich an, die Transferphase direkt in das Qualifizierungskonzept mit einzubeziehen.
Nur durch solch eine systematische Herangehensweise lässt sich verhindern, dass Bildungsmaßnahmen angeboten werden, die vielleicht, aber eben nur vielleicht, lernwirksam sind und einen hohen Praxisnutzen aufweisen.
Welche Themen erwarten Sie?
Bedarfssituation
Bedarf der Teilnehmenden beachten
Der Ausgangspunkt für jedwede Schulung ist der konkrete Bedarf einer bestimmten Fach- oder Führungskraft. Ziel ist es, ihr Hilfsmittel an die Hand zu geben, die sie darin unterstützen, Alltagsfragen und -probleme selbstständig zu lösen sowie Alltagssituationen zu meistern. Schulungen müssen immer an den Bedarf der Teilnehmenden angepasst sein. Es darf nicht passieren, dass Fach- oder Führungskräfte Schulungen besuchen, die keinen konkreten Nutzen für den Alltag haben.
Teilnehmeranalyse
Teilnehmende kommen mit eindeutigen Zielen, bestimmten Vorerfahrungen und klaren Erwartungen in eine Schulung. Auch die individuelle Lernkompetenz spielt bei allen Beteiligten eine Rolle. Die Teilnehmervoraussetzungen sollten immer Grundlage für den Aufbau der Schulung, die Auswahl der Themen und die Wahl der Methoden sein.
Lerndesign
Das richtige Lerndesign fördert den Transfer
Es gibt unterschiedliche Lernwege und unterschiedliche Formen von Qualifizierungen. Es gilt, den Weg und die Form auszuwählen, die zu den Zielen der Teilnehmenden und zum Lernbedarf passen, sowie gleichzeitig darauf zu achten, dass das Lerndesign gut geeignet ist, den Transfer zu fördern. Meist bietet sich eine Kombination verschiedener Lernwege und Lernformen an.
Lernsetting
Trainerinnen und Trainer sollten ihre Schulungen strikt auf den Transfer ausrichten und demgemäß auf die Methoden und Medien zurückgreifen, die den Transfer fördern. Das erfordert nicht selten, dass Trainerinnen und Trainer auf gängige Schulungsverläufe mit längeren Phasen theoretischen Inputs ganz verzichten müssen.
Transferförderung in der Schulung
In jeder Schulung gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Transfer zu fördern. Es gilt, die richtigen Methoden auszuwählen und sie gezielt einzusetzen.
Transfer in die Praxis
Den Transfer in die Praxis sollten Sie genauso präzise planen wie die Schulung selbst. Dazu gehören die Planung von Transferhilfen, die Förderung des Austausches sowie die Entwicklung von Umsetzungsstrategien.
Individuelle Transfersicherung
Unterstützung durch die Führungskraft
Die einzelnen Teilnehmenden sind primär selbst verantwortlich für die Umsetzung des Gelernten. Allerdings dürfte es oft ohne Unterstützung nicht gehen. Eine besondere Rolle kommt dabei der Führungskraft zu.
Umfeld-Transfersicherung
Die Umsetzung sollten möglichst nicht die Teilnehmenden allein, sonders das Team in Angriff nehmen, in dem sie arbeiten. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Gemeinsam ist es einfacher, Möglichkeiten der Umsetzung auszuloten und Maßnahmen Schritt für Schritt umzusetzen.
Qualitätssicherung
Evaluationsstrategie
Ob Erkenntnisse und Erfahrungen aus Schulungen im Alltag ankommen, ist keine Frage des Vermutens. Zu einer systematischen Transferförderung und -sicherung gehört auch eine angemessene Strategie der Qualitätssicherung, mit aussagekräftigen Kennwerten und einer passenden Evaluationsstrategie.
Info: Zu diesem Buch gibt es begleitende Arbeitshilfen zum Herunterladen. Die Download-Ressourcen sind im Buch durch das nebenstehende Symbol gekennzeichnet. Den Link hierzu finden Sie in der inneren Umschlagklappe des Buchs (Print) bzw. auf Seite 2 unter den bibliografischen Angaben (E-Book).
BedarfssituationTransfer beginnt vor der Schulung
1. Ermitteln Sie den Bedarf von Gruppen
2. Bestimmen Sie den individuellen Bedarf
3. Beziehen Sie die Führungskraft mit ein
4. Setzen Sie den Fokus auf Teammaßnahmen
5. Achten Sie auf die Rahmenbedingungen
6. Planen Sie zusammen mit den Teilnehmenden
Erfolgswahrscheinlichkeiten
Wie gut ein Training tatsächlich ist, zeigt sich an dessen Wirkungen im (Berufs-)Alltag. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Training zu den erhofften Resultaten führt, variiert. Fast unmöglich wird sie, wenn beispielsweise Fachkräfte Fachseminare besuchen, die thematisch gar nicht ihr Aufgabengebiet betreffen. Die Erfolgswahrscheinlichkeiten steigen wiederum, wenn das Training genau auf den Bedarf angepasst ist, die Teilnehmenden vom Nutzen überzeugt sind und die Umsetzung leicht möglich ist und zudem systematisch unterstützt wird.
Die Bedeutung der Abstimmung der Planung auf die Teilnehmervoraussetzungen sollten Sie nicht unterschätzen. Ohne die Lernbedürfnisse der Teilnehmenden zu kennen und zu berücksichtigen, muss jedes Seminar provisorisch bleiben.
Vermeiden Sie angebotsorientierte Schulungen, wie dies in vielen Organisationen noch üblich ist. Es ist einfach, bestimmte, häufig nachgefragte Schulungen anzubieten. Und mit einigen Themen können Sie eigentlich nicht danebenliegen. Zeitmanagement, Belastungsbewältigung, Rhetorik und Projektmanagement sind immer nachgefragt.
Eine Fülle von Schulungsangeboten zu entwickeln und online zu stellen, zeugt nur vordergründig von der Leistungsfähigkeit des Bereichs Learning & Development. Es ist eher ein Beleg dafür, dass die Analyse des Bedarfs und die Ausrichtung der Trainings auf diesen Bedarf vernachlässigt wird.
Bedarfssituation
Bildungsmaßnahmen, die sich auf Wünsche der Fachkräfte stützen, dürften häufig eine hohe Zufriedenheit als Ergebnis aufweisen, der praktische Nutzen für den Alltag, gar für die Organisation, ist aber meist schwer nachzuweisen Jedoch ist es schwer, den praktischen Nutzen für den Alltag oder gar für die Organisation abzuschätzen. Es geht nicht um Bedürfnisse, es geht um Bedarf. Unpräzise Bedarfsanalysen können von vorneherein den Nutzen der Qualifizierung schmälern oder sogar verhindern. Wenn etwa Fachkräfte sich Schulungen wünschen, deren Nutzen weder die Vorgesetzten noch die Weiterbildungsprofis einschätzen können, kann der Nutzen tatsächlich vorhanden sein – es bleibt aber eine Vermutung.
Die Bedarfsanalyse gehört zu den Kernaufgaben von Learning & Development, wobei auch ein Trainer diese Aufgabe übernehmen kann. Wichtig ist, dass vorher untereinander abgesprochen wird, wer sich darum kümmert.
Fragen, die Sie bei der Planung berücksichtigen sollten
Sie als Bildungsexperte oder Trainerinnen und Trainer müssen bereits bei der Planung der Schulung Folgendes wissen und beachten:
Wo arbeiten die Teilnehmenden?
Welche Aufgaben sind ihnen anvertraut?
Unter welchen Rahmenbedingungen arbeiten sie?
Wie sehen die zugehörigen Arbeitsabläufe aus?
Welche möglichen Schwierigkeiten können bei der Arbeit in welcher Häufigkeit auftreten?
Wie können und sollen die Teilnehmenden auf ebendiese Schwierigkeiten reagieren?
Wie können Abläufe bei Schwierigkeiten produktiver gestaltet werden?
Gut wäre es, wenn die Teilnehmenden aus demselben Arbeitsbereich kommen, vergleichbare Tätigkeiten ausüben und Sie die Arbeitsplätze der Teilnehmenden aus eigener Erfahrung kennen.
Schwieriger ist eine Bedarfsanalyse, wenn Schulungen offen ausgeschrieben werden, keine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Auch hier ist eine Berücksichtigung der Arbeitssituation möglich, auch wenn es in erster Linie darum geht, Gemeinsamkeiten zu finden, die auf möglichst alle Teilnehmenden zutreffen.
Sechs Schritten sollten Sie bei der Bedarfsanalyse besondere Aufmerksamkeit widmen:
Bedarf von Gruppen analysieren
individuellen Bedarf bestimmen
Führungskraft einbeziehen
Bedarfssituation
Fokus auf Teilnehmermaßnahmen setzen
Rahmenbedingungen berücksichtigen
Teilnehmende bei der Planung einbeziehen
Schritt 1 Ermitteln Sie den Bedarf von Gruppen
Bei der Planung von Qualifizierungsmaßnahmen gibt es zwei Ansätze:
Sie planen Maßnahmen für eine bestimmte Zielgruppe, wissen aber noch nicht, wer sich zum Training anmelden wird.
Sie planen eine Veranstaltung für eine bestimmte Teilnehmergruppe. In diesem Fall wissen Sie, wer die Schulung besuchen wird.
In beiden Fällen gibt es bestimmte Anlässe, die eine Qualifizierung notwendig machen.
Bei der Aufgabenanalyse geht es um die Effektivität und Effizienz der Arbeit:
Welche Aufgaben werden vernachlässigt?
Wo gibt es Möglichkeiten zur Erhöhung der Produktivität?
Wo zeigen sich Defizite bei der Aufgabenerledigung?
Wo existieren Einbußen bei der Qualität?
Bei der Verhaltensanalyse stehen die Fach- und Führungskräfte selbst im Mittelpunkt:
Wie verhalten sie sich in bestimmten Situationen, bei bestimmten Anforderungen?
Wo lassen sich Mängel erkennen?
Wo zeigt sich Unzufriedenheit bei den Kundinnen und Kunden?
Wo tauchen immer wieder Fehler auf?
Wie lassen sich diese Mängel ausräumen?
Die Verhaltensanalyse ist in vielen Bereichen der Methodenkompetenz und in allen Bereichen der Sozialkompetenz einsetzbar. Ein Beispiel ist der Umgang mit „schwieriger“ Kundschaft. Voraussetzung für eine Verhaltensanalyse ist allerdings eine ausreichende Zahl an Beobachtungen oder eine Befragung, im Beispiel etwa bei Kundinnen und Kunden.
Die Betroffenheitsanalyse untersucht, ob Fachkräfte von Veränderungen und Neuerungen betroffen sind, und wenn ja, in welcher Weise und welcher Schulungsbedarf daraus entsteht.
Typische Situationen sind:
Die Rahmenbedingungen ändern sich. Beispiel: Niederlassungen werden aufgegeben, die Produktion wird zusammengelegt.
Die Arbeitsabläufe ändern sich. Beispiel: In der Auftragsabwicklung wird SAP eingeführt.
Maßnahmen der Organisationsentwicklung machen Qualifizierungen notwendig. Beispiel: Es werden neue Maschinen angeschafft. Die Mitarbeitenden müssen darin geschult werden, mit diesen Maschinen umzugehen.
Neue Aufgaben kommen hinzu. Beispiel: Die Qualitätssicherung soll zusätzlich die Wareneingangskontrolle übernehmen.
Ressourcen werden zentralisiert oder dezentralisiert. Beispiel: Eine Niederlassung übernimmt komplett den Wareneinkauf.
Die Betroffenheitsanalyse kann damit gut zur Analyse des (wahrscheinlichen) Bedarfs bestimmter Zielgruppen genutzt werden.
Die Problemanalyse versucht Reibungspunkte aufzuspüren und abzustellen. Ein Beispiel sind gehäufte Kundenbeschwerden wegen langer Bearbeitungszeiten bei Reklamationen. Auch hier ist man wieder auf Beobachtungen angewiesen, andere Methoden sind Gespräche oder Datenerhebungen.
Eine Sonderform der Problemanalyse ist die Analyse kritischer Zwischenfälle. Auf dieser Grundlage lassen sich Qualifikationen ableiten, die helfen, solche Vorfälle zu vermeiden. Ein Beispiel sind Beschwerden wegen unhöflichen Personals im Kundenservice.
Die Schwachstellenanalyse nimmt Abläufe unter die Lupe und analysiert, wo es „hakt“. Ein Beispiel ist der mangelnde Informationsaustausch zwischen Fachabteilungen. Ermitteln lässt sich dies in Gesprächen und Workshops.
Analysen können wichtige Hinweise für Qualifizierungsbedarf bieten
Die genannten Methoden können wertvolle Hinweise für Qualifizierungsbedarf liefern. Voraussetzung ist auch hier, dass der Bereich Learning & Development sich entweder aktiv dieser Methoden bedient oder über entsprechende Analysen – etwa mithilfe des Organisations- oder IT-Referats – Kenntnis erlangt.
Nur auf der Grundlage einer solchen Bedarfsanalyse lässt sich zudem beurteilen, ob ein Training überhaupt ein sinnvoller Weg ist oder ob es nicht angemessener wäre, auf alternative Lernformen zurückzugreifen. Gute Beispiele sind hierfür ein Tutorensystem oder ein regelmäßiger Austausch zwischen Fachkolleginnen und -kollegen.
Bei Zielgruppen und Teilnehmergruppen ist das Vorgehen unterschiedlich. Im ersten Fall erfolgt die Planung mit Blick auf den (vermeintlichen) Bedarf einer mehr oder weniger klar umrissenen Gruppe an Fach- oder Führungskräften mit ähnlichen Aufgaben. Im zweiten Fall wird meist der Wunsch nach einem Training an den Bereich Learning & Development herangetragen.
Bedarf von Zielgruppen
Viele Qualifizierungsangebote wenden sich an bestimmte Zielgruppen, wie etwa:
Ausbildung von Multiplikatoren,
Ausbildung am Arbeitsplatz,
Einarbeitung neuer Fachkräfte.
Die Schulung von Zielgruppen ist ein wichtiges Feld der betrieblichen Qualifizierungsstrategie, da viele Ziele des Unternehmens nicht ohne eine systematische Qualifizierung einzelner Zielgruppen erreicht werden.
Zielgruppenentwicklung
Ein typisches Feld bei der Zielgruppenentwicklung ist die Qualifizierung von Führungskräften. Aber es gibt auch eine ganze Reihe anderer Zielgruppen, die Sie nicht vergessen sollten. Denken Sie etwa an einen Servicetechniker, eine Kundenbetreuerin oder an Fachkräfte im Custumer Service. Denken Sie auch an die vielen zusätzlichen Aufgaben, die in einem Unternehmen anfallen, von der Sicherheitsbeauftragten bis hin zum Ersthelfer.
Auf keinen Fall sollte es passieren, dass einer Gruppe von Fachkräften bestimmte Aufgaben und Funktionen im Unternehmen anvertraut werden, ohne dass sie dafür die notwendige Qualifikation besitzen. Und diese Qualifikation sollte zeitnah erfolgen.
Selbst bei Maßnahmen, die sich explizit an bestimmte Zielgruppen richten, ist eine Differenzierung innerhalb der Zielgruppen für ein bedarfsgerechtes Training oft sinnvoll.
Führungskräfteentwicklung
Beispiel
Hier lassen sich unterscheiden:
Nachwuchsführungskräfte
Führungsebene I (Teamleitung)
Führungsebene II (Bereichsleitung)
Führungsebene III (Abteilungsleitung)
Leitungsspitze
Bei der Schaffung von Angeboten für Zielgruppen darf nicht am Bedarf vorbei entwickelt werden. Dies ist durch einen ausreichend intensiven Dialog mit der Zielgruppe sicherzustellen.
Reden Sie nicht über die Zielgruppen, reden Sie mit den Zielgruppen.
Ebenso wichtig ist die Akzeptanz der Maßnahmen. Dies ist keine Frage des Vermutens, sondern dies muss abgesichert werden.
Das Hauptproblem bei der Entwicklung von Bildungsmaßnahmen bei Zielgruppen ist die Streubreite des individuellen Bedarfs. In jedem Fall muss deshalb vor der Durchführung von Schulungen für einzelne Zielgruppen geprüft werden, wie der individuelle Bedarf aussieht.
Beispiel
Sollen alle Führungskräfte Kompetenzen im Führen von Zielvereinbarungsgesprächen, Leiten von Teams und in der Leistungsbewertung erwerben, sollte erst einmal festgestellt werden, wer im Einzelnen bereits über welche Vorkenntnisse verfügt.
Bedarfsdeckung in drei Schritten
Methodisch sollten Sie bei der Bedarfsdeckung deshalb in drei Schritten vorgehen:
Als erstes müssen Sie den Bedarf der Zielgruppe präzise bestimmen. Hier hilft eine Aufgabenanalyse.
Als nächstes müssen Sie abgrenzen, wer zur Zielgruppe gehört und wer nicht. Hier können Sie einen Vergleich der Aufgaben der Zielgruppe mit den Aufgaben der einzelnen Fach- und Führungskraft vornehmen.
Danach müssen Sie überprüfen, ob die einzelne Fach- oder Führungskraft aus der Zielgruppe diesen Bedarf überhaupt individuell hat.
Alle Personen, die einer Zielgruppe zugehörig sind, ohne Bedarfsanalyse zu schulen, also frei nach dem Motto „Du hast Pech, Du gehörst zur Zielgruppe und wirst deshalb auch geschult“, ist weder ökonomisch noch der Motivation der Teilnehmenden zuträglich.
Zielgruppenspezifische Qualifizierungen sind nicht immer der richtige Weg. Sinnvoller dürften oft individuelle Entwicklungsprogramme sein – ein aufwendiges, aber sicherlich wirkungsvolleres Verfahren als Schulung nach dem Gießkannenprinzip. Das Bedarfsprofil der Zielgruppe bildet dafür den Rahmen.
Bedarf von Teilnehmergruppen
Sammeln Sie Informationen über die Teilnehmenden
Sie haben den Auftrag, eine Schulung für eine bestimmte Teilnehmergruppe durchzuführen. Dann sollten Sie sich Informationen über die Teilnehmenden besorgen, um ihnen genau die Schulung zu bieten, die sie sich wünschen und mit den Inhalten, die sie benötigen.
Nehmen Sie diese Chance wahr. Zu viele Schulungen geraten allein deshalb in Schieflage, weil die Trainerin oder der Trainer zu wenig Informationen über Ziele der Schulung, über die Vorkenntnisse und Erwartungen der Teilnehmenden gesammelt hat und sich so nicht präzise genug vorbereiten konnte.
Bereits bei der Ermittlung des Bedarfs sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, gemeinsam darüber nachzudenken, bei welchen Tätigkeiten und in welchen Situationen neue Herangehensweisen notwendig sind und wie die Schulung dazu beitragen kann, gezielt solche Änderungen vorzunehmen.
Meist geschieht die Bedarfsanalyse im Vorgespräch mit dem Auftraggeber. Wichtig ist für Sie, den Anlass zu kennen und die Frage zu klären, wie es zu dem Wunsch nach einer Schulung gekommen ist.
Leitfragen der Bedarfsanalyse
Dabei helfen Ihnen folgende Fragen:
Von wem ging die Initiative für die Maßnahme aus?
Was soll mit der Maßnahme bewirkt werden?
Warum ist die Maßnahme gerade jetzt aktuell?
Worauf sollen Sie bei der Planung der Schulung besonders achten?
Wie lange darf die Schulung dauern?
Fragen Sie auch nach den Teilnehmenden:
Wie wurden die Teilnehmenden für die Maßnahme ausgewählt?
Wie hoch ist die Bereitschaft der Teilnehmenden, an der Maßnahme teilzunehmen?
Klären Sie die Ziele ab:
Was soll mit der Maßnahme erreicht werden?
Was genau sollen die Teilnehmenden nach dem Training wissen, können und umsetzen?
Welche Themen sollen im Schwerpunkt behandelt werden?
Welche Alltagsfragen und Alltagsprobleme sollen Gegenstand der Schulung sein?
Wenn das Training erfolgreich ist, woran wird der Auftraggeber dies merken?
Das Gespräch mit dem Auftraggeber schafft einen groben Rahmen. Präzisere Informationen erhalten Sie, wenn Sie zusätzlich den Bedarf der einzelnen Teilnehmenden in den Blick nehmen.