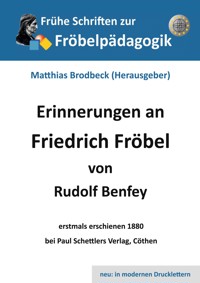
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch gibt Einblicke in das Leben und in die Gedankenwelt Friedrich Fröbels sowie in seine Wirkungskreise. Mitte der 1840er Jahre ereilte den Journalisten und Schriftsteller Rudolf Benfey die Kunde von Friedrich Fröbel und er machte sich auf, ihn zu finden. Sie erleben in diesem Buch, wie Benfey vom 'Außenstehenden' immer mehr zum 'Involvierten' wird, wie aus ursprünglicher Reserviertheit Fröbels ein immer vertrauteres Neben- und Miteinander wird. Dabei erfahren Sie Fröbel als Menschen in seinem Wirkungskreis, in seinen vielfältigen sozialen Beziehungen und Sie begeben sich auf die eine oder andere "Tagesreise" im Leben des großen Pädagogen und Kindergartenerfinders. Sie erfahren von den Anfechtungen (wie dem preußischen Kindergartenverbot von 1851), aber auch den Würdigungen und Freuden, die Fröbel zu Lebzeiten erfahren hat. Rudolf Benfey, der selbst auch manche Anfechtung seiner religiösen und politischen Gesinnung wegen erfuhr, wird zum Anhänger und Verfechter Fröbelscher Ideen - auch und vor allem nach dessen Tod. Dieses Buch ist ein historisches Zeugnis, das dem Leser den Menschen Friedrich Fröbel und auch seine Ideen näherzubringen vermag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRÜHE SCHRIFTEN ZUR FRÖBELPÄDAGOGIK – DAS HEIßT:
Der Erziehungswissenschaftler Michael Winkler sah sich 2010 zu der bemerkenswerten Feststellung veranlasst, dass Fröbel nicht zeitgemäß sei:
[...] nicht, weil er dem Denken und der Sprache des beginnenden 19. Jahrhunderts verhaftet blieb. [...] vielmehr [...], weil er unserem gegenwärtigen pädagogischen Denken voraus ist, [...] Was er erkannt und verstanden hat, vor allem: wie er versucht hat, für die Komplexität vorrangig der kindlichen [...] Entwicklung [...] eine angemessene theoretische Sprache, zureichende Begriffe und eine sinnvolle Praxis zu entwickeln, das geht kaum zusammen mit dem, was gegenwärtig als Pädagogik diskutiert wird. [....] Da geht es [...] um Steuerung, Messung und Bewertung, um Integration von Bildungslandschaften, um neue Institutionen, [...] um Choreografien des Unterrichts, vor allem jedoch überall um Schule und Instruktionspädagogiken [...]1
Allenthalben ist ein anwachsendes Interesse an Friedrich Fröbel, seinen Ideen und seinem Wirken zu spüren. Dies wurde sicherlich auch von Veröffentlichungen wie Norman Brostermans „Inventing Kindergarten" und Mitchel Resnicks „Lifelong Kindergarten" inspiriert.
Wir haben uns darum entschlossen, im Vorfeld des 175. Todestages Friedrich Fröbels (2027) sowie seines 250. Geburtstages (2032) den Interessenten von heute den Zugang zu Werken Fröbels, seiner Mitstreiter, Zeitgenossen und unmittelbaren Nachfolger zu erleichtern, indem wir die nur noch schwer erhältlichen und noch dazu nur in Frakturschrift zugänglichen Werke der Fröbelzeit und der ersten Jahrzehnte danach in zeitgemäß rezipierbare Buchform bringen.
Die Transkription aus der Frakturschrift in zeitgemäßen Schriftsatz erfolgte jeweils unter weitestgehender Anpassung an die orthografischen Regeln, die zum Bearbeitungszeitpunkt Gültigkeit hatten. Ausnahmen bilden Archaismen sowie Friedrich Fröbel zuzuschreibende Wortschöpfungen. Der Satzbau blieb unverändert.
Matthias Brodbeck (Herausgeber)
1 Winkler, Michael: Der politische und sozialpädagogische Fröbel. In: Karl Neumann, Ulf Sauerbrey, Michael Winkler {Hrsg.): Fröbelpädagogik im Kontext der Moderne - Bildung, Erziehung und soziales Handeln - edition Paideia, Jena 2010, S. 28ff.
GEDANKEN DES HERAUSGEBERS
Rudolf Benfey (31. Dezember 1821 – 21. Februar 1891) war Journalist, Pädagoge und Schriftsteller, der auch für seine engen Verbindungen zu Friedrich Fröbel und dessen Pädagogik bekannt wurde. Geboren in Nörten bei Göttingen wuchs Benfey in einer Zeit großer politischer und sozialer Umwälzungen auf, die seine späteren Aktivitäten und Ansichten maßgeblich beeinflussten.
Rudolf Benfey wurde in eine intellektuell anregende Umgebung geboren und entwickelte früh ein Interesse an Bildung und Gesellschaft. Seine Bewunderung für Friedrich Fröbel, den Begründer des Kindergartens, prägte sein pädagogisches Denken nachhaltig.
Seit den 1840er Jahren war Rudolf Benfey politisch aktiv und wohl auch an revolutionären Bewegungen beteiligt. Diese politische Tätigkeit führte 1847 zu seiner Ausweisung aus Preußen, welche vor allem mit seiner Verbindung zur Wislicenus'schen Freien Gemeinde in Halle (1846/47) begründet wurde. Benfey wurde verdächtigt, mit Mitgliedern dieser Gemeinde in Kontakt zu stehen. Die Freie Gemeinde war eine religiöse und soziale Reformbewegung, die sich von der traditionellen Kirche abwandte und liberale Werte vertrat.
Benfey setzte sein Wirken als Privatgelehrter in Göttingen fort und reichte 1853 eine Beschwerde wegen Beeinträchtigung seiner persönlichen Freiheit ein. 1859 wurde die preußische Ausweisungsverfügung gegen Benfey schließlich aufgehoben, möglicherweise wegen Änderungen der politischen Lage, möglicherweise aber auch infolge einer Neubewertung seiner Aktivitäten.
Als überzeugter Anhänger Friedrich Fröbels setzte er sich für die Verbreitung von dessen Ideen ein. Er war von der Bedeutung einer kindzentrierten Erziehung und der herausragenden Rolle des Spiels für frühkindliches Lernen überzeugt.
Rudolf Benfey lebte und arbeitete in verschiedenen Städten, darunter Weimar, Graz und Dresden. Er starb am 21. Februar 1891 in Jena.
Vorliegende Schrift gibt Einblicke in das Leben und in die Gedankenwelt Friedrich Fröbels sowie in seine Wirkungskreise – ein historisches Zeugnis, das dem Leser den Menschen Friedrich Fröbel näherzubringen vermag.
Matthias Brodbeck, im April 2025
Inhalt
0. Vorwort des Verfassers
1. Was ich über Fröbel hörte.
2. Wie ich denn doch Fröbel endlich kennen lernte
3. Drei Wochen in Keilhau.
4. Ein Nachmittag bei Friedrich Fröbel
5. Das Spielfest zu Altenstein
6. Die erste Woche in Liebenstein.
7. Die Woche des klaren Erkennens.
8. Auswärts und zurück.
9. Der Fremdenbesuch in Mariental und meine Abreise.
10. Die Lehrerversammlung in Gotha.
11. Abermals in Liebenstein.
12. Die ausklingende Saite
0. Vorwort des Verfassers
Ein Charakterbild sollen diese Erinnerungen zu zeichnen versuchen. Ein Charakterbild des Genius, der in Deutschlands Kulturentwicklung schon bis jetzt eine große Rolle spielte, aber eine größere noch zu spielen gewiss berufen ist. Schon vor 30 Jahren, gleich beim Beginn des ersten Besuches wurde der erste Spatenstich zum Entwerfen dieses Charakterbildes unternommen; vor 3 Jahren wurde endlich die Arbeit vollendet, um von da ab bis vor einem Vierteljahre, wo der Druck begann, noch im Pulte liegen zu bleiben. 27 Jahre also auf die erste Schöpfung verwendet! Da musste natürlich der ursprüngliche Entwurf öfter umgestaltet und nach neuen Gesichtspunkten eingerichtet werden. So entstand dieses Werkes eigentümliche Form, das teilweise schlichte Erzählung und teilweise auch gerundete, möglichst dramatische Bilder enthält, und durch beide vereint den Eindruck auch bei den Lesern zu erzeugen sucht, den viele der Mitlebenden beim Gespräche mit diesem Genius empfunden haben.
Es war etwas Eigentümliches in den Wirkungen, die der Verkehr mit Fröbel hervorrief. Für Denjenigen, der nicht tiefer über Erziehung nachgedacht hatte, blieb dieser seltsame Mann ein Rätsel, „wie ein Buch mit sieben Siegeln, zu denen der Schlüssel im Meere versenkt sei." Für den Mittelschlag der Menschen hatte er sogar etwas Fremdartiges, welches sie gern verspotteten. —
Aber Derjenige, der schon über Erziehung nachgedacht hatte, brauchte nur ein wenig aus seinem inneren Leben zu beichten und konnte dann mit Sicherheit darauf rechnen, durch eine solche Fülle zündender Gedanken und geistreicher Einblicke in verschiedene Gebiete so angeregt zu werden, dass ein geistiger Prozess, eine innere Entwicklung in ihm daraus entstehen musste. Diese zündende begeisternde Gabe, die ja Fröbel auf so viele hochbedeutende Männer und Frauen bekanntlich ausgeübt hat, ich erinnere nur an die drei großen Mitarbeiter bei der Schöpfung in Keilhau, an die von ihm ausgebildeten, hochbegabten Kindergärtnerinnen, an seine Propagandistin Marenholtz-Bülow und an seinen begeisterten Fürsprecher Diesterweg — schien mir der wichtigste Zug in seinem Wesen, den zum klaren Bewusstsein zu bringen, höchste Aufgabe des Darstellers sein muss.
Um dieses zu erreichen, durfte ich nicht wie ich anfangs wollte, nur einzelne Äußerungen Fröbels möglichst getreu wiedergeben, — da hätte mein Bericht der Gefahr nicht entgehen können, den Leser mit manchem Neuen zu überschütten, für das den Schlüssel zu finden ihm schwer geworden wäre, — sondern ich musste mich darauf beschränken, nur einen Teil der von ihm geäußerten Ansichten in diesem Werke zu benutzen, — aber dieses dann möglichst vollständig entwickelt und zur Klarheit gebracht darzustellen, um so zu erreichen, dass der Widerstreit der Meinungen, wie er sich in lebhafter Unterhaltung ergibt, möglichst genau nachgebildet werde. So entstanden bei wichtigen Punkten des Zusammenseins förmliche Dialoge, wo ich Fröbel in ähnlicher Weise seinen Besuchern gegenüberzustellen suchte wie dieses Plato mit Socrates getan hatte. —
Die Schwierigkeit, so großen Meistern nachzustreben, war mir nicht entgangen und erregte bei mir oft lebhafte Befürchtungen, mein Ziel zu verfehlen. Aber die hohe Bedeutung des großen Mannes einerseits, wie andererseits der glückliche Umstand, gleichzeitig mit so vielen interessanten Persönlichkeiten bei Fröbel zusammengetroffen zu sein, gaben mir den Mut, den Inhalt der schlichten Wahrheit einzufassen in die Form der Dichtung, wenn die letztere auch gegen den gewichtigen Inhalt von Fröbels eigenen Worten oft in Schatten treten musste. „Der Kern seiner glänzenden Ideen wird doch daraus mächtig hervortreten", so sagte ich mir; vor allem aber auch die Kraft seiner hinreißenden Beredsamkeit, wenn ich gleichzeitig schildere, wie er alle Hörende mit sich fortriss. Das war mein Streben bei der Ausarbeitung.
Der Leser mag darum entschuldigen, wenn ich aus meiner eigenen Entwicklungsgeschichte Mancherlei herbeibrachte, was an sich zwar weniger wichtig scheinen könnte, aber doch im Zusammenhänge des Ganzen dazu dient, die Einwirkungen Fröbels auf den Hörer klarzustellen, den ich am genauesten schildern konnte, weil ich es selbst bin. — Alles, was hier dargestellt ist, soll dazu dienen, jenen mächtigen Gesamteindruck lebhaft hervortreten zu lasten, und der Leser wird darum mit mir nicht rechten, wenn hier und da eine oder die andere Äußerung vor einer scharf-prüfenden Kritik nicht wird Stich halten können. Der größte Teil der von Fröbel hier wiedergegebenen Äußerungen ist diplomatisch genau. Ob überall der Charakter der mannigfaltigen Persönlichkeiten vollständig wiedergegeben ist, das zu untersuchen, kann nur der Zukunft anheimfallen, aber selbst Irrtümer in diesem Gebiete würden verzeihlich sein bei der Schwierigkeit der Aufgabe und dürsten dadurch wertvoll werden, dass sie zur weiteren Forschung anregten.
Diese wird aber nötig sein, denn von allen Seiten drängen innere und äußere Gründe auf die tiefere Erforschung dieses hohen Genius. Denn vor allem folgender Umstand. Nicht sein Heimatland vorherrschend, sondern fremde Nationen mussten uns erst darauf aufmerksam machen, welche Fülle von anregenden Geistesfunken von diesem tatkräftigen Manne ausgegangen sind. Erst in diesen Tagen hat man in dem Brüsseler Unterrichtskongresse von kundiger Seite darauf hingewiesen, dass aus den Bildungsnöten unserer Tage nur die Aufnahme der Fröbelschen Lehre retten könne. In Belgien sowohl wie in Österreich legt man ernsthaft Hand an das Durchführen seiner Ideen, in Amerika wie in Russland — England auch nicht ausgeschlossen — bildet man immer mehr treue Anhänger seiner Richtung aus ... — und in Deutschland wusste man vor wenigen Jahren noch kaum, dass Fröbel, außer Erfinder des Kindergartens zu sein, noch nach andern Seiten der Pädagogik hin wahrhaft fördernde Bestrebungen erweckt habe.
Schon dem Auslande gegenüber ist es notwendig, Zeugnis dafür abzulegen, dass wir jetzt endlich auch erkennen, dass ein großartiger Organismus der Menschenerziehung diesem Genius vorschwebte, deren erste Stufe er in den Abhandlungen zu „Mutter- und Koseliedern" niederlegte und deren Abschluss in seinen Taten zu Keilhau enthalten waren. Der Kindergarten, den er im Anschluss an Comenius‘ Mutterschule einrichtete, ist nur eine Mittelstufe zwischen der „Wissenschaft der Mutter", wie sie Frau von Marenholtz-Bülow auf Grund seiner Anregungen empfahl und der Volksschule, wie er sie in der Schweiz zu gründen begann und in seinen Lehrkursen zu Burgdorf schilderte, nach den Grundzügen, die er in Keilhau gelegt hatte. Schulgarten und Schulwerkstatt bilden hier Ergänzung zu dem belehrenden Unterrichte, der bei ihm vorherrschend als gelegentlicher auftritt.
Neben dieser Rücksicht gegen das Ausland wirken aber noch mächtigere Gründe mit, die aus unserer Entwicklung entlehnt werden müssen. Nach dem 400jährigen Kampfe zur Neugestaltung Deutschlands, der endlich mit der Schöpfung unseres Kaiserreiches vor 10 Jahren abgeschlossen wurde, musste sich natürlich die ganze Aufmerksamkeit des denkenden Volkes darauf wenden, mit welchem Inhalte die neugewonnene Form auszufüllen und zu beleben sei. Unser großer Kaiser hat mit dem Worte „Wohlfahrt" uns das richtige Ziel gewiesen, aber über die Mittel, die zu diesem Ziele führen, schwanken schon seit 10 Jahren die Meinungen nach den verschiedensten Richtungen hin. Man hat früher den Deutschen zu viel Idealismus gern vorgeworfen, aber seitdem wir nach der Realpolitik zu streben scheinen, hat sich gezeigt, dass hinter diesem Namen sich die egoistischste Interessenpolitik zu verstecken suchte, die möglicherweise das Unglück im Geleite haben könnte, uns in langdauernde verwirrende Kämpfe zu stürzen, wie wir sie schon oft in der Geschichte erlebt haben. Um diesem Unglücke aus dem Wege zu gehen, muss Aufgabe aller wahren Volksfreunde sein, dahin zu blicken, woher Hilfe kommen kann. Uns scheint dieselbe nur möglich zu sein.
Wenn im deutschen Volke selbst ein waches Verlangen entsteht, hilfreich bessernde Hand an die Schäden zu legen, die unsere weitere Entwicklung hemmen. Diese liegen vorherrschend in Gebieten, denen die früheste Erziehung am besten begegnen kann. Unsere Mädchen und Jungfrauen werden nicht genügend für die Aufgaben der Mutter und Gattin vorgebildet. Und nur eine genügende weibliche Vorbildung könnte uns Männer schaffen, die gewillt und begabt genug wären, an den höchsten Aufgaben der Menschheit ernsthaft mitzuarbeiten. Dieses ahnte schon Fröbel, und seine geistvolle Schülerin Marenholtz-Bülow legte schon 1867 in dem Werke „Die Arbeit und die neue Erziehung" den Gedanken klar, dass die soziale Frage nur richtig gelöst werden könne, wenn schon von den ersten geistigen Regungen an, die sich bei dem Kinde zeigen, die Einwirkung der Mutter darauf ausgehe, in dem neuen Erdenbürger die Lust zum Schaffen und Neugestalten zu erwecken. Das großartige Problem, an dem sich der Franzose Fourier sein Leben lang zerquälte, ohne zum Ziel zu gelangen, das Problem, den Genuss dauernd mit der Arbeit zu verbinden, hat Fröbel zur Lösung gebracht, indem er in dem Kinde schon die Lust an der Arbeit erweckte und den Schöpfertrieb ihm zur Mitgift zuwendete.
Welcher der deutschen Staaten ist wohl mehr dazu berufen, die Wege zu bahnen, wie die Fröbelschen Ideen zum vollständigen Nationalgut umgebildet werden können, als derjenige Staat, dessen vergangene Geschichte ihn schon im Voraus dazu bestimmt zu haben scheint. — Bei einem fleißigen Durchforschen der deutschen Geschichte wird man finden, dass der bayrische Stamm schon mehrere Male in entscheidenden Epochen den tiefsten Instinkt des deutschen Volkes begriff und zur Geltung brachte. Heinrich II. wusste während seiner Regierungszeit das durch das phantastische Bild der Erneuerung des Römerreiches von seinen ursprünglichen Grundlagen abirrende deutsche Königtum der Ottonen auf das rechte Maß zurückzuführen; und als Ludwig VII., der Bayer, die von Rudolf von Habsburg begonnene bürgerliche Politik richtig zu verbinden wusste mit den größeren Ansprüchen, die die Hohenstaufen, wenngleich auf verkehrtem Wege, erhoben hatten, da sah es au-, als ob die Zukunft Deutschlands auf ähnliche Basen gegründet werden könnte wie in den Staaten des Atlantischen Ozeans, wo damals schon die Bürgerfreundlichkeit der Könige neue Zustände herbeigeführt hatte.
Doch was brauchen wir in so weite Fernen zu greifen, die vier Wittelsbacher Könige, die in diesem Jahrhunderte in konsequenter Reihenfolge den bayrischen Staat mit geistigen Errungenschaften bereicherten, schufen einen Kranz voll geistiger Anregungen, die notwendig zu weiteren edlen Taten führen müssen. Vor allem war es Ludwig I. innere Beziehung zu den großartigen Ideen des achtzehnten Jahrhunderts, die auf Weimarer Boden entstanden und gepflegt, von diesem großartigen Fürsten nach dem Isar-Ufer geleitet wurden. Diese werden Bayern mit der größten Notwendigkeit zum Ausgangspunkt der Durchführung der Fröbelschen Ideen machen müssen. Schillers ästhetische Briefe waren ebenso sehr Ausgangspunkt für Fröbels tiefere Ideen, wie schon früher der von Fichte und Schleiermacher empfangene geistige Anstoß, welcher wiederum auf Herders Humanitätsideen zurückzuführen ist. Nachdem , nun Ludwig I. den durch Maximilian I. verjüngten bayrischen Staat in Verbindung gesetzt hatte, mit dem Keimpunkte aller höheren deutschen Ideen — denn von Thüringen ging 1794, wie schon 1212 die Wurzel für spätere große Ideenkreise aus — so brachte Maximilian II. eine weitere Stütze hinzu, durch Vertiefung der Volksbildung und schöpferische Organisationen. Damit ist nun der wahre Boden für die Neugestaltung geschaffen.
Dass diese nach der wissenschaftlichen Seite auf Mathesis und Musik zu gründen ist, dass letztere mit den großen Bestrebungen Wagners zusammenhängt und warum das so ist, haben wir auf Seite 50 dieses Buches ausgeführt wie an anderer Stelle der Fortsetzerin Fröbels, der Frau Wiseneder, gedacht. All das konnte in diesem Werke angedeutet, nicht ausgeführt werden. Spätere Arbeiten werden vielleicht am Faden bis dahin hoffentlich neuentstandener Institute darlegen können, dass in Ludwig II. Geist schon die Vorbilder für dasjenige mächtig lebten, was erst die Zukunft bringen kann, als er die Verlockungen zurückwies, die im Januar 1870 an ihn herantraten und als er im Juli 1870 so rasch entschlossen sein Volk unter des Kaisers Führung mit in den Kampf für Deutschlands Neugestaltung führte.
Der freundliche Leser mag verzeihen, dass ich ihn in dieser Vorrede so tief in die Gegenwart hineinführe. Habe ich doch auch in den betreffenden Teilen des Buches die Stimmung, die uns vor 30 Jahren beherrschte, getreu abzubilden versucht. Der geistige Kampf, der uns damals bewegte, ist noch nicht vollständig entschieden. Nicht mit der äußeren Form, sondern erst mit dem innerem Gehalte ist unser Deutsches Reich wahrhaft gegründet. Dieser innere Gehalt Neudeutschlands aber ist durch die Taten unserer großen Dichter und Denker begründet. Diese haben die Resultate unserer früheren Kämpfe in sich ausgenommen. Das Streben, die aus dem germanischen Geiste entsprungene Idee der Genossenschaft mit der, vom römischen Reiche stammenden Staatsidee zu verknüpfen, war Angelpunkt der Entwicklung der deutschen Geschichte.
Nicht bloß im Kampfe zwischen Kaiser und Papst handelte es sich um dieses Problem, welches England und Ungarn so richtig lösten, sondern auch der Mittelpunkt der nationalen Bewegung vom 13. bis 17. Jahrhundert, die wir Reformation nennen, war ebenfalls Kampf des bürgerlichen Familiensinns gegen den aus romanischen Landen eingeführten cäsarischen Gedanken. In Deutschland scheiterte Karls des Großen deutsche Idee der Gauverfassung, weil er den tiefen innersten Trieb der Stämme nicht genügend genug beachtete und von den großen Ideen, die einen Sickingen und Hutten bewegten, konnte Luther nur wenig retten. Doch was das neunte und sechzehnte Jahrhundert nicht vermochten, vermag vielleicht das neunzehnte so vorzubereiten, dass es dem zwanzigsten gelingt es durchzuführen; die nächste Zeit wird die Probe zu liefern haben. Stärken wir uns dazu, indem wir uns erinnern, dass zu den Genien, die den Stolz unseres Volkes ausmachten, auch Friedrich Fröbel zu rechnen ist und dass er uns lehren kann, wie schon in der Genossenschaft der Kinder ein Staatssinn sich erzeugen kann, der nicht wie in Antigone in Kampf mit der Familie tritt, sondern nur ausbaut, was jene begründet hat. Gelingt uns das, so wird die Geschichte gern von uns sagen können, dass unser Kaiser Weißbart auch einen Freund fand, der aber treuer als der Löwe war, denn er stand ihm nicht bloß im Kampfe gegen die Feinde bei, sondern half die Mittel finden, die den Fels auch im Meere der Leidenschaften Kraft geben, der auslösenden Eigenschaft des Wassers zu widerstehen. —
Möge das Geschick uns auch dieses vergönnen.
1. Was ich über Fröbel hörte.
Von Wiesbaden kam ich und war ganz entzückt über die interessanten Resultate der Jacotot’schen Methode, die ich im Kreisschen Institut beim französischen Sprachunterricht hatte, anwenden sehen. Dass die 11- und 12-jährigen Knaben schon nach kurzer Zeit auf Französisch ihren Lehrern Rede und Antwort stehen konnten, dass während der ganzen Stunde fast kein deutsches Wort, als höchstens bei der Interpretation einer Stelle, in deren Mund kam, hatte auf mich umso mehr Eindruck gemacht, als ich von meiner Gymnasialzeit her nur den schleppenden Unterricht in den modernen Sprachen kannte. —
Lebhaft und gesprächig, wie man im zweiundzwanzigsten Jahre ist, erzählte ich einem Mitreisenden, der sich dafür zu interessieren schien, von dem gehabten Eindrücke, als ein ebenfalls im Wagen befindlicher Mitreisender sich in die Rede mischte und sagte: „Wenn Sie sich für Unterricht so interessieren, dann hätte ich gewünscht, Sie wären vor einigen Tagen in Darmstadt gewesen, wo man in der ganzen Stadt von einem seltsamen Manne sprach, der dort Vorträge über Unterricht gehalten hat." Natürlich waren wir beide gespannt und wollten von unserem Mitreisenden Näheres hören, doch dieser, offenbar bloß Geschäftsreisender, konnte uns nur das allerseltsamste Bild von dem merkwürdigen Manne, von dem er gehört, entwerfen. Er selbst sei nicht in die Vorlesung gegangen, so lautete seine Mitteilung, aber an der Gasthofstafel, wo er gesessen, hat er zwei Tage nur von dem Manne reden gehört. Es soll ein Wundermann sein, der den Kindern das Lernen im höchsten Grade erleichtert. —
Mein anderer Mitreisender, mit dem ich vorher gesprochen, schaltete ein: „Aha, wieder eine neue Auflage des Philanthropismus, er wird den Kindern die Buchstaben auf Zuckerkuchen backen lassen!" — „Nein," fuhr der Berichterstatter fort, „so etwas war es nicht, sagten die Leute, die bei Tische darüber sprachen; es stritten sich zwei an der Tafel darüber, ob es Spielerei oder Spiele wären, und der eine sagte, das ganze Kunststück jenes Mannes sei, die Kinder fortwährend spielen zu lassen, und während sie spielten, lernten sie alles Mögliche." Das schien uns beiden wohl ein bisschen arg nach Jägerlatein zu schmecken und wir sahen uns erstaunt über die Äußerung des Fremden an; dieser fuhr fort: „Ja, der Mann selbst soll ein ganz eigentümlicher Mensch sein; wenn die Kinder ihn sehen, so laufen sie zu ihm hin und reichen ihm die Hand, so weiß er sie mit dem Auge zu fesseln." —
„Ein neuer Rattenfänger von Hameln!" meinte mein Mitreisender; „führt er auch die Kinder in die Berge, um sie nach Siebenbürgen zu verkaufen?" — „Nein,"sagte der Fremde, der diesen Scherz kaum zu verstehen schien, „in Siebenbürgen ist er nicht gewesen, aber in der Schweiz, und reist manchen Sommer mit den Kindern wieder hin."
Immer seltsamere Konturen nahm also die Erzählung an. — Ich fragte den Mitreisenden, wo jener denn die Kinder her nimmt, ob etwa von der Straße. „Nein, er soll ein großes Institut gegründet haben, tief in Thüringen, das seine Verwandten leiten, und mit diesen Kindern reise er nach der Schweiz." Und wie kommt er nach Darmstadt? Aber mit dieser Frage schienen wir die Intelligenz des Reisegenossen in Verlegenheit zu setzen, er wusste nichts darauf zu erwidern. — Jedenfalls ist er ein Propagandist für irgendeine Idee. — Vielleicht vom Schnepfenthaler Institut gesandt, ein Schüler oder Nachkomme Salzmanns. — Haben sie denn nichts weiteres über diesen seltsamen Mann gehört? „O ja, er bekümmert sich viel um die Steine, die sich in den Bergen finden, und lehrt den Kindern deren Gestatten kennen; er ist auch ein Jäger gewesen und hat den Krieg mitgemacht gegen die Franzosen, — mehr weiß ich nicht." — Das Gespräch wandte sich bald auf andere Dinge, erst kurz vor Frankfurt fiel es mir ein, den Fremden nach dem Namen jenes Vortragenden zu fragen, doch er hatte diesen nicht behalten, er wüsste nicht genau, ob er Fröbler oder Fröhlich hieße, war endlich die Antwort, die ich bekam, — so geschah es am 29. September des Jahres 1844.
Durch eine sonderbare Ideenverkettung jedoch wollte die Erinnerung des Vorganges nicht aus meinem Gedächtnis weichen. Kurz vor zu Bette Gehen, als ich die Erlebnisse des Tages noch einmal genau erwog, wurde ich über einige Tatsachen stutzig: Zu dem Manne laufen alle Kinder — das war die erste Betrachtung, — es muss also doch etwas in ihm liegen, was der Kinder Herz ergreift, — „er soll den Kindern alles durch Spiele lehren," — das ist eine Unmöglichkeit, sagte ich mir, ein bedeutendes Missverständnis mein Berichterstatter muss hier falsch gehört oder verwirrt aufgefasst haben, — aber dann wieder: Er beschäftigt sich mit Steinen und macht die Gestalten klar? — Ich hatte den Winter vier Jahre vorher mich weidlich mit Mineralogie abgemüht und vor dem Rätsel der Kristallformen war ich ahnungsvoll an der Pforte stehen geblieben.
Angestrengteste Mühe und Arbeit hatten mich eben nur mit den oberflächlichsten Umrissen derselben bekannt gemacht, denn die Fähigkeit des Auges, klar und scharf alle diese Erscheinungen zu erkennen, war leider in der früheren Jugend nicht genug geweckt und die Anschauung konnte nicht gleichen Schritt halten mit dem Wunsche, das Erlernte geistig zu durchdringen. Ähnlich war es mir ein Jahr später beim Praktikum der Chemie ergangen, auch hier musste ich es beklagen, dass ich in der frühen Jugend nicht genügende Sinnesübungen vorgenommen, und dass deshalb mein Auge mich bei genauen Unterscheidungen der Farben und beim sorgfältigen Beobachten der Fällungen meist im Stiche ließ. — Es mag etwas Bedeutungsvolles liegen in der Weise, wie jener Mann die Kinder mit den Gestalten der Steine bekannt macht. Immer interessanter wurde mir dieses ahnungsvolle Bild, es ließ mich in der Nacht kaum schlafen.
Am folgenden Tage ging ich zu einem befreundeten Institutsvorsteher, bei dem ich vor meiner Wiesbadener Reise etwa 14 Tage hospitiert und seine Schule kennen gelernt hatte; diesem teilte ich das erlebte Abenteuer mit und fragte, ob er Fröbler oder Fröhlich kenne.
Der Name war ihm unbekannt. Ein junger Lehrer, der zuhörte, meinte: „sollte der Fremde sich nicht etwa verhört haben und Fröbel aus Keilhau gemeint haben?" — Der Institutsvorsteher schüttelte das Haupt. — „Zu dem passen ja die Züge nicht; übrigens, wenn’s der wäre, so hätten Sie auch nichts verloren, er ist vor kurzem in Frankfurt gewesen und ist wohl jetzt nach Darmstadt gegangen. — Aber ich halte all das, was er vorbrachte, für pädagogischen Schwindel, hie und da sind wohl gesunde Bemerkungen, Manches von Pestalozzi wacker benützt. Aber er hält die Kinder mit unnützen Kleinigkeiten auf, da müssen sie Papier flechten und ausschneiden und alles Mögliche treiben; jedoch auf ein wirkliches Lesen und Schreiben und sonstige vernünftige Wissenschaft scheint er nicht zu kommen, er beschäftigt sich nur mit 4- bis 6-jährigen Kindern." Ich fragte hierauf, ob. es denn nicht richtig sei, dass er ein Institut habe.
„Gehabt," war die Antwort; „seine Verwandten haben es jetzt, er ist dort ungeheuer unpraktisch vorgegangen, hat sogar Griechisch vor Latein lernen lasten." — Nun, das empfiehlt ja auch Herbart, war meine Antwort. — Der Institutsvorsteher meinte, alle solche Versuche können nur von Seite des Staates ausgehen, wir Lehrer sind an die Wünsche der Eltern gebunden, die wollen, dass ihre Kinder zur entsprechenden Zeit in die Staatsanstalten eintreten können. Fröbel hat aber von jeher seine eigenen Wege wandern wollen. Er hatte ja in den 20iger Jahren auch Kinder aus Frankfurt, aber wenn man sie ihm übergab, dann behauptete er, dieselben könnten vor der Universitätszeit nicht seine Schule verlassen, denn er nehme einen anderen Gang, lege weit mehr Wert auf Naturwissenschaft, als man sonst das tut, und er verschiebe den Unterricht in den klassischen Sprachen auf ein reiferes Alter."
Aber das ist ja ganz vernünftig, platzte ich heraus, das ist ja meine Sehnsucht schon seit Langem, dass eben die realen Wissenschaften, der Anblick des Lebens der Kinder Geist erstarken soll, ehe sie an den schweren Stoff von Völkern aus der Vergangenheit herantreten. — „Schwärmerei," meinte der Institutsvorsteher, „wenn Sie erst eine Zeit lang gewirkt haben, werden Sie sehen, wir hängen von den Eltern ab und nicht wir können den Erziehungsplan der Kinder bestimmen, sondern nur mit Hilfe des Staates können da bedeutende Veränderungen vorgenommen werden."
Von nun ab ließ es mir keine Ruhe; war schon durch die erste Mitteilung eine dunkle Sehnsucht erwacht, von dem seltsamen pädagogischen Wanderer Näheres zu erfahren, so hatten die Bemerkungen des Institutsvorstehers meinen Wunsch zur lebhaften Neugier gestaltet. Dass ich einen Reformator im Sinne und Geiste Pestalozzis, nur den modernen Ansprüchen näher stehend, in Fröbel finden würde, unterlag nach den bisherigen Notizen fast keinem Zweifel, und gerade das, was jener Institutsvorsteher als diejenigen Punkte hervorgehoben hatte, die ihm nicht gefielen, lockte mich an.
Ich durchlebte damals einen großen inneren Kampf, zu dem pädagogische Anschauungen vielfach den Anstoß gegeben haben. Nach vierjährigem Studium war ich doch noch im Zweifel, nach welcher Richtung hin ich zunächst meine Tätigkeit wenden sollte. Innere und äußere Umstände hatten es veranlasst, dass sowohl der anfängliche Plan, mich den Naturwissenschaften, der Chemie, zu widmen, aufgegeben wurde, wie auch der in den letzten anderthalb Jahren verfolgte, mich der Publizistik, Schriftstellerei zu widmen, noch nicht in Angriff genommen werden konnte. Im Sommer 1844, wo ich still in meiner Heimat lebte, war mir eine feurig geschriebene Biografie Pestalozzis in die Hände gekommen. Anfang und Ende fehlten und selbst jetzt habe ich es noch nicht herausbringen können, wer der Verfasser dieses Werkes gewesen, das offenbar kurz nach Begründung des Instituts zu Yverdon geschrieben worden war. Dieses Werk hatte einen ungeheuren Eindruck auf mich gemacht und in mir den Wunsch geweckt, mich dem Schulwesen zu widmen.
Um Erfahrung zu gewinnen, war ich damals nach Frankfurt und Wiesbaden gegangen, mit der Absicht, bei günstiger Gelegenheit am ersteren Orte zu bleiben.
Die Nachricht jedoch von dem seltsamen Mann in Thüringen ließ mir jetzt keine Ruhe und trieb andere Entschlüsse hervor. An dem Institutsleben und Treiben in Frankfurt hatte ich überhaupt keinen Geschmack finden können; dieses Einüben der Schularbeiten mit den Kindern, das bloße Nachhilfesystem, schien mir mehr den geistigen Aufschwung zu lähmen als zu fördern. All die trüben Erfahrungen, die mir seinerzeit das Schulleben verleidet hatten, tauchten wieder vor meiner Seele auf. — In Wiesbaden freilich, bei Kreis, wo die drei Brüder, Schüler Pestalozzis, mit Begeisterung die neuen Systeme pflegten, war der Eindruck auf mich ein erhebender. Doch auch hier vermisste ich trotzdem einen lebendigen Verkehr mit den realen Wissenschaften, die mir während meiner Universitätszeit so weitreichende Anregungen gegeben hatten.
Aber der Thüringer, das musste mein Mann sein, das fühlte ich; — mein Entschluss war rasch gefasst, ich musste um jeden Preis hin, den Mann erforschen und kennen lernen. Noch denselben Tag schrieb ich nach meiner Heimat, dass ich von Frankfurt über Fulda zu meinen Verwandten nach Erfurt reisen würde, um auch dort und in Thüringen Schulanstalten kennen zu lernen; nach dorthin möchten weitere Briefe und Nachrichten gesendet werden. Noch denselben Abend saß ich im Stellwagen, der mich nach dreitägiger Fahrt ins Thüringische brachte.
Hier gingen die Forschungen nach Fröbel wieder an. Die Frankfurter hatten nämlich nur den Ort Keilhau benannt, ohne aber irgendeine Stadt in der Nähe, also Rudolstadt oder Blankenburg, mir zu nennen. Es galt also, von Erfurt aus Weiteres zu erfahren. Die Kreise, die mir zunächst zugänglich waren, wussten wieder nichts und verwiesen mich an die Universitätsstadt Jena, wo ich gewiss die genauesten Nachrichten erhalten könnte. Also auch dorthin musste ich pilgern; im Burgkeller dort wurden mir endlich von den Studierenden, die ich kennen lernte, genaue Mitteilungen gemacht.
Ein junger, sehr begeisterter Burschenschafter, der schon durch Studierende, mit denen ich in Berlin gewesen, von mir gehört, machte mir genaue Mitteilungen über das Keilhauer Institut, und sprach mit hoher Begeisterung von Fröbels Genossen Middendorff, zu dem ich gewiss die höchste Zuneigung empfinden würde. Auch über den Lehrgang dort und über die Einrichtungen, die Kinder zu stärken und körperlich gewandt zu machen, wurden mir hier die ersten Mit gemacht. Von Fröbel selbst wusste dieser Studierende, der mit einigen Kommilitonen im Sommer das Institut besuchte, weniger zu erzählen; er hob nur hervor, dass derselbe sich jetzt den kleinen Kindern hauptsächlich widme, und sich von der eigentlichen schulmännischen Tätigkeit fern halte; — auf Dörfern der Umgebung wirken er und Middendorff für die erste und früheste Kindererziehung.
Durch alle diese Mitteilungen war ich nun schon von vornherein mit dem günstigsten Vorurteil für Fröbel erfüllt und brannte vor Sehnsucht, nach Keilhau zu reisen. Der Studierende meinte, da müsste ich noch einige Zeit warten, weil die Schüler und die meisten Lehrer auf Ferien seien. — Mir verschlug das nichts; ich wollte in Erfurt die Zeit abwarten. Doch da trat das Schicksal mit einem Hemmnis dazwischen; in meinem Gasthause angekommen, finde ich einen von Erfurt nachgeschickten Brief — „eiligst zu besorgen", — ich öffne denselben und eine donnernde Philippika von meinem ältesten Bruder und Vormund verweist mir den kecken Streich von der Verschiebung der Kulisse von Frankfurt nach Thüringen. Ohne Bewilligung hätte ich das nicht tun dürfen, sofort soll ich nach Hause kommen, wo man mir allerlei andere Pläne Vorschlägen will. Nun würde freilich die Philippika allein auf Remonstration und Retardation meinerseits gestoßen sein; aber das Schlimmste war dabei, das Reisegeld, welches ich bestellt hatte, war ausgeblieben, und meine Verwandten in Erfurt waren angewiesen, mir einen Postplatz nach Göttingen zu lösen und mich nur mit solchen Reisemitteln zu versehen, dass ich auf der Fahrt nicht zu hungern brauchte l Gegen diese Schicksalsnotwendigkeit ließ sich nicht kämpfen; ich blieb in Erfurt, so lange mich die Verwandten behielten, und zog dann füll wieder nach der Heimat zurück.
Der schöne Traum, den Weisen von Keilhau kennen zu lernen, war für das Erste in das Nichts versunken.
2. Wie ich denn doch Fröbel endlich kennen lernte.
„Heraus, mein gutes Schwert, lass den Sickingen nicht verderben!" — So begann am 20. April des Jahres 1846 der große Historiker und Professor an der Halleschen Universität Max Dunker eine Toastrede, die der Erinnerung Sickingens gewidmet war, beim Festessen zu Ehren des Andenkens an den Geburtstag des rüstigen Kämpfers für Geistesfreiheit, am Huttentage.
Die damalige freisinnige Partei in Halle, die sogenannten „Lichtfreunde", liebte es, solche Gelegenheiten zu benutzen, um die Zeitideen unter dem Volke zu verbreiten. — Eine herrliche Gesellschaft war zusammengekommen, Männer, die damals noch keineswegs ahnten, nach welch verschiedenen Himmelsstrichen sie einst geführt würden, und welche verschiedenen Arbeiten ihnen einst zufallen würden. Max Dunker war damals noch der stürmende Demokrat und Niemand dachte noch, dass er einst als Geheimrat und Privatsekretär des jetzigen Kronprinzen des deutschen Reiches fungieren werde; Dr. Schwarz, der spätere Gotha‘sche Konsistorialrat und Oberhofprediger, hatte zu Ehren Huttens gesprochen, und Robert Heym, der später so langsam fortschreitende Gothaer, hatte uns damals zu riesigem Schritt aufgefordert: „Wer will mit mir von Ufenau nach Königsberg?"
Mit diesen Worten leitete er einen Lobgesang auf Immanuel Kant ein und durch seine ganze Rede kehrte immer wieder: „Folgt mir von Ufenau nach Königsberg, lasst uns gehen von Ufenau nach Königsberg, — ja, das ist der Weg von Ufenau nach Königsberg!" Dazwischen hatte der ernste Wislicenus, der Bibelerklärer, den deutschen Bürgerstand gefeiert und die Wahlverwandtschaft zwischen diesem und Luther hervorgehoben. — Allmählich waren die offiziellen Toaste verrauscht, aber noch immer sollte die Beredsamkeit kein Ende nehmen; auf die offiziellen Redner waren andere gefolgt, die nur von der Stimmung des Herzens gedrängt, das Wort ergriffen. Ich war bis dahin schweigender Zuhörer gewesen, aber meine Nachbarn drängten mich fortwährend, ebenfalls etwas „loszulassen" und eine „Pauke" von mir zu geben.
Endlich konnte ich nicht widerstehen und sprach über Pestalozzi und Diesterweg, auf den letzteren, der eben damals vielfach angegriffen wurde, toastierend. In diesem Toaste gedachte ich auch an paffender Stelle des Schülers Pestalozzis, der in Keilhau in so überraschender Weise den Grundgedanken der Anschauungen des Meisters in neue Bahnen lenkte, und stellte diesen Schüler Pestalozzis als Ergänzung zu Diesterweg hin.





























