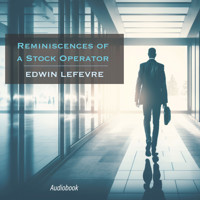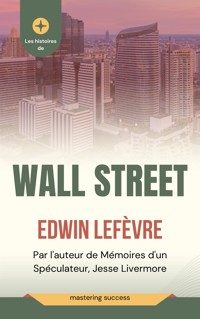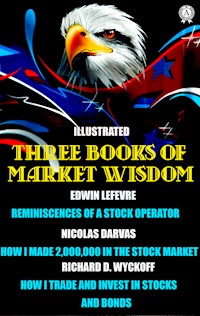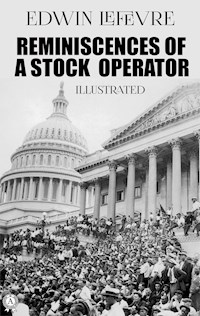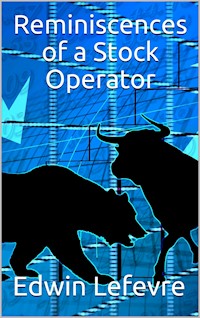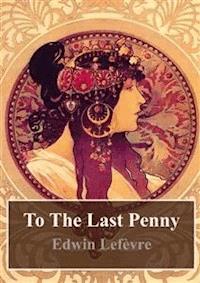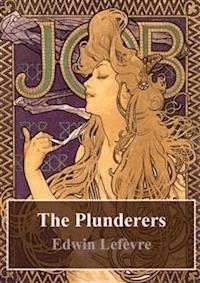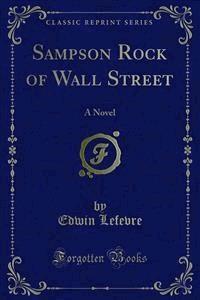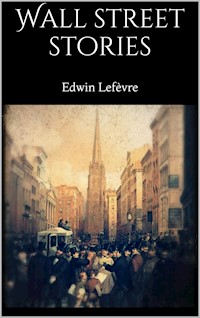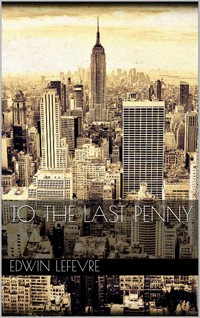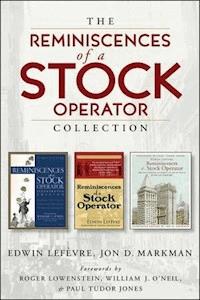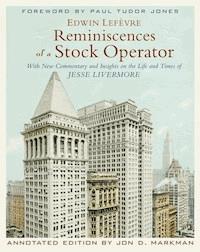12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Erinnerungen eines Börsenspekulanten ist ein Buch, das alle großen Finanzinvestoren und -persönlichkeiten gelesen und davon mit großem Enthusiasmus berichtet haben. Es gilt als moderner Klassiker der Börsen- und Finanzliteratur und wird oft als Schlüsselroman bezeichnet, um den sich viele Mythen ranken. Den erzählerischen Rahmen bildet die fiktionalisierte Lebensgeschichte der Wall-Street-Legende Jesse Livermore, der als 15-jähriger seine ersten eintausend Dollar mit Aktien verdiente und im Laufe seiner ereignisreichen Trading-Karriere riesige Vermögen gewann - und wieder verlor. Fast 100 Jahre sind seit der ersten Ausgabe des Buches, das erstmals 1925 erschien, vergangen. Und immer noch findet es fortwährend neue Leser, die sich von den hier dargelegten Börsenweisheiten, den psychologischen Gesetzen und den Tipps zu Risikoabwägungen inspirieren und leiten lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Erinnerungen eines Börsenspekulanten
Der Autor
EDWIN LEFÈVRE wurde 1871 in der kolumbianischen Stadt Colón geboren, die heute zur Republik Panama gehört, und als kleiner Junge in die USA geschickt, um dort eine bessere Schulbildung zu erhalten und später an der Lehigh University in Pennsylvania zu studieren. Mit 19 machte er sich jedoch als Journalist selbstständig und wurde schließlich Börsenspekulant an der Wall Street. Er schrieb mehrere Bücher und Artikel über die Mechanismen an der Börse, bevor ihm mit der fiktionalisierten Lebensgeschichte über Jesse Livermore ein Bestseller gelang. Er starb 1943 in Dorset, Vermont.
Das Buch
»Eine Quelle der Weisheit für Investoren«ALAN GREENSPAN
Ein ganzes Jahrhundert ist seit dem erstmaligen Erscheinen dieses Buches vergangen, aber immer noch findet es fortwährend neue Leser, die sich von den hier dargelegten zeitlosen Börsenweisheiten, den psychologischen Gesetzen und den Tipps zu Risikoabwägungen inspirieren und leiten lassen.
»Ein Börsenklassiker, der Lesern einen lohnenden Einblick in die Denkweise von Aktienspekulanten gibt.«THE WALL STREET JOURNAL
»Absolute Lieblingslektüre, auch nach zwanzig Jahren, in denen ich die Erinnerungen immer wieder gelesen habe.«KENNETH L. FISHER, FORBES
Der amerikanische Börsenklassiker NEU ÜBERSETZT
Edwin Lefèvre
Erinnerungen eines Börsenspekulanten
Aus dem Amerikanischen von Petra Pyka
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Juli 2023© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023Alle Rechte vorbehalten.Titel der amerikanischen Originalausgabe: Reminiscenses of a Stock Operator, erstmals erschienen 1923 bei George H. Doran, New York.Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, nach einer Vorlage von Kjetil Waren Johnsen / Wisuell Design Titelabbildung: Aerial Photograph of Lower Manhattan in New York City - © National Archives & Records AdministrationAutorenfoto: © Public DomainE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-2888-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Erstes Kapitel
Erstes Kapitel
Sobald ich die Schule verlassen hatte, fing ich als Kurstafeljunge in einem Maklerhaus an. Ich konnte gut mit Zahlen umgehen. In der Schule bewältigte ich den Stoff von drei Jahren Arithmetik in nur einem Jahr. Besonders gut konnte ich kopfrechnen. Als Kurstafeljunge war es meine Aufgabe, die Börsenkurse auf eine große Tafel im Kundenbereich zu schreiben. Normalerweise saß immer ein Kunde am Ticker und rief die Notierungen aus. Mir konnte das gar nicht schnell genug gehen. Ich hatte schon immer einen Kopf für Zahlen gehabt und konnte sie mir problemlos merken.
In dem Maklerhaus hatte ich viele Kollegen. Natürlich kam man sich näher, doch wenn es auf dem Markt hoch herging, hatte ich von 10 bis 15 Uhr so viel zu tun, dass nicht viel Zeit blieb, um sich zu unterhalten. Dafür habe ich während der Arbeitszeit sowieso wenig übrig.
An der Börse konnte noch so viel los sein – Gedanken über meine Arbeit machte ich mir trotzdem. Für mich stellten die Kursnotierungen nicht die Preise der Aktien dar – also so und so viele Dollar pro Stück –, es waren bloß Zahlen. Natürlich hatten diese Zahlen eine Bedeutung, und sie veränderten sich ständig. Und das war alles, was mich zu interessieren hatte – die Veränderungen. Warum sich die Zahlen veränderten, wusste ich nicht, und es war mir auch gleich. Darüber zerbrach ich mir nicht den Kopf. Ich nahm lediglich die Veränderungen zur Kenntnis. Nur sie beschäftigten mich – unter der Woche fünf Stunden täglich, samstags zwei.
Das weckte mein Interesse am Kursverhalten. Ich hatte ein gutes Zahlengedächtnis und wusste daher immer noch ganz genau, wie sich die Kurse am Vortag entwickelt hatten, kurz bevor sie nach oben oder nach unten ausschlugen. Meine Begabung fürs Kopfrechnen kam mir dabei sehr gelegen.
Wie ich feststellte, neigten die Aktienkurse im Aufwärts- ebenso wie im Abwärtstrend zu bestimmten typischen Verhaltensweisen. Ich hatte unendlich viele Vergleichsmöglichkeiten, die ich als Präzedenzfälle heranzog. Obwohl ich erst 14 Jahre alt war, merkte ich, wie ich nach Hunderten von Beobachtungen unwillkürlich nachprüfte, ob sich daraus verlässliche Rückschlüsse ziehen ließen. Und zwar indem ich das Verhalten, das Aktien am jeweiligen Tag zeigten, ihrer Entwicklung an anderen Tagen gegenüberstellte. Schon bald versuchte ich mich daran, Kursentwicklungen zu prognostizieren. Dabei orientierte ich mich, wie schon gesagt, einzig und allein an den bisherigen Kursbewegungen. Ich hatte die Zahlenkolonnen im Kopf und wartete darauf, dass sich die Kurse genau in diese Richtung entwickelten. Ich hatte sie »registriert« – Sie wissen schon, was ich meine.
So erkennt man beispielsweise, wann die Anzahl der Kaufaufträge nur ganz leicht über der Menge der Verkaufsorders liegt. Dann findet auf dem Aktienmarkt eine Schlacht statt, und der Ticker kann Ihnen in sieben von zehn Fällen verraten, wie diese ausgeht.
Noch etwas begriff ich sehr früh: An der Wall Street gibt es nichts Neues. Das kann gar nicht sein, weil seit jeher spekuliert wird. Was sich heute auf dem Aktienmarkt abspielt, hat es so schon einmal gegeben, und es wird sich auch künftig wieder ereignen. Das hat sich mir fest eingeprägt. Und weil ich mir so gut merken konnte, wann und wie sich die Dinge jeweils entwickelten, konnte ich aus meinen Erfahrungen Kapital schlagen.
Meine Gedankenspiele faszinierten mich sehr, und ich war so sehr bestrebt, das Steigen und Fallen aller Kurse vorherzusagen, dass ich mir eigens dafür ein Heft anschaffte. Darin trug ich meine Beobachtungen ein. Ich führte aber nicht etwa Buch über Fantasiegeschäfte wie so viele andere, die auf dem Papier Millionen verdienten oder verloren, ohne etwas davon zu haben oder deshalb im Armenhaus zu landen. Mein Büchlein war eher so etwas wie eine Erfolgsbilanz. Ich wollte damit nicht nur voraussichtliche Kursbewegungen bestimmen, sondern vor allem überprüfen, ob meine Beobachtungen zutrafen – mit anderen Worten: ob ich damit richtiglag.
Nehmen wir an, ich hatte einen Tag lang alle Kursschwankungen einer umsatzstarken Aktie verfolgt und befunden, dass sie sich genauso verhielt wie immer, bevor sie um acht oder zehn Zähler abrutschte. Dann hielt ich etwa am Montag fest, um welchen Titel es sich handelte und zu welchem Kurs er notierte, und schrieb dazu, wo er nach den bisherigen Erfahrungen am Dienstag und Mittwoch stehen müsste. Diese Notizen glich ich später mit den eingehenden Tickerdaten ab.
So erwachte mein Interesse daran, was mir der Ticker zu sagen hatte. Die Kursschwankungen assoziierte ich im Kopf sofort mit Auf- oder Abwärtsbewegungen. Natürlich gibt es für solche Schwankungen immer einen Grund, aber den Ticker interessiert das nicht. Er gibt auch keine Erklärungen. Ich versprach mir schon mit 14 Jahren keine Antworten vom Ticker, ebenso wenig wie jetzt mit 40. Warum eine Aktie heute eine bestimmte Bewegung zeigt, wird vielleicht erst in zwei oder drei Tagen oder nach Wochen oder Monaten erklärlich. Doch was geht uns das an? Uns interessiert doch, was der Ticker heute sagt – nicht morgen. Nach den Gründen können wir später fragen. Handeln müssen wir aber sofort, sonst bringt es nichts. Das habe ich immer wieder beobachtet. Wissen Sie noch, wie Hollow Tube neulich drei Punkte verlor, während der übrige Markt kräftig zulegte? Das war die Tatsache. Am Montag darauf erfuhren wir, dass der Verwaltungsrat die Dividende festgesetzt hatte. Das war der Grund. Die Verwaltungsratsmitglieder wussten das natürlich, und selbst wenn sie persönlich keine Aktien abstießen, so kauften sie zumindest auch nicht zu. Die Insiderkäufe fielen weg – es gab also keinen Grund, warum der Kurs nicht fallen sollte.
Ich führte mein kleines Notizbuch etwa sechs Monate lang. Nach Feierabend ging ich nicht sofort nach Hause, sondern hielt erst noch die Zahlen fest, die mich interessierten, und sah mir die Veränderungen an. Dabei achtete ich jedes Mal auf Wiederholungen und Parallelen im Kursverhalten – im Grunde lernte ich, den Ticker zu lesen, auch wenn mir das damals nicht bewusst war.
Eines Tages sprach mich in der Mittagspause einer der anderen Bürogehilfen an. Er war etwas älter als ich und fragte mich unter der Hand, ob ich ein bisschen Geld übrig hätte.
»Warum willst du das wissen?«, gab ich zurück.
»Na ja, ich habe da diesen erstklassigen Tipp für Burlington bekommen. Ich will einsteigen, wenn ich jemanden finde, der mitmacht.«
»Was meinst du mit ›einsteigen‹?«, wollte ich wissen. Ich dachte, die Einzigen, die einsteigen oder auf Tipps setzen konnten, seien die Kunden – gewiefte alte Hasen mit jeder Menge Zaster. Schließlich brauchte man Hunderte oder gar Tausende, um an der Börse zu spekulieren. Das konnte doch nur, wer eine eigene Karosse hatte und einen Kutscher mit Zylinder.
»Na, einsteigen eben. Wie viel Geld hast du denn?«, drängte er.
»Wie viel brauchst du?«
»Also, mit 5 Dollar Einsatz kann ich fünf Aktien ordern.«
»Und wie willst du das machen?«
»Ich kaufe so viele Burlington-Aktien, wie ich im Bucket Shop für das Geld bekomme, das ich als Einschuss hinterlegen kann. Das ist eine todsichere Sache. Das Geld liegt quasi auf der Straße, wir müssen es nur noch aufheben. Wir werden unseren Einsatz locker verdoppeln.«
»Warte mal«, sagte ich da und zog mein Notizbuch heraus.
Ob ich mein Geld verdoppeln würde, interessierte mich gar nicht – wohl aber seine Behauptung, Burlington würde zulegen. Stimmte das, so müsste es eigentlich aus meinen Notizen hervorgehen. Ich sah nach, und tatsächlich: Die Burlington-Aktie verhielt sich meinen Aufzeichnungen zufolge genau so, wie sie es gewöhnlich vor einem Kursanstieg tat. Ich hatte noch nie im Leben etwas an der Börse ge- oder verkauft und mich auch nie mit den anderen Jungs im Glücksspiel versucht. Doch sah ich darin eine großartige Gelegenheit, um zu prüfen, ob meine Rechnerei – mein kleines Steckenpferd – etwas taugte. Mir war sofort klar: Wenn meine Erkenntnisse keinen praktischen Nutzen hatten, dann waren sie im Grunde wertlos. Also gab ich ihm mein ganzes Geld. Wir legten zusammen, trugen unsere Barschaft in den nächsten Bucket Shop und kauften Burlington. Zwei Tage später machten wir Kasse. Mir blieben 3,12 Dollar Gewinn.
Nach diesem ersten Erfolg begann ich, auf eigene Rechnung in den Bucket Shops zu spekulieren. Ich ging in der Mittagspause hin und kaufte oder tätigte Leerverkäufe – da hatte ich nie eine Präferenz. Ich spekulierte mit System und setzte nicht auf eine favorisierte Aktie oder bestimmte Meinungen. Für mich war das ein reines Rechenexempel. Und es sollte sich herausstellen, dass meine Strategie für die Bucket Shops ideal war. Denn dort wettet ein Spekulant im Grunde auf die Schwankungen, die der Ticker auf dem Papierstreifen ausspuckt.
Es dauerte gar nicht lange, und ich verdiente in den Bucket Shops weit mehr als mit meinem Job im Maklerhaus. Also kündigte ich. Meiner Familie war das gar nicht recht, doch sie konnten wenig dagegen sagen, als sie sahen, wie viel Geld ich nach Hause brachte. Ich war ja noch ein Kind, und so ein Bürogehilfe verdiente nicht viel. Als Spekulant machte ich mich dagegen richtig gut.
Mit 15 Jahren hatte ich meinen ersten Tausender beisammen und legte meiner Mutter das Geld auf den Tisch – alles in wenigen Monaten in den Bucket Shops verdient, und zwar zusätzlich zu dem, was ich schon laufend zum Haushalt beigesteuert hatte. Meiner Mutter schwante Übles. Sie wollte, dass ich das Geld zur Sparkasse bringe, weil es mich sonst in Versuchung führen könnte. Sie hatte noch nie gehört, dass ein Fünfzehnjähriger mit nichts angefangen und so viel Geld verdient hatte. Sie konnte gar nicht glauben, dass das Geld echt war. Sie lebte ständig in Sorge und machte sich Gedanken. Doch ich dachte nur daran, wie ich auch weiterhin beweisen könnte, dass meine Rechnereien korrekt waren. Nur darum ging es mir – recht zu behalten, indem ich meinen Verstand benutzte. Lag ich richtig, wenn ich meine Überzeugungen an zehn Aktien überprüfte, dann würde ich bei einem Handel mit hundert Aktien zehnmal mehr recht behalten. Mit höheren Einsätzen zu spekulieren bedeutete für mich nur eines: Es bestätigte noch deutlicher, dass ich recht hatte. Mehr Mut erforderte es absolut nicht. Das machte für mich keinen Unterschied. Wer nur zehn Dollar besitzt und diese aufs Spiel setzt, braucht mehr Mut als einer, der eine Million einsetzt, wenn er noch eine zweite auf der hohen Kante hat.
Mit 15 Jahren lebte ich jedenfalls ganz gut vom Aktienmarkt. Meine ersten Börsengeschäfte machte ich in kleineren Bucket Shops, wo jemand, der mit 20 Aktien auf einmal handelte, schon als verkappter John W. Gates oder J. P. Morgan galt. Damals legten die Bucket Shops ihre Kunden selten aufs Kreuz. Das hatten sie gar nicht nötig. Es gab andere Möglichkeiten, ihnen ihr Geld abzunehmen, auch wenn sie eigentlich richtiglagen. Das Geschäft dieser Winkelmakler war enorm lukrativ. Wurde es ordnungsgemäß betrieben – also so anständig wie in dieser Branche möglich –, dann sorgte schon die Kursentwicklung dafür, dass die Leute Geld verloren. Schließlich reichten kleinste Schwankungen aus, um einen Einschuss von einem dreiviertel Punkt aufzuzehren. Und wer einmal betrog, war für immer aus dem Geschäft und konnte seinen Laden dichtmachen. Niemand hätte dort mehr gehandelt.
Ich arbeitete allein, ganz ohne irgendwelche Mitstreiter – ein typischer Einmannbetrieb. Schließlich kam es auf meinen Kopf an, nicht wahr? Entweder entwickelten sich die Kurse so, wie ich es mir – ohne jede Hilfe von Freunden oder Partnern – ausgerechnet hatte, oder nicht. Und das konnte niemand aus Rücksicht auf mich verhindern. Ich sah daher keinen Grund, mich anderen anzuvertrauen. Natürlich hatte ich Freunde, aber geschäftlich war ich immer als Einzelkämpfer unterwegs und regelte die Dinge lieber im Alleingang.
Naturgemäß dauerte es nicht lange, bis es die Bucket Shops leid waren, dass ich meine Wetten ständig gewann. Wenn ich kam und mein Einschussgeld auf den Tisch legte, wollten sie es nicht mehr annehmen. Nichts zu machen, hieß es. Etwa um dieselbe Zeit bekam ich den Spitznamen »Boy Plunger«: Ich war der »junge Wilde« unter den Spekulanten. Immer wieder musste ich mir neue Broker suchen und tingelte von einem Bucket Shop zum nächsten. Am Ende spekulierte ich sogar unter falschem Namen. Ich stieg mit kleinen Positionen von nur 15 oder 20 Aktien ein. Manchmal, wenn sie Verdacht schöpften, leistete ich mir anfangs gezielt ein paar Verluste, um dann zum richtigen Schlag auszuholen. Doch es war immer das Gleiche: Irgendwann wurde ich ihnen zu teuer, und sie gaben mir zu verstehen, dass ich meine Geschäfte woanders machen und ihren Eignern nicht die Dividende verhageln sollte.
Als mir ein größerer Anbieter, bei dem ich seit Monaten Geschäfte getätigt hatte, die Tür wies, beschloss ich, ihn noch um eine größere Summe zu erleichtern. Der besagte Bucket Shop unterhielt Filialen in der ganzen Stadt, in Hotelhallen und in umliegenden Orten. Ich suchte eine der Zweigstellen in einem Hotel auf, stellte dem Geschäftsführer ein paar Fragen und schloss das erste Geschäft ab. Doch sobald ich mit meiner üblichen Strategie auf eine umsatzstarke Aktie setzte, fragte prompt die Hauptstelle nach, wer denn da spekuliere. Der Geschäftsführer erklärte mir, was man vom ihm wissen wollte, und ich gab meinen Namen als Edward Robinson aus Cambridge an. Er rief seinen Oberboss an und teilte ihm die gute Nachricht mit. Doch der erkundigte sich unmittelbar, wie dieser Edward Robinson denn aussehe. Auch das gab der Geschäftsführer an mich weiter, woraufhin ich ihm riet: »Sagen Sie einfach, ich sei klein, dick, dunkelhaarig und trüge einen buschigen Bart!« Doch er beschrieb mich wahrheitsgetreu. Er lauschte in den Hörer, lief rot an, legte auf und forderte mich auf abzuzischen.
»Was hat man Ihnen denn gesagt?«, fragte ich höflich.
»Sie sagten: ›Verdammter Narr, haben wir Ihnen denn nicht eingeschärft, dass Sie mit Larry Livingston keine Geschäfte machen sollen? Und Sie lassen zu, dass er uns um 700 Dollar erleichtert!‹« Was er sich sonst noch anhören musste, wollte er mir nicht sagen.
Ich versuchte mein Glück nacheinander in den übrigen Filialen, doch sie waren allesamt vorgewarnt und wollten mein Geld nicht nehmen. Ich konnte die Bucket Shops nicht einmal betreten, um mir die Kurse anzusehen, ohne dass ich von Mitarbeitern angegangen wurde. Ich versuchte wieder ins Geschäft zu kommen, indem ich meine Besuche über längere Zeiträume streckte und auf die verschiedenen Winkelbörsen aufteilte, doch auch das brachte nichts.
Am Ende blieb mir nur noch ein Anbieter – der größte und reichste von allen: die Cosmopolitan Stock Brokerage Company.
Die Cosmopolitan war mit der Note A-1 exzellent eingestuft und sehr gut im Geschäft. Sie hatte Niederlassungen in fast allen Industriestädten Neuenglands. Dort nahm man mein Geld an, und ich konnte ein paar Monate lang Aktien kaufen und leerverkaufen und verbuchte Gewinne und Verluste. Doch nach einer Weile bekam ich die üblichen Probleme. Man wies mich dort aber nicht so offen ab wie in den kleinen Bucket Shops – nicht etwa aus Fairness, sondern weil sie wussten: Machte es die Runde, dass sie einen Kunden ablehnten, weil dieser zufällig ein bisschen Geld verdiente, würde das ein schlechtes Licht auf sie werfen. Aber sie ließen sich etwas anderes einfallen, was mich fast genauso hart traf: Sie verlangten von mir eine Sicherheitsleistung von drei Punkten und forderten zunächst einen halben, dann einen und schließlich eineinhalb Punkte Aufschlag. Das war ein ordentliches Handicap! Wie das ging? Ganz einfach: Nehmen wir an, Steel notiert bei 90, und Sie wollen kaufen. Normalerweise würde dann auf dem Ticket stehen: »10 Steel zu 90 1/8 gekauft«. Bei einer Marge von einem Punkt bedeutete das: Fiel der Kurs unter 89 ¼, war man automatisch aus dem Rennen. In einem Bucket Shop gab es weder Nachschussforderungen noch die lästige Pflicht, seinen Makler anzuweisen, zu jedem Kurs zu verkaufen.
Das Aufgeld, das mir die Cosmopolitan abforderte, war ein Schlag unter die Gürtellinie. Für mich bedeutete das: Lag der Kurs bei 90, wenn ich kaufte, so stand auf meinem Ticket nicht »10 Steel zu 90 1/8 gekauft«, sondern »10 Steel zu 91 1/8 gekauft«. Das hieß, auch wenn die Aktie 1 ¼ Punkt zulegte, nachdem ich sie gekauft hatte, stünde ich noch immer mit einem Verlust da, wenn ich die Position glattstellte. Indem sie außerdem von vornherein auf einer Sicherheitsleistung von drei Punkten bestanden, verringerten sie mein Handelsvolumen um zwei Drittel. Doch da kein anderer Bucket Shop überhaupt noch mit mir Geschäfte machen wollte, musste ich mich wohl oder übel darauf einlassen, wenn ich weiter spekulieren wollte.
Natürlich lief es für mich mal besser, mal schlechter, doch unter dem Strich verbuchte ich nach wie vor Gewinn. Den Leuten von der Cosmopolitan reichte das heftige Handicap aber noch nicht, das sie mir verpasst hatten, um mich aus dem Feld zu schlagen. Sie versuchten, ein doppeltes Spiel mit mir zu treiben. Doch mein Instinkt rettete mich.
Wie gesagt, war die Cosmopolitan für mich die letzte Möglichkeit. Sie war die finanzkräftigste Winkelbörse in Neuengland und setzte in der Regel keine Obergrenzen für ihre Geschäfte fest. Ich war vermutlich ihr umsatzstärkster Einzelkunde im täglichen Stammpublikum. Sie verfügte über schicke Büros und die größte, umfassendste Kurstafel, die ich je gesehen hatte. Sie ging über die ganze Länge des großen Raumes und wies alle Kurse aus, die man sich nur vorstellen konnte: also Aktien, die an den Börsen in New York oder Boston gehandelt wurden, Baumwolle, Weizen, Lebensmittel, Metalle – einfach alles, was in New York, Chicago, Boston und Liverpool ge- und verkauft wurde.
Wissen Sie, wie in Bucket Shops gehandelt wurde? Man gab sein Geld einem Mitarbeiter und sagte ihm, was man kaufen oder leerverkaufen wolle. Er schaute auf den Ticker oder die Anzeigetafel und übernahm den dort notierten Kurs – den aktuellsten natürlich. Auf dem Ticket hielt er auch die Uhrzeit fest, ganz ähnlich wie bei einer offiziellen Maklerabrechnung. Es ging also daraus hervor, dass man für den Kunden eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt und Kurs an einem bestimmten Tag ge- oder verkauft hatte und wie viel Geld dieser dafür hinterlegt hatte. Wollte man seine Position glattstellen, wendete man sich wieder an den (oder – je nach Anbieter – auch einen anderen) Mitarbeiter und informierte ihn entsprechend. Er stellte den zuletzt gehandelten Kurs fest oder – falls es keine Umsätze gegeben hatte – wartete, bis der Ticker die nächste Notierung ausspuckte. Dann hielt er den Kurs und den Zeitpunkt auf dem Ticket fest, zeichnete es ab und gab es dem Kunden zurück. Dieser ging damit zur Kasse und konnte sich den ausgewiesenen Betrag auszahlen lassen. Wandte sich der Markt aber gegen den Kunden, und der Kurs überschritt die durch den Einschuss gesetzte Grenze, wurde die Position automatisch aufgelöst. Das Ticket war dann nur noch ein wertloses Stück Papier.
In den kleineren Bucket Shops, in denen man schon fünf Aktien handeln konnte, waren die Tickets kleine Zettel in unterschiedlichen Farben – für Käufe und Verkäufe. In Haussephasen, wenn alle Kunden auf steigende Kurse setzten und zufällig richtiglagen, wurde es für solche Läden manchmal eng. Dann kassierte der Bucket Shop sowohl eine Kauf- als auch eine Verkaufsprovision. Kaufte man eine Aktie zu 20, stand auf dem Ticket 20 ¼. Das bedeutete, ein Anstieg um einen Punkt zählte für den Käufer nur zu ¾.
Die Cosmopolitan war aber das Beste, was Neuengland zu bieten hatte. Sie hatte Tausende Kunden, und ich glaube tatsächlich, ich war der einzige, den man dort fürchtete. Weder das halsabschneiderische Aufgeld noch die mit drei Punkten hohe Sicherheitsleistung, die man mir abforderte, hatten meine Geschäfte nachhaltig beeinträchtigt. Ich kaufte und verkaufte weiter, so viel sie mich ließen. Mitunter hielt ich 5.000 Aktien gleichzeitig.
An dem Tag, als sich zutrug, was ich Ihnen gleich erzählen werde, hatte ich 3.500 Sugar-Aktien leerverkauft. Ich stand mit sieben großen rosa Tickets über jeweils 500 Stück da. Die Cosmopolitan verwendete große rosa Tickets mit einer Leerzeile, in der Nachschusszahlungen eingetragen werden konnten. Natürlich gab es so etwas in einem Bucket Shop nicht. Je weniger Sicherheitsleistung, desto besser für den Anbieter, der ja davon profitierte, wenn der Kunde alles verlor. Wollte man bei einem kleineren Anbieter für ein Geschäft mehr Geld hinterlegen, wurde ein neues Ticket ausgestellt. Auf diese Weise konnte man dem Kunden erneut die Kaufprovision abziehen und ihm für jeden Punkt, um den der Kurs zurückging, nur einen ¾ Punkt gutschreiben. Denn auch die anfallende Verkaufsprovision wurde so berechnet, als handele es sich um ein neues Geschäft.
Ich weiß noch, dass ich am betreffenden Tag über 10.000 Dollar als Sicherheitsleistung hinterlegt hatte.
Ich war erst 20 Jahre alt, als ich meine ersten 10.000 Dollar in der Tasche hatte. Sie hätten meine Mutter hören sollen! Man hätte meinen können, nur der alte Rockefeller höchstpersönlich dürfe 10.000 Dollar in bar mit sich herumtragen. Immer wieder ermahnte sie mich, mich doch endlich zufriedenzugeben und einer geregelten Arbeit nachzugehen. Sie wollte nicht begreifen, dass ich kein Spieler war, sondern mein Geld damit verdiente, dass ich eins und eins zusammenzählte. Für sie waren 10.000 Dollar ein Vermögen – für mich nur mehr Einsatzkapital.
Ich hatte meine 3.500 Sugar-Aktien zu 105 ¼ leerverkauft. Es war noch ein Spekulant anwesend, der eine Short-Position über 2.500 Aktien hielt: Henry Williams. Ich saß gern am Ticker und rief dem Kurstafeljungen die Notierungen zu. Der Kurs entwickelte sich genau so, wie ich es angenommen hatte. Er gab ein paar Zähler nach und legte dann eine kurze Atempause ein, um weiter abzurutschen. Der Markt schwächelte insgesamt, und es sah recht vielversprechend für mich aus. Doch das Zögern der Sugar-Aktie stimmte mich plötzlich misstrauisch. Mich beschlich ein ungutes Gefühl. Ich dachte, ich sollte besser aussteigen. Da notierte das Papier bei 103 – auf dem Tagestief –, doch nicht einmal das konnte mich beruhigen. Ich wurde immer nervöser. Irgendwas stimmte da nicht, das spürte ich ganz genau. Ich konnte aber nicht sagen, was. Doch wenn da etwas im Busch war, und ich wusste nicht, was, konnte ich mich auch nicht dagegen wappnen. Also sollte ich wohl besser den Absprung wagen.
Wissen Sie, ich neige nicht zu überstürzten Entscheidungen. Das liegt mir einfach nicht. Schon als Kind brauchte ich immer einen triftigen Grund für alles. In dieser Situation hatte ich keinen solchen Grund, doch ich fühlte mich so unwohl, dass ich es nicht länger aushielt. Ich rief Dave Wyman zu mir, den ich kannte, und bat ihn: »Dave, können Sie hier übernehmen? Tun Sie mir bitte den Gefallen, und warten Sie einen Moment, bevor Sie den nächsten Kurs für Sugar ausrufen, ja?«
Er versprach es mir. Ich stand auf und überließ ihm meinen Platz am Ticker, damit er die Kurse ausrufen konnte. Ich zog meine sieben Sugar-Tickets aus der Tasche und ging zu dem Schalter hinüber, an dem der Angestellte saß, der die Tickets beim Glattstellen abzeichnete. Da ich aber keinen stichhaltigen Grund hatte auszusteigen, stand ich einfach da, lehnte mich gegen den Tresen und hielt meine Tickets so in der Hand, dass der Mann sie nicht sehen konnte. Kurz darauf hörte ich den Fernschreiber rattern und sah, dass der Bucket-Shop-Mitarbeiter Tom Burnham rasch den Kopf drehte und aufhorchte. Ich spürte ganz deutlich, dass da etwas in der Luft lag, und traf eine Entscheidung. Im selben Moment setzte Dave Wyman am Ticker an mit: »Su …«. Blitzschnell knallte ich meine Tickets vor Burnham auf den Tresen und rief: »Sugar glattstellen!«, noch bevor Dave den Kurs ausrufen konnte. Folglich musste das Maklerhaus meine Sugar-Position zum letzten Kurs auflösen. Kurz darauf rief Dave erneut 103 aus.
Meinen Berechnungen nach hätte Sugar inzwischen unter 103 gefallen sein müssen. Das lief nicht, wie es sollte. Ich witterte eine Falle. Auf jeden Fall ratterte der Fernschreiber inzwischen wie verrückt, und Tom Burnham hatte meine Tickets unabgezeichnet liegen lassen und lauschte, als warte er auf etwas. Ich rief ihm zu: »Hey, Tom, worauf warten Sie, verdammt noch mal? Zeichnen Sie die Tickets ab – zu 103! Na los!«
Alle Anwesenden konnten mich hören und schauten alarmiert auf. Gab es Probleme? Die Cosmopolitan hatte bisher zwar immer gezahlt, doch man konnte nie wissen – und ein Run auf so einen Bucket Shop beginnt genauso wie ein Run auf eine Bank. Wurde ein Kunde misstrauisch, folgten schnell andere. Widerwillig kam Tom herüber und zeichnete meine Tickets ab – mit »glattgestellt zu 103«. Mit säuerlicher Miene schob er mir alle sieben Tickets zu.
Toms Tresen war nur ein paar Schritte von der Kasse entfernt, aber ich war noch nicht ganz dort angekommen, um mir mein Geld auszahlen zu lassen, als Dave Wyman am Ticker aufgeregt schrie: »Meine Güte! Sugar 108!« Zu spät. Also lachte ich nur und rief Tom zu: »Hat wohl nicht geklappt diesmal, was?«
Das Ganze war natürlich ein abgekartetes Spiel gewesen. Henry Williams und ich hatten zusammen 6.000 Sugar-Aktien leerverkauft. Der Bucket Shop hatte unsere Einschussgelder kassiert, und vielleicht gab es noch viele weitere Spekulanten in dieser Filiale, die Sugar leerverkauft hatten. Möglicherweise ging es insgesamt um 8.000 oder sogar 10.000 Aktien. Nehmen wir an, sie hatten für Sugar Einschusszahlungen in Höhe von 20.000 Dollar eingenommen. Dafür lohnte es sich für den Bucket Shop schon, an der New Yorker Börse den Markt zu manipulieren, um uns abzuservieren. Gab es früher in einem Bucket Shop für eine Aktie zu viele Long-Positionen, war es durchaus üblich, sich einen Makler zu suchen, der den Kurs der betreffenden Aktie so weit drückte, dass alle auf Long-Seite engagierten Kunden abserviert wurden. Der Bucket Shop verlor dadurch selten mehr als ein paar Punkte auf mehrere Hundert Aktien, verdiente aber Tausende von Dollars.
Genau so etwas hatte die Cosmopolitan mit Henry Williams, mir und anderen Leerverkäufern versucht. Ihre Makler in New York trieben den Kurs hoch auf 108. Danach fiel er natürlich wieder zurück, doch Henry und viele andere schauten in die Röhre. Bei jedem unerklärlichen Einbruch einer Aktie, auf den sofort eine Erholung folgte, sprachen die Zeitungen seinerzeit von einem Bucket-Shop-Manöver.
Kaum zehn Tage nach dem Versuch der Cosmopolitan, mich auf diese Weise über den Tisch zu ziehen, knöpfte ihr ein New Yorker Spekulant ironischerweise gleich 70.000 Dollar ab. Dieser Mann hatte seinerzeit erheblichen Einfluss auf den Markt, war Mitglied der New Yorker Börse und hatte sich als Baissespekulant während der Bryan-Panik im Jahr 1896 einen Namen gemacht. Er geriet immer wieder mit der Börsenordnung aneinander, die ihn daran hinderte, Pläne auszuführen, die auf Kosten anderer Börsenmitglieder gingen. Eines Tages kam er auf die Idee, dass sich vermutlich weder die Börse noch die Strafverfolgungsbehörden beschweren würden, wenn er den Winkelbörsen des Landes einen Teil ihrer unrechtmäßig erworbenen Gewinne abjagte. In diesem Fall beauftragte er 35 Männer, sich als Kunden auszugeben. Sie suchten die Zentrale und die größeren Filialen des Bucket Shops auf. An einem bestimmten Tag kauften sie zu einem vereinbarten Zeitpunkt eine bestimmte Aktie in so großer Stückzahl, wie sie ihnen die Geschäftsstellenleiter zubilligten. Hatte der Gewinn eine bestimmte Höhe erreicht, sollten sie sich unauffällig zurückziehen. Natürlich verbreitete er währenddessen in seinen Kreisen, die Aktie wäre ein heißer Tipp, und trieb den Preis im Präsenzhandel selbst in die Höhe – unterstützt von den Parketthändlern, die große Stücke auf ihn hielten. Da er die geeignete Aktie für diese Aktion sorgfältig ausgewählt hatte, konnte er den Kurs problemlos um drei oder vier Punkte steigern. Seine Auftragskäufer in den Bucket Shops kassierten wie vorgesehen.
Ein Bekannter erzählte mir, der Spekulant habe mit diesem Trick netto 70.000 Dollar verdient, zuzüglich der Spesen und Honorare für seine Helfershelfer. Diese Nummer zog er landesweit gleich mehrfach durch und strafte so die größeren Bucket Shops von New York, Boston, Philadelphia, Chicago, Cincinnati und St. Louis ab. Eine seiner Lieblingsaktien war Western Union, denn eine nur mäßig umsatzstarke Aktie wie diese konnte man leicht um ein paar Zähler nach oben oder nach unten treiben. Seine Helfer kauften sie zu einem bestimmten Kurs, verkauften sie mit zwei Punkten Gewinn, gingen anschließend short und nahmen in Abwärtsrichtung noch einmal drei Punkte mit. Neulich habe ich übrigens gelesen, der Mann soll mittellos und unbeachtet verstorben sein. Hätte er 1896 das Zeitliche gesegnet, wäre ihm zumindest eine Spalte auf der ersten Seite jeder New Yorker Zeitung sicher gewesen. Als es dann so weit war, bekam er gerade mal zwei Zeilen auf Seite fünf.
Zweites Kapitel
Ich hatte erkannt, dass die Cosmopolitan Stock Brokerage Company nicht davor zurückschreckte, mich mit unlauteren Waffen zu schlagen, als selbst das brutale Handicap von drei Punkten Einschuss mit einem Aufgeld von eineinhalb Zählern nichts brachte, und kapierte, dass sie mit mir sowieso keine Geschäfte machen wollte. Wenig später entschloss ich mich, nach New York zu gehen. Dort konnte ich im Büro eines Mitglieds der New Yorker Börse spekulieren. Mit einer Niederlassung in Boston war mir nicht gedient, denn dorthin mussten die Kurse erst telegrafisch übermittelt werden. Ich wollte direkt an der Quelle sitzen. So kam ich im Alter von 21 Jahren nach New York – mit 2.500 Dollar in der Tasche. Das war alles, was ich hatte.
Ich hatte zwar mit 20 schon einmal 10.000 Dollar besessen und für das Sugar-Geschäft über 10.000 Dollar eingesetzt, doch ich gewann ja nicht immer. Meine Handelsstrategie war einigermaßen solide, und ich gewann mehr, als ich verlor. Wäre ich dabei geblieben, hätte ich damit vielleicht sieben von zehn Mal richtig gelegen. Tatsächlich machte ich stets Gewinn, wenn ich mir meiner Sache von vornherein sicher war. Doch ich stellte mir selbst ein Bein, weil ich nicht genug Grips hatte, um mich strikt an meine Strategie zu halten – und nur dann einzusteigen, wenn ich mich vergewissert hatte, dass sämtliche bisherigen Entwicklungen dafürsprachen. Alles hat seine Zeit, aber das war mir damals noch nicht klar. Und genau aus diesem Grund scheitern an der Börse so viele, obwohl sie nicht auf den Kopf gefallen sind. Es gibt natürlich Idioten, die bei allem, was sie anfassen, grundsätzlich danebengreifen. Doch es gibt auch die Börsen-Dummköpfe, die glauben, sie müssten ständig kaufen und verkaufen. Dabei kann niemand jeden Tag triftige Gründe haben, um Aktien zu kaufen oder zu verkaufen – oder so viel wissen, dass er jedes Mal kluge Entscheidungen trifft.
Das beste Beispiel dafür bin ich selbst. Wenn ich mich beim Lesen des Tickers auf meine Erfahrungen verließ, so zahlte sich das aus. Doch wenn ich ohne Sinn und Verstand spekulierte, verlor ich sofort. Da bin ich keine Ausnahme. Ich stand vor der riesigen Kurstafel, während der Ticker lief und andere um mich herum ihre Wetten platzierten und erlebten, wie sich ihre Tickets entweder in bare Münze verwandelten oder im Papierkorb landeten. Natürlich ließ auch ich mich manchmal wider besseres Wissen zu spontanen Geschäften hinreißen. In einem Bucket Shop, wo die Gewinnspanne nicht groß ist, fackelt man nicht lange. Zu schnell ist man aus dem Spiel. Viele Verluste an der Wall Street sind dem Drang zu ständiger Aktivität zuzuschreiben, ungeachtet der aktuellen Marktbedingungen. Das gilt auch für Profis, die glauben, sie müssten wie ein Gehaltsempfänger jeden Tag Geld nach Hause bringen. Und Sie müssen bedenken: Ich war ja praktisch noch ein Kind. [Zu der Zeit wusste ich noch nicht, was ich noch lernen sollte und was mich 15 Jahre später dazu bewog, zwei lange Wochen abzuwarten und zuzusehen, bis eine Aktie, die ich sehr optimistisch beurteilte, 30 Zähler zugelegt hatte. Erst dann fühlte ich mich sicher genug, sie zu kaufen. Damals war ich pleite und versuchte, wieder ins Spiel zu kommen. Leichtsinn konnte ich mir nicht leisten. Ich musste unbedingt richtigliegen, deshalb wartete ich ab.] Das war 1915. Und es ist eine lange Geschichte, auf die ich an anderer, passenderer Stelle noch ausführlicher eingehe. Zunächst will ich schildern, wie es kam, dass mir die Bucket Shops, nachdem ich sie jahrelang in ihrem eigenen Spiel geschlagen hatte, fast meine ganzen Gewinne abnehmen konnten.
Ich bin ihnen sehenden Auges ins offene Messer gelaufen! Und das ist mir im Leben nicht nur einmal passiert. Der Spekulant ist selbst sein größter Feind – und der teuerste obendrein. Doch zurück zum Thema. Ich kam also mit 2.500 Dollar in der Tasche nach New York. Dort gab es keine halbseidenen Bucket Shops. Der Börse war es in Zusammenarbeit mit der Polizei gelungen, sie weitgehend zurückzudrängen. Außerdem war ich auf der Suche nach einem Markt, auf dem mein Einsatzkapital das einzige war, das meinen Geschäften Grenzen setzen konnte. Ich hatte zwar nicht sehr viel davon, doch ich rechnete fest damit, dass sich das ändern würde. Für den Anfang musste ich vor allem einen Anbieter finden, der mich nicht über den Tisch ziehen würde. Also suchte ich ein an der New Yorker Börse tätiges Maklerhaus auf, das eine Niederlassung in meiner Heimatstadt hatte, deren Mitarbeiter mir zum Teil bekannt waren. Der Makler ist inzwischen längst nicht mehr im Geschäft. Dort hielt es mich nicht sehr lange. Einer der Teilhaber war mir nicht sympathisch. Also wechselte ich zu A. R. Fullerton & Co. Dort war man offenbar über meine früheren Erfahrungen informiert, denn es dauerte nicht lange, und ich wurde nur noch als der Boy Trader bezeichnet. Ich habe immer jünger ausgesehen, als ich bin. Das war in mancher Beziehung ein Nachteil, doch es zwang mich, mich zu behaupten, weil so viele versuchten, aus meiner Jugend Vorteile zu ziehen. Die Leute in den Bucket Shops sahen, wie jung ich war, und hielten meinen Erfolg unwillkürlich für Anfängerglück.
Was soll ich sagen? Kein halbes Jahr später war ich finanziell am Ende. Als Spekulant war ich recht aktiv gewesen und galt als Gewinner. Ich nehme mal an, die Makler haben an meinen Provisionen nicht schlecht verdient. Eine Zeit lang mehrte sich mein Kapital, doch am Ende kam es, wie es kommen musste: Ich verlor. Ich war zwar nicht unvorsichtig gewesen, doch Verluste waren nun einmal unvermeidlich. Ich kann Ihnen auch sagen, warum: nämlich wegen meines beachtlichen Erfolgs in den Bucket Shops.
Meine Strategie ging nämlich nur in einem Bucket Shop auf, wo ich auf Kursschwankungen setzte. Nur darauf stützte sich meine Lesart des Tickers. Wenn ich kaufte, stand der Kurs vor mir an der Tafel. Schon vor der Kaufentscheidung wusste ich genau, wie viel ich für die betreffende Aktie zahlen musste. Und ich konnte sie stets sofort wieder abstoßen. Ich konnte Gewinne abschöpfen, weil ich blitzschnell reagieren konnte. [Im Sekundentakt konnte ich weiter auf mein Glück vertrauen oder meinen Verlust begrenzen.] So war ich manchmal ganz sicher, dass sich eine Aktie um mindestens einen Punkt bewegen würde. Dann musste ich nicht gierig zugreifen, sondern konnte mit einem Einschuss von einem Punkt arbeiten und mein Geld im Handumdrehen verdoppeln. Es reichte auch ein halber Punkt. Bei 100 oder 200 Aktien am Tag kam am Monatsende ein anständiges Sümmchen heraus.
In der Praxis brachte mein Vorgehen natürlich das Problem mit sich, dass so ein Bucket Shop, selbst wenn er über die Mittel verfügte, fortlaufend empfindliche Verluste zu verkraften, dieses Spiel nicht mitspielte. Dort duldete man keine Kunden, die sich erdreisteten, ständig zu gewinnen.
So oder so – ein für Bucket Shops perfekt geeignetes Handelssystem funktionierte bei Fullerton nicht. Dort kaufte und verkaufte ich nämlich tatsächlich Aktien. Der Kurs von Sugar mochte auf dem Ticker 105 betragen, wenn ich einen Einbruch um drei Punkte kommen sah, doch zu dem Zeitpunkt, zu dem der Ticker 105 anzeigte, lag der Kurs im Handelssaal der Börse vielleicht bei 104 oder 103. Bis mein Leerverkaufsauftrag über 1.000 Stück zur Ausführung bei Fullertons Parketthändler eintraf, konnte er noch weiter gefallen sein. Ich wusste erst genau, zu welchem Kurs ich meine 1.000 Aktien leerverkauft hatte, wenn mir ein Mitarbeiter Meldung machte. Mit einer Transaktion, die mir im Bucket Shop hundertprozentig 3.000 Dollar Gewinn gebracht hätte, verdiente ich bei einem Börsenmakler daher unter Umständen keinen Cent. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber Tatsache ist, dass die Kurse, die der Börsenschreiber bei A. R. Fullerton auswarf, für mein Handelssystem nie aktuell genug waren. Und das war mir nicht klar.
Dass ich mit einer einigermaßen umfangreichen Verkaufsorder den Kurs in der Regel selbst noch drückte, kam erschwerend hinzu. Im Bucket Shop musste ich keine Auswirkungen meiner eigenen Geschäfte auf den Markt einkalkulieren. In New York erlitt ich Verluste, weil ganz andere Spielregeln galten. Und ich verlor nicht etwa deshalb, weil ich jetzt seriöse Geschäfte machte, sondern weil ich keine Ahnung hatte. Mir war immer gesagt worden, ich könne den Ticker gut lesen. Doch auch wenn ich das noch so meisterhaft verstand, half es mir nicht weiter. Womöglich hätte ich viel besser dagestanden, wenn ich selbst auf dem Parkett gehandelt hätte – im Handelssaal der Börse. Dort hätte ich mein System vielleicht direkt an die dortigen Bedingungen anpassen können. Im Stich gelassen hätte es mich aber natürlich trotzdem, sobald ich in so großem Stil gehandelt hätte wie heute – schon allein wegen der Effekte meiner eigenen Geschäfte auf die Kurse.
Kurz, ich verstand nicht genug von der Börsenspekulation. Ich beherrschte einen nicht unerheblichen Teilbereich, was für mich immer sehr wertvoll war. Doch wenn ich trotz alledem Verluste einstecken musste, welche Chancen hatte dann ein unerfahrener Grünschnabel, Gewinne zu erzielen – und auch noch zu realisieren?
Ich merkte schnell, dass meine Strategie nicht richtig aufging, erkannte aber nicht, woran das lag. Manchmal funktionierte mein System hervorragend. Dann produzierte es plötzlich einen Fehlschlag nach dem anderen. Ich war erst 22, wie Sie wissen – also noch nicht so von mir überzeugt, dass ich mich für unfehlbar gehalten hätte. Ich suchte durchaus den Fehler in meinem System, war aber einfach zu jung und unerfahren.
Die Leute im Maklerhaus waren sehr nett zu mir. Aufgrund der Einschussforderungen konnte ich nicht so hoch einsteigen, wie ich wollte, doch in ihrer Freundlichkeit hatten der alte A. R. Fullerton und seine Mannschaft dafür gesorgt, dass ich nach sechs aktiven Handelsmonaten nicht nur mein ganzes Einsatzkapital und sämtliche bisherigen Gewinne verloren hatte, sondern dem Maklerhaus auch noch ein paar Hundert Dollar schuldete. Nun stand ich da: noch ein halbes Kind, das nie von zu Hause fort gewesen war, total blank. Trotzdem wusste ich genau, mit mir stimmte alles, es lag nur an meiner Strategie. Was ich sagen will, ist, dass ich nie mit der Börse haderte. Der Ticker hat immer recht. Sich über den Markt aufzuregen bringt überhaupt nichts.
Ich wollte unbedingt weitermachen, also suchte ich umgehend den alten Fullerton auf und bat ihn: »Können Sie mir 500 Dollar leihen, A. R.?«
»Wofür?«, wollte er wissen.
»Ich brauche ein bisschen Geld.«
»Wofür?«, fragte er erneut.
»Für Einschussgelder natürlich«, erklärte ich.
»500 Dollar?«, meinte er stirnrunzelnd. »Du weißt, dass du 10 Prozent hinterlegen musst – also 1.000 Dollar für 100 Aktien. Besser, ich gebe dir Kredit … «
»Nein«, widersprach ich. »Ich will keinen Kredit. Ich schulde Ihrer Firma bereits Geld. Ich möchte, dass Sie mir 500 Dollar leihen, damit ich losgehen, mehr daraus machen und dann wiederkommen kann.«
»Wie soll das gehen?«, wollte der alte A. R. wissen.
»Ich spekuliere damit in einem Bucket Shop«, erklärte ich.
»Handele doch lieber hier«, meinte er.
»Nein. Ich weiß nicht genau, ob ich hier gewinnen kann. Aber ich bin ganz sicher, dass ich in den Bucket Shops Geld verdienen kann. Ich weiß, wie das geht. Und ich habe auch schon eine Ahnung, was ich hier falsch gemacht habe.«
Er gab mir das Geld, und ich verließ das Maklerbüro, in dem der junge Schrecken der Bucket Shops, wie man mich nannte, sein ganzes Vermögen verspekuliert hatte. Nach Hause zurück konnte ich nicht, weil die dortigen Winkelbörsen keine Geschäfte mehr mit mir machten. New York kam auch nicht infrage, denn dort gab es damals keine Bucket Shops. In den 90er-Jahren sollen Broad Street und New Street voll davon gewesen sein, heißt es. Doch als ich sie brauchte, gab es keine. Nach einigem Überlegen entschloss ich mich, nach St. Louis zu gehen. Ich hatte gehört, dort solle es zwei größere Anbieter geben, die im gesamten mittleren Westen gut im Geschäft waren. Sie mussten stattliche Gewinne einfahren und unterhielten Filialen in Dutzenden von Städten. Es hieß, sie seien nach Umsatz mit keinem Unternehmen der Ostküste zu vergleichen. Sie würden ganz offiziell betrieben, und selbst die angesehensten Kunden tätigten dort bedenkenlos ihre Börsengeschäfte. Einer erzählte mir sogar, der Eigentümer eines der Unternehmen sei Vizepräsident der Handelskammer, doch das konnte nicht in St. Louis gewesen sein. Ich ging jedenfalls mit meinen 500 Dollar dorthin, um mir wieder genügend Einsatzkapital zu beschaffen, das ich dann für Einschusszahlungen bei A. R. Fullerton & Co. verwenden konnte, seines Zeichens Mitglied der New Yorker Börse.
In St. Louis angekommen, machte ich mich in meinem Hotelzimmer frisch und ging auf die Suche nach den Bucket Shops. Der eine Anbieter war die J. G. Dolan Company, der andere H. S. Teller & Co. Ich wusste, ich könnte sie in die Tasche stecken. Ich würde auf Nummer sicher gehen und mein Geschäft konservativ aufziehen. Meine große Angst war, dass mich jemand erkennen und verraten würde, denn jeder Bucket Shop im ganzen Land hatte schon vom Boy Trader gehört. Das ist wie im Casino, wo Klatsch und Tratsch schnell weitergetragen wird.
Dolan war günstiger gelegen als Teller, also ging ich zuerst dorthin. Ich hoffte, man würde mich ein paar Tage spekulieren lassen, bevor man mir die Tür wies. Die Filiale war enorm groß. Es waren mehrere Hundert Personen anwesend, die auf die Kurstafel starrten. Ich freute mich, denn in der Menge hatte ich bessere Chancen, unerkannt zu bleiben. Ich stand da und verfolgte die Kurse. Sorgfältig wählte ich die Aktie für meine erste Wette aus.
Ich schaute mich nach dem Schalter um, an dem ein Mitarbeiter das Geld entgegennahm und dafür ein Ticket ausgab. Der Angestellte sah zu mir herüber. Also ging ich hin und fragte: »Kann man hier Baumwolle und Weizen handeln?«
»Ja, mein Junge«, sagte er.
»Und kann ich auch Aktien kaufen?«
»Wenn du das Geld dafür hast«, entgegnete er.
»Da machen Sie sich mal keine Sorgen, das Geld habe ich schon«, gab ich den jungen Angeber.
»Das hast du also, ja?«, schmunzelte er.
»Wie viele Aktien kriege denn ich für 100 Dollar?«, fragte ich ungeduldig.
»Hundert Stück. Wenn du die 100 Dollar hast.«
»Ich habe 100 Dollar. Sogar 200!«, gab ich zurück.
»Was du nicht sagst!«, meinte er.
»Kaufen Sie einfach 200 Aktien für mich«, forderte ich ihn in scharfem Ton auf.
»200 wovon?«, fragte er da ganz ernst, denn jetzt ging es ums Geschäft.
Ich schaute noch einmal auf die Kurstafel, wie um die richtige Wahl zu treffen, und erklärte: »200 Omaha.«
»Also gut«, sagte er. Er nahm mein Geld entgegen, zählte es und stellte das Ticket aus.
»Wie heißt du?«, wollte er wissen, und ich entgegnete: »Horace Kent.«
Er gab mir das Ticket, und ich ging hinüber und setzte mich zu den Kunden, die darauf warteten, dass sich ihr Geld mehrte. Meine Aktie reagierte schnell, und ich platzierte an diesem Tag gleich mehrere Trades. Am nächsten Tag ebenfalls. In zwei Tagen verdiente ich 2.800 Dollar und hoffte inständig, sie würden mir eine ganze Woche zubilligen. Wenn es so weiterliefe, stünde ich gar nicht so schlecht da. Dann würde ich den anderen Bucket Shop aufsuchen. Wenn ich dort noch einmal so viel Glück hätte, könnte ich mit einer schönen Stange Geld nach New York zurückkehren, womit sich etwas anfangen ließ.
Als ich am Morgen des dritten Tages unbedarft am Schalter stand und 500 B.R.T. orderte, sagte der Angestellte dort: »Hören Sie, Mr Kent, der Chef würde Sie gerne sprechen.«
Mir war klar: Das Spiel war aus. Doch ich fragte: »Was will er denn von mir?«
»Das weiß ich nicht.«
»Wo finde ich ihn?«
»Er hat ein eigenes Büro. Gehen Sie dort hinein.« Er zeigte auf eine Tür.
Als ich eintrat, saß Dolan an seinem Schreibtisch. Er drehte sich schwungvoll zu mir und meinte: »Setzen Sie sich doch, Livingston.«
Er bot mir einen Stuhl an. Meine letzte Hoffnung war verpufft. Keine Ahnung, wie er herausgefunden hatte, wer ich war. Vielleicht aus dem Meldebuch im Hotel.
»Weshalb wollten Sie mich denn sprechen?«, fragte ich.
»Hören Sie, mein Junge, ich habe nichts gegen Sie. Ganz und gar nichts, verstehen Sie?«
»Und was wollen Sie mir damit sagen?«, fragte ich.
Der große, kräftige Mann stand von seinem Drehstuhl auf und sagte: »Kommen Sie mal mit, Livingston«, und ging zur Tür. Er öffnete sie und zeigte auf die Kunden in dem großen Raum.
»Sehen Sie sie?«, fragte er mich.
»Wen soll ich sehen?«
»Na, die Leute. Schauen Sie sich die mal an, mein Junge. Das sind bestimmt 300 – 300 Verlierer! Davon lebe ich mit meiner Familie. Verstehen Sie? Und dann kommen Sie daher und kassieren in zwei Tagen mehr, als mir diese 300 in zwei Wochen einbringen. Kein gutes Geschäft, mein Junge – jedenfalls nicht für mich! Ich habe nichts gegen Sie. Behalten Sie meinetwegen, was Sie gewonnen haben. Aber mehr ist nicht drin. Jedenfalls nicht hier.«
»Aber wieso denn? Ich …«
»Lassen Sie es gut sein. Sie haben mir gleich nicht gefallen, als Sie vorgestern hereingekommen sind. Schon auf den ersten Blick. Ich dachte mir schon, dass Sie Ärger machen würden. Ich rief den Trottel dort zu mir« – er zeigte auf den Verantwortlichen am Schalter – »und fragte, was Sie hier wollten. Als er es mir erzählte, sagte ich: ›Mir gefällt der Knabe nicht. Der macht Ärger!‹ Da sagt doch der Naivling: ›Ach was, Chef. Der heißt Horace Kent und ist ein kleiner Frechdachs, der einmal mit den großen Hunden pinkeln will. Der ist schon in Ordnung.‹ Ich ließ ihn gewähren, und der Wirrkopf hat mich 2.800 Dollar gekostet. Nichts für ungut, mein Junge. Aber für Sie ist der Safe ab jetzt zu.«
»Aber hören Sie …«, versuchte ich es noch einmal.
»Nein, Sie hören jetzt mal, Livingston«, sagte er. »Ich weiß über Sie Bescheid. Ich verdiene mein Geld mit den Wetten der Verlierer da draußen. Sie gehören nicht hierher. Ich will nicht unsportlich sein. Was Sie uns abgenommen haben, können Sie behalten. Doch ich weiß jetzt, wer Sie sind, und wenn ich Sie trotzdem weitermachen ließe, wäre das schön dumm von mir. Also machen Sie, dass Sie weiterkommen, mein Junge.«
Also verließ ich Dolan’s mit meinen 2.800 Dollar Gewinn. Die Teller-Niederlassung war gleich um die Ecke. Ich hatte herausgefunden, dass Teller sehr reich war und auch viele Wettbüros betrieb. Ich beschloss, mein Glück in seinem Bucket Shop zu versuchen. Ich fragte mich, ob es wohl klug wäre, klein anzufangen und mich dann bis auf 1.000 Aktien hochzuarbeiten oder lieber gleich in die Vollen zu gehen, weil ich befürchten musste, dass ich vielleicht nur einen Tag hätte. Sobald sie Geld verlieren, schauen sie schnell genauer hin, und ich wollte doch unbedingt die 1.000 Stück B.R.T. kaufen. Ich war mir sicher, dass da vier oder fünf Punkte für mich drin waren. Doch wenn sie Verdacht schöpften oder zu viele andere Kunden in der Aktie long engagiert waren, dann ließen sie mich vielleicht gar keine Order platzieren. Ich hielt es für besser, meine Trades zu streuen und klein anzufangen.
Der Laden war nicht so groß wie Dolan’s, doch nobler eingerichtet, und die Kunden schienen einer gehobeneren Schicht anzugehören. Das passte mir ausgezeichnet, und ich beschloss, doch meine 1.000 B.R.T. zu ordern. Ich trat an den entsprechenden Schalter und sagte zu dem Angestellten: »Ich würde gern B.R.T. kaufen. Wie hoch ist das Limit?«
»Es gibt kein Limit«, erklärte der Mann. »Sie können kaufen, so viel Sie wollen – vorausgesetzt, Sie haben das Geld dafür.«
»Dann kaufen Sie 1.500 Stück«, sagte ich und zog mein Bündel Scheine aus der Tasche, während der Angestellte begann, das Ticket auszustellen.
Doch er wurde von einem rothaarigen Mann unsanft weggestoßen. Der lehnte sich zu mir herüber und sagte: »Wissen Sie, Livingston, gehen Sie doch zu Dolan’s zurück. Wir wollen keine Geschäfte mit Ihnen machen.«
»Ich warte nur auf mein Ticket«, sagte ich. »Ich habe gerade ein paar B.R.T. gekauft.«
»Hier kriegen Sie kein Ticket«, erklärte er. Da hatten sich schon mehrere Mitarbeiter hinter ihm versammelt und starrten mich feindselig an. »Versuchen Sie nicht noch einmal, hier Geschäfte zu machen. Wir sind nicht interessiert. Kapiert?«
Es hatte keinen Sinn, sich aufzuregen oder zu protestieren. Also ging ich in mein Hotel zurück, zahlte meine Rechnung und nahm den ersten Zug nach New York. Wie bitter. Ich wollte doch unbedingt eine größere Summe zusammenbringen, und bei Teller kam ich nicht ein einziges Mal zum Zuge.
Zurück in New York, gab ich Fullerton seine 500 Dollar zurück und begann mit dem restlichen Geld aus St. Louis wieder zu spekulieren. Ich hatte bessere und schlechtere Phasen, konnte mich aber in der Gewinnzone halten. Immerhin musste ich mir keine Riesenfehler abtrainieren, sondern nur verinnerlichen, dass zur Börsenspekulation mehr gehörte, als mir klar war, bevor ich bei Fullerton anfing. Fast wie ein Zeitungsleser, der gern das Kreuzworträtsel in der Sonntagsbeilage löst und erst zufrieden ist, wenn er es bis auf den letzten Buchstaben ausgefüllt hatte. Ich wollte mein Rätsel jedenfalls unbedingt lösen. Mit den Bucket Shops hatte ich allerdings endgültig abgeschlossen – dachte ich zumindest. Doch ich sollte mich irren.
Ich war schon ein paar Monate wieder in New York, als ein älterer Herr Fullertons Maklerbüro betrat. Er hieß McDevitt und kannte A. R. Mir war zu Ohren gekommen, dass die beiden früher einmal gemeinsame Eigentümer von mehreren Rennpferden gewesen sein sollten. Dass der Mann bessere Zeiten gesehen hatte, war offensichtlich. Wir wurden einander vorgestellt. Er erzählte den Anwesenden von ein paar Gaunern aus dem Westen, die Rennbahnen abgezockt hatten – zuletzt in St. Louis. Der Kopf der Bande, so McDevitt, sei der Wettbüro-Eigner Teller.
»Welcher Teller?«, fragte ich.
»Na, Teller. H. S. Teller.«
»Ich kenne den Vogel«, erklärte ich.
»Der taugt nicht viel«, sagte McDevitt.
»Das kann man wohl sagen. Und ich habe noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen.«
»Und wie wollen Sie das machen?«
»Na, wie schon? Solche Leute muss man dort treffen, wo es ihnen wehtut – im Geldbeutel. In St. Louis kann ich ihm zurzeit nichts anhaben. Aber irgendwann bietet sich bestimmt eine Gelegenheit.« Ich erzählte McDevitt, was ich Teller nachtrug.
»Er hat auch schon versucht, hier in New York Fuß zu fassen, das ist ihm aber nicht gelungen. Deshalb hat er einen Laden in Hoboken aufgemacht. Es heißt, dort kann man ohne Limit spekulieren. Angeblich soll so viel Geld über den Tisch gehen, dass sich der Felsen von Gibraltar dagegen wie ein Staubkorn ausnimmt.«
»Was für eine Art Laden ist das?« Sicher meinte er ein Wettbüro.
Aber nein. »Ein Bucket Shop«, sagte McDevitt.
»Und Sie sind sicher, dass der noch im Geschäft ist?«
»Das ist mir von mehreren Seiten bestätigt worden.«
»Geredet wird viel, wenn der Tag lang ist. Können Sie verlässlich herausfinden, ob der Betrieb dort läuft und mit welchen Einsätzen man spekulieren kann?«
»Kein Problem, mein Junge«, meinte McDevitt. »Ich fahre morgen selbst hin, und wenn ich wieder da bin, sage ich Ihnen Bescheid.«
Das tat er. Offenbar war Teller bereits gut im Geschäft und nahm so viel Geld an, wie er nur kriegen konnte. Das war an einem Freitag. In der betreffenden Woche hatte der Markt in einer Tour zugelegt – das war wohlgemerkt vor 20 Jahren –, und es war sonnenklar, dass am Samstag ein kräftiger Rückgang der Gewinnrücklagen ausgewiesen werden würde. Das sollte den großen Parketthändlern die gängige Ausrede liefern, auf den Markt aufzuspringen und zu versuchen, ein paar der schwächeren Maklerhäuser zu verdrängen. Es würde in der letzten halben Handelsstunde die üblichen Reaktionen geben – vor allem bei besonders umsatzstarken Aktien. Selbstredend betraf das dieselben Aktien, in denen Tellers Kunden die größten Long-Positionen hielten. Ein wenig Short-Engagement würde der Bucket Shop daher sicher gerne sehen. Es gab nichts Schöneres, als solchen Leuten gleich doppelt eins auszuwischen – und bei Einschüssen von einem Punkt war nichts einfacher als das.
Am betreffenden Samstagmorgen fuhr ich unverzüglich hinüber nach Hoboken zur Teller-Filiale. Dort gab es einen großen Raum für Kunden mit einer imposanten Kurstafel, einer vollständigen Belegschaft und sogar einem grau uniformierten Wachmann. Es hatten sich bereits rund 25 Kunden eingefunden.
Ich kam mit dem Geschäftsführer ins Gespräch. Als er mich fragte, ob er etwas für mich tun könne, verneinte ich. Schließlich könne man auf der Rennbahn angesichts der Quoten und der Freiheit, beliebig hohe Wetten zu platzieren, in Minuten um mehrere Tausend Dollar reicher werden, statt sich bei Aktien mit Kleinvieh abzugeben und womöglich tagelang warten zu müssen. Da erklärte er mir, wie viel sicherer es sei, an der Börse zu spekulieren, und wie viel manche seiner Kunden dort verdienten – ganz, als wäre er ein seriöser Makler, der für seine Kunden an der Börse Aktien kaufte und verkaufte. Wer sich nur intensiv genug engagiere, könne so viel verdienen, dass keine Wünsche offenblieben. Er musste annehmen, ich sei auf dem Weg ins Wettbüro und wollte mir noch schnell etwas von meinem Geld aus der Tasche ziehen, bevor ich es auf der Rennbahn verlor. Deshalb drängte er mich, ich solle mich ranhalten, weil der Markt am Samstag um 12 Uhr schlösse. Dann bliebe mir ja noch der ganze Nachmittag, um anderen Beschäftigungen nachzugehen. Und mit den richtigen Aktien könne ich meine Einsätze noch ein bisschen aufpolstern.
Ich schaute ihn gewollt ungläubig an. Er redete weiter auf mich ein. Dabei behielt ich die Uhr im Auge. Um 11 Uhr 15 sagte ich: »Also gut«, und erteilte ihm Leerverkaufsaufträge für mehrere Aktien. Ich blätterte 2.000 Dollar auf den Tisch, die er nur zu gerne an sich nahm. Er wünschte mir viel Erfolg und gab der Hoffnung Ausdruck, mich von nun an häufiger zu sehen.
Es kam, wie ich es erwartet hatte. Die Trader setzten die Aktien, von denen sie sich die meisten fallenden Stopps versprachen, gnadenlos unter Druck – und prompt purzelten die Kurse. Ich stellte meine Positionen glatt, kurz bevor in den letzten fünf Minuten eine Rallye einsetzte, weil sich Trader eindecken und ihre zuvor leerverkauften Titel zurückkaufen mussten.
Das bescherte mir 5.100 Dollar Gewinn. Den wollte ich kassieren.
»Ich bin wirklich froh, dass ich hereingeschaut habe«, erklärte ich dem Geschäftsführer und reichte ihm meine Tickets.
»Das kann ich Ihnen aber nicht auf einmal auszahlen«, gestand er mir. »Mit solchen Summen habe ich nicht gerechnet. Sie können sich Ihr Geld am Montagmorgen abholen – todsicher.«
»Meinetwegen. Aber erst geben Sie mir alles, was Sie dahaben.«
»Sie müssen mich erst die kleineren Gewinne auszahlen lassen«, wandte er ein. »Ich gebe Ihnen Ihren Einschuss zurück – und alles, was dann noch übrig bleibt. Bitte warten Sie aber, bis ich die anderen Tickets ausgelöst habe.« Also wartete ich, während er die anderen Gewinner auszahlte. Ich machte mir keine Sorgen um mein Geld. In einer Filiale, die so gut lief, würde Teller sich nicht vor der Zahlung drücken. Und wenn doch, konnte ich auch nicht mehr tun, als mir zu sichern, was in der Kasse war. Ich bekam meine 2.000 Dollar und noch etwa 800 Dollar obendrauf. Mehr war nicht da. Ich erklärte dem Geschäftsführer, ich würde Montagmorgen wiederkommen. Er versprach mir hoch und heilig, dass mein Geld dann auf mich warten würde.
Am Montag war ich kurz vor 12 Uhr in Hoboken. Ich sah, dass sich der Geschäftsführer mit einem Mann unterhielt, den ich aus St. Louis kannte. Er war mit im Büro gewesen, als mich Teller zu Dolan zurückgeschickt hatte. Mir war sofort klar, dass der Geschäftsführer der Zentrale telegrafiert und diese einen Mann abgestellt hatte, der die Sache untersuchen sollte. Wer selbst ein Gauner ist, vertraut grundsätzlich niemandem.
»Ich möchte mein restliches Geld abholen«, sagte ich zu dem Geschäftsführer.
»Ist das der Mann?«, fragte der Kerl aus St. Louis.
»Ja«, erklärte der Manager und zog ein Bündel Scheine aus der Tasche.
»Moment mal.« Der Mann aus St. Louis ging dazwischen und sagte zu mir: »Livingston – wir haben Ihnen doch erklärt, dass wir mit Ihnen keine Geschäfte machen wollen.«
»Erst geben Sie mir mal mein Geld«, sagte ich zum Geschäftsführer, und er händigte mir zwei Tausender, vier Fünfhunderter und drei Hunderter aus.
»Was haben Sie gesagt?«, fragte ich den Mann aus St. Louis.
»Wir haben Ihnen gesagt, dass wir nicht wollen, dass Sie bei uns Geschäfte machen.«
»Das haben Sie. Und deshalb bin ich hier.«