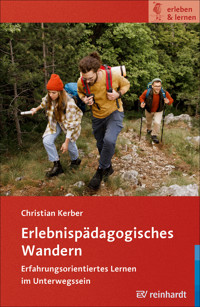
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: erleben & lernen
- Sprache: Deutsch
Wandern in der Natur und im Gebirge erfreut sich heute in der Freizeitgestaltung großer Beliebtheit. Betrachtet man die Potenziale des Unterwegsseins im Sinne von persönlicher Weiterentwicklung, entsteht ein wirkungsvolles erlebnispädagogisches Handlungsfeld, das gerade für heranwachsende junge Menschen ein wichtiger Impulsgeber für die Lebensgestaltung sein kann. Das Buch möchte anregen, für jede Zielgruppe ein individuelles Setting zu entwickeln. Es richtet sich an Erlebnispädagogen und -pädagoginnen sowie an alle pädagogischen Fachkräfte, die mit Gruppen von Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen wandern. Die Rolle der Gruppenleitung sowie die Bedeutung von Führungskompetenz in den Bereichen Moderation, Intervention und Reflexion wird ausführlich dargelegt und anhand von Praxisbeispielen erläutert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Band 24Herausgegeben vonProf.in Dr. Janne Fengler, Prof. i.R. Dr. Werner Michl,Holger Seidel
Christian Kerber
Erlebnispädagogisches Wandern
Erfahrungsorientiertes Lernen im Unterwegssein
Mit 20 Abbildungen und 4 Tabellen
Ernst Reinhardt Verlag München
Kerber, Christian, ist Diplom-Sozialpädagoge (FH) mit Zusatzausbildung personzentrierte Beratung, Gesprächspsychotherapie und systemisch-personzentriertes Coaching (GWG), sowie Erlebnispädagoge be® und staatlich geprüfter Berg- und Skiführer.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03322-5 (Print)ISBN 978-3-497-62000-5 (PDF-E-Book)ISBN 978-3-497-62001-2 (EPUB)
© 2025 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v. § 44b UrhG einschließlich Einspeisung/Nutzung in KI-Systemen ausdrücklich vor.
Dieses Werk kann Hinweise/Links zu externen Websites Dritter enthalten, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich entfernt.
Printed in EU
Cover unter Verwendung eines Fotos von © iStock/skynesher (Agenturfoto. Mit Models gestellt)
Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth
Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, Kemnatenstr. 46, D-80639 München Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
1 Ursprung und Anfänge des Wanderns
1.1 Vom Sinn des Unterwegsseins
1.2 Philosophische Betrachtungen mit Henry David Thoreau
1.3 Die skandinavischen Wurzeln des Unterwegsseins in der Natur
1.4 Die Wandervogelbewegung
1.5 Die Entstehung des Vereins- und Verbandswesens
1.6 Wandern – archaische Sehnsucht oder Volkssport?
2 Vorbereitung und Planung
2.1 Physische Voraussetzungen
2.2 Ausrüstung und Material
2.3 Tourenplanung
2.4 Abenteuerpotenziale und Risikoanalyse
2.5 Analyse des akzeptablen Restrisikos
2.6 Gesundheits- und resilienzfördernde Faktoren
3 Formen des Unterwegsseins
3.1 Meditatives Wandern
3.2 Unternehmungen ohne Übernachtung
3.3 Mehrtagestouren
3.4 Pilgern und Weitwandern
3.5 Überquerung der Alpen
3.6 Alleine oder in der Gruppe?
3.7 Wandern im Winter
4 Wandern als erlebnispädagogisches Medium
4.1 Potenziale und Lernchancen
4.2 Führung und Verantwortung
4.3 Vorbereitende Übungen
4.4 Während des Unterwegsseins
4.5 Reflexion und Transfer in den Alltag
5 Fallbeispiele und pädagogische Interventionen
5.1 Motivationsförderung
5.2 Das Feuer in einer Gruppe entfachen
5.3 Wie die Gruppe laufen lernt
5.4 Wenn es einfach anders kommt
6 Weitere Anwendungsformen
6.1 Orientierungstour
6.2 Abseits der gewohnten Wege
7 Hilfreiche Tipps für die Leitung
7.1 Erforderliche Qualifikationen
7.2 Haftung und Versicherung
7.3 Hinweise auf Ausbildungsinstitute
Anhang
Literatur
Weitere Informationsquellen
Bildnachweis
Sachregister
Vorwort
Ein Buch über das Wandern im erlebnispädagogischen Sinne zu schreiben führt mich an eine eindrückliche Erfahrung, die über 25 Jahre alt ist, zurück. Ich war mit einer Gruppe von Seeleuten auf einem Höhenweg in den Dolomiten unterwegs. Die zwölf mit allen Wassern gewaschenen und sehr verwegenen Männer wollten nach Jahrzehnten auf den Weltmeeren noch einmal in der Gruppe unterwegs sein und an die Abenteuerqualität ihres Berufslebens anknüpfen. Heute weiß ich, dass dies wohl einer meiner ersten erlebnispädagogischen Kurse im Kontext Wandern war, die ich als Leiter durchführen durfte. Schließlich waren alle wichtigen Faktoren vorhanden: Ein von Abenteuer geprägtes Umfeld, das dazugehörige auf Persönlichkeitsentwicklung ausgerichtete Ziel, ein Wechsel zwischen aktions- und reflexionsgeprägten Anteilen und schließlich eine von Wertschätzung und Empathie geprägte Beziehungsqualität in der Gruppe mit einem hohen Anteil an Selbstexploration und Authentizität. Dass vieles mehr oder weniger zufällig passierte, spielt in der Rückschau keine Rolle. Entscheidend war das, was im Moment passierte. Die Berge sprachen natürlich für sich selbst und trotzdem hätte es nicht ausgereicht, einfach unterwegs zu sein. Die herrschende Atmosphäre, ausgelöst durch die Menschen, die sich in diesem Rahmen bewegten, führte von der bloßen Wanderung in eine Kultur des gemeinsamen Unterwegsseins.
In diesem Buch soll diesem Übergang mehr Beachtung geschenkt werden. Unter verschiedenen Blickwinkeln werden nicht nur praktische, technische und sicherheitsrelevante Aspekte beleuchtet. Es geht vor allem um das Wandern als erlebnispädagogisches Medium, um das Unterwegssein im Sinne von persönlicher Weiterentwicklung. Die Erfahrungen, die diesem Buch zugrunde liegen, beruhen in den meisten Fällen auf dem Unterwegssein mit Gruppen. Viele Ansätze lassen sich jedoch auch auf die persönliche Ebene übertragen.
In einer der abendlichen Reflexionsrunden fiel der Satz: „Wandern ist die tiefste Verbundenheit mit der Erde“. Das ist umso eindrücklicher, weil er von den Seeleuten stammt, die zur damaligen Zeit viele Monate des Jahres auf dem Meer verbrachten. Vielleicht war es diesen Menschen im Spätherbst ihres Lebens noch einmal wichtig, mit der Erde in Verbindung zu sein. Vielleicht war es auch nur ein Zufall. Das kleine Teelicht in Gestalt eines Leuchtturms, das ich nach der Wanderung geschenkt bekommen habe, gibt mir, und dafür bin ich bis heute dankbar, Orientierung und einen weiten Blick auf die Bedeutung und die damit verbundenen Möglichkeiten und Potenziale des Unterwegsseins. Welchen Stellenwert dieses Erlebnis heute für die Seemänner hat und ob es mich eines Tages auf die Weltmeere zieht, bleibt jedoch unbeantwortet.
Christian KerberOberstaufen, im Februar 2025
Hinweis: In diesem Buch habe ich bewusst auf eine genderneutrale Schreibweise verzichtet, da das Ziel einer guten und flüssigen Lesbarkeit für mich an erster Stelle stand. Damit in Verbindung steht ein Menschenbild, das jedes Individuum, unabhängig von seinem Geschlecht, als bedingungslos gleichwertig anerkennt.
1 Ursprung und Anfänge des Wanderns
Natürlich ist die Betrachtung des Wortes Ursprung ein Unterfangen, das eine Abhandlung der Entstehungsgeschichte der Menschheit nach sich ziehen würde. Vielmehr geht es an dieser Stelle darum, an einem Moment zu beginnen, in dem das Unterwegssein über die Notwendigkeit der Fortbewegung hinausging und als wertvoll erkannt wurde. Sei es einem Teil der Wesensart des Menschen geschuldet, oder weil die modernen Bedingungen der Gesellschaft es als festen Teil der Lebensgestaltung nicht mehr erforderlich machten, regelmäßig zu Fuß unterwegs zu sein. Es gilt ferner zu betrachten, wie das Wandern eine touristische Bedeutung bekam und aus welchen politischen und gesellschaftlichen Bewegungen sich Vereine und Verbände gebildet haben. Vor allem in den Kunst- und Literaturepochen des 19. Jahrhunderts, die den Begriff Natur romantisierten, befinden sich wichtige Anfänge des heutigen Verständnisses von Erlebnispädagogik. Dieser Art der geschichtlichen Betrachtung sei zu Beginn ein kurzer Abriss gewidmet.
1.1 Vom Sinn desUnterwegsseins
„Wandern ist eine Tätigkeit der Beine und ein Zustand der Seele.“(Hofmiller 2011, 124)
Mit den Worten von Josef Hofmiller, einem Allgäuer Schriftsteller und Literaturkritiker, der sich seinerzeit in besonderer Weise dem Nachlass von Friedrich Nietzsche angenommen hat, wird die universale Lebensmetapher des Unterwegsseins bewusst: Das Leben, das mit der Geburt in unser rationales Verständnis übergeht und mit dem Tod wieder ins Unbewusste entschwindet. Über das Davor und Danach gibt es viele Theorien und Sichtweisen. Fest steht jedoch, dass es ein Dazwischen gibt und das bezeichnen wir im Allgemeinen als Leben. In diesem Leben sind wir durch die Anatomie unseres menschlichen Körpers zu Fuß unterwegs. Wir können uns gar nicht davor verwehren. In einigen afrikanischen Stämmen ist es traditionell üblich, die Kinder bis zum Alter von drei Jahren ausnahmslos auf dem Rücken zu tragen. Wenn sie dann in einer feierlichen Zeremonie von ihrer Mutter heruntergehoben werden, laufen sie ohne zu üben los, sicher und geradlinig (Dinslage 1986, 59). Das Gehen ist also, bezogen auf dieses Phänomen, ein im Menschen angelegtes Mittel der Fortbewegung.
Bis vor einigen Jahrzehnten war es im Lebensalltag unmöglich, darauf zu verzichten. In unserer heutigen technologisch orientierten Welt verliert der Mensch, bedingt durch den hohen Grad an Automatisierung unserer Lebensprozesse, den Zugang zu dieser einstigen Notwendigkeit. Die lebenswichtigen Grundbedürfnisse wie Nahrungsbeschaffung, Sozialkontakte oder physische Sicherheit lassen sich auch ohne Gehen abdecken. An diese Stelle rückt in existenzieller Hinsicht eine Art Unterwegssein ohne Erfordernis.
Eine Erscheinungsform, die meist ohne die genannte Notwendigkeit große Bedeutung im Tagesablauf vieler Menschen hat, ist der Spaziergang. Die Motivation dahinter liegt oft nicht darin, ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder zu einem anderen Ort zu gelangen. In vielen Fällen geht es um seelischen Ausgleich, um einen Kontakt mit der Natur oder darum, das Tempo des Berufslebens in ein entschleunigtes Schlendern zu bringen. Spaziergehen als möglicherweise einfachste Form des Unterwegsseins erfordert keine Vorbereitungen. Es braucht weder eine besondere Ausrüstung noch Ortskenntnisse. Im Grunde genommen kann man immer aus dem Moment heraus damit beginnen und jederzeit wieder damit aufhören. Vielleicht liegt auch in dieser Einfachheit für viele Menschen der Reiz und die Wichtigkeit des regelmäßigen Tuns.
Der deutsche Dichter Christian Morgenstern schrieb dazu, dass Gedanken oft wollen – wie Kinder und Hunde –, dass man mit ihnen im Freien spazieren geht (Morgenstern 1897). Darin wird wohl das größte Potenzial des Spaziergehens erkennbar – die positive Bedeutung für unseren Geist. Gedanken können sich ordnen und komplexe Zusammenhänge werden durch die oft reizarme und natürliche Umgebung gefiltert und gereinigt. Daraus entspringen neue Blickwinkel und Perspektiven auf den einen oder anderen Zusammenhang oder auch auf grundsätzliche Lebensfragen. In der Aussage Morgensterns, der unter anderem auch für seine komische Lyrik bekannt war, steckt noch ein weiterer Aspekt. Er unterstellt Kindern und Hunden das Bedürfnis, die Gedanken im Freien zu lüften. Das mag damit zusammenhängen, dass sich Kinder und Hunde weniger an gesellschaftlichen Konventionen messen, sondern in besonderem Maße aus sich heraus leben und Bedürfnisse daher direkter und authentischer zum Ausdruck bringen können, wie eine Art Spieltrieb, der neben sich noch das große Bedürfnis des Unterwegsseins in der Natur in sich trägt.
Doch sei der universellen Lebensmetapher des Unterwegsseins noch einmal ein Blick gewürdigt. Der Mensch geht, gleichgültig in welcher Erscheinungsform, durch das Leben, das mit den Maßstäben unseres Bewusstseins einen Anfang und ein Ende kennt. Bezogen auf einen Spaziergang oder eine Wanderung lassen sich die einzelnen Abschnitte oft übersetzen und verstärken den metaphorischen Status von Leben und Wandern (Tab. 1).
Tab. 1: Einfache Analogien vom Unterwegssein im Leben und in der Natur
Lebensthema
Bedeutung beim Wandern
Geburt
Mein Rucksack ist gepackt. Ich bin bereit, loszugehen.
Kind sein
Ich lasse mich treiben und schaue, wohin ich heute gehe.
Lebensentscheidungen
Der Weg gabelt sich, ich weiß nicht wohin es geht, aber mir ist bewusst, dass ich nur einen Weg gehen kann.
Lebenskrise
Ich kann nicht mehr weiter gehen. Aber hier sitzen bleiben bringt nichts – ich muss weiter oder wieder zurück.
Erfolge
Ich habe den Gipfel erreicht, der Lohn für alle Mühen. Wo ist mein nächstes Ziel?
Lebenstempo und Rhythmus
Wie schnell und gleichmäßig bin ich heute unterwegs?
Regeneration
Wie viel Kraft habe ich noch, wann muss ich Pause machen?
Gefahr und Risiko
Kann ich es bei diesen Verhältnissen riskieren, weiter zu gehen?
So wie es im Leben noch viele weitere Aspekte gibt, so kommen auch beim Unterwegssein eine Vielzahl von Situationen und Zuständen vor, die sich manchmal mehr, manchmal auch weniger auf das Konstrukt Leben übertragen lassen. Und es gibt noch eine eindrückliche Verbindung im Sinne einer Art Lebensgesetz, ein Zitat, das Franz Kafka zugeschrieben wird: „Wege entstehen, indem wir sie gehen.“ Das ist im Leben so wie auch im Unterwegssein.
1.2 Philosophische Betrachtungen mit Henry David Thoreau
„Geht einer zuversichtlich in der Richtung seiner Träume weiter und strebt danach, das Leben zu leben, das er sich ausmalte, dann wird er mehr Erfolg haben, als er sich träumen ließ.“ (Thoreau 2009, 262)
Dieses Zitat von Henry David Thoreau (1817–1862) erinnert etwas an die Worte Kurt Hahns, dem Vater der neueren Erlebnispädagogik, der einst sagte: „Wir vermögen mehr, als wir glauben. Wenn wir das erleben, werden wir uns nicht mehr mit weniger zufrieden geben.“ (Roscher 2005,8) Dieser Vergleich dient in erster Linie nicht dazu, die Wurzeln der Erlebnispädagogik zu ergründen. Und doch erklärt sich dadurch die Bedeutung Thoreaus für die gegenwärtige Einordnung von Vertrauen in Bezug auf Potenzialentfaltung und inneres Wachstum. Henry David Thoreau lebte von 1817–1862 in Concord/Massachusetts. Nach verschiedenen Versuchen, als Lehrer und Bleistiftfabrikant in die Anfänge des industriellen Zeitalter Amerikas einzutauchen, kehrte er dieser Welt mit 28 Jahren den Rücken und zog, ausgestattet mit etwas Werkzeug und ein paar Grundnahrungsmitteln, in eine kleine Blockhütte am Waldensee. Sein sogenanntes Walden-Experiment dauerte zwei Jahre und zwei Monate und war ursprünglich ein Zeichen des Protests gegen die Entwicklungen der amerikanischen Gesellschaft. Aus einer anfänglich kritischen Position der zur Politik erwuchs eine tiefe und sehr empfindsame Haltung in Bezug auf die Natur. Thoreau verbrachte den größten Teil seiner Zeit mit Spazierengehen.
„Ich denke, dass ich nicht meine Gesundheit und geistige Klarheit aufrechterhalten könnte, wenn ich nicht vier Stunden täglich – und meistens ist es sogar mehr – durch die Wälder und über die Hügel schlendern würde und dabei vollkommen frei von weltlichen Dingen bin.“ (Thoreau 2009, 12)
Aus dieser Haltung heraus entdeckte er Stück für Stück die Umgebung seiner Hütte. Er fertigte Geländezeichnungen an und vermaß sogar akribisch den nahegelegenen Waldensee. Aus der entstandenen Muße seiner Spaziergänge entsprang ein Perspektivenwechsel, der den Status des Menschen als Teil der Gesellschaft aufhob und ihn zu einem Bewohner und Teil der Natur machte. Thoreau dokumentierte seine Wanderungen und Spaziergänge genauestens. Er folgte seiner Intuition, wenn es um die Wahl der Himmelsrichtung ging, in die er lief und verband diese Wahl dann mit den jeweiligen Sonnenständen der Jahreszeit. Meist war er mit sich alleine unterwegs, da er, wie er sagte, in seinem ganzen Leben nur ein oder zwei Menschen begegnet sei, die die Kunst des Wanderns verstanden. Einer davon war Ralph Waldo Emerson (1803–1882), Begründer des amerikanischen Transzendentalismus, der als häufiger Weggefährte Thoreaus galt.
„Es war ein Vergnügen und ein Privileg, mit ihm zu spazieren. Er kannte das Land wie ein Fuchs oder ein Vogel. Man musste sich seiner Führung blind anvertrauen – und wurde dafür großartig belohnt.“ (Thoreau 1862, 91)
Emerson war von den Ansichten Thoreaus tief beeindruckt und huldigte ihm nach seinem Tod als den ersten „wahren“ Amerikaner. Er beschrieb ihn als einen Menschen, der alleine, ohne wesentlichen Besitz, aber auch ohne ein einziges Laster lebte. Dies machte ihn frei, glücklich und unabhängig. Er liebte die Natur so sehr, war so glücklich in ihrer Einsamkeit, dass er Städte mit Argwohn betrachtet und glaubte, dass deren Luxus und Verlockungen den Menschen und seine Umwelt zugrunde richteten. Aus dieser Energie heraus verlieh Thoreau dem Begriff Schlendern eine neue Bedeutung. Ursprünglich war das Wort von einem Müßiggänger abgeleitet, der unter einem Vorwand im Land umhergestrichen ist, um nach Almosen zu betteln. Thoreau prägte im Schlendern die Qualität des entschleunigten und zufälligen Unterwegsseins. Er erkannte darin einen Mehrwert und beschrieb seine Form des Gehens als „galant und heldenhaft zugunsten des eigenen Geistes“.
Sein bekanntestes Werk „Walden – ein Leben mit der Natur“ zeugt sehr eindrücklich von seinen Erfahrungen. „Vom Spazierengehen“, eines der letzten Werke Thoreaus, dessen Veröffentlichung er nicht mehr selbst erlebte, machte noch einmal deutlich, um was es ihm ging:
„Ich möchte zugunsten der Natur sprechen, zugunsten absoluter Freiheit und Wildheit – und ich möchte den Menschen als untrennbaren Teil der Natur und nicht als Mitglied der Gesellschaft betrachten.“ (Thoreau 1862, 5)
Thoreau starb 1862 im Alter von 44 Jahren an Tuberkulose. Seine Freunde am Totenbett staunten über das Lächeln in seinem Gesicht und die Gelassenheit, mit der er seinem Ende entgegensah.
1.3 Die skandinavischen Wurzeln des Unterwegsseins in der Natur
Friluftsliv ist eine Bezeichnung aus dem Norwegischen und kann nicht eindeutig übersetzt werden. Es bezeichnet eine Art „in der Natur aktiv sein“ und sich dabei selbst und in der Gruppe zu erleben. Dazu gehört eine Geisteshaltung, die auf einen naturbezogenen Lebensstil ausgerichtet ist (Liedtke/Lagerstrøm 2007, 13 f).
Die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts von Hendrik Ibsen erwähnte Bewegung stößt in Zeiten der wachsenden Umweltzerstörung auch in Mitteleuropa auf immer größer werdendes Interesse. In der Begrifflichkeit des Aktivseins in der Natur stecken sowohl die Aspekte des körperlichen Handelns und Arbeitens, des Unterwegsseins und auch Verweilens – gleichzeitig aktiv im Geiste. Friluftsliv ist daher ein weitgefasster Begriff, den viele Skandinavier für sich vereinnahmen. Im Jahr 1993, im von der Regierung ausgerufenen Jahr des Friluftsliv, bezeichneten die Menschen Norwegens die Stille und Mystik der Natur als die größte Ressource für Erholung, Selbstfindung, Gesundheit und Sinngebung.
Als der Begriff zunehmend politisch genutzt wurde und auch in die akademische Ausbildung einfloss, war es unabdingbar, den Begriff und die Ziele von Friluftsliv genauer zu beschreiben:
1. Den Aufenthalt in der Natur als eine höhere Lebensqualität verstehen, die sich aus Erlebnissen im Kindesalter speist und ihre Wirkung im Alter entfaltet.
2. Sich selbst als einen Teil der Natur zu sehen und aus diesem Zugehörigkeitsgefühl ein tieferes Verständnis für die Umweltzerstörung gewinnen.
3. Den wertschätzenden Umgang mit der Natur auf die Interaktion mit anderen Menschen übertragen und auf die Beziehungsgestaltung im Alltag transferieren.
4. Sich von dem einfachen Leben in der Natur inspirieren lassen und im Verzicht einen Mehrwert im Sinne von Klarheit entdecken.
5. Verantwortung für sich und andere übernehmen und dabei grundlegende Kompetenzen erwerben, die die beteiligten Individuen und das Umfeld gleichermaßen miteinbeziehen.
(Liedtke/Lagerstrøm 2007, 103f)
In dieser Zielbeschreibung wird erkennbar, auf welchen Ebenen Natur eine Wirkung zeigen kann. Miteinbezogen sind soziale Gesichtspunkte und Verhaltensempfehlungen für das Leben in der Gemeinschaft. Der Rolle der Gruppenleitung und die damit einhergehende Verantwortungsfrage sind übrigens in der Leitungsform Vegledning (Wegleitung) (Bittner 2009, 68f) beschrieben. Die Gruppenleitung ist sozusagen ein Teilnehmer im Gruppengeschehen. Sie nimmt sich zum einen selbst in der jeweiligen Aktion wahr, gibt aber auch Orientierung bei der Gestaltung des Gruppenprozesses und trägt die Verantwortung in sicherheitsrelevanten Situationen. In einem größeren Verständnis dieses Ansatzes wird deutlich, dass die Gedanken um den Begriff Frilufstliv die Herausforderungen unserer modernen Gesellschaft thematisieren. Es werden Wege aufzeigt, mit sich und der Natur in Balance zu sein. Dieser Verantwortung haben sich schon berühmte Vordenker von Frilufstsliv, darunter Fridtjof Nansen, Roald Amundsen und auch Henrik Ibsen, angenommen. Sie waren auch die Kinder der industriellen Revolution, die die bäuerliche Kultur zurückdrängte. Heute, in der zehnten Generation, in der Menschen nicht mehr überwiegend frei in der Natur leben, braucht es Orientierung, wie die damit einhergehende Entfremdung zur Natur verhindert werden kann. Das norwegische Friluftsliv kann dabei ein wichtiger Impulsgeber sein.
Nils Faarlund, einer der gegenwärtigen Wegbereiter der Bewegung, fasst dies mit den Worten zusammen: „In der Modernität sollte Friluftsliv der Tradition nach für jeden Menschen ermöglicht werden. Voraussetzung dafür ist ein möglichst naturfreundlicher und nicht zu langwieriger Zugang zur freien Natur.“ (Faarlund 2009, 26)
1.4 Die Wandervogelbewegung
Die Namensfindung der Bezeichnung Wandervogel beruht auf einer kuriosen Geschichte. Eine junge Wandergruppen fand auf einem Grabstein die Inschrift: „Wer hat euch Wandervögeln die Wissenschaft geschenkt, dass ihr auf Land und Meeren nie falsch die Flügel lenkt …“. Die anwesenden Gruppenmitglieder beschlossen kurzerhand, den Namen zu übernehmen. Als offizielles Geburtsdatum wird der 04. November 1901 angegeben, obwohl das Wort Wandervogel erstmals in einem 1837 erschienenen Gedicht von Joseph Eichendorff „aufzutreten scheint“ (Laqueur 1978, 29). Aus rechtlichen Gründen wurde der Verein „Wandervogel – Ausschuss für Schülerfahrten“ von Erwachsenen, darunter vier Schriftsteller und ein Arzt, ins Leben gerufen. Es ging in der Zeit der fortschreitenden Industrialisierung der Städte darum, sich von den engen Normen von Schule und Gesellschaft zu trennen, um in der Natur eine eigene Lebensart zu etablieren. Der Wandervogel, der Wandern als eine Art kulturelle Alternative bezeichnete, war somit auch Impulsgeber für zahlreiche andere Jugendbewegungen.
In der Jugend die Wanderlust zu pflegen, die Mußestunden durch gemeinsame Ausflüge nutzbringend und erfreulich auszufüllen, den Sinn der Natur zu wecken und zur Kenntnis unserer deutschen Heimat anzuleiten – so stand es in den anfänglichen Statuten der Gründungsväter. Gleichzeitig wurde auch ein Gegenimpuls zur sogenannten Stubenhockerei und den Gefahren von Alkohol und Nikotin angestrebt.
Die Art des Unterwegsseins hat zweifellos einen tiefen Eindruck hinterlassen. Die jungen Männer, Mädchen waren zunächst noch von der Bewegung ausgeschlossen, zogen mit Gitarre, Liederbuch – das Liederbuch „Der Zupfgeigenhansl“ wurde von dem Wandervogelführer Hans Breuer 1909 veröffentlicht – und dem nötigsten Gepäck los, um den engen sozialen Zwängen des Alltags mit absoluter Freiheit zu begegnen. Es entwickelte sich ein Lebensstil, der von Askese, Einfachheit und Freiheit geprägt war.
Der deutsche Schriftsteller Otto Roquette brachte dieses Gefühl in einem Gedicht zum Ausdruck (Laqueur 1978, 29):
„Ihr Wandervögel in der Luft, im Ätherglanz, im Sonnenduft,in blauen Himmelswellen, euch grüß’ ich als Gesellen!Ein Wandervogel bin ich auch, mich trägt ein frischer Lebenshauch,und meines Sanges Gabe, ist meine liebste Habe.“ (Roquette 1896, 7)
Die Mitgliedschaft im Wandervogel duldete keine Mitläufer und aufgenommen wurde nur, wer zur Gruppe zu passen schien. Die Mitglieder mussten einen hohen Anteil ihrer Freizeit einbringen – es herrschte eine Kultur von „ganz oder gar nicht“. Wie schon erwähnt, waren Mädchen und Frauen zunächst unerwünscht. Gegen große Widerstände gründete sich erst 1905 der sogenannte Bund der Wanderschwestern. Sie legten großen Wert darauf, ein reiner Mädchenbund zu sein und wollten einen Raum schaffen, der jungen Frauen und Mädchen ein Raum für geschlechtsspezifische Entwicklung bietet.
Die jeweiligen Gruppenleiter wurden sowohl als Kameraden, Häuptlinge oder auch als Führer bezeichnet. Darin wird erkennbar, wie sich hierarchischen Strukturen im Spannungsfeld von Führungsverantwortung und absoluter Freiheit finden mussten.
In den ersten zehn Jahren wuchs die Bewegung langsam und stetig an. Es entstanden in ganz Deutschland eine Vielzahl von Gruppen, die sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausrichtung in Folgeverbände aufspalteten. Aus der ursprünglich naiven Freude am Wandern wurde bald eine von Jugendlichen und Studenten geprägte Subkultur. Die Nationalsozialisten wussten dies für sich zu nutzen. Sie verbaten 1935 den Begriff Wandervogel und überführten sämtliche noch existierende Gruppen in die Hitlerjugend. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden einige Gruppe wieder ins Leben gerufen. Die Bewegung konnte jedoch nie an die Blütezeit vor dem Ersten Weltkrieg anknüpfen.
1.5 Die Entstehung des Vereins- und Verbandswesens
Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine e.V.
Das Bestreben in der Gesellschaft, Wanderern und Bergsteigern eine Organisationsform und Zugehörigkeit zu geben, geht ebenfalls ins vorletzte Jahrhundert zurück. Im Jahr 1883 schlossen sich verschiedene bereits aktive Wandervereine zum Verband Deutscher Touristenvereine zusammen. Ziel war es, ein zusammenhängendes Unterkunftsnetz für Wander- und Jugendgruppen zu schaffen. Bereits 1912 zählten sich über 700 Häuser, 60 Wandervereine und über 180.000 Mitglieder zum Verband. Ein weiteres Anliegen des Verbandes war es, den Mitgliedern „Verkehrserleichterungen“ in Bezug auf Beförderungspreise des öffentlichen Verkehrs zu verschaffen. Außerdem wurde schon damals versucht, strukturarme Regionen zu stärken, indem sie durch die gezielte Herausgabe von Wanderempfehlungen touristisch beworben wurden.
Im Jahr 2024 zählte der Verband 600.000 Mitglieder, die in 58 regionalen Wandervereinen organisiert waren. Für Kinder und Jugendliche wurde unter dem Dach des DWV die Deutsche Wanderjugend ins Leben gerufen. Zu den Hauptaufgaben der Verbandsarbeit zählen die Schaffung und Pflege von landschaftlich und kulturell attraktiven Wanderwegen unter umweltverträglichen Gesichtspunkten.
Mehr Informationen auf www.wanderverband.de.
Deutscher Alpenverein
Der Deutsche Alpenverein (DAV) wurde 1869 in München gegründet. Er hatte das Ziel, die touristische Erschließung der Ostalpen zu fördern und war daher in den Anfängen eher im Alpenraum aktiv. Erst später breiteten sich die Vereinsaktivitäten auch auf die Mittelgebirge in Deutschland aus. Durch die Attraktivität der alpinen Stützpunkte wuchs der Verein noch vor dem Ersten Weltkrieg auf über 100.000 Mitglieder an. Mit der Etablierung eines Ausbildungssystems und der Kartografierung der erschlossenen Bergregionen kamen weitere Aufgaben in den Verantwortungsbereich des Vereins. Schon früh prägten Diskussionen um die Ethik von Neuerschließungen und die damit verbundene Beeinflussung von Naturräumen die Grundausrichtung des Leitbilds. Bereits 1923 wurde in den sogenannten Tölzer Richtlinien der Neubau von Hütten und Wegen offiziell verboten. Die Vereinsmitglieder wollten die Berge und die Natur in ihrer Ursprünglichkeit bewahren und sehnten sich schon damals nach Ruhe und Abgeschiedenheit.
Die Bewältigung des Ansturms auf die Alpen, der Anfang 1920 eine neue Größenordnung erfuhr und bis heute angehalten hat, zählt wohl zu den größten Herausforderungen des Deutschen Alpenvereins. Unter diesem Gesichtspunkt ist es erforderlich, den Schutzauftrag für die Alpen mit den Interessen der Wanderer und Bergsteiger in Einklang zu bringen. Als größte nationale Bergsteigervereinigung zählt der DAV heute mehr als 1,5 Mio. Mitglieder (Stand 31.12.2023). Er gilt als bedeutender Wegbereiter für Ausbildung, Jugendarbeit und Leistungssportförderung in den verschiedenen Disziplinen des Bergsteigens.
Mehr Informationen auf www.alpenverein.de.
Naturfreunde e.V.
„Immer mehr lebt in unserem deutschen Volke das Streben auf, dem Staub und der Enge der Großstadt und der freudlosen Arbeit zu entfliehen. Diesem Streben Rechnung zu tragen, hat sich vor einiger Zeit der Arbeiterwanderbund ‚Die Naturfreunde‘ konstituiert.“ (Aufruf des Vereins in einem internen Schreiben: An die Genossen, Naturfreunde, Arbeiterwanderer, 1895)





























