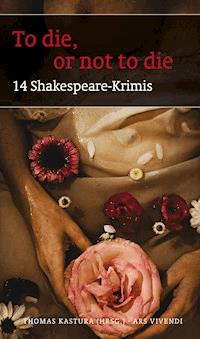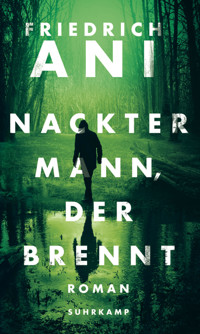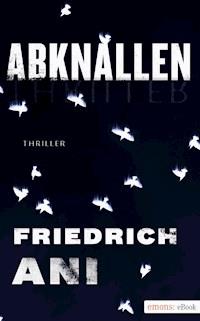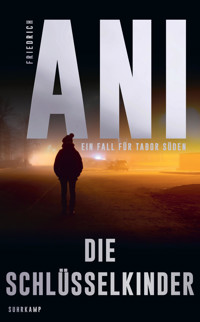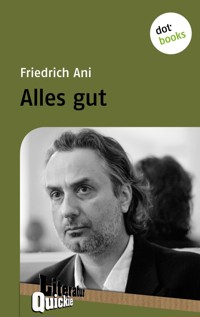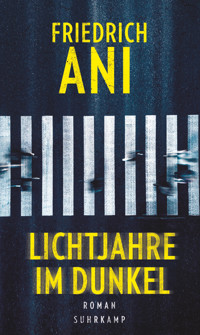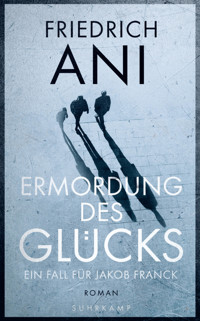
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jakob-Franck-Serie
- Sprache: Deutsch
Das Glück wird ermordet, als der 11-jährige Lennard Grabbe nicht nach Hause kommt und später als Mordopfer aufgefunden wird. Exkommissar Jakob Franck überbringt den Eltern die schrecklichste aller Nachrichten. Während die Sonderkommission auf der Stelle tritt und die Familie keinen Weg findet, mit dem Verlust umzugehen, vergräbt Franck sich in Zeugenaussagen und Protokollen, verbringt Stunden am Tatort. Angetrieben wird er dabei nicht nur von dem Bedürfnis, der Familie zu Klarheit zu verhelfen, sondern auch von den schmerzhaften Erinnerungen an die ungelösten Mordfälle seiner Karriere.
Nach dem mit dem Deutschen Krimi Preis ausgezeichneten Auftakt der Reihe um Jakob Franck, Der namenlose Tag, folgt nun der langerwartete zweite Teil. Friedrich Ani vereint erneut grenzenlose Traurigkeit, menschliche Abgründe und atemlose Spannung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
FRIEDRICH ANI
ERMORDUNG DES GLÜCKS
Roman
Suhrkamp
When there is no more
You cut to the core
Quicker than anyone I knew
When I’m all alone
In the great unknown
I’ll remember you
Bob Dylan,
»I’ll remember you«
I
In Reichweite das Meer1
Aus der Spiegelung der Eingangstür schaute ihr eine abblätternde Frau entgegen.
Je länger sie hinsah, desto stärker wurde ihre Verwunderung darüber, dass sie noch da war, nach so vielen Tagen absoluter Abwesenheit in ihrer Welt; genau vierunddreißig Tage waren es heute.
Hier stand sie, nah an der Scheibe, als wäre es das Allereinfachste, nach der Klinke zu greifen und die Tür zu öffnen. Leute gafften sie an; Feiglinge, die keinen Finger rührten, die stehen blieben und den Schnee störten, der ihr allein gehörte.
Das war schon so gewesen, als sie noch ein kleines Mädchen war: Wenn der erste Schnee fiel, dann nur für sie; sie sammelte die Flocken in ihrer Schürze und brachte sie nach Hause und sagte, schau, Mama, ich hab dir Sterntaler mitgebracht, die sind noch ganz frisch.
Daran dachte sie fast jedes Jahr. Sie erzählte niemandem davon, nicht einmal Lennard.
Der Gedanke an ihn entfachte einen Brand in ihr. Sie sog die kalte Luft ein und vermisste den Geschmack nach Schnee. Da stimmt doch was nicht, rief sie, aber ihre Stimme erhörte sie nicht.
Sie legte den Kopf schief und lauschte; lautlos klopften die Flocken an die Tür. Die Gesichter verschwanden, eins ums andere. Schließlich kam niemand mehr die Straße entlang, kein Auto fuhr; in wabernder Dunkelheit wirbelte Schnee an den Häuserwänden empor. Wie ein unverdienter Segen erschien ihr die Stille.
Für ein paar Sekunden vergaß sie den Schmerz und kehrte noch einmal zu dem Mädchen mit der Schürze voller geschmolzener Sterntaler zurück.
Da tauchte der Mann vor ihr auf und verscheuchte ihr Spiegelbild und jede flüchtige Geborgenheit.
Unwillkürlich machte sie einen Schritt nach hinten in Richtung Kuchentheke. Das Gesicht des Mannes auf der Straße wirkte alt und grau und bedrohlich. Der schwarze Schal quoll aus dem Kragen der braunen Lederjacke, der Riemen seiner Umhängetasche verlief quer über die Jacke, wie eine schwarze Narbe.
Nachdem sie das alles registriert hatte, drückte sie die Augen zu und ballte die Fäuste. Als ihr bewusst wurde, was sie tat, riss sie die Augen wieder auf. In einem Anfall von Panik glaubte sie, der Fremde hätte in der Zwischenzeit das Café betreten. Dann fiel ihr ein, dass die Tür verriegelt war, der Schlüssel steckte. Sie sah hin. Im selben Moment klopfte der Mann an die Tür.
Wieder zuckte sie zusammen; diesmal aber bewegte sie sich nicht von der Stelle. Im Nebenraum mit den Tischen, dem Zeitungsständer und dem Strandkorb brannte Licht, ein milchiger Schein fiel bis zur Kuchentheke. Die zitternde Frau kam sich vor wie auf einem Präsentierteller.
Der Mann klopfte erneut an die Tür, nicht laut, beinah behutsam und ohne seine ausdruckslose Miene zu verändern oder ein Zeichen von Ungeduld erkennen zu lassen. Gleichzeitig vermittelte er den Eindruck unbedingter Entschlossenheit, dachte die Frau und wagte einen Schritt nach vorn.
Sofort streckte der Mann, auf dessen Haaren und Wangen sich Schneeflocken sammelten, den Rücken und faltete die Hände vor dem Bauch. Diese Geste irritierte die Frau.
Sie zögerte. Aus einem geschäftsmäßigen Impuls heraus überlegte sie, wie spät es sein mochte und ob sie um die Zeit gewöhnlich noch geöffnet hatten; lächerlich; das Café hatte seit einer Woche geschlossen.
Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten sie an jenem Freitag vor mehr als einem Monat schon zugesperrt; Stephan war dagegen gewesen, und Claire, ihre Angestellte, hatte versprochen, jeden Tag von morgens bis abends durchzuarbeiten.
Fast hatte sie die Tür erreicht, da erschrak sie ein drittes Mal. Ihr Blick krallte sich in das Gesicht hinter der Glasscheibe. Sie kannte die Sorte von Mann, die Art, wie er sie ansah, wie er dastand, aufrecht, selbstbewusst, zielstrebig; sein gepflegtes Äußeres, das perfekt rasierte Gesicht, die kurz geschnittenen Haare; die Lederjacke.
Männern in solchen Lederjacken, mit dieser Körperhaltung, diesen ebenso ruhigen wie lauernden Augen war sie in den zurückliegenden Wochen häufig begegnet, anfangs täglich. Meist traten sie zu zweit auf, und jedes Mal fühlte sie sich von ihnen eingekreist und eingeengt. Obwohl sie sich Mühe gaben, freundlichen Frieden zu verbreiten, feuerten sie damit das Toben ihrer Angst erst an.
Der Mann da draußen war ein Kripomann.
Sie hatte ihn nie zuvor gesehen. Vermutlich gehörte er nicht zu der Abteilung, die nach ihrem verschwundenen Sohn suchte; andernfalls hätte der Chefermittler, dessen Name ihr gerade nicht einfiel, seinen Kollegen telefonisch angekündigt.
Das bedeutete, dachte sie und streckte die Hand nach dem Schlüssel aus, der Mann war für die Suche nach Lennard nicht direkt zuständig, sondern hatte andere Fragen auf Lager – wie schon einmal ein Kommissar, der sich für Belange aus Lennards Schule interessiert hatte.
Mit einem Seufzer fast vergessener Erleichterung öffnete sie die Tür.
Schneeflocken wehten ihr in die Augen; sie blinzelte und lächelte und rieb hastig über ihr Gesicht, wie die neugierigen Leute, die sie von drinnen beobachtet hatte. Mit unerwarteter Munterkeit wollte sie den Polizisten begrüßen und hereinbitten. Doch er kam ihr zuvor.
»Sie sind Tanja Grabbe?«
Seine Stimme hatte nichts vom Übermut des Schnees.
»Ja, natürlich, ich bin Frau Grabbe, und Sie sind von der Polizei?«
»Mein Name ist Jakob Franck. Ich bin ein ehemaliger Kripobeamter. Können wir reingehen und uns an einen Tisch setzen? Ich habe Ihnen und Ihrem Mann eine schlimme Nachricht zu überbringen.«
Dann verschwand die Welt um sie herum.
Als die Welt wieder da war, gehörte Tanja Grabbe nicht mehr dazu. Neben ihr saß Stephan und hielt ihre Hand. Warum er das tat, begriff sie nicht. Er hatte den Arm auf den Tisch gelegt und schaute sie an, als würde er sie nicht erkennen; fast hätte sie ihm ihren Namen gesagt.
Wahrscheinlich, dachte sie vage, war der Mann gar nicht Stephan, sondern einer, der ihm ähnlich sah, mit den lockigen, silbrig schimmernden schwarzen Haaren, die schon wieder zu lang waren und bis auf den Kragen seines weißen Hemdes fielen. (Seit Jahr und Tag musste sie ihn ermahnen, regelmäßig zum Friseur zu gehen und darauf zu achten, dass dieser nicht nur wieder eine seiner Geschichten erzählte, vielmehr einen ordentlichen Schnitt zustande brachte; ein Konditor hatte gepflegt auszusehen; wehe, ein Haar landete in der Glasur oder im Teig oder sonst wo in der Auslage). Rasiert war er auch nicht.
Wer war dieser Mann neben ihr, der unaufhörlich ihre Hand hielt?
Erschrocken wandte sie den Blick von seinem Gesicht ab zum Tisch; aus dem Ärmel ihres blauen Kleides ragte eine farblose Hand, umklammert von Fingern mit sehr kurz geschnittenen Fingernägeln; ihre Hand; Stephans Hand. Sie glaubte nicht, was sie sah. Sie hob den Kopf und geriet in das Blickfeld eines Mannes, den sie schon einmal gesehen hatte. Sie überlegte, wann das gewesen sein mochte. Sie kam nicht drauf.
Dann fiel ihr auf, dass sie die einzigen Gäste waren. Sie saßen am ersten Tisch beim Durchgang zum Verkaufsraum, der halb im Dunkeln lag, und niemand kam herein. Etwas stimmte mit der Stille nicht, die gehörte nicht hierher, genauso wenig wie sie, dachte Tanja Grabbe und sah wieder auf ihre Hand, die in den Fingern mit den dunklen Härchen eingeschlossen war, als hätte der Mann ein Recht dazu.
Allmählich kehrte die Zeit in sie zurück.
Sie erinnerte sich, wie sie dagestanden hatte, ungefähr in der Mitte des Raumes, zwischen Kuchentheke und Tür, und die Leute auf der Straße im wirbelnden Schnee innegehalten hatten, um sie anzustarren wie ein Tier im Zoo. Sie hatte keine Reaktion gezeigt, das wusste sie noch, und der Gedanke daran löste sekundenlang Genugtuung in ihr aus; die Gaffer verschwanden, und die Schneeflocken tanzten für sie allein, wie sie es gernhatte.
Der Mann mit der ledernen Umhängetasche hatte das zaubrische Spiel vor ihren Augen zerstört, und alles war tot.
»Sie sind schuld.«
»Sollen wir nicht doch einen Arzt verständigen?«, sagte der Mann ihr gegenüber. Ihn anzusehen, schaffte sie nicht. Die Umklammerung durch die fremde Hand löste eine Starre in ihr aus, die ihr bis in den Nacken reichte.
Ihr wurde schwindlig; seltsamerweise befürchtete sie nicht, ohnmächtig zu werden, so, wie es ihr früher in verwirrenden Situationen passiert war, wofür sie sich hinterher maßlos geschämt hatte.
Stattdessen breitete sich eine ungeahnte Ruhe in ihr aus, als habe sie ein Medikament von Doktor Horn eingenommen oder zwei Gläser des schweren Rotweins getrunken, mit dem sie ihre Hochzeitstage feierte.
Auch wenn sie fürchtete, einen peinlichen Eindruck zu machen, so schief, wie sie dasaß, in ihrem abgetragenen Kleid und mit den splissigen Haaren – die plötzliche Tonlosigkeit ihrer Gedanken versöhnte sie fast mit der Anwesenheit der beiden ungebetenen Gäste.
Nur die Stille, drinnen wie draußen, störte sie immer noch, sie traute ihr nicht, sie kam ihr verlogen vor.
»Frau Grabbe«, sagte der Mann in der Lederjacke. Er sprach in ihr linkes Ohr; sie sah ihn aus den Augenwinkeln. »Haben Sie verstanden, was ich Ihnen und Ihrem Mann mitgeteilt habe?«
»Mein Sohn ist tot.«
Tanja Grabbe hörte ihre Stimme und war gleichzeitig überzeugt, nicht gemeint zu sein. Unvermittelt sah sie den Mann neben sich an und hätte ihn am liebsten umarmt, weil er wie erfroren dasaß, die Hände in den Hosentaschen, mit lichtlosem Blick. Im gelben Schein der Deckenbeleuchtung wirkte sein Gesicht, als sei es mit Wachs überzogen, sie hätte es abgeschabt, wenn sie gewusst hätte, wie.
»Sag doch was.« Behutsam strich sie ihm durch die Haare; sie beugte sich vor und gab ihm mit der Wimper ihres rechten Auges einen Schmetterlingskuss auf die Wange. Sie sog den vertrauten Geruch seines Rasierwassers ein, schnupperte ihm nach und lehnte sich zurück.
Einen Moment später holten die Erinnerungen sie ein.
Sie rang nach Luft, warf dem Mann auf der anderen Seite des Tisches einen ungläubigen Blick zu; sogar sein Name fiel ihr wieder ein und das, was er zu ihr gesagt hatte, nachdem sie ihn mit einem unschuldigen Kommissar verwechselt hatte.
Als hätte ein Dämon ihren Schlaf vernichtet, von dem sie endlich einen Wimpernschlag lang hatte kosten dürfen, schreckte sie auf.
Sie blickte um sich, erkannte die Welt wieder und begann, mit aufgerissenem Mund Laute auszustoßen, die in Francks Ohren wie das Keuchen eines Tieres klangen. Das waren, wusste er, die Echos seiner Worte, die erst jetzt, eine Stunde nach seinem Erscheinen, in ihr widerhallten, mit kaum zu bändigender Wucht.
Da sie ihren Mann im Augenblick des jähen Begreifens losgelassen hatte, griff Franck nach ihren Händen; sie zuckte, wie schon mehrmals, zusammen und versteckte die Hände im Schoß.
»Wollen wir wieder miteinander sprechen?« Franck spürte den Blick von Stephan Grabbe, aber er konzentrierte sich auf die Frau.
»Tun wir das nicht die ganze Zeit?«, fragte sie abwesend, weiter keuchend.
»Nein, Sie wollten lieber still sein.«
Ihr Versuch, den Mund zu schließen, gelang ihr erst beim vierten oder fünften Mal. Als sie das Geräusch bemerkte – mit aufeinandergepressten Lippen schnaubte sie durch die Nase –, senkte sie verschämt den Kopf.
Bisher hatte Franck dem Ehepaar nur mitgeteilt, dass der Leichnam ihres vermissten elfjährigen Sohnes aufgefunden worden war, nichts weiter, keine Details der Umstände und des Ortes. Ein Freund aus der Mordkommission hatte ihn darum gebeten.
Schon während seiner Dienstzeit hatte Franck es sich zur Aufgabe gemacht, Hinterbliebenen die Nachricht vom Tod eines Angehörigen zu überbringen, unabhängig davon, ob er als Ermittler direkt an dem Fall beteiligt war. Eines Tages hatte er – ausgelöst durch ein Verbrechen, das so war wie alle anderen – die Entscheidung getroffen; wann immer er seither gefragt wurde, nahm er das Überbringen auf sich. Seine Pensionierung hatte nichts daran geändert.
Sein Beileid und das seiner ehemaligen Kollegen hatte er bereits ausgesprochen und die Worte beim Eintreffen des Ehemanns wiederholt. Grabbe hatte erklärt, er habe die Enge nicht mehr ertragen und sei zwei Stunden ziellos an der Isar entlanggelaufen, »abseits des schrecklichen Weihnachtsgedöns«, hatte er hinzugefügt.
Mit einer entschlossenen Bewegung nahm Grabbe die Hände aus den Hosentaschen und legte sie auf den Tisch. »Danke, dass Sie sich so viel Zeit nehmen, Herr …«, sagte er.
»Franck.«
»Unser Lennard ist also nicht einfach gestorben, sondern er ist …«
»Hast du nicht zugehört? Lennard ist tot.« Ohne das geringste Aufhebens von ihrer Stimme gemacht zu haben, verstummte Tanja Grabbe wieder. Sowohl Franck als auch ihr Mann sahen sie an; sie hatte den Kopf gesenkt und kaute auf den Lippen.
»Ihr Sohn«, sagte Franck, »wird im Gerichtsmedizinischen Institut untersucht, erst danach wissen wir, was mit ihm passiert ist.«
»Er wurde ermordet«, sagte Grabbe.
»Das steht noch nicht fest.«
Das war keine Lüge, dachte Franck. Eine Lüge wäre gewesen, wenn er nein gesagt hätte.
Andererseits ging sein Kollege, der die Ermittlungen leitete, mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Junge nicht Opfer eines Unfalls, sondern eines Gewaltverbrechens geworden war. Dem ersten Augenschein nach hatte der Täter mit brachialer Wucht zugeschlagen, dem Schüler direkt ins Gesicht, woraufhin dessen Hinterkopf gegen einen Widerstand geprallt war. Die genaue Todesursache würde in mehreren Stunden oder erst im Lauf des morgigen Tages feststehen. Auf seine Frage, ob der Fundort der Leiche zugleich der Tatort war, hatte Franck keine klare Antwort erhalten, die Ermittler zweifelten eher daran.
»Und der Wald«, sagte Stephan Grabbe, »wo er gefunden wurde, wo ist der?«
Er hatte es schon einmal gesagt. »Im Süden, an der Stadtgrenze.«
»Wo, Herr Kommissar?«
»Einfach Franck, bitte. Sie erfahren alles, was wichtig ist, wenn die ersten Untersuchungen abgeschlossen sind. Haben Sie Vertrauen. Möchten Sie mir etwas von Ihrem Sohn erzählen? Möchten Sie, dass wir gemeinsam beten?«
Tanja Grabbe hob den Kopf.
In ihren Augen sah Franck etwas, das er das Ewige Licht nannte – ein Flackern, das sich vielleicht von der unverbrüchlichen Liebe zwischen dem Toten und seinem Nächsten nährte; ein Sichaufbäumen gegen die allumfassende Finsternis.
»Ich möchte ihn sehen«, sagte sie. »Und Sie bringen mich zu ihm, jetzt gleich.«
Wie schon oft in ähnlichen Situationen nahm Franck den Blick seines Gegenübers wie seinen eigenen an; er zelebrierte ein kurzes Schweigen und achtete auf seinen Tonfall. »Ich werde Sie begleiten, wenn Sie das wünschen, aber wir müssen noch warten; wenn Sie wollen, warte ich mit Ihnen.«
»Wie lang?« Ihre Stimme huschte aus dem Mund, der sich sofort wieder verschloss.
Franck sagte: »Das weiß ich nicht.«
Eine Minute verging, vielleicht zwei. Auf einmal streckte Tanja Grabbe die Hand aus, wartete, dass Franck sie ergriff, und stand auf. »Dann kommen Sie mit, Sie haben’s versprochen.«
Franck ging um den Tisch herum, Hand in Hand mit der Frau. Sie gingen hinter Stephan Grabbe vorbei, der eine Weile brauchte, bis er die Situation erfasste und sich umdrehte. Da hatte seine Frau schon den blauweiß gestreiften Strandkorb an der hinteren Wand erreicht. Sie ließ Francks Hand los und sank auf die Knie; sie legte die Hände wie zum Gebet aneinander und blickte in das verschattete Möbelstück, dessen Bambusgeflecht und Schaumstoffpolster neu und unbenutzt aussahen.
Nach einer Weile, während niemand ein Wort sprach, streifte Tanja Grabbe ihre weißen, plüschigen Hausschuhe ab – sie bildeten einen kuriosen Kontrast zu dem zerknitterten, aber aus feinem Stoff gewebten, ultramarinblauen Kleid.
Franck bemerkte, dass Grabbe auf seinem Stuhl hin und her rutschte; er trat einen Schritt zur Seite, um nicht weiter in Grabbes Blickfeld zu stehen.
Eine Aura von Andacht umhüllte die stumme, kniende Frau mit den blonden Haaren. Ihr Mund berührte die Fingerspitzen, ihr Blick galt der leeren, überdachten Sitzecke.
Franck dachte an den Namen des Cafés, in dem sie sich befanden – Café Strandhaus –, und sein Blick fiel auf die gerahmte Fotografie an der Wand gegenüber dem Strandkorb; die Vergrößerung einer Aufnahme, die einen weißen Strand und Dünen im Wind zeigte, ein wenig unscharf und verwackelt. Franck versetzte sich in die Position des Fotografen und bildete sich ein, in seinem Rücken das Rauschen des Meeres zu hören.
Und als existierte ein Zusammenhang mit der Menschenlosigkeit des Bildes, kehrte Franck zu der einen Frage zurück, die Tanja und Stephan Grabbe noch nicht gestellt hatten und deren Beantwortung nicht in seiner Macht lag, sosehr er es sich für seinen Besuch bei den Eltern gewünscht hätte.
Wann, an welchem Tag, zu welcher Stunde nach seinem Verschwinden am Abend des achtzehnten November hatte der elfjährige Lennard Grabbe sterben müssen?
An nichts anderes dachte auch Tanja Grabbe, vor dem Strandkorb kniend, scheinbar betend. Sie sah ihn da sitzen, ihren Jungen, in kurzen Hosen und mit bloßem Oberkörper; seine Beine reichten über das Polster nicht hinaus, er freute sich so, weil seine Eltern ihm einen echten Strandkorb ins Café gestellt hatten. Er wollte, dass sie sich neben ihn fläzten, doch dafür reichte der Platz nicht; also nahm seine Mutter ihn auf den Schoß, sein Vater setzte sich zu ihnen, und Lennard streckte den Arm aus und zeigte aufs Meer, das die Wand war; und von draußen schien die Sonne herein.
Wie Sommer an der Nordsee waren diese Momente; wie eine Zeit, die nie verging.
Daran dachte Tanja Grabbe und gleichzeitig an die Frage, die sie sich nicht zu stellen getraute. Insgeheim hatte sie erwartet, Stephan würde ihr die Frage abnehmen. Wo war er überhaupt?
Sie wandte sich vom Strandkorb ab und erschrak schon wieder. Sie hatte den Mann vergessen, der nah bei ihr stand; der an allem schuld war; der ihr die Antwort auf eine Frage verweigerte, von der er doch wissen musste, wie sehr diese in ihr wütete.
Stephan saß immer noch am Tisch, weit weg von ihr.
Die Knie taten ihr weh vom Steinboden.
Vor dem Fenster fiel Schnee.
Vor vierunddreißig Tagen war Lennard verschwunden, und heute war er wieder aufgetaucht.
Wo war er denn?
»Ich will ihn sehen«, sagte sie zum zweiten Mal.
»Woran denkst du? Und sag nicht, an nichts.«
»Ich denke an dich.«
»Hier bin ich.«
»Ich denke an dich, wie du früher gewesen sein mochtest, als kleines Mädchen.«
»Fang nicht wieder mit deinem Alter an. Und mit meinem schon gar nicht, verstanden?« Marion Siedler schob das Bierglas näher zu ihm. »Trink endlich aus, dann hol ich dir ein frisches. Was ist denn mit dir? Ich dachte, wir schauen den Film an.« Sie war schon dabei, aufzustehen. »Du denkst an den Jungen. An seine Mutter, die die ganze Nacht im Strandkorb verbracht hat, nachdem du bei ihr warst. Hast du in den vergangenen Tagen noch mal Kontakt mit ihr gehabt?«
Franck trank einen Schluck, stellte das leere Glas auf den Tisch, ohne es loszulassen.
Seit seinem Besuch im Café Strandhaus waren acht Tage vergangen. Ohne seinen Beistand einzufordern, hatten die Eltern einen Tag nach seinem Besuch den Leichnam ihres Sohnes identifiziert. Die Ursache von Lennards Tod war weitgehend geklärt.
Aufgrund eines massiven Schlages hatte er einen Schädelbruch erlitten und war innerlich verblutet. Der Täter hatte die Leiche in einem Waldstück bei Höllriegelskreuth am Isarkanal abgelegt und unter Ästen und Holzresten versteckt, wo ihn der Hund einer Spaziergängerin entdeckte. Nach dem vorläufigen Abschluss seiner Untersuchungen hielt der Gerichtsarzt es für wahrscheinlich, dass Lennard noch am Abend seines Verschwindens getötet worden war. Hinweise auf den Tatort fehlten bisher, genauso wie auf den Täter. Die Beisetzung des Jungen fand am morgigen Samstag, an Silvester, auf dem Ostfriedhof statt. Franck würde dort sein.
Darüber wollte er nicht sprechen.
»Wie war das, in Germering aufzuwachsen?« Er fragte nicht, um sich abzulenken; er hatte andere Gründe.
Vom ersten Gespräch an, das er im Zusammenhang mit dem Fall Lennard Grabbe geführt hatte, bestimmte ein anderes Verbrechen nicht minder seine Gegenwart, eines, von dem er geglaubt hatte, er wäre damit im Reinen.
»Wieso in Germering?«
»Weil du dort aufgewachsen bist.«
»Ich bin nicht in Germering aufgewachsen«, sagte seine Exfrau. »Bist du betrunken?«
»Nein.«
»Würde es dir viel Mühe bereiten, diesen polizistischen Blick sein zu lassen?«
»Seit wann bist du nicht in Germering aufgewachsen?«
»Ich schick dich gleich nach Hause, wenn du weiter so wirr daherredest.«
»Ich habe dir nur eine Frage gestellt.«
»Wer hat jemals behauptet, ich wär in Germering aufgewachsen?«
»Du.«
»Ich nicht.«
»Natürlich.«
»Du hörst mir nie zu.«
»Ich höre dir zu.«
»Du hörst deinen Verdächtigen zu, deinen Tätern, deinen Zeugen, nicht zu vergessen: den Angehörigen. Mir offensichtlich nicht. Sonst wüsstest du, dass ich nicht in Germering geboren und aufgewachsen bin, sondern …?«
»Sondern?«
»Sondern in Unterpfaffenhofen. Wie lang kennst du mich?«
»Unterpfaffenhofen, Germering, das ist doch dasselbe.«
»Das ist nicht dasselbe. Zu meiner Zeit waren Germering und Unterpfaffenhofen getrennte Orte, und das weißt du auch.«
»Das habe ich vergessen.«
»Wie viel hast du getrunken, bevor du zu mir gekommen bist? Sei ehrlich.«
»Nichts.«
»Du lügst.«
»Ich lüge nicht. Ich frage dich, weil … weil … Lass uns den Film anschauen.«
Marion Siedler stellte ihr Rotweinglas, das sie während des Gesprächs in der Hand gehalten hatte, auf den Tisch und streckte die Hand aus. »Du denkst gar nicht an mich«, sagte sie. Er sah weiter zur Wand, wie ertappt. »Du denkst an deine Schwester. Das Schicksal des Jungen hat dich an sie erinnert. Schau mich an.«
Er tat es. »Ich habe wirklich an dich gedacht.«
»Wieso hast du an mich gedacht, Hannes?«
»Weil … weil …« Er kam sich vor wie ein stotternder Junge, der sich für etwas rechtfertigte und nicht einsah, wieso. Wieder wich er ihrem Blick aus.
In seiner Vorstellung war Marion das Mädchen, das er vom Fenster aus im Hinterhof stehen sieht, in einem braunen Mantel und mit einer rosafarbenen Mütze, deren Bommel so weiß ist wie ein Schneeball. Seit einer Stunde starrt er durch die beschlagene Scheibe ins Schneegestöber, als könnte er darin ein Muster erkennen, eine Botschaft, einen Hinweis auf das Monster, das seine Familie heimgesucht hat und dann spurlos verschwunden ist.
Je mehr Zeit verging, desto stärker fühlte er sich in der Pflicht zu handeln, seinen Eltern Erlösung zu schenken; doch er wusste nicht, wie.
Am Fenster stehend, die Hände in den Taschen seiner ausgefransten Lieblingsjeans, das Mädchen im Hof und den uniformierten Polizisten anstarrend, der mit ihr redete, vergaß er das Fußballtraining, die Hausaufgaben in Physik und Geschichte, die bevorstehende Schulaufgabe in Englisch und alles, was seine Mutter zu ihm gesagt hatte, bevor sie ihn bat, in sein Zimmer zu gehen und abzuwarten.
Er hätte ihr nicht folgen dürfen, dachte er. Er hätte in den Hof hinuntergehen und den Polizisten zwingen müssen, die Wahrheit zu sagen.
Nie zuvor hatte er seinen Vater weinen sehen. Sein Vater hatte nicht einfach geweint, wie seine Mutter, er hatte geprustet und geschluchzt, aus seinen Augen schienen die Tränen zu spritzen, und die Laute, die er ausstieß, waren das Unheimlichste, was sein Sohn je gehört hatte.
Das Weinen seines Vaters erfüllte auch das Kinderzimmer; Jakob wagte nicht, sich umzudrehen, aus Furcht, sein Vater stünde in der Tür, aufgedunsen vom Schmerz, mit vor ohnmächtigem Zorn zuckenden Händen.
Wie gebannt blickt er hinunter zu dem Mädchen im Wintermantel. Als sie den Kopf hebt und ihm ihr blasses, schneenasses Gesicht zuwendet, erschrickt er maßlos, und sein Herz schlägt über ihn hinaus.
»Du warst das«, sagte Franck. »Du, und niemand anderes.«
Sein Blick, seine Stimme, sein Schweigen verrieten Marion Siedler, dass er keine Erwiderung erwartete; er nickte, als bedanke er sich für ihr Verständnis. »Die ganze Zeit habe ich dich vor mir gesehen. Bestimmt hast du im Winter Bommelmützen getragen. Wie das Mädchen im Hof. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Sie war aus der Nachbarschaft, sie kam wohl zufällig vorbei und sah den Streifenwagen. Du hast zu mir hochgesehen, da wäre ich beinah in Ohnmacht gefallen.«
»Damals kannten wir uns noch nicht. Und du warst in deiner Kindheit bestimmt kein einziges Mal in Unterpfaffenhofen.«
»Bestimmt nicht.«
»Nein«, sagte sie und wollte nicht verstummen.
Von jenem Wintertag in seiner Jugend hatte er ihr erzählt, als sie noch unentwegt ihre Nähe neu erfanden. Später verschloss er das Unglück in seiner Erinnerung, und sie drängte ihn nicht. Jetzt jedoch, so schien ihr, forderte er sie ungelenk auf, ihm das Sprechen zu erleichtern.
Sie sagte: »Euch beide hätt ich gern kennengelernt. Nach allem, was ich weiß, wart ihr ein eingeschworenes Team, du und deine kleine Schwester.«
»Sie war größer als ich. Aber zwei Jahre jünger. Manchmal küsste sie mich auf den Kopf.«
»Lina.«
»Du hast ihren Namen nicht vergessen«, sagte Franck.
»Das hat dir gefallen, wenn sie dich auf den Kopf geküsst hat. Das hab ich übrigens auch ab und zu getan, wenn du geschlafen hast; meist hast du dann aufgehört zu schnarchen.«
Etwas in seiner Erinnerung erschrak; er wollte nichts davon wissen. »Ich musste die ganze Woche an sie denken«, sagte er schnell. »An jedem einzelnen Tag. Wie schon lange nicht mehr.«
»Was ist passiert?«
Er verfiel in ein Schweigen, das Marion verwunderte. Aus der Zeit ihrer Ehe kannte sie ihn als einen von Berufs wegen verschlossenen Menschen. Im Lauf der Zeit – er hatte begonnen, in der Welt der Toten, für die er als Hauptkommissar im Morddezernat zuständig war, ein und aus zu gehen, und darüber allmählich das Liebesein vergessen – akzeptierte sie sein Gebaren als eine ebenso unheimliche wie ernstzunehmende Eigentümlichkeit, untauglich allerdings für die Ehe.
Gleichwohl hatte sie ihn nie als jemanden gekannt, der ihr etwas verheimlichte oder dem vor Eigennutz die Worte ausgingen. Hannes – seit ihren gemeinsamen Kinotagen nannte sie ihn so und er sie Gisa – lehnte ein bewusstes, manipulatives Schweigen geradezu körperlich ab; jeden, der sich so verhielt, betrachtete er grundsätzlich als Lügner, und Lügner raubten ihm schon in der Arbeit jegliche Geduld.
»Was schaust du so?«, fragte er.
»Jetzt hab ich an dich gedacht.«
»Und was?«
Sie stand auf, lächelte flüchtig, nahm das Bierglas und ging in die Küche. Sie lehnte sich gegen den Kühlschrank und verbot ihren Gedanken, in Herznähe zu geraten.
II
Hörst du, wie sie schweigen?
Das Jahr verschwand hinter einer weißen Wand.
Tanja Grabbe, die Frau im schwarzen Kleid mit dem blauen Stein an der Halskette, legte die Hand an die Fensterscheibe und wünschte, der Schnee nähme sie mit, dorthin, wo ihr Sohn jetzt war, in einem Strandkorb am Meer.
Das Geschirrklappern hallte in ihr wider.
Seit sie sich hingesetzt hatte – jemand hatte sie dazu gezwungen, vermutlich der Polizist oder ihr Mann, sie wusste es nicht mehr –, rieb sie die Knöchel ihrer zur Faust geballten Hände aneinander, gequält von Fragen: Wieso machen die Leute so viel Krach? Wieso reden sie so laut? Wieso rasselt die Kaffeemaschine die ganze Zeit? Wieso muss ich hier sein? Wieso ist alles so?
Durch die Gardinen vor den Gasthausfenstern sah sie das dichte Schneetreiben. Wenn sie die Augen fest schloss, spürte sie das harte Holz des Schlittens unter sich und Lennards Gewicht auf ihr und den Wind, der ihnen ins Gesicht schlug; wenn sie die Augen wieder öffnete, saß ein Mann in einem schwarzen Anzug neben ihr; er starrte auf ihre Hände.
Einige Sekunden lang empfand sie das Geräusch ihrer sich wie mechanisch auf und ab schiebenden Knöchel als lästig. Dann nahm sie wieder dieses Pochen wahr, das vorhin auf dem Friedhof an der Stelle ihres Körpers begonnen hatte, an der sie vor ungefähr zwölf Jahren zum ersten Mal seine Anwesenheit gespürt hatte.
Von diesem Moment an, hatte sie damals Dr. Horn erklärt und ihn an seine Schweigepflicht erinnert, würde ihr Leben zur Vollendung reifen. Vorher sei sie nichts als eine Schattenfrau gewesen. Mit Dr. Horn traute sie sich offen zu sprechen.
Jetzt sah sie den Arzt da sitzen, an einem Tisch beim Tresen; die grauhaarige Frau neben ihm ließ ihn nicht zu Wort kommen; er hörte zu, wie er es immer tat, wie er auch Lenny, dessen Redefluss manchmal endlos schien, immer hatte ausreden lassen.
Nichts als das Pochen in ihr. Ihr Körper, dachte sie, erinnerte sich.
Eine Zeitlang wurde sie die Frage nicht los, wer den Arzt gezwungen hatte, sich an einen anderen Tisch zu setzen. Bestimmt hatte er neben ihr Platz nehmen wollen, und jemand hatte ihn daran gehindert. So wie jemand ihr den Wunsch verwehrt hatte, in der Aussegnungshalle auf einem Stuhl am Kopfende des Sarges zu sitzen.
»Möchtest du nicht doch was essen?«, fragte der Mann neben ihr. Sie wandte ihm den Kopf zu, betrachtete sein Gesicht mit den seltsam vertrauten Augen, seine viel zu schwarzen, wie gefärbt wirkenden Haare, die sie anders in Erinnerung hatte, länger, lockiger.
Stephan, dachte sie, was machst du für Sachen, wenn man nicht auf dich aufpasst?
Vor ihr stand ein Teller mit grünem Salat und einer Tomatenscheibe auf dem obersten Blatt; der Anblick löste Übelkeit in ihr aus. Hastig griff sie nach der Hand ihres Mannes, krallte ihre Nägel in seine Haut und hörte erst damit auf, als sie, wie aus einer Eingebung heraus, wieder in sein Gesicht sah. Er biss sich auf die Lippen, hielt offensichtlich die Luft an. Sofort ließ sie ihn los. Er riss die Augen auf, atmete hektisch ein und aus und pustete dann, wie ein verletztes Kind, auf die Innenseite seiner Hand. Die verschämte Geste jagte Tanja Grabbe einen solchen Schrecken ein, dass sie anfing, laut zu schluchzen.
Die Gespräche verstummten. Der Arzt warf einen besorgten Blick herüber. Ein Mann mit Vollbart, der am selben Tisch saß wie sie, erhob sich und zwängte sich auf die Bank neben sie. Er legte den Arm um sie, und sie schmiegte den Kopf an seine Schulter. Er streichelte ihr Gesicht und nickte den Gästen zu. In leiserem Ton gingen die Gespräche weiter.
Die Nähe ihres Bruders versöhnte Tanja Grabbe ein wenig mit dem Alleinsein. Das war schon so gewesen, als sie zehn oder elf war; wenn Max sie in den Arm nahm oder bloß hochhob – ohne Anlass, aus purem Übermut –, fiel alles Gewicht von ihr ab, dachte sie dann, alle Schüchternheit und Furcht.
Jeder in der Gaststätte kannte Maximilian Hofmeister; die meisten wussten von der vertrauensvollen Beziehung der Geschwister, die offensichtlich auch nach Tanjas Heirat unverändert geblieben war; der eine oder andere aus ihrem Bekanntenkreis mochte sich im Lauf der Jahre gefragt haben, welche Position der Vater des Jungen, Stephan Grabbe, dabei einnahm und ob der Umgang der beiden ihn gelegentlich bedrücke oder gar verletze.
Obwohl Grabbe als Geschäftsmann – er führte mit seiner Frau das Café nahe der Münchner Freiheit – jeden Tag Präsenz zeigen musste, galt er im Umgang mit Leuten als zurückhaltend, fast arrogant. Seinen Sohn begleitete er, ganz gleich bei welchem Wetter, jedes Wochenende zum Fußballspielen; im Sommer fuhr er mit Frau und Kind an die Nordsee; nach den Ferien erzählte Lennard in seiner allseits bekannten, Worte sprudelnden Art jedem, den er kannte, wie toll sein Vater und er im Meer geschwommen seien und wie sie Hunderte von Muscheln und Steinen gesammelt und am Hundestrand gekickt hätten, bis alle Hunde total fertig gewesen seien, weil sie dauernd dem Ball hinterhergerannt waren. Über seinen Vater verlor Lennard nie ein schlechtes Wort.
»Ich möcht was sagen.«
Tanja Grabbe nahm ihre Gabel und klopfte an ein Wasserglas. Alle verstummten. »Ich möcht was sagen«, wiederholte sie. »Aufstehen kann ich nicht.« Sie schloss für einen Moment die Augen. Auch aus der Küche war kein Geräusch mehr zu hören.
Beinah lautlos, nur von einem matten Brummen begleitet, glitt draußen eine Straßenbahn auf den verschneiten Schienen vorüber.
Von der unerwarteten Entscheidung seiner Schwester überrascht, rutschte Maximilian Hofmeister ein Stück von ihr weg und rieb verwundert seinen Bart, bis er das Geräusch bemerkte und damit aufhörte.
In den Augen von Pfarrer Olbrich, der am Kopfende der langen Tischreihe saß, umgab die schwarz gekleidete Frau mit dem seidenen Schleier im blonden, kaum gebändigten Haar eine Aura tragischer Jugendlichkeit und gealterter Sehnsüchte. In diesem Moment war er sich nicht sicher, ob sie je eine Erfüllung im Leben erfahren hatte. Über die seelische Katastrophe, die der Tod eines Kindes bei jeder Mutter auslöste, hatte sie in den Gesprächen, die Olbrich mit ihr und ihrem Mann zu führen versuchte, nicht ein Wort verloren. Stattdessen hatte sie ihn gebeten, sowohl in der Kirche als auch in der Aussegnungshalle allein auf einem Stuhl vor dem mit weißen Rosen geschmückten Sarg sitzen zu dürfen. Da ihm kein überzeugendes Argument dagegen eingefallen war, hatte Olbrich zugestimmt, doch Grabbe verweigerte seiner Frau die Bitte, was sie widerspruchslos hinzunehmen schien.
Als Lennards Mutter im Gasthaus ansetzte zu sprechen, faltete Arthur Olbrich die Hände vor der Brust und bemerkte, dass zwei Tische weiter ein anderer Trauergast dasselbe tat. Als dieser den Kopf hob, erinnerte sich der Pfarrer daran, dass der Vater des Jungen erwähnt hatte, dieser Mann habe ihnen zwei Tage vor Weihnachten die Todesnachricht überbracht und sei bis Mitternacht geblieben.
Dann passierte noch etwas, das dem erfahrenen Priester fast ein Lächeln abgerungen hätte. Nachdem er die Hände gefaltet hatte, kam ihm ein Psalm in den Sinn, den er in Gedanken sprechen wollte; gleichzeitig fiel ihm ein Absatz aus dem Koran ein, den er vor kurzem gelesen hatte: Alle gehören wir Gott; unsere Reise geht zu ihm; o du zur Ruhe zurückgefundene Seele; du warst anderen ein Wohltäter, kehre nun in Frieden zu deinem Herrn zurück; schließe dich dem Kreis meiner Diener an, gehe also in mein Paradies ein.
Während Olbrich sich noch wunderte, was Gott nach der Beerdigung eines katholischen Jungen mit diesem Gedankensprung bei ihm bezweckte, rezitierte Hauptkommissar a.D. Jakob Franck jenen Psalm für sich, den er schon öfter bei seinen Begegnungen mit Hinterbliebenen gebetet und den ursprünglich auch der Priester im Sinn gehabt hatte: Ehe die Berge geboren wurden, die Erde entstand und das Weltall, bist du, o Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit; du lässt die Menschen zurückkehren zum Staub und sprichst: kommt wieder, ihr Menschen; denn tausend Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht.
»Mein Sohn ist nicht gestorben«, sagte Tanja Grabbe. »Er sitzt an diesem Tisch und sieht uns an, weil wir alle schuld sind.«
Sie sah niemanden an, nur das gerahmte Foto mit der schwarzen Schleife, das vor ihr auf dem Tisch stand, neben der Vase mit den weißen Rosen.
»Welcher Elefant hat größere Ohrwascheln?«, sagte sie. »Der afrikanische oder der asiatische? Hat’s immer durcheinandergebracht, mein Lennard, er war sich ganz sicher, dass der asiatische richtig ist. Lauter so Fragen. Bin auch nicht viel gescheiter als er; im Fußball weiß ich nichts, da ist er unschlagbar, besser als jeder seiner Mitschüler.
Er ist Mittelstürmer, das wissen Sie ja; schon siebenundfünfzig Tore hat er in diesem Jahr geschossen und dreiunddreißig Vorlagen gegeben, oder wie man das nennt, damit ein anderer das Tor schießen kann. Die Zahlen hat er mir extra aufgeschrieben, ich musst sie mir merken, weil er mich abgefragt hat. Siebenundfünfzig Tore, das ist Schulrekord, und er bekam eine Urkunde dafür.«
Sie streckte die Hand nach dem Foto aus, ohne es zu berühren. »Ist ein Mann aufgetaucht aus dem Schnee und hat an die Tür geklopft.«
Sie ballte die Hand zur Faust und klopfte vier Mal auf die Tischdecke. »Hab gleich gewusst, wer da ist. Ein Polizist. Woran erkennt man einen Polizisten? An der Uniform, sagt Lennard, das stimmt; aber Uniform ist nicht nur Kleidung, Uniform ist auch, wie einer schaut und sich gibt und Dinge sagt, wie: Ihr Kind ist gestorben. So was sagt sonst niemand, nur ein Polizist.
Hab ihn gleich erkannt; und verwechselt. Bin so dumm. Wieso hast du das nicht gleich kapiert?, hat Lennard zu mir gesagt, in seinem Strandkorb, wo er immer sitzt. Ich bin so dumm, so dumm, er hat ganz recht.
Alles voller Schnee; die Leute sind am Café vorbeigesaust, Gott sei Dank alle weg. Da fällt der Mann vom Himmel, eine Ledertasche umgehängt, und ich denk: ein Polizist, der will wieder Sachen wissen, was aus der Schule, oder der Direktor hat ihn geschickt, weil er mir die Fußball-Urkunde bringen soll. Wegen der siebenundfünfzig Tore. War doch der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien.
So was hab ich gedacht und aufgesperrt und den Mann reingelassen; er war ganz weiß und hatte eine rote Nasenspitze. An der Tür hat er was zu mir gesagt, ich hab nicht hingehört; später auch nicht. Doch, später schon, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Stephan kam dann auch, weiß nicht, wo er vorher war, hat vielleicht einen Schneemann gebaut. Weiß man oft nicht, was Stephan so treibt, wenn er nicht kocht oder backt. Meistens kocht und backt er, das ist bekannt.
So getäuscht in jemand hab ich mich schon ewig nicht mehr. Polizist hat noch gestimmt, aber den Rest hab ich mir zusammengereimt; das verzeiht mir Lennard nie.«
»Kein Wort von dem, was der Polizist sagt, ist wahr. Wir beide wissen das. Ich hab mir gedacht, dass wir die Urkunde, wenn du einverstanden bist, ins Wohnzimmer hängen, an die Wand neben dem Fernseher, dann haben wir sie immer im Blick. Kannst es dir ja noch überlegen.
Nicht, dass Sie meinen, Lennard ist ein Fernsehkind; er schaut gern Fußball, auch schon mal spät in der Nacht, aber nur, wenn am nächsten Tag schulfrei ist. Da achten wir drauf, Stephan und ich. Das ist mein Mann, hier neben mir, und das ist mein Bruder, hier auch neben mir, er leitet den Friseursalon Hofmeister in der Fraunhoferstraße, unser Familienunternehmen. Da ist meine Mutter, hallo, Mama, hoffentlich genierst du dich nicht für mich; weil ich so red und allen Leuten Sachen aus unserem Leben erzähl. Das muss sein; sonst versteht niemand, was passiert ist.
Der Polizist aus dem Schnee ist schuld. Wenn er nicht gekommen wär, hätten wir alle länger leben können, du auch, Mama, du auch, Max, du auch, Stephan, ich auch. Jetzt lebt nur noch unser Lennard.
Da ist er, an der Isar nach dem gewonnenen Spiel gegen die Mannschaft aus Pullach, vier zu eins, und er hat zwei Tore geschossen. Schau, wie er sein weißes Trikot durchgeschwitzt hat; erschöpft sieht er aus; er rennt und rennt immer noch, wenn die anderen längst am Boden liegen; wo mag er bloß die Kondition herhaben, von mir bestimmt nicht, wahrscheinlich von seinem Vater. An dem Nachmittag hab ich ihn während des Spiels fotografiert, auch hinterher, da standen alle im Kreis und haben sich gegenseitig bejubelt, weil sie ihren Angstgegner besiegt hatten. Schau, wie er lacht. Hat sich noch nie gern fotografieren lassen, aber da hab ich ihn erwischt, und das war ein Glück. Torschützenkönig Lennard Grabbe.
Du bist nicht nach Haus gekommen, niemand weiß, wieso, nicht einmal der siebengescheite Polizist; der kennt sich im Totsein aus, im Lebendigsein nicht so. Wenn er nämlich wirklich was wüsst, könnt er mir sagen, welchen Weg Lennard von der Schule aus gegangen ist und wo genau dann was passiert ist, was sowieso nicht stimmt. Kann nicht stimmen, weil’s keinen Beweis gibt, und was man nicht beweisen kann, existiert nirgendwo auf der Welt.«
Daraufhin schwieg sie.
Niemand gab einen Mucks von sich. Der Koch, der Ehemann der Wirtin, und sein dunkelhäutiger Gehilfe waren lautlos aus der Küche gekommen; sie hatten sich hinterm Tresen an die Wand gelehnt und verfolgten die immer wieder abbrechenden, mit ebenso stockender wie eindringlicher Stimme vorgetragenen Sätze der Frau, die ihre rechte Hand wieder zur Faust geballt hatte. Jede ihrer noch so unscheinbaren Bewegungen verursachte ein eigentümliches Rascheln ihres Kleides – als würde der Stoff sich an der Stille reiben. Auf den jungen Äthiopier, der geduckt, seine Hände versteckt unter der Kochschürze, hinter seinem Chef stand, machte sie einen Unheil verkündenden Eindruck.
Lange sah sie Pfarrer Olbrich ins Gesicht. Da er seine Augen nicht senkte, was ihr angemessen erschienen wäre, wandte sie den Kopf ab. Beim Anblick des Mannes, dessen Anwesenheit sie vergessen hatte, erschrak sie. Ihre Reaktion blieb niemandem verborgen, so dass Jakob Franck keine Wahl hatte, als die auf ihn gerichteten Augenpaare gleichmütig zu ertragen.
Franck war hier, weil Stephan Grabbe ihn eingeladen hatte, und er würde – nicht zum ersten Mal bei einer solchen Gelegenheit – ein paar Worte sagen, falls ein Angehöriger ihn dazu aufforderte; Polizeiworte; mit den Kollegen abgestimmte Aussagen zu den laufenden Ermittlungen; Trostworte, geschöpft aus jahrelanger Erfahrung als Verteiler von Sätzen in den Nächten allumfassender Sprachlosigkeit.
»Die Wahrheit möcht ich wissen«, sagte Tanja Grabbe, an Franck gerichtet.
Mit einer Antwort rechnete sie nicht; ihre Aufmerksamkeit galt schon wieder dem Foto, den Rosen, der Welt in ihr allein. »Ich möcht wissen, mit wem Lennard nach Höllriegelskreuth gefahren ist. Was soll er denn da? Was gibt’s da zu sehen? Wohnt da ein Ork, den er treffen wollt? Glaub ich nie und nimmer. Jemand hat ihn gezwungen, mitzukommen, aber wer? Das verschweigen die Kommissare, sie stellen immer nur Fragen und behaupten Sachen, die ich nicht versteh. Wenn man was sagt, was niemand versteht, denken alle, das muss bedeutend sein. So eine Lüge und Gemeinheit! Wer ist der Mensch, der Lennard von der Schule abgeholt und nach Höllriegelskreuth gebracht hat? Hat sich in Luft aufgelöst; oder sich in einem Erdloch vergraben; oder ist nach Amerika ausgewandert. Dieser Mensch hat meinen Sohn angeblich umgebracht. Wie denn?
In der Zeitung steht, Lennard ist erschlagen worden. Von wem denn? Von einem Unsichtbaren. Oder hat einer von euch ihn gesehen? Nein. Niemand hat ihn gesehen, erst recht nicht die Polizei.
Ich bin Lennards Mutter, woher nehmt ihr das Recht, mich anzulügen? In der Zeitung steht, jemand hätt sein Fahrrad geklaut, deswegen musst er zu Fuß nach Haus gehen; deswegen ist alles so gekommen; das alles. Wenn er mit dem Fahrrad gefahren wär, hätt ich das ganze Toastbrot nicht wegschmeißen müssen. Das war nicht schlimm; sonst darf man kein Essen wegwerfen; das tun wir auch nicht, stimmt’s, Stephan?
Toast Hawaii mit Ananas und Schinken; isst er genauso gern wie Fischstäbchen und Nudeln mit Ketchup; waren im Ofen, die Toastbrote; Ankunftszeit halb acht. Ich hab gewartet; stimmt überhaupt nicht. Wieso hätt ich denn warten sollen, ich wusst ja, dass er gleich kommt.
Weiß nicht mehr, was ich getan hab, aufgeräumt wahrscheinlich, die Wäsche aus dem Trockner geholt. Den Regen hab ich verflucht, den Wind, den ekelhaften November. Kann sein, dass ich den Fernseher angeschaltet hab, um rauszukriegen, ob das Wetter irgendwann besser wird oder ob’s durchregnet bis zum Ende des Jahres. Kein Schirm. Lennard hasst Schirme. Er hat den Regen gern; wenn der Regen auf seinen Kopf trommelt, lacht er; wie auf dem Foto nach dem gewonnenen Spiel. Schaut, wie glücklich er ist.
Niemand schaut hin. Er schaut bloß mich an. Weil er mich kennt und weiß, dass ich nie lügen würd. Ehrlichkeit, das hab ich ihn gelehrt, ist das tägliche Brot, das wir uns gegenseitig schenken, und also ist er ein aufrichtiger Mensch geworden; ohne Ehrlichkeit verhungern wir auf die Dauer.
Sie sagen mir nicht, was auf dem Heimweg meines Sohnes geschehen ist, Herr Kommissar, Sie haben versprochen, das Rätsel zu lösen. Wir warten immer noch auf das erlösende Wort, mein Sohn und ich, wir sitzen hier und warten, und ich weiß nicht, ob ich noch länger Geduld haben mag.
Dunkel war’s, es regnete unaufhörlich, und der Regen und sein Mittäter, der Wind, verwischten alle Spuren, war’s nicht so? Zwei Stunden hab ich Ihrem Kollegen zugehört; er hat mir erklärt, wie die Polizei mit Supertechnik die Gegend durchsucht hat, stundenlang, tagelang, klang eindrucksvoll. Aber der Regen halt; und der Sturm halt; und die Sonne war auch schon untergegangen; und kein Zeuge weit und breit; kein Mensch hat halt was gesehen.
Kannst du das glauben, Lennard? Dass niemand auf der Straße war, als du aus der Schule kamst und im strömenden Regen dein Radl gesucht hast; der ganze Stadtteil menschenleer? Hab den Kommissar gefragt, ob denn keine Straßenbahnen gefahren sind, er sagte: dochdoch, auch Taxis, Autos überhaupt, dochdoch. Wahrscheinlich saßen in allen Fahrzeugen Blinde oder Insassen mit siebzehn Dioptrien und beschlagenen Brillen.«
»Wir gehen den Weg allein, Herr Pfarrer, im Vertrauen auf Gott, den Herrn, heißt’s. Was kann Gott, der Herr, gegen ein Unwetter ausrichten? Offensichtlich nichts; wehrlos im Himmel, schlechte Sicht, lausiger Tag. Ich kam an einem Supermarkt vorbei; da kaufst du dir manchmal eine Cola oder was Süßes, was genau, verrätst du mir nicht. Musst du nicht; fällt nicht unter Unehrlichkeit, ist bloß ein Spiel; wenn ich rausfind, was du dir gekauft hast, gibst du’s gleich zu und musst gestehen, dass ich schlauer bin als du, zumindest ab und zu. Die Kassiererin kennt dich, hab ihr ein Foto von dir gezeigt, sie sagt, du bist ein höflicher Junge, auch ein wenig schüchtern; sie sieht dich oft; nicht oft genug; am Abend vom achtzehnten November saß sie bis acht an der Kasse, du kamst nicht rein; sie ging nicht raus zum Rauchen, wie sonst, hat sie gesagt, draußen hat’s gestürmt, und sie blieb im Trocknen, das kann man gut verstehen.
Ging den Weg allein, die Eintrachtstraße runter, am Gasthaus vorbei, in dem wir jetzt sind, und ich hab überlegt, ob ich reingehen und mich aufwärmen soll, einen Tee mit Rum oder einen Obstler trinken. Hab’s nicht getan; hatte keine Zeit; hab meinen Schirm mit beiden Händen festgehalten, damit er nicht wegfliegt. Nicht weinen, hab ich zu mir gesagt, wieso weinst du denn? Dann hab ich begriffen, dass ich gar nicht wein, sondern der Regen mir dauernd seine Tränen ins Gesicht wirft. Das musst du mir schon glauben, wenn ich’s sag.
An der Friedhofsmauer entlang bin ich gegangen, in die Regerstraße eingebogen, bis ich wieder zu Haus war. Unterwegs hab ich jeden gefragt, der mir entgegenkam: Haben Sie meinen Sohn gesehen? Haben Sie meinen Sohn gesehen? Haben Sie meinen Sohn gesehen? Und sie sagten: neinnein; alle sagten: neinein. Sie haben mich belogen, hab ich recht, Lennard?
Und der Junge, der dein Radl geklaut hat, behauptet, er würd dich nicht kennen; die Polizei ließ ihn laufen, er ist bloß ein Dieb, sagen sie, außerdem hätt er das Radl freiwillig wieder zurückgebracht. Kann schon sein. Mag ja sein. Er hat das Radl zurückgebracht, aber ohne dich drauf.