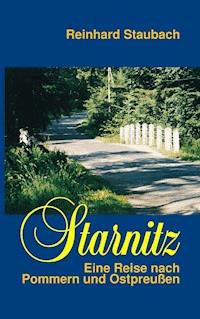Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was tun, wenn sich ein riesiger schwarzer Hund anschickt, einem das Steak vom Teller zu fischen? Kann man etwas von Vater Spatz und seinem begriffsstutzigen Jungen lernen, der das Aufsperren seines Schnabels zum Lebensinhalt erklärt hat? Schmecken gependelte Schnitzel tatsächlich besser, und wer hat wirklich den Vorteil davon? Was würden Sie empfinden, wenn Sie herausfänden, dass Ihr Ur-Ur-Ur-Großvater ein Sklavenhändler war? - Geschichten zum Schmunzeln und manchmal auch zum Nachdenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kein Badestrand
Aus der Rolle gefallen
Die Patrone
Ein Hund zum Dinner
Das Spatzen-Söhnlein
Das Schwarzwaldhaus
Prinz 4
Unterstützung kommt
Raubritter Reinhard
Schnell „Zum Klabautermann“
Würstchen mit Aura
Die Wiege der Menschheit
Dialog über Rituale
Ermunterung ist steuerfrei
Gaben von Kostnix
Harmonie
Unglaubliche Hilfe
Wenn ein Licht aufgeht
Brunnenvergiftung
Eisbein mit Musik
Das alte Dokument
Die Schmuckliste
Wie es euch gefällt
Schnitzel, gependelt
Kalender gesucht
Blutrünstige Bestie
Das Rendezvous
Empire State Building
Attacke in Finnland
Der Metall-Container
Der Pfosten
Martinstag
Das Schlossgespenst
Der Gipfel
Immer, wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit sich zu besinnen.
Mark Twain
Kein Badestrand
In Jönköping war ich aus dem Bus gestiegen. Schon am Busbahnhof leuchtete mir Schwedens zweitgrößter See entgegen, der Vättersee. Also schnell den Koffer ins Hotel bringen, dann zurück zum See, an den Badestrand. Von dort war der Sonnenuntergang sicher besonders schön.
Mein Hotel lag in der City, keine fünf Minuten zu Fuß entfernt. Schnell war ich zurück am Bahnhof. Doch da war kein Strand. Zwischen See und Stadt lagen die Eisenbahnschienen. Wieso hatte man den Bahnhof und den Busbahnhof direkt an den See geklebt? Mochten die Schweden in Jönköping nicht baden? Lebte hier eine wasserscheue Volksgruppe, deren Existenz mir bisher entgangen war?
Ich schaute zurück auf die Stadt und wieder zum See. Es wäre doch wunderbar gewesen, an Wochenenden oder nach Feierabend aus der City an den See zu spazieren und ein paar Runden zu schwimmen, ohne das Auto aus der Garage holen zu müssen. Aber nein, die Stadtväter hatten sich dafür entschieden, zwischen See und Stadt die Eisenbahnschienen zu verlegen. Dabei hätten sich die Reisenden doch sicherlich auch darüber gefreut, den Bahnhof mitten in der City zu haben, wie es bei unzähligen anderen Städten üblich ist. Hatten sich die Stadtväter von der Eisenbahngesellschaft einwickeln lassen, damit sich die Durchreisenden aus dem Zug am ungetrübten Blick auf den See ergötzen könnten?
Meine Augen wanderten rechts am Ufer entlang. Ein kleiner Hafen, in dem einige Segel- und Motorbote dümpelten Danach Stand? Nein, kein Strand. Soweit das Auge reichte, Steinbrocken und Gestrüpp am Ufer, kein Strand. Aber links vom Bahnhof - denkste, fast das gleiche Bild, allerdings ohne Hafen. Weit und breit kein Strand.
Ich ging zum Hafen und schaute ins Wasser. Es war klar und sauber. Keine Spur von Verunreinigung. Allerdings, weiter links im Westen steht die alte Streichholzfabrik. Ob die noch produziert und Giftiges in den See entsorgt? Jönköping war ja mal international führend in der Streichholzindustrie. Die ersten Streichhölzer entsprachen nicht den heutigen Produkten und waren oft unsicher und explosiv. Man hatte mit verschiedenen Chemikalien experimentiert. Dabei brannte die Fabrik ein paar Mal ab. Ob dabei vielleicht die klugen Köpfe der Stadt in den Flammen umgekommen waren? Anschließend haben dann vielleicht Schwachköpfe das Rathaus besetzt und die Eisenbahnschienen dort verlegt, wo sie immer noch liegen. Ging nun meine Fantasie mit mir durch? Ich gebot ihr ernsthaft Einhalt.
Meine schwedischen Freunde fragte ich schließlich, warum es in Jönköping am Vättersee keinen Strand gebe. Die Antwort erklärte alles: Der See ist so tief, dass das Wasser selbst im heißen Sommer nicht warm genug wird, um darin zu baden. Weiter im Norden gibt es flache Uferabschnitte, wo man baden kann.
Später las ich nach, dass der Vättersee im Süden (also bei Jönköping) über 100 Meter tief ist. Meine Empörung auf die Stadtväter versenkte ich in den Tiefen der dunkelblauen Fluten. Zudem entdeckte ich schmale Sandstreifen am östlichen Ufer im Stadtbereich. Ich hatte sie vom Bahnhof aus nicht sehen können. Aber gebadet hat dort niemand.
Wieso hatte ich mich überhaupt über den fehlenden Strand aufgeregt? Sollen die Schweden doch Stände anlegen, wo sie wollen. Was geht mich das an? Wieso hatte ich die Stadtväter insgeheim als kurzsichtig, beknackt und bekloppt bezeichnet? Nicht die jetzigen, aber jene, die vor etwa einhundert Jahren die Schienen dort verlegt hatten, wo sie heute immer noch liegen.
Mein Problem: Ich war mit einer Erwartung an den See gekommen, die nicht erfüllt wurde. Nicht die Tatsachen, sondern die eigenen Erwartungen können die Stimmung total vermiesen.
Hätte ich vom Ufer gleich einen Schwarm Haifische im Wasser patrouillieren gesehen, dann wäre ich vielleicht glücklich gewesen, dass es keinen Strand gab.
Aus der Rolle gefallen
Das Desaster war perfekt. Über 200 Leute im Publikum und mein Partner auf der Bühne hält sich nicht an den Text. Es verschlägt mir stante pede die Sprache, und er redet unbekümmert weiter, als gehöre es sich so. Insgeheim staune ich über seinen Einfallsreichtum. Offenbar hat er seinen Text vergessen und ist nun buchstäblich aus der Rolle gefallen. Wir spielen einen scharfen Disput, ein Wort gibt das andere. Kein Platz für eine Gesprächspause. Die Souffleuse verfolgt mit großen Augen das Geschehen auf der Bühne und hüllt sich in Schweigen. Wie soll ich da nun wieder einsteigen? Augen zu und durch.
Nach der Szene haue ich meinen Partner hinter der Bühne an: „Was war denn mit dir los? Wieso bringst du so einen irren Text? Die Szene lief bisher doch immer gut?“
Alfred grinst: „Wieso ich? Du hast dich doch nicht an den Text gehalten.“
Frechheit!
„Du hättest sagen müssen“, fährt er fort und zitiert: „,...holen Sie die Frau zurück, bevor es zu spät ist’, dieser Satz ist aber nicht von dir gekommen. Darin steckt mein Stichwort, nämlich ,zurückholen’. Weil das nun nicht kam, musste ich mir etwas anderes einfallen lassen. Logo?“
Als er die Stelle zitiert, verschwindet der Nebel aus meinem Gehirn. Er hat Recht! Nicht er, sondern ich war aus der Rolle gefallen.
„Stimmt. Tut mit leid.“
„Vergiss es. Die Zuschauer haben eh nichts gemerkt.“
Auch das war richtig, durch seine spontane Improvisation, war die Szene gerettet worden. Ein großartiger Kollege.
Wir sind beide keine professionellen Schauspieler, sondern Mitglieder im dörflichen Theaterverein. Jährlich ein humorvolles Bühnenwerk einzustudieren, bereitet uns viel Freude. Ich war erst mit 50 auf die Bretter, die angeblich die Welt bedeuten, getreten. Und ich staunte darüber, dass ich selbst längere Textpassagen auswendig lernen konnte. In der Schule war ich stets im Boden versunken, wenn ich ein Gedicht aufsagen sollte.
Jene Bühnenszene, in der ich bei meinen Partner unberechtigt beschuldigt hatte, verfolgte mich noch Jahre später. Denn bereits als Kind hatte ich in der Sonntagsschule die Aussage Jesu aus der Bergpredigt gelernt:
Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen! - und dabei steckt in deinem Auge ein Balken? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. - (Mt 7:3-5)
Den Balken im eigenen Auge zu bemerken, kann verdammt schwierig sein. Ich war beim Theaterspiel gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich einen Fehler gemacht haben könnte, dass ich einen Balken im eigenen Auge übersah. Ohne nachzudenken hatte ich die Schuld bei meinem Bühnenpartner gesucht.
Den entscheidenden Satz mit dem wichtigen Stichwort hatte ich nicht absichtlich übergangen. Ich hatte nicht einmal bemerkt, dass er fehlte, obwohl ich den Satz in den vorangegangenen Vorstellungen stets an der richtigen Stelle sagte.
Vermutlich hat mein Versagen nicht den Weltfrieden gefährdet. Dennoch, wie war der Balken in mein Auge gekommen? Fehler zu machen, ist eine menschliche Eigenschaft. Sie zu verbergen, oder Fehler zu rechtfertigen, ist bisweilen unverzeihlich.
Die Patrone
Geschichtsunterricht in der Schule kann nerven, besonders, wenn eine Klassenarbeit ansteht. Wann war der Dreißigjährige Krieg? Wie hießen die Schiffe, mit denen Kolumbus Amerika entdeckte? Warum trat Bismarck als Reichskanzler ab? Und so weiter, und so weiter. Daten und Fakten, die niemanden interessierten. Doch Olli gestaltete den Geschichtsunterricht einzigartig, und kein Schüler wagte zu stören. Bis auf ein Mal, aber das geschah unabsichtlich.
Olli nannten wir unseren Lehrer, manchmal liebevoll, oft respektvoll und zuweilen ein bisschen ängstlich. Er war ein Mann in den besten Jahren und unterrichtete an der Glückstädter Volksschule Deutsch, Mathematik, Physik, Geschichte und was sonst noch an Volksschulen jener Zeit geboten wurde. Nur beim Sport war Olli nie zu sehen.
Es geschah, als ich im sechsten Schuljahr war. Auf dem Stundenplan stand Geschichte. Olli hatte sich auf den Schreibtisch gesetzt und die Beine baumeln lassen. Nur zum Geschichtsunterricht setzte er sich auf den Schreibtisch, nie bei einem anderen Unterrichtsfach. Jedes Mal wunderte ich mich über seine dünnen Beine. Denn Olli war recht korpulent. Doch seine Beine und Arme steckten wie nicht dazu gehörend am runden Köper. Wenn er ging, fiel es nicht so auf, weil er stets weite graue Anzüge trug. Dazu Schlips und Kragen, was um 1960 bei Lehrern üblich war. Doch wenn Olli sich auf den Schreibtisch setzte und seine Beine baumeln ließ, dann entstand zwischen dem Hosensaum und den Schuhen eine Lücke, in der die weißen Streichholzbeine hervor leuchteten.
Jeder Lehrer hat seine Methode, die Schüler zu disziplinieren. Wir hatten beispielsweise einen, der uns stolz seinen neu erworbenen Rohrstock zeigte und ausführte, wie er zur Anwendung kommen würde. Er ließ es nicht nur bei der Demonstration, der Rohrstock kam tatsächlich zum Einsatz. Damals war die Prügelstrafe in der Schule noch gang und gäbe.
Olli disziplinierte die Schüler mit seiner Stimme. Nie wurde er handgreiflich. Seine Stimme reichte. Die wurde dann nicht nur einfach laut, er brüllte wie ein Löwe. Hatte er zuvor noch in Zimmerlautstärke gesprochen, so donnerte er plötzlich los, dass buchstäblich die Scheiben klirren. Sein Organ vernahm man im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulhof bei geschlossenen Fenstern und Türen. - Nach so einem Ausbruch herrschte Ruhe, und alle Schüler waren eingeschüchtert. Ollis Methode, für Ruhe zu sorgen, funktionierte.
Im Geschichtsunterricht kamen derartige Ausbrüche nicht vor, bis auf das eine Mal. Seiner Meinung nach sollten die Schüler etwas über die historischen Ereignisse erfahren.
Olli setzte sich auf den Schreibtisch und erzählte Geschichte. Das konnte er so interessant, dass alle aufmerksam zuhörten. Er berichtete mit ruhiger Stimme auf eine Art und Weise, als wäre er selber dabei gewesen. Ein Bericht aus erster Hand, sozusagen. Dabei spielte es keine Rolle, ob er von den Germanen, den Römern oder dem Dritten Reich berichtete. Er wusste unglaublich viele Details über die historischen Ereignisse. In der Klasse war es stets mucksmäuschenstill, niemand schlief, alle lauschten gespannt.
Auch Axel war offenbar von der Erzählung so fasziniert, dass er nicht mehr darauf achtete, was er unter der Schulbank tat. Er hatte eine Patrone mitgebracht und stocherte mit der Zirkelspitze daran herum. Ich sah, was er tat, dachte mir aber nichts dabei. Nach Manövern der Marine oder des Heeres konnte man hin und wieder in der Umgebung derartige Patronen finden, die die Soldaten in ihren Gewehren verwendeten. Gewöhnlich waren sie leer, kleine Blechhülsen, die an einer Seite offen waren.
Doch Axel hatte eine Patrone gefunden, die noch verschlossen war. Plötzlich knallte es, und Axel war in eine bläuliche Rauchwolke gehüllt. Olli erkannte sofort den Übeltäter, sprang vom Schreibtisch und brüllte Axel an, dass allen Schülern das Blut in den Adern gefror.
Axel blieb unverletzt. Auch sonst war niemand zu Schaden gekommen. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte und Olli wieder Zimmerlautstärke anschlug, verkündete er das Strafmaß: vierzig Seiten eines Schulheftes Zeile für Zeile voll schreiben mit dem Satz: Ich darf den Unterricht nicht stören.
Axel blickte verstört. Die Strafe war hoch, aber nicht ungerecht und außerdem machbar. Ein ganzes Schulheft vollschreiben in zwei Tagen.
Nach einer kleinen Pause machte Olli einen Alternativvorschlag. Im städtischen Kino laufe gerade der Film „Die Feuerzangenbowle“. Er habe den Film mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle bereits gesehen. Er basiere auf dem gleichnamigen Roman von Heinrich Spoerl. Das sei ein wunderbarer Film über einen erfolgreichen Schriftsteller, der inkognito wieder zur Schule gehe und dort allerlei Unsinn anstelle. Deshalb schlage er vor, dass Axel die Strafarbeit nicht zu schreiben brauche, wenn er die gesamte Schulklasse in den Film einlade.
Axels Augen leuchteten auf. Die Schüler jubelten. Allerdings, so viel Taschengeld hatte Axel nicht, um die über vierzig Jungen in der Klasse einzuladen. Olli meinte, er solle wegen des Geldes mit den Eltern reden. Axels Eltern waren zwar keine Millionäre, gehörten aber zu den Wohlhabenden in Glückstadt.
Am nächsten Tag verkündete Axel, dass seine Eltern ihm das Eintrittsgeld fürs Kino vorschießen würden. So traf sich also die gesamte Schulklasse mit Olli am Samstagnachmittag vor dem Kino der Stadt. Großartig.
Ein Hund zum Dinner
Das Restaurant an der Landstraße außerhalb des Dorfes machte einen guten Eindruck, gepflegt und sauber. Soeben war der Abendstern aufgegangen, und dezente Lampen erhellten das Gebäude. Mit der Lady meines Herzens beschloss ich, die kulinarischen Angebote der Küche zu testen. Weil es ein warmer Sommerabend war, setzten wir uns an einen Tisch auf der Terrasse.
Kaum waren die Speisen serviert und der Ober wieder im Gebäude verschwunden, tappte ein riesiger, schwarzer Hund gemächlich um die Hausecke, wie ein Wachmann, der seine Runden dreht. Doch er drehte keine Runde. Noch ahnte ich keinen Ärger, obwohl er mich an Satan persönlich erinnerte. Hatte ich so ein Tier nicht auf mittelalterlichen Teufelsdarstellungen gesehen? Der Mischling war offenbar das Ergebnis einer leidenschaftlichen Liebe zwischen einem Berner Sennenhund und einem belgischen Bloodhound. Er steuerte langsam und zielstrebig auf unseren Tisch zu.
Er war groß; seine Schnauze würde bis an die Tischkante reichen. Auch dass bemerkte ich, obwohl er noch etliche Meter von unserem Tisch entfernt war. Nun bin ich zwar tierlieb, aber als jener schwarze Geselle bis auf eine Armlänge heran gezottelt war und gierig auf meinen Teller schaute, erkannte ich die Grenzen meiner Tierliebe. Ich war nicht bereit, mir mein Nachtmahl wegschnappen zu lassen, und informierte ihn deutlich und unmissverständlich darüber.
„Pfui!“, sagte ich. Und noch einmal etwas lauter: „Pfui! Verdufte! Hau ab! Das ist mein Essen! Geh weg! Weg hier! Verschwinde!“ Die letzten Worte hatte ich schon etwas lauter gesagt.
Doch den schwarzen Kerl interessierten meine Wünsche nicht im Geringsten. Als habe er nichts gehört positionierte er seine Schnauze noch näher an den Steak-Teller. Die Situation wurde brenzlig. Die Lady meines Herzens schaute mich mit großen Augen an und hielt ihre Hände schützend über ihren Teller. Doch sobald es darauf ankäme, würde sie die makellos lackierten Fingernägel blitzschnell in Sicherheit bringen. Da war ich mir sicher.