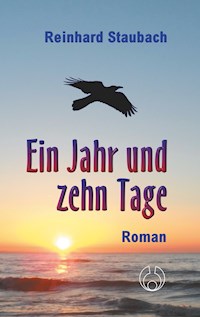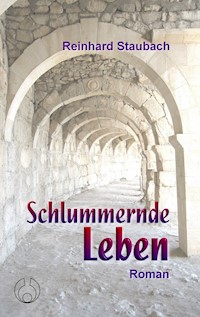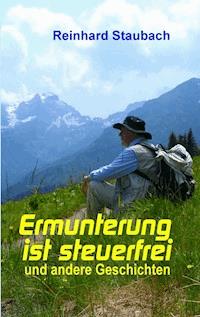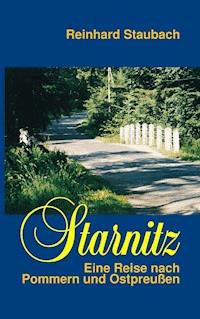
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Im Juni 2002 reiste Reinhard Staubach mit Verwandten nach Polen. Er berichtet über die Reise und seine Kindheit in dem unter polnischer Verwaltung stehenden Hinterpommern. In Starnitz fanden sich seine Eltern. Dort endete 1945 für die Mitreisenden die Flucht vor der Roten Armee. Rathsdamnitz, Stolp, Stolpmünde, Mützenow, Kosemühl, Braunsberg und natürlich Starnitz standen im Mittelpunkt der Reise. Aber auch Frauenburg, Danzig, Karthaus und Hela wurden von der elfköpfigen Gruppe besucht. Ein Reisebericht mit historischem Rückblick und 60 Fotos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Pommern und Ostpreußen
Braunsberg (Braniewo)
Danzig (Gdańsk)
Kosemühl (Kozin)
Rathsdamnitz (Dębnica Kaszubska)
Starnitz (Starnice)
Kaschubei (Kaszubskie)
Am Kriener See
Stolpmünde (Ustka)
Mützenow (Możdżanowo)
Stolp (Słupsk)
Halbinsel Hela (Mierzeja Helska)
Rückfahrt
Pommern und Ostpreußen
Dieses Buch berichtet von einer Reise an Geburtsorte und spätere Aufenthaltsorte in Pommern und Ostpreußen, die heute in Polen liegen. Für meine Mitreisenden ist es die alte Heimat. Ich weiß mit dem Begriff Heimat nicht so recht umzugehen, weil ich nur zum Teil dort aufwuchs. Meine Geburtsurkunde wurde in Dębnica-Kaszubska in polnischer Sprache ausgestellt. Obwohl wir im täglichen Sprachgebrauch den Ort Rathsdamnitz nannten und nennen, hatte ich nie das Gefühl, in Deutschland geboren zu sein. Jedes Mal, wenn ich dorthin reiste, stiegen besondere Gefühle auf. Es müssen Heimatgefühle sein. Starnitz (Starnice) und Rathsdamnitz (Dębnica-Kaszubska) sind die Orte, an denen ich bis zum zehnten Lebensjahr aufwuchs. 1958 kamen wir als Aussiedler in die Bundesrepublik Deutschland.
Dies war meine fünfte Reise in die alte Heimat und bis nach Braunsberg (Braniewo) in Ostpreußen, kurz vor der russischen Grenze. Dort wurde meine Mutter geboren. Auch meine mitreisenden Verwandten Ulla, Hilde und Bruno erblickten dort das Licht der Welt, und machten sich 1945 von Braunsberg auf die Flucht vor der Roten Armee. Weiterhin reisten mit: Edith und Helmut aus Starnitz, Erich, der in Rathsdamnitz aufwuchs, Uschi aus Stolp (Słupsk), Egon, der waschechte Berliner aus Pommern und meine Schwester Brigitte, die auch in Starnitz geboren wurde. Insgesamt waren wir elf Personen.
Da wir Orte in Pommern und in Ostpreußen aufsuchen wollten, hatte ich ein Ferienhaus in der Kaschubei gemietet. Es lag für uns zentral. Von dort unternahmen wir unsere Ausflüge und schwelgten in Erinnerungen.
Gegen achtzehn Uhr erreichten wir am 15. Juni 2002 mit drei PKWs Kiełpino südlich von Kartuzy (Karthaus). Nach ein wenig Sucherei standen wir vor unserem Ferienhaus. Es war das größte und schönste Haus in der Straße mit einem gepflegten Vorgarten. Vom Eigentümer keine Spur. Freundliche Nachbarn halfen, ihn aufzuspüren.
Wir waren von der langen Fahrt ungeduldig und müde. Um acht Uhr begann unsere gemeinsame Reise bei Schillings in Libbenichen, nahe des Deutsch-Polnischen Grenzübergangs Kürstrin (Kostrzyn). Die Berliner waren drei Stunden früher aufgebrochen. Ich fuhr zwei Tage zuvor aus Oberschwaben los. Am Ende der Reise zeigte mein Autotacho über viertausend Kilometer mehr an.
Schließlich betraten wir die großzügigen, schönen Räume des Ferienhauses. Der freundliche Pächter aus Kartuzy sprach gutes Englisch und war emsig bemüht, fehlende Bettdecken und Stühle herbei zu schaffen. Doch er schien an Grenzen zu stoßen. Wir machten das Beste daraus und erlebten eine wunderbare und harmonische Woche in Polen, in der alten Heimat.
Braunsberg (Braniewo)
Gleich am Tag nach der Ankunft machten wir uns morgens auf die Fahrt nach Braunsberg (Braniewo). Der eingeteilte Küchendienst hatte an diesem Morgen, wie auch an den folgenden Tagen, ausgezeichnet funktioniert. (Bruno holte jeden Morgen frische Brötchen aus dem nahen Laden.) Wir waren gut gestärkt und bester Laune.
Bild 1 - Die Reisegruppe auf der Brücke über die Passarge in Braunsberg
Unsere Reiseroute führte durch Danzig. Da ich den Großstadtverkehr in und um Danzig kannte, vergatterte ich Egon und Bruno, die die beiden anderen Autos fuhren, mir ja dicht zu folgen. Sonst seien wir verloren. Denn der Verkehr sei genau so dicht und hektisch wie in Berlin oder München. Die Fahrt durch Danzig erwies sich dann jedoch weniger aufregend. Ich hatte übersehen, dass wir an einem Sonntagmorgen unterwegs waren. Außerdem gab es eine neue Umgehungsstraße. Gemütlich ließen wir Danzig mit den mehrspurigen Schnellstraßen hinter uns.
Bei mir kam noch einmal sehr lebhaft die Bekanntschaft mit der Danziger Polizei vor vier Jahren hoch. Damals war ich mit meiner Mutter, Hilde und Ulla durch Danzig gefahren. Der Verkehr war dicht und ich versuchte alle Hinweisschilder gleichzeitig zu lesen, um ja nicht die Ausfahrt zu verpassen. Auf einer riesigen Kreuzung war es dann geschehen. Zu spät sah ich, dass die zweite Ampel gerade auf rot umgeschaltet hatte. Es geschah nicht aus böser Absicht und es war nichts gefährliches passiert. Doch augenblicklich später heulte eine polnische Polizeisirene auf und ich sah im Rückspiegelden Streifenwagen aus der Querstraße schießen, uns folgend. Ein junger Polizist bat um meine Papiere. Er sprach deutsch, ich mochte es kaum glauben. Er sprach gutes Deutsch. Ich stieg aus und überlegte, wie es weiter gehen könnte, wenn er meinen Führerschein einzöge. Meine Mitreisenden hatten keinen Führerschein. Später erzählten sie mir, dass sie im Auto kalkuliert hätten, ob sie genügend Geld für die Strafe zusammen bekämen. Der junge Polizist belehrte mich sehr eindringlich auf deutsch, dass ich einen schweren Fehler gemacht hätte. Sein Kollege sagte etwas auf polnisch zu ihm. Er belehrte mich noch einmal. Dann gab er mir die Papiere zurück und wünschte uns eine gute Fahrt. Noch ehe ich es recht kapiert hatte, waren die beiden Polizisten mit ihrem Streifenwagen verschwunden. Nie und nimmer hatte ich damit gerechnet, nur eine mündliche Ermahnung zu erhalten.
Bild 2 - Ulla, Hilde und meine Mutter vor ihrer ehemaligen Schule in Braunsberg, die bis 1945 Adolf-Hitler-Schule genannt wurde.
Bild 3 - Hilde, meine Mutter und Ulla auf den Stufen zur ehemaligen Adolf-Hitler-Schule in Braunsberg
Bild 4 - Pfarrkirche zu Ehren der hl. Katharina von Alexandrien in Braunsberg
Bild 5 - Die wieder aufgebaute Pfarrkirche zu Ehren der hl. Katharina von Alexandrien in Braunsberg
Die Fahrt nach Braunsberg verlief problemlos. Nachdem wir an Elbing (Elbląg) vorbei waren, bogen wir auf die Autobahn Richtung Königsberg ab. Doch der Begriff Autobahn ist übertrieben. Das sollte es ja erst werden, damals, im Dritten Reich. Die Trasse für vier Fahrspuren ist noch deutlich sichtbar. Aber es sind nur zwei Fahrspuren ausgebaut, auf denen der Verkehr in beide Richtungen verläuft. Etwa neunzig Prozent der rechteckigen Betonplatten aus der Vorkriegszeit sind noch gut erhalten. Nur an wenigen Stellen musste ausgebessert werden.
Gegen Mittag erreichten wir Braunsberg und stellten die Autos auf dem großen Parkplatz neben der Pfarrkirche zu Ehren der hl. Katharina von Alexandrien (Bild 5 und 4) ab. Es war noch Gottesdienst, deshalb verschoben wir die Besichtigung und schauten uns die Stadt an.
Bruno verließ Braunsberg als Siebenjähriger und kam jetzt zum ersten Mal wieder in seine Geburtsstadt. Zunächst erkannte er nichts wieder. Erst später kamen einzelne Bilder hoch. Auch bei meiner Mutter, Hilde und Ulla, die alle in Braunsberg aufgewachsen sind, konnte ich dieses Phänomen beobachten. Braunsberg blieb bis Anfang 1945 vom Zweiten Weltkrieg verschont. Dann wurde dort aber um so heftiger gekämpft und die Stadt weitgehend zerstört. Wo einst Häuser standen, klaffen nun leere Flächen, oder es wurden neue Gebäude errichtet. Dadurch hat sich das Stadtbild wesentlich verändert. Als ich 1989 zum ersten Mal mit meiner Mutter in Braunsberg war, stiegen bei ihr als erstes die Erinnerungen an die Pfarrkirche (Bild 5) auf. Sie bedauerte, dass all die schönen Bilder innen verschwunden waren. Erst anschließend sahen wir die Dokumentation, aus der hervorging, dass auch die 600-jährige Pfarrkirche im Krieg völlig zerstört wurde. Eine Ecke des Turms ragte nach Kriegsende wie ein mahnender Finger gen Himmel. Lange Jahre wollte man die majestätische Ruine als Mahnmal für die Tragödie des Krieges stehen lassen. 1979 begann der Wiederaufbau, und seit 1982 finden wieder Gottesdienste statt.
Bruno erzählte mir später, dass es ihm sehr nahe gegangen sei, als die Kirchenglocken läuteten. Und am Braunsberger Bahnhof hätte er eine Gänsehaut bekommen. Denn dorthin hatte er seinen Vater begleitet und zum letzten Mal gesehen. Mit vielen anderen Landsern sei sein Vater eingestiegen und hätte mit der Feldflasche aus dem abfahrenden Zug gewunken. Wenige Monate später sei die Nachricht eingetroffen, dass sein Vater vermisst wurde. Niemand hat je wieder von ihm gehört.
Beim Stadtrundgang suchten wir die ehemalige Adolf-Hitler-Schule (Bild 2) auf. Sie scheint vom Krieg nichts abbekommen zu haben. Ulla, Hilde und meine Mutter gingen dort zur Schule (Bild 2 und Bild 3). Die Hindenburg-Schule, die Bruno besuchte, fanden wir nicht. Das Grundstück ist teils frei, teils von einem neuen Gebäude bedeckt.
Bild 6 - Der Pflaumengrund in Braunsberg
Am Pflaumengrund (Bild 6) musste meine Mutter noch einmal die Fenster zeigen, an denen die jungen Burschen des Gymnasiums (Bild 7) standen und zu ihr hinüber pfiffen, wenn sie sich am Fenster oder im Garten des gegenüberliegenden Hauses sehen ließ. Und es machte ihr offensichtlich Spaß, sich zu zeigen. Sie war ja auch ein hübsches Mädchen. Das Haus steht nicht mehr, in dem sie damals bei einem Studienrat als Hausmädchen diente.
Bild 7 - Das Gymnasium am Pflaumengrund in Braunsberg
Nachdem wir einen Blick auf den Bahnhof (Bild 8) geworfen hatten, ging es in die Bruno-Schafrinski-Str. Die Straße heißt jetzt: Ul. Władysława Jagiełły. Dort hatten die Marquardts und die Rauters mit elf Familienmitgliedern in Nr. 24 bis 1945 die linke Doppelhaushälfte bewohnt (Bild 9). Erst im letzten Moment, als Kanonendonner zu hören war und die Granaten in der Straße einschlugen, machte man sich von dort aus auf die Flucht über das zugefrorene Frische Haff.
Bild 8 - Der Bahnhof in Braunsberg
Der jetzige Hausbewohner kennt uns von früheren Besuchen. Er kam freundlich ans Gartentor und lud uns zum Kaffee ein. Gerne und unbekümmert zeigte er die Räume, in denen Bruno, Hilde, Ulla und Agatha (Bild 10) einst zu Hause waren. Besonders stolz war der Pole auf den Ausbau des Obergeschosses nach hinten. Bruno, der polnisch spricht, konnte sich gut mit ihm unterhalten.
Bild 9 - Das ehemalige Haus der Marquardts in Braunsberg
Wir waren mit elf Personen gekommen und elf Personen sollen in dieser kleinen Haushälfte gelebt haben? Mir wurde bewusst, dass man früher wohl etwas bescheidener lebte. Meine Mutter erzählt auch, dass die Kinder oben, wo Margarethe Rauter (meine Tante Grete) mit ihrer Familie wohnte, keinen Sitzplatz am Tisch hatten. Die Kinder aßen im Stehen, aus Platzmangel für Stühle. Joseph und Theresia Marquardt, meine Großeltern, hatten das Haus gebaut. Beide, wie fast alle Familienmitglieder, überstanden die Flucht bis Starnitz. Dort starb mein Großvater noch vor meiner Geburt an Magen- und Darmkrebs. Drei Wochen war die neunköpfige Gruppe zu Fuß von Braunsberg bis Stolp in Pommern unterwegs gewesen. Dort wurde sie von der russischen Armee überrollt und in Starnitz einquartiert:
Bild 10 - Bruno, Ulla, Hilde und meine Mutter mit dem jetzigen polnischen Hauseigentümer (rechts) vor jenem Haus in Braunsberg, aus dem sie 1945 flüchteten
Joseph und Theseria Marquardt
Margarete Rauter mit ihren vier Kindern Ursula, Hilde, Alfred und Bruno
Agatha Marquardt (meine Mutter) und
Anton Rauter aus Kl. Rautenberg
Bild 11 - Bruno erinnerte sich am Bahnhof der Haffufer-Bahn: „Ja, da drüben war das mit dem Säbel...“
Nach einem freundschaftlichen Abschied vom polnischen Bewohner (Bild 10) verließen wir das Haus, den ehemaligen Besitz der Marquardts in Braunsberg, und fuhren zum kleinen Bahnhof der Haffufer-Bahn ganz in der Nähe. Von diesem Bahnhof trat die Familie so manchen Ausflug an. Wahrscheinlich waren es nur zwei oder drei Fahrten. Denn die einfachen Leute reisten damals nicht so oft. Doch als ich die Braunsberger so reden hörte, gewann ich den Eindruck, sie wären jedes Wochenende unterwegs gewesen.
Bruno erinnerte sich am Bahnhof (Bild 11) an die Geschichte mit dem Säbel. „Ja, da drüben war das...“ Als kleiner Junge hatte er mit seinem Bruder Alfred in einem trockenen Brunnenschacht einen Säbel entdeckt. Den konnte man natürlich nicht liegen lassen. Braunsberg war eine Garnisonsstadt mit zwei großen Kasernen. Mein Großvater, Joseph Marquardt, arbeitete in der Kleiderkammer der Artilleriekaserne.
Der Schacht mit dem Säbel war offenbar nicht sehr tief. Bruno ließ den ein Jahr älteren Alfred hinunter, ein Kinderspiel. Aber die Kalkulation ging nicht auf. Bruno konnte Alfreds Hände nicht mehr erreichen, um ihn wieder herauf zu ziehen. Deshalb saß der kleine Alfred im Schacht fest. Beide wussten nichts besseres, als den Großvater um Hilfe zu holen. Mit Großvater und einem Strick kehrte Bruno zum Brunnen zurück. Nachdem der Großvater Alfred herausgezogen hatte, kam das dicke Ende. Er verwendete den selben hilfreichen Strick, um die beiden Lorbasse zu vertrimmen.
Bild 12 - Am Hafen von Frauenburg mit der Kathedrale im Hintergrund
Lorbass, welch ein schönes Wort. Aus der deutschen Umgangssprache ist es fast gänzlich verschwunden. Mei