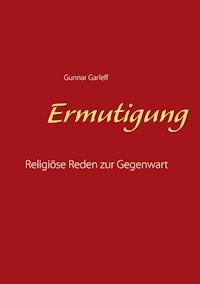
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die in diesem Buch versammelten religiösen Reden sind sonntägliche Gegenreden gegen die mediale Überflutung mit dem Immerschlimmerismus und dem zunehmenden Radikalismus unserer Zeit. Sie sind Ermutigungen, die Schönheit und die Freude des Lebens auch in Zeiten wie diesen nicht zu verlieren und sich immer wieder neu zu vergewissern, dass Gott diese Freude vor allem Anfang in uns hineingelegt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vergewisserung und Bewältigung (Vorwort)
Zwang zum Update
Up(to)date im Angesicht des Kreuzes
Kein Profilbild
Dazugehören?
Kraft zum Menschsein
Mehr Stille wagen
Gnade und Zweifel eines Vaters
Scharfes Wort
Entfremdet und geliebt
Prophetische Rede als Hoffnung
Es könnte so einfach sein
Ökonomische Kehrtwende
Gut sein ist Sein im Zusammensein
Resilienzoption
Vom Umgang mit dem Scheitern
Vergebung und Mitmenschlichkeit
Ich werde für euch da sein
Leben gegen den Immerschlimmerismus
Vergewisserung und Bewältigung (Vorwort)
Wie politisch darf die Predigt sein? Diese Frage wird immer wieder gestellt und findet entsprechend Widerhall in der öffentlichen Debatte. Zum Jahreswechsel 2017/2018 löste der Chefredakteur der Zeitung „Die Welt“ mit einem Tweet eine entsprechende Debatte aus. Ulf Poschardt hatte am Heiligabend die Predigt des Pfarrers und Poltikers Steffen Reiche gehört, in der sich dieser kritisch u.a. mit der Politik Donald Trumps auseinandersetzte. Freilich war die Kritik Poschardts – dem Twitterzeitalter geschuldet – 140 Zeichen lang und generalisierend: „Wer soll eigentlich noch freiwillig in eine Christmette gehen, wenn er am Ende der Predigt denkt, er hat einen Abend bei den #Jusos bzw. der Grünen Jugend verbracht?“1
Ohne auf die Diskussion dieser konkreten Predigt eingehen zu wollen und auch ohne grundsätzlich das Feld Kirche und Politik bearbeiten zu wollen, gibt diese Frage Anlass, die Intention von Predigten zu reflektieren. In einem Interview mit der Zeitung „Die Zeit“ erklärte Ulf Poschardt seine Kritik. Ihm gehe es nicht um eine entpolitisierte, rein geistlich-spirituelle Predigt, er kritisiere vielmehr eine festzustellende Sprache, die sich mehr dem politischen Jargon anpasse, als sich am religiösen Bedürfnis der Menschen zu orientieren. „Es geht mir um Sprache und Formulierungen. Das Sprachspiel auf der Kanzel darf nicht das eines Parteitages sein.“2 Zur Diskussion steht also nicht die politische Dimension des Evangeliums, sondern vielmehr die Aufgabe kirchlicher Verkündigung im Medienzeitalter. Warum heute predigen? Warum heute Orientierung aus der Bibel suchen?
Eine Annäherung an mögliche Antworten führt unweigerlich in die Tiefen der religiösen Frage überhaupt. Wenn die Funktion der Religion so etwas wie Kontingenzbewältigung ist und Religionen kulturelle Zeichensysteme sind, die „Lebensgewinn in Entsprechung zu einer letzten Wirklichkeit“ verheißen3, dann sind die religiösen Zeichen und Rituale auf die jeweilige Situation des Menschen in seinen sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhängen bezogen. Es geht in der Religion immer zugleich um die Gestaltung und Deutung der Gottesbeziehung wie auch der Weltbeziehung.
Bezogen auf die Funktion der Predigt bedeutet dies, dass sie bei der Welterfahrung bzw. der Lebenswelt ansetzt. Zur Aufgabe der Predigt als religiöser Rede gehört es, die Lebenserfahrung ihrer Hörerinnen und Hörer mit der religiösen Tradition und Überlieferung in Beziehung zu setzen. Sie bleibt dabei nicht auf einer weltimmanenten Ebene stehen, sondern bringt eine transzendentale, eine theologische Dimension ins Spiel. Die Aufgabe der Predigt ist dabei eine zweifache: Sie macht ein Deutungsangebot der menschlichen Situation, welche immer eingebunden ist in eine soziale, politische Situation. Zugleich eröffnet sie ein Sinnangebot, in dem sie, vermittelt über den biblischen Text und die Lehrtradition ihrer Glaubensgemeinschaft, die gegenwärtigen menschlichen Kontingenzerfahrungen mit den überlieferten religiösen (in diesem Sinn auf Gott bezogenen) Kontingenzbewältigungen in Beziehung setzt. In dieser doppelten Bezogenheit auf Gegenwart und Tradition will die Predigt zur Stärkung der Gottes- und der Weltbeziehung des Einzelnen wie auch der Gemeinschaft beitragen.
In diesem Sinne setzen die hier zusammengestellten Predigten als religiöse Reden4 mit aktuellen Fragen der Lebenswelt ein. Die meisten Predigten sind seit 2016 entstanden, so dass das die gesellschaftliche Diskussion beherrschende Thema der Flüchtlingsmigration immer wieder aufgegriffen wird. Aber ebenso werden Fragen des individuellen Anpassungsdrucks in Schule und Gesellschaft, die Frage der Zugehörigkeit und der Bedeutung von Gemeinschaft, jene der Gesundheit und des gegenwärtigen gesellschaftlichen Skandalismus und Alarmismus aufgegriffen. Wenn religiöse Reden diese Themen aufgreifen, dann ist ihr Ziel nicht, eine gründliche soziologische Analyse vorzulegen, sondern die darin enthaltene Lebens- und Sinnfrage zu stellen.
Zugleich sind die religiösen Reden auf biblische Texte bezogen. Die Auswahl der Schriftstellen orientiert sich dabei an der evangelischen Perikopenordnung. Diese sich am Kirchenjahr und nicht an der gesellschaftlichen Frage orientierende Textauswahl hat für die je aktuelle religiöse Rede den Vorteil, dass sie den Text als fremden Gast ernst nimmt, der in eine geschichtliche Situation quasi von außen hineinfällt. Es bewahrt die Predigtpraxis davor, stets nur die dem Prediger eigenen Lieblingsthemen und -thesen zu variieren. Der biblische Text als fremder Gast öffnet vielmehr die gegenwärtige Weltwahrnehmung für eine vergangene und eine religiöse Wahrnehmung; er weitet den Wahrnehmungshorizont der Predigt.5
Wer den biblischen Text als fremden Gast ernst nimmt, der sieht in ihm nicht den vertrauten Freund oder alten Bekannten, dessen stereotype Antworten immer schon erwartbar sind. Biblische Texte kommen aus einer fremden, vergangenen Zeit; ihre Sprache ist nicht die heutige. Sie sind nach meinem Verständnis nicht vom Himmel gefallen, sondern Deutungs- und Sinnangebote zur Kontingenzbewältigung ihrer Zeit. Eine historisch-kritische Exegese ist für mich daher unabdingbar. Sie geschieht aber nicht, um den religiösen Gehalt in Frage zu stellen oder gar zu relativieren, sondern um die Texte für die Erfahrungen von heute zu öffnen. Wer einem Fremden offen begegnet, will mehr über ihn wissen und gibt zugleich etwas von der eigenen Geschichte in den Dialog ein. In diesem Dialog zwischen der Zeit des Textes (bzw. seiner Entstehung) und der Zeit der Interpretation (in diesem Sinne der Predigtvorbereitung) entsteht die gemeinsame Basis für den Erfahrungsaustausch. Tradition wird lebendig, wenn sie nicht nur rituell am Leben gehalten wird, sondern wenn sie eine existentielle, eine emotionale Wirkung entfaltet.
Es ist das Faszinierende der biblischen Geschichten, dass in ihnen Menschen Erfahrungen verarbeiten, die unseren heutigen ähnlich sind, auch wenn die historischen Rahmenbedingungen der Antike gänzlich unterschieden sind von denen des Technologie- und Medienzeitalters. Aber die biblischen Autoren haben ihre Kontingenzerfahrungen in Geschichten und Liedern in Rückbindung an die Gotteserfahrung verarbeitet.
Predigten als religiöse Reden legen immer auch Zeugnis ab vom Glauben und von der Ethik des Predigers. Gewiss ist die Kanzel kein Ort für Parteitagsreden, aber sie ist auch kein unparteiischer Ort jenseits des gesellschaftlichen Diskurses. Einer der in diesem Band abgedruckten Reden wurde vor einiger Zeit von einem Hobby-Historiker der Vorwurf gemacht, dass sie erstmals seit dem zweiten Weltkrieg von der Handschuhsheimer Kanzel Regierungshandeln rechtfertige und christlich legitimiere. Zu Recht wird auf dem Hintergrund der Erfahrungen des ersten und zweiten Weltkrieges derartiges kritisiert. In Predigten geht es nicht darum, das Handeln der Mächtigen religiös zu legitimieren oder gar zu überhöhen. Aber ebenso wenig ist die Kanzel der Ort einer Totalopposition. In der kritisierten Predigt geht es auch gar nicht um die Entscheidungen der Regierung, sondern vielmehr um die Verrohung der Sprache im politischen Diskurs und die Frage, welche impliziten Handlungsmodelle eigentlich im biblischen Zeugnis zur Lösung komplexer gesellschaftlicher Themen zu entdecken sind. Können diese etwas zum Umgang mit dem Fremden und der Flüchtlingsaufnahme in Europa und besonders vor Ort beitragen?
Politische Entscheidungen haben meist den Horizont eines ganzen Landes oder Kontinents im Blick. Religiöse Reden sind dagegen – mit Ausnahme einiger Bischofspredigten an Feiertagen – Reden an eine örtliche Gemeinde. Ihre Reichweite ist die Nachbarschaft, der Sozialraum ihrer Hörer und Hörerinnen. Von der Kanzel herab ist das Rentenproblem nicht zu lösen, aber der Umgang mit den älter werdenden Menschen in der Gemeinde anzusprechen. Von der Kanzel kann die Flüchtlingspolitik nicht zum Ziel geführt werden, aber es lassen sich Impulse setzen für den Umgang mit Geflüchteten in der Stadt, in der Nachbarschaft. Aufgrund einer Predigt von einer Kanzel wird kein Präsident seine Politik, seine Rhetorik, seine Tweets ändern, aber jene, welche die Predigt hören, können ermutigt und geistlich erbaut werden, gegen diese radikalisierte Sprache des Hasses im Kleinen, im Lokalen eine Sprache der Liebe zu setzen.
In diesem Sinne sind die in diesem Buch versammelten religiösen Reden vielleicht auch so etwas wie eine sonntägliche Gegenrede gegen die mediale Überflutung mit dem Immerschlimmerismus (Matthias Horx) und dem zunehmenden Radikalismus unserer Zeit. Ich verstehe sie als Ermutigungen, die Schönheit und die Freude des Lebens auch in Zeiten wie diesen nicht zu verlieren und sich immer wieder neu zu vergewissern, dass Gott diese Freude vor allem Anfang in uns hineingelegt hat.
Gunnar Garleff
1https://twitter.com/ulfposh/status/945078664445792256 (abgerufen am 6.4.2018).
2https://www.zeit.de/2018/02/ulf-poschardt-christmette-politik-kritik-tweet (abgerufen am 31.5.2018)
3 Vgl. Gerd Theißen, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie der urchristlichen Religion, Gütersloh 22001, S. 19: „Religion ist ein kulturelles Zeichensystem, das Lebensgewinn durch Entsprechung zu einer letzten Wirklichkeit verheißt.“
4 Vgl. zur Definition der Predigt als religiöser Rede W. Gräb, Predigtlehre. Über religiöse Rede, Göttingen 2013.
5 Vgl. dazu Gunnar Garleff, Spurensuche. Mit Fragen unserer Zeit der Bibel begegnen, Saarbrücken 2014, S. 3-10.
Zwang zum Update6
7:30 Uhr am Morgen: Die LED-Leuchte am Handy leuchtet. Das Display zeigt schon am frühen Morgen die ersten Nachrichten an. Ein paar Mails – wer schreibt die eigentlich mitten in der Nacht? Und dann – täglich grüßt der Updateserver – der Hinweis: Folgende Updates liegen vor.
Ich wische es weg – zack. Die Programme, die da genannt werden, kenne ich auch gar nicht, nutze sie gar nicht wissentlich. Und trotzdem sagt mir die Meldung schon am frühen Morgen, quasi nach dem Aufwachen: Du musst updaten. Aufwachen und updaten.
Wenn ich dann ins Büro komme, begrüßt mich der PC mit der Meldung: Jetzt updaten auf Windows 10.
Weiter geht es analog: Die Post bringt die neuesten Gesetze und Verordnungen mit einem dicken Postpaket – als sei Weihnachten.
Am Nachmittag finde ich mich wieder in einer Fortbildung mit dem Titel „Der Neue Bildungsplan“ und höre die Aufgabe: Update für den Religionsunterricht – jetzt bitte Aneignungsdidaktik statt Vermittlungsdidaktik und bitte alles schön differenziert auf verschiedenen Lernniveaus und Kompetenz fördernd. – Du musst updaten. Das ist der Zwang zum Update.
Weil das mit dem Zwang zum Update immer schleuniger geht, gibt es auf der anderen Seite die Entschleuniger mit immer neuen Updates zur Burn-Out-Prophylaxe. Man kommt kaum noch nach. Was für ein Irrsinn!
Der Zwang zum Update wurde mir allerdings vollends deutlich, als meine Tochter ihr Zeugnis nach Hause brachte und stöhnte: „Morgen schreiben wir Englisch und übermorgen Latein.“ Erinnerungen idealisieren ja manchmal, aber ich bilde mir ein, dass es in meiner Schulzeit zwischen Zeugnis und der nächsten Arbeit eine gewisse Phase der Regeneration gab. Heute aber gilt es immer und überall wachsam zu sein, denn ständiges Updaten heißt auch ständig bereit sein für Neues, aktualisieren.
Um up to date zu sein, richten wir die Termine nach Germanys Next Top Model, Rote Rosen und GZSZ aus, gibt es Pushnachrichten für Apps aller Art, läuft das Radio den ganzen Tag, aktualisieren wir ständig unsere Strategien in allen Lebenslagen und lassen wir PC, TV und CD-Player immer auf Standby. Bloß nichts verpassen, bloß nicht rasten, sonst ist sie weg, die Anschlussmöglichkeit im Leben. Was gestern noch galt, kann heute schon überholt sein.
In mir regt sich müder Widerstand. Geht das eigentlich? Wollen wir uns ständig erneuern, verändern, updaten? Und ich stelle mir selbstkritisch die Frage, wie viel Update brauche ich eigentlich? Ist es nicht einfach auch mal schön, zu sein, gegenwärtig, gelassen, im Raum sein. Und fertig. Sehnsucht nach Ruhe und einem updatefreien Raum?
„der den Himmel durchschritten hat“
Letztlich dient ja auch der Gottesdienst in gewisser Weise dem Update. Zwischen Bußgebet und Abendmahl geht es um nicht weniger als um eine Erneuerung, um eine Reaktualisierung der Gottesbeziehung.
Auf dem Hintergrund des Zwangs zum Update und mit einer gewissen Sehnsucht nach verheißener Ruhe lese und höre ich den Predigttext aus dem Hebräerbrief, im 4. Kapitel:
Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.
Hebräer 4,14-16
Die Empfänger damals brauchen ein Update des Christusbekenntnisses und sie brauchten auch eine Erinnerung an die Öffnung des Himmels. Welche Bedeutung hat der Glaube, wenn auf Erden sich nichts ändert?
Was bringt es, an Christus zu glauben, wenn du in deinem alltäglichen Leben ständig von Ansprüchen, Leistungsforderungen, Klassenarbeiten und Updatezwängen getrieben bist, wenn es kein „genug“ mehr gibt und kaum mehr Pause? Wenn ständig neueste Nachrichten und Eilmeldungen auf dich einprasseln?
Wo ist der verheißene Himmel, der die Erde küsst? Wo ist die verheißene Ruhe für die Seele?
Der Hohepriester, an den unser unbekannter Autor erinnert, hat die Aufgabe, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Er hat Zugang zum Allerheiligsten. Er ist in gewisser Weise Anwalt der Menschen, vor allem aber ist er als Priester zuständig, Gott das Opfer darzubringen, damit die Beziehung Gottes zu den Menschen up to date bleibt und vor allem, dass diese Beziehung ins Lot kommt.
Der Hohepriester tut dies, indem er für die Menschen am Versöhnungstag opfert. Er tut seinen Dienst – das Opfer stellt alles wieder her, aber es ist in dieser alttestamentlich tradierten Form in gewisser Weise ein Instrument, ein ritueller Gegenstand, der mechanisch empathiefrei Gott dargebracht wird.
Unser ständiger Zwang zum Update ist ja auch weitgehend empathiefrei. Wir drücken auf eine Taste, wischen übers Display, wir funktionieren und lernen, damit alles im Lot bleibt. Gegen diesen ermüdenden Automatismus und gegen diesen Trott schreibt der Hebräerbrief: „Wir haben einen großen Hohenpriester, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis.“
Der Hohepriester Jesus Christus hat die Grenze zwischen Himmel und Erde aufgehoben. Er hat den Himmel durchschritten. Der Hohepriester Christus ist kein Heiliger, der fernab der Erde wirkt und keiner, der hinter dem Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel opfert, sondern dieser Hohepriester kennt das Leiden, er kennt das Leben. Jesus leidet mit unserer Schwachheit, er leidet selbst an dem unruhigen Getriebensein, in dem wir stecken.
Jesus hat den Himmel geöffnet, durch ihn haben wir einen mitleidenden Gott, einen Gott, der nicht ruhig gestellt werden muss durch Opfer und Rituale, sondern einen Gott, der unser Leben weitet und Raum schenkt.
Denn das finde ich jenseits des Hebräerbriefes in den Jesusgeschichten immer wieder spannend: Die Evangelien erzählen in gewisser Weise auch von einem getriebenen Jesus. Die Menschen erwarten von ihm allerhand: Hier ein Wunder. Dort ein Gleichnis. Hier eine Antwort auf eine prüfende Frage. Dort die Sättigung von 5000 Hungrigen.
Jesus kennt die Situation des Updates und zugleich hat er sie ein für alle Mal überwunden. Am Kreuz hat er durch sein Opfer die Updateautomatik aufgehoben. Aus dieser Beziehung heraus, im Leiden, öffnet er den Himmel für uns Menschen. Jesus öffnet für dich den Himmel, aber wie können wir den Himmel in uns aufnehmen, ihn wirken lassen? Der Himmel bleibt offen.
Ruhe-Raum
Aus dem geöffneten Himmel wendet er sich dir zu. Gott wendet sich dir zu, weil er deine Schwäche, deine Not, deinen Stress sieht. Und er lädt dich ein, vor seinen Thron der Gnade zu treten.
„Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.“
Mitten im Updatezwang schenkt er dir einen Raum der Ruhe. Ist es nicht genau das, was viele von uns suchen? Einen Raum der Ruhe, wo ich einmal Pause habe vom Lernen, vom Lärmen, von Ansprüchen, von der Wachheit, immer up to date zu sein. Dieser Raum kann ganz verschieden sein. Für viele von euch Konfirmanden ist es vielleicht das eigene Zimmer, wo man mal die Tür zumachen kann. Für manche ist es einfach der Wald, das Feld, der Garten.
Für mich ist es immer wieder die Kirche. Dieser Raum mit seiner hellen Schlichtheit. Mit seinem Klang und seiner Musik, mit seiner Stille. Kirchen sollten häufiger offen sein, denn sie atmen doch irgendwie die Geschichten, die in ihnen erzählt werden. Die Geschichten, in denen der Himmel geöffnet wird und Gott nah kommt.
Ein Raum der Ruhe - für mich ist es auch ein Gottesdienst wie dieser: Du kannst kommen, einfach da sein, Atem holen, dich niederlassen. Wenn du magst, dann kannst du zuhören, was da erzählt wird, kannst eintauchen in Worte und Gedanken oder lässt einfach die Gedanken baumeln. Du darfst dich fallen lassen in die offenen Arme Gottes und vor seinen Gnadenthron treten und glauben: Gott kennt mein Leben mit Freude und Not. Oder um es mit Hape Kerkeling zu sagen: „Der Schöpfer wirft uns in die Luft, um uns am Ende wieder einzufangen. … Und die Botschaft lautet: Hab Vertrauen in den, der dich wirft, denn er liebt dich und wird vollkommen unerwartet auch der Fänger sein.“7
Darum tritt hinzu mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, lass dir Ruhe und Kraft schenken, Barmherzigkeit und Lebensspeise! Komm wie du bist, ob auf dem neuesten Stand oder schon „upgedatet“! Für Gott ist das egal. Der Himmel ist geöffnet für dich – ganz gegenwärtig – mit allem, was du bist.
6 Predigt am Sonntag Invokavit, 14.2.2016 in der Friedenskirche in Handschuhsheim zu Hebr. 4.14-16..
7 Hape Kerkeling, Ich bin dann mal weg, 2009, S. 345
Up(to)date im Angesicht des Kreuzes8
Auf der Suche nach Identität
Jeden Morgen steht sie vor dem Spiegel, schaut sich an. Kleiderprobe – T-shirt rot oder blau? Jeans oder Rock? Die Haare geflochten oder offen? Das richtige Make Up?
Und er geht durch die Hauptstraße: Was ist in und was ist out? Bin ich noch up to date mit meinen Interessen? Habe ich das richtige Smartphone? Die coole Cappie? Die richtigen Moves?
Es ist nicht immer leicht, Ich zu sein, aber vielleicht kommt es darauf auch gar nicht an. Hauptsache man gehört dazu, hat die richtigen Insignien der Gruppe, den richtigen Slang, die richtige Religion, die richtigen Freunde, die richtige Hautfarbe. Dabei sein, dazu gehören – das ist nicht unwichtig. Der Mensch ist ein soziales Wesen.
Doch damit nicht genug. Wichtig ist: die Gruppe muss stimmen, angesagt sein. Es muss nach außen strahlen: der richtige Verein, der richtige Stadtteil, die richtige Gang. Wer dazu gehört, der hat die Chance auf Macht und Einfluss. Irgendwie. Wer will schon gerne in der Schule abseits stehen oder mit den Außenseitern zusammen sein.
Und so sind wir beständig damit beschäftigt, uns selbst zu optimieren, gut da zu stehen, jede Peinlichkeit zu vermeiden und diskret unsere Scham zu unterdrücken. Unsere Kinder erziehen wir zum Erfolg in der Gesellschaft, damit sie es zu etwas bringen. Für das Glück müssen wir funktionieren. Möglichst wenig Pausen, viel Schaffen, gut in der Schule sein. Hier ein Pöstchen, da ein Ämtchen. Dann können wir erzählen, was wir alle tun und unsere Kinder erst, grandios.
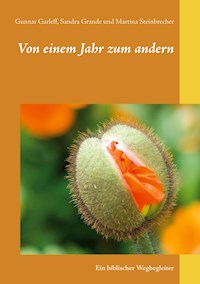













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














