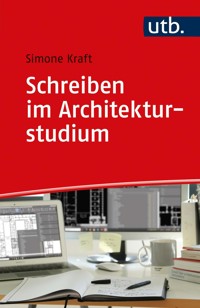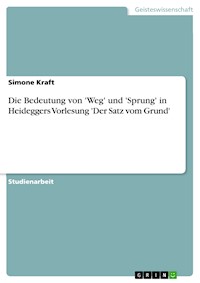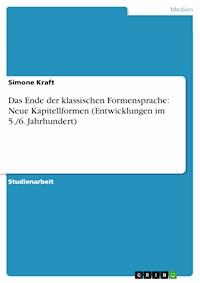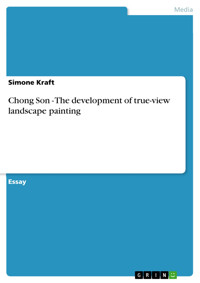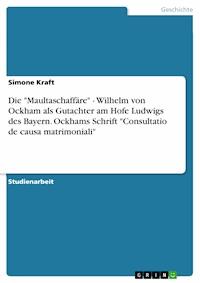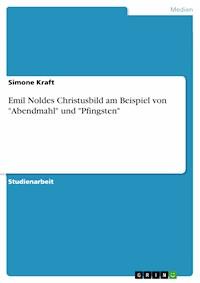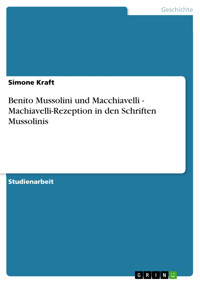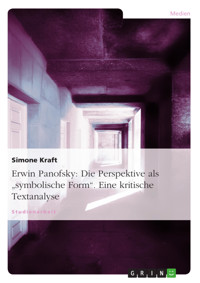
Erwin Panofsky: Die Perspektive als „symbolische Form“. Eine kritische Textanalyse E-Book
Simone Kraft
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Kunst - Allgemeines, Kunsttheorie, Note: 1,0, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Kunsthistorisches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: „Die Perspektive als ‚symbolische Form’", einer der bedeutendsten Texte Erwin Panofskys und eine der grundlegenden Schriften der Kunstgeschichte, ist keine leicht zugängliche und widerspruchsfreie Schrift. Zwar ist der Text in der Forschung viel diskutiert worden, dennoch fehlt oft die direkte Auseinandersetzung mit dem Geschriebenen. Bezeichnenderweise wird „Die Perspektive als ‚symbolische Form’“ erst Anfang der 90er Jahre ins Englische übersetzt, obwohl Panofsky seit 1933 in den Vereinigten Staaten lehrte. Kollege und Freund Panofskys ist der Philosoph Ernst Cassirer. Erwähnenswert wird diese Gelehrtenfreundschaft durch Cassirers Hauptwerk „Philosophie der symbolischen Formen“ in drei Bänden – ein neuartiger Denkansatz zur damaligen Zeit, der allerdings schon bald in Vergessenheit geraten ist, obwohl er in die Richtung der modernen Semiotik weist. Auf Cassirer geht die Prägung des Begriffs der „symbolischen Form“ zurück, auf den sich Panofsky direkt bezieht. In diesem Text hat, so scheint es, Panofskys ganze humanistische Bildung Ausdruck gefunden. Der beeindruckende Fußnotenapparat, der für die Druckfassung eingearbeitet worden ist und großteils Anmerkungen zum aktuellen Forschungsstand der jeweiligen Bereiche umfasst, übertrifft an Volumen nahezu den Haupttext. Allein die Anmerkungen bieten eine Fülle von Ansätzen, die zu erörtern schon ein ergiebiges Unterfangen bilden würde. Der Text selbst behandelt im wesentlichen zwei Problemkreise, die zunächst wenig miteinander zu tun zu haben scheinen – ein Sachverhalt, der nicht zuletzt zu den Verständnisschwierigkeiten der Schrift beiträgt. Zum einen wird die Theorie einer möglichen antiken Perspektive entwickelt, zum anderen formuliert der Autor seine These der Perspektive als „symbolischer Form“. Die vorliegende Arbeit versucht, den Text zu strukturieren, die wichtigsten Ansätze herauszuarbeiten und eine analytische Besprechung zu leisten. Dabei wird bewusst auf eine Berücksichtigung der Fußnoten weitgehend verzichtet, da sie eine Fülle von Zusatzinformationen liefern, die für die hauptsächlichen Ideen allerdings weniger wichtig sind. Es soll auch versucht werden, die beiden genannten, voneinander zunächst unabhängig erscheinende Problemkreise in einen möglichen Bezug zu stellen und Panofskys Gedankengang nachzuvollziehen. Insgesamt soll der Text soweit wie möglich für sich sprechen, um so die grundlegenden Ideen aber auch Kritikpunkte zu erarbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1.1) Einleitung
1.2) Formaler Aufbau des Texts und Vorgehensweise der Textanalyse
2) Entwicklung und Bedeutung der Perspektive in der
abendländischen Kunst
2.1) Begriffserklärungen
2.1.1) Begriffsklärung 1: „Perspektive“
2.1.2) Begriffsklärung 2: „Symbolische Form“
Cassirers Terminus’ und Panofskys Verständnis
2.2) Entwicklung der abendländischen Raumdarstellung
bis zur Zentralperspektive (Kapitel III)
2.2.1) Von der Spätantike bis zum Mittelalter
2.2.2) Vom Mittelalter bis zur Renaissance
2.3) Auswirkungen der Zentralperspektive (Kapitel IV)
2.4) Problematik der „Wirklichkeitsabbildung“ der Perspektive (Kapitel I+II)
3) Zusammenfassung
4) Literaturverzeichnis
5) Abbildungen
1) Einleitung
„Die Perspektive als ‚symbolische Form’", einer der bedeutendsten Texte Erwin Panofskys und eine der grundlegenden Schriften der Kunstgeschichte[1], ist keine leicht zugängliche und wiederspruchsfreie Schrift. Zwar ist der Text in der Forschung viel diskutiert, dennoch oder gerade deswegen, fehlt oft die direkte Auseinandersetzung mit dem Geschriebenen. Bezeichnenderweise wird „Die Perspektive als ‚symbolische Form’“ erst Anfang der 90er Jahre ins Englische übersetzt, obwohl Panofsky seit 1933 in den Vereinigten Staaten lehrte und auch als bedeutender Kunsthistoriker galt.[2] Bis zu seiner Emigration arbeitete Panofsky, von dem noch immer keine angemessene Biografie vorhanden ist[3], seit 1921 an der neugegründeten Universität Hamburg, zunächst als Privatdozent, später als Professor für Kunstgeschichte. In Hamburg trägt er auch erstmals „Die Perspektive als ‚symbolische Form’“[4] in der Vortragsreihe 1924/25 der Bibliothek Warburg vor. Zwei Jahre später wird der Text von dem damaligen Leiter der Bibliothek, Fritz Saxl, in der Schriftenreihe „Vorträge der Bibliothek Warburg 1924-1925“[5] herausgegeben. Kollege und Freund in Hamburg ist der Philosoph Ernst Cassirer, auch er ein begeisterter Nutzer der kulturhistorisch ausgerichteten Warburg-Bibliothek. Erwähnenswert wird diese Gelehrtenfreundschaft durch Cassirers Hauptwerk „Philosophie der symbolischen Formen“ in drei Bänden[6] – ein neuartiger Denkansatz zur damaligen Zeit, der allerdings schon bald in Vergessenheit geraten ist, obwohl er in die Richtung der modernen Semiotik weist.[7] Auf Cassirer geht die Prägung des Begriffs der „symbolischen Form“ zurück, auf den sich Panofsky direkt bezieht.
In diesem Text hat, so scheint es, Panofskys ganze humanistische Bildung Ausdruck gefunden. Der beeindruckende Fußnotenapparat, der für die Druckfassung eingearbeitet worden ist und großteils Anmerkungen zum aktuellen Forschungsstand der jeweiligen Bereiche umfasst, übertrifft an Volumen nahezu den Haupttext.[8] Allein die Anmerkungen bieten eine Fülle von Ansätzen, die zu erörtern schon ein ergiebiges Unterfangen bilden würde. Der Text selbst behandelt im wesentlichen zwei Problemkreise, die zunächst wenig miteinander zu tun zu haben scheinen – ein Sachverhalt, der nicht zuletzt zur den Verständnisschwierigkeiten der Panofskyschen Schrift beiträgt. Zum einen wird die Theorie einer möglichen antiken Perspektive entwickelt, zum anderen formuliert der Autor seine (grundlegende) These der Perspektive als „symbolischer Form“.
Die vorliegende Arbeit versucht, den Text zu strukturieren und die wichtigsten Ansätze herauszuarbeiten und eine analytische Besprechung zu leisten. Dabei wird bewusst auf eine Berücksichtigung der Fußnoten weitgehend verzichtet, da sie eine Fülle von Zusatzinformationen liefern, die für die hauptsächlichen Ideen allerdings weniger wichtig sind.[9] Es soll auch versucht werden, die beiden genannten, voneinander zunächst unabhängigen erscheinenden Problemkreise in einen möglichen Bezug zu stellen und Panofskys Gedankengang nachzuvollziehen. Insgesamt soll der Text soweit wie möglich für sich sprechen, um so die grundlegenden Ideen aber auch Kritikpunkte zu erarbeiten.
1.1) Formaler Aufbau des Texts und Vorgehensweise der Textanalyse
Der Text umfasst in der aktuellsten Edition der Ausgabe von Michels und Warnke „Deutschsprachige Aufsätze II“ , die auch Vorlage dieser Arbeit ist, fast 100 Seiten, die in vier Kapitel gegliedert sind. Ein sehr großer Teil davon entfällt, wie schon erwähnt, auf Fußnoten. Ziel und Systematik seiner Schrift erläutert Panofsky im Text selbst nicht näher, der Hörer bzw. Leser wird nicht durch den Vortrag geleitet. Besonders ein Zuhörer braucht jedoch einen „roten Faden“, um konzentriert folgen zu können. Zudem setzt Panofsky ein umfassendes humanistisches Grundwissen voraus.
„Die Perspektive als ‚symbolische Form’“ behandelt in den ersten beiden Kapiteln die Probleme der Zentralperspektive, die sich aus der Konstruktionsmethode ergeben, und die Frage nach der „Sehwirklichkeit“. Daran anschließend wird die antike Raumdarstellung besprochen, um einen neuen Interpretationsansatz einer möglichen konstruierten Perspektive im Altertum zu entwickeln. Dieser stützt sich auf mittlerweile nicht mehr vertretene Grundlagen der Wahrnehmungspsychologie der 20er Jahre[10] und wird daher in dieser Arbeit nicht eingehend diskutiert werden. Der Schwerpunkt wird die Besprechung der Hauptthese Panofskys zur „Perspektive als ‚symbolischer Form’“ sein, die eigentlich erst in den letzten beiden Kapiteln behandelt wird: Auf Beobachtungen zur Entwicklung der Perspektive seit der Spätantike bis hin zur Entstehung der zentralperspektivischen Konstruktion in der Renaissance (Kap. III) folgen hier Überlegungen zu den Auswirkungen der Mathematisierung der Raumdarstellung.
Diese Arbeit wird „Die Perspektive als ‚symbolische Form’“ inhaltsorientiert besprechen und sich nach den drei großen Themenkomplexen Entwicklungsgeschichte, Auswirkungen und Probleme der (Zentral)Perspektive gliedern. Da nicht chronologisch vorgegangen wird, werden nacheinander Kapitel III, Kapitel IV und schließlich Kapitel I+II vorgestellt. Insbesondere Kapitel III und IV, in denen mit der Entwicklungsgeschichte und der Bedeutung der Perspektive Panofskys grundlegende These entfaltet wird, soll eingehend bearbeitet werden, um die Argumentationsweise des Autors beobachten und damit feststellen zu können, was sein Ansatz zu leisten vermag, aber auch welche Schwierigkeiten mit ihm verbunden sind. Bevor diese einzelnen Themenkomplexe jedoch eingehend besprochen werden können, sind vorausgehend einige grundlegende Begriffsklärungen zu leisten. So soll zunächst die Bedeutung von „Perspektive“ erklärt werden, um danach den Terminus „Perspektive als ‚symbolische Form’“ in einer einleitenden Beschreibung verständlich zu machen. Es sei schon hier vorweg gesagt, dass in der Beantwortung dieser Frage nicht nur das zentrale Thema des Textes liegt, sondern auch seine wesentliche Schwierigkeit.
Zur Verdeutlichtung der kunsthistorischen Ausführungen wird soweit wie möglich Panofskys Bildauswahl beibehalten, zumal die hinsichtlich ihrer erklärenden Funktion wichtigeren. Wo es sich als nötig erweist, werden auch weitere, bei Panofsky nicht gezeigte Bildbeispiele herangezogen.