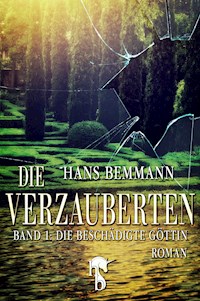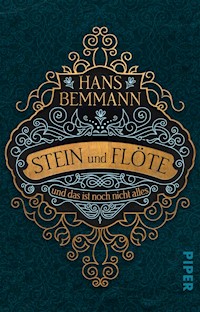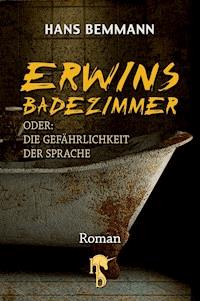
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein fantasievoller, fesselnder Roman von Hans Bemmann, dem Autor des Beststellers »Stein und Flöte«: In einem Staat, in dem Bücher verboten sind, gibt es nur wenige, die Widerstand leisten. Unter ihnen ist Erwin, der in seinem Badezimmer ein Literaturarchiv von verbotenen Schriften angelegt hat. Von seinem nahezu unzugänglichen Hinterhaus aus wird unter Lebensgefahr die Literatur aus der Zeit vor »Großen Nationalen Sprachreinigung« weiterverarbeitet. Als eines Tages der pflichtbewusste Beamte Albert S. auf Erwins Geheimnis stößt, ist er fasziniert davon und beginnt, Nachforschungen über die Literatur der »Vor-Zeit« anzustellen – ohne zu ahnen, auf welches Abenteuer er sich dabei einlässt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hans Bemmann
Erwins Badezimmer
oder:Die Gefährlichkeit der Sprache
Roman
Für Dorothea Ader (Honny soit qui mal y pense!) und die Teilnehmer ihres legendären Oberseminars
Vorwort des Herausgebers
Vor einiger Zeit überbrachten mir zwei junge Männer, die sich offenbar auf einer Art Bildungsreise per Autostop befanden, die hier im folgenden publizierten Papiere nebst den Grüßen meiner liebenswerten Cousine Rachel. Sie schrieb mir, ihr sei daran gelegen, dass diese Briefe samt den beigefügten Texten zumindest einem mir vertrauten Personenkreis bekanntgemacht würden. Ich komme diesem Wunsch umso lieber nach, als sich eine solche Veröffentlichung vorzüglich in die Reihe jener Publikationen fügt, die ich von Zeit zu Zeit und ein wenig außerhalb der Legalität herausgebe, um sie meinen Freunden zugänglich zu machen, ein Hobby, das mir neuerdings sehr erleichtert wird durch eine jener fabelhaften modernen Druckmaschinen, die dermaßen raumsparend unterzubringen und zudem leicht transportabel sind, dass man sie bequem auf einem Handwägelchen durch die Straßen ziehen könnte (was ich natürlich, um kein Aufsehen zu erregen, lieber vermeide, wenn ich mich – wie so oft – wieder einmal genötigt sehe, in einer gewissen Eile Wohnung und Produktionsstätte zu wechseln).
Rachels Begleitbrief habe ich ans Ende des Buches gestellt, damit der geneigte Leser die ganze Geschichte schön der Reihe nach zur Kenntnis nehmen kann. Einige Ortsnamen habe ich vorsichtshalber unkenntlich gemacht, im Übrigen aber das Manuskript unangetastet gelassen, obwohl mein Taktgefühl mich eigentlich dazu drängte, einige für die gute Rachel kompromittierende Passagen zu streichen. Sie hat mich jedoch ausdrücklich gebeten, dies nicht zu tun, und diesen Wunsch muß ich respektieren. Wie die Dinge liegen, wäre eine solche Diskretion für sie inzwischen sowieso ohne jeden Belang. Ich konnte Rachel schon immer gut leiden, aber jetzt – ich gestehe es frei und offen – bewundere ich sie. Ihren Freund Albert jedoch, den kennenzulernen ich leider nie das Vergnügen hatte, kann man nur beneiden.
H.
B., am 15. September
Sehr verehrte Frau Doktor,
es ist einige Zeit vergangen seit jenem Morgen im Juni, an dem Sie mit Ihren geschickten Händen meinen verstauchten Fuß eingegipst haben. Ich war damals ziemlich wütend darüber, dass ich den Rest der Tagung in L. (und wohl – wie sich dann auch erwiesen hat – noch einen beträchtlichen Teil des Sommers) mit einem hinderlichen Klumpfuß würde verbringen müssen; aber Sie haben das alles schon richtig gemacht, denn mittlerweile ist von den Folgen meines Unfalls kaum noch etwas zu spüren. Allerdings trage ich noch immer die elastische Binde, die Sie mir empfohlen haben. Seien Sie also beruhigt: Ich setze Ihren Heilerfolg nicht leichtfertig aufs Spiel.
All das hätte ich Ihnen eigentlich schon früher schreiben sollen, aber da war ja noch Ihre Bitte um Aufklärung über die Vorgeschichte der Großen Nationalen Sprachreinigung, der ich nachkommen wollte. In dieser Angelegenheit geeignetes Material beizubringen, erwies sich allerdings als nicht so einfach wie die Stillegung meines verstauchten Fußes (womit ich Ihre Verdienste um mein Wohlergehen keineswegs schmälern will). Sie meinten damals, dass ein im Dienst seiner Wissenschaft ergrauter Philologe solche Informationen ohne Weiteres zur Hand haben müsse, und schienen überrascht, dass ich – zu meiner nicht geringen Beschämung – stattdessen nur einige vage Vermutungen vorweisen konnte.
Ich war – wie gesagt – beschämt und machte mich nach meiner Rückkehr nach B. trotz meiner Gehbehinderung sofort daran, diese Wissenslücke aufzufüllen, nicht zuletzt mit dem Ziel, Ihnen durch eine ausführliche Darlegung meine Dankbarkeit zu beweisen, und dies nicht nur für die Instandsetzung meines Fußes, sondern vor allem für die liebevolle Behutsamkeit, mit der Sie sich dieser Aufgabe gewidmet haben. (Ich kenne Ärzte, die dergleichen zu erledigen pflegen wie die Reparatur eines Rasenmähers.) Um es nun gleich zu sagen: Beschämt bin ich heute nicht mehr, nachdem ich erfahren habe, auf was für ein schwieriges Unterfangen ich mich da eingelassen habe. Dass die offiziellen Geschichtsbücher darüber allenfalls einige Andeutungen verlauten lassen (und die Schulbücher nicht einmal dies), hatten Sie ja schon selber festgestellt. Also auf zu den Quellen!, sagte ich mir in meiner philologischen Naivität und ahnte dabei nicht, welch dornenvolle Pfade zu beschreiten ich mich anschickte.
Im allgemein zugänglichen Bestand unserer Universitätsbibliothek ließ sich jedenfalls nichts Geeignetes auffinden, und mir wurde bei meinem vergeblichen Fahnden in den schier endlosen Sachkatalogen zum ersten Mal voll bewusst, dass unsere Sprachgeschichte offenbar erst mit dem Zustand nach der Großen Nationalen Sprachreinigung einsetzt. Was vor diesem Zeitpunkt geschehen ist, scheint keinen Menschen zu interessieren. Verrückt, nicht wahr?
Doch mich interessierte es jetzt, und ich wendete mich an einen Herrn des Aufsichtsdienstes um Auskunft, einen jungen Mann mit Bürstenhaarschnitt und den gänzlich humorlosen Augen eines dem Erstarrungsprozess des Staatsbeamten mit Gleichmut entgegenblickenden Menschen. Dieser Bibliotheksbedienstete schaute mich auf meine Frage hin mit solcher Fassungslosigkeit an, als habe er nun seinerseits einen Verrückten vor sich oder gar jemanden, der ihn zu unanständigen, ja kriminellen Handlungen verleiten wolle. Was ich hier überhaupt zu suchen habe, fragte er, und ob ich vielleicht zu jenen outcasts gehöre, die noch immer nicht begriffen hätten, dass ein nützliches Glied der Gesellschaft sich den Aufgaben der Gegenwart zu widmen habe, statt die überwundenen Irrtümer der Vergangenheit wieder hervorzugraben. Ich war schließlich froh, dass ich meinen Ausweis nicht vorzeigen musste, und machte, dass ich ohne großes Aufsehen davonkam.
Auf diese Weise war nichts zu holen, so viel hatte ich begriffen. Andererseits bestärkte die scharfe Reaktion dieses jungen Schnösels meine Vermutung, dass es da doch etwas zu holen geben müsse, nur eben nicht für jedermann. Glücklicherweise habe ich nun einen Studienfreund, der, wie ich aus gelegentlichen Andeutungen wusste, irgendwie mit alten Büchern zu tun hat, ohne dass er mir je erzählt hätte, was er eigentlich macht, und ich hatte ihn auch nicht danach gefragt, weil er den Eindruck erweckte, dass er nicht gern darüber redet. Ich rief ihn also an und vereinbarte mit ihm ohne mit meinem eigentlichen Anliegen herauszurücken ein Zusammentreffen in einer kleinen Kneipe der Altstadt.
Nachdem wir unseren ersten Schoppen Rotwein getrunken und ein bisschen über die alten Zeiten geschwätzt hatten, blickte mein Freund – ich will ihn hier Erwin nennen – mich plötzlich scharf an und sagte:
»Du willst doch was? Rück endlich heraus damit!«
Da fasste ich mir ein Herz und erzählte ihm von meinen Erfahrungen bei der Literatursuche in der Universitätsbibliothek. Er hörte mir lächelnd zu und sagte schließlich: »Hör mal, bist du so naiv oder tust du nur so? Hast du wirklich noch nichts vom Konzentrationsmagazin für Vor-Literatur gehört?«
»Nein«, sagte ich, »das habe ich nicht. Wer redet denn schon von solchen Sachen?«
»Da hast du auch wieder recht«, sagte er. »Davon spricht man besser nicht.«
»Und woher weißt du dann von einer solchen Einrichtung?«, fragte ich.
Da blickte er mir prüfend in die Augen und sagte nach einer Weile: »Ich arbeite dort.«
Was ich dann von ihm erfuhr, war für mich so unfassbar, dass ich es kaum glauben konnte. Heute erscheint es mir im Hinblick auf meine eigene wissenschaftliche Tätigkeit jedoch nur logisch, und ich kann mir kaum noch erklären, warum ich dergleichen nicht schon längst vermutet hatte. (Ein Grund mag wohl darin zu suchen sein, dass man mein Institut dermaßen mit Aufträgen zur Nutzung der Gegenwartssprache eindeckt, dass unsereiner kaum Zeit findet, über solche fern liegenden Gebiete auch nur nachzudenken.)
Der Tatbestand lässt sich in aller Kürze folgendermaßen zusammenfassen: Nach der Großen Nationalen Sprachreinigung hat man alle Druckwerke, die vor diesem Zeitpunkt erschienen waren, und natürlich auch alle alten Handschriften aus sämtlichen Bibliotheken herausgezogen und auch in unzähligen Haussuchungen bei Privatleuten aufgestöbert und beschlagnahmt. Ein ganzes Heer von staatstreuen Wissenschaftlern wurde durch viele Jahre hindurch damit beschäftigt, diese Literatur daraufhin zu überprüfen, ob ihr Inhalt Schlüsse auf Zustände oder Denkweisen vor der Großen Nationalen Sprachreinigung zulasse. Was sich in dieser Hinsicht als harmlos erwies (es war wenig genug!), wurde freigegeben, und alles Übrige in dem besagten Konzentrationsmagazin zusammengeführt, wo es nur einem ausgewählten Kreis von Wissenschaftsbeamten zur Verfügung steht.
Als ich das erfahren hatte, wunderte mich nichts mehr. »Und was machst du dort?«, fragte ich. Es muss wohl ein gutes Stück Abscheu in meinen Worten mitgeklungen haben, denn Erwin hob die Hand zu einer beschwichtigenden Geste und sagte: »Du solltest nicht vorschnell über einen Freund urteilen. Da du offen zu mir gesprochen hast, will ich das auch tun.«
Während er das sagte und schon fortfahren wollte, kamen ein paar Leute in das Lokal und setzten sich an den Nebentisch. Erwin verstummte auf der Stelle, blickte rasch zu ihnen hinüber und sagte dann nur noch: »Hast du morgen Abend Zeit?«, und als ich nickte, fügte er hinzu: »Dann schau doch bei mir herein! Sagen wir gegen acht? Ich habe noch ein paar Flaschen alten Rotwein im Keller. Den solltest du kennenlernen.«
»Du weißt ja, dass ich mich für alte Sachen interessiere«, sagte ich. Dann verabschiedeten wir uns voneinander und ich ging nach Hause.
In dieser Nacht habe ich wenig geschlafen, denn die Sache mit diesem Konzentrationsmagazin ging mir ständig im Kopf herum und ich begann mich zu fragen, was für eine Art von Philologie ich eigentlich bisher betrieben hatte. Dieses Herumhantieren mit Wörtern, deren Ursprung und Geschichte ich nicht einmal kannte, erschien mir plötzlich völlig sinnlos und je länger ich darüber nachdachte, desto deutlicher wurde mir bewusst, dass ich keinerlei Recht darauf gehabt hatte, meinen Freund für das, was er vermutlich tat, zu verachten. Was war ich denn schon? Der Handlanger irgendwelcher Leute weiter oben in den Staatsministerien, die von meinem Institut sogenanntes Wortfeldmaterial anforderten, beispielsweise zu Themen wie Gegenwartsoptimismus, Antiindividualismus oder Gestrigkeitsbekämpfung. Indem ich mich selbst zu verabscheuen begann, wuchs zugleich in mir die Begierde, über diese amtlich verordnete Mauer hinweg in die Vergangenheit zu blicken; denn ich ahnte, dort müsse irgendetwas zu finden sein, das all diese bisher von mir und Tausenden anderer Kollegen betriebene Sprachtechnologie aus den Angeln heben könnte.
Solchen Gedanken hing ich auch am folgenden Tage noch nach, während ich an meinem Institutsschreibtisch lustlos in Begriffskarteien blätterte. Mir war zumute, als tasteten meine Finger die Oberfläche von Vorstellungen ab, die in unseren Wörterbüchern mit diesen Lautfolgen verknüpft werden, ohne dass ich begriff, was sich unter dieser dünnen Haut von Eindeutigkeit in der Tiefe verbarg. Ich muss gestehen, dass ich an diesem Tag meinem Dienst nicht besonders pflichteifrig nachgekommen bin und mich immer wieder bei dem Gedanken ertappte, was Erwin mir am Abend wohl mitteilen wollte.
Sie können sich vorstellen, dass ich mich überpünktlich bei ihm einfand. Er wohnt in einem jener schmalen Häuser der Altstadt, deren Erdgeschos von aufwendig ausgestatteten (und teuren!) Geschäften bis in den letzten nutzbaren Winkel dermaßen ausgefüllt ist, dass man die zwischen den Schauvitrinen des Eingangsbereichs eingeklemmte Tür zu den Wohnungen der oberen Stockwerke kaum finden kann. Normalerweise kommt man ja überhaupt nicht auf den Gedanken, dass hinter diesen auf romantisch hergerichteten und dabei auch noch bis oben hin mit Leuchtreklame dekorierten Pfefferkuchenhausfassaden jemand wohnen könnte und vermutet dort allenfalls Warenmagazine. Ich musste eine enge, steile Treppe, die obendrein nur unzureichend beleuchtet war, bis zum dritten Stockwerk hinaufklettern, fand seitwärts der Tür einen altertümlichen Klingelzug und hörte, sobald ich ihn betätigte, drinnen eine volltönende Glocke anschlagen. Mir war zumute, als fordere ich Einlass in eine mir völlig fremde Welt, und dieser Eindruck verstärkte sich noch, sobald Erwin die Tür geöffnet und mich hereingebeten hatte. Nicht dass sein Mobiliar und die sonstige Einrichtung der Wohnung ungewöhnlich gewesen wären – Sie wissen ja, man kriegt heutzutage ohnehin nur serienmäßig hergestellte Sachen –; dennoch wirkten die einzelnen Gegenstände, die Garderobe etwa, ein gerahmter Kunstdruck im Flur und dann insbesondere die Möbel des Wohnzimmers, in das er mich führte, irgendwie überraschend, so als sähe man dergleichen zum ersten Mal. Vielleicht lag dies daran, dass sie auf eine Weise zusammengestellt und plaziert waren, die weder den von unseren vielbeliebten Illustrierten für elegante Wohnkultur gepflegten Normen entsprach noch an jenen in den Interieurs von Familiensendungen des Fernsehens bevorzugten Stil erinnerte, der einen straks in die Rolle eines Schauspielers versetzt, sobald man eine fremde Wohnung betritt. Hier bei meinem Freund meinte man zwar jedes Stück zu kennen, aber durch die Art der Zusammenstellung erschien es zunächst befremdlich, bis einem bewusst wurde, dass man es nie zuvor richtig betrachtet hatte.
Erwin bot mir einen dieser modernen Sessel an, der überraschenderweise wesentlich bequemer war, als er aussah; der Rotwein stand schon geöffnet bereit, und als ich ihn beschnuppert und gekostet hatte (er war in der Tat vorzüglich!), nahm mein Freund unser Gespräch an der gleichen Stelle wieder auf, an der er es unterbrochen hatte. »Ich will also«, begann er, »deine unverblümte Frage mit der gleichen Offenheit beantworten. Allein schon diese Frage und die Art, wie du sie gestellt hast, haben mir gezeigt, dass du im Grunde eine andere und weitergehende Vorstellung von deiner Wissenschaft gewonnen hast, als dies gegenwärtig in diesem Lande öffentlich zulässig erscheint. Was ich dir jetzt zu sagen habe, ist in gewissem Sinne vertraulich, wie du gestern Abend schon vermutet haben wirst. Das heißt jedoch nicht, dass ich dich auffordern werde, gegenüber jedermann darüber zu schweigen. Im Gegenteil: Ich überlasse es deiner Entscheidung, wem du diese Gedanken und Informationen weitergeben willst; denn ich bin andererseits durchaus daran interessiert, dass diese Dinge unter die Leute kommen – zumindest unter bestimmte Leute, Leute, die sich die richtigen Fragen stellen.«
Ich muss ihn wohl ziemlich verständnislos angeblickt haben, denn er machte eine wegwerfende Geste und fuhr fort: »Später wirst du das schon begreifen. Was hältst du überhaupt von den Dingen, die ich dir gestern erzählt habe?«
»Ich finde es scheußlich, wenn Bücher auf diese Art eingesperrt werden«, sagte ich, »und noch weniger kann ich begreifen, wie du dich zu einem solchen Geschäft hergeben kannst.«
»Das hatte ich gehofft«, sagte Erwin und lehnte sich befriedigt zurück. »Ich will versuchen, es dir zu erklären. Du wirst ein wenig Geduld haben müssen; denn ich muss dazu ziemlich weit ausholen. Halte dich inzwischen an den Rotwein. Es ist genug davon da.« Er nahm selber einen Schluck, verkostete ihn genüsslich und griff dann seinen Faden wieder auf: »Das alles begann schon während unseres Studiums. Ich besuchte damals während der Semesterferien meinen Großonkel, der, wie ich wusste, gleichfalls Philologie studiert und dann eine Zeitlang als Privatdozent an der Universität von K. gewirkt hatte, ehe er sich vom Lehrbetrieb zurückzog. Er hatte nebenbei ein paar Romane geschrieben, was zwar seinem Ruf als Wissenschaftler nicht eben dienlich gewesen war, ihm aber so viel Geld eingebracht hatte, dass er davon ein einigermaßen sorgloses Leben führen konnte. Seither hauste er in einem ausgedienten Bauernhof des Mittelgebirges in der Gegend von L. weitab von jeder größeren Stadt und lebte dort, wie man in unserer Familie sagte, seinen Forschungen, was immer das heißen mochte; denn publiziert hatte er seit seinem Fortgang von der Universität kein Wort.
Als ich seine Einladung erhielt, freute ich mich also nicht nur darauf, in den urigen Wäldern Pilze zu suchen, sondern zugleich erwachte auch meine Neugier darauf, was der Alte dort eigentlich trieb. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich hatte umsteigen müssen, ehe ich zuletzt mit einem klapprigen Autobus und von der nächstliegenden Haltestelle aus nach einstündigem Fußmarsch das Gehöft erreichte. Onkel Max war im Garten vor dem uralten Fachwerkhaus damit beschäftigt, seine Tomaten aufzubinden. Er begrüßte mich ohne das anlässlich von Besuchen bei entfernteren Verwandten sonst übliche Tamtam, nichts von ›Junge, wie du gewachsen bist!‹ und dergleichen, sondern führte mich ohne viele Worte und Umstände in eine weiß gekalkte Gästekammer mit Blick zum Wald und sagte, das Essen stünde schon fertig auf dem Herd, und wir könnten uns gleich zu Tisch setzen. Auf diese Weise überkam mich das Gefühl, in diesem Haus, das ich noch nie betreten hatte, schon seit Jahren ein- und ausgegangen zu sein.«
Erwin erzählte sogar noch, was es zu Mittag gegeben hatte (der Großonkel verstand sich offenbar gut aufs Kochen) und beschrieb sehr eingehend Haus und Hof, doch das will ich Ihnen hier ersparen, verehrte Frau Doktor, um Sie nicht zu langweilen. Also zum Wesentlichen: Nach Tisch verstrickte ihn der Großonkel in ein Gespräch über sein Studium, erkundigte sich nach den Vorlesungen dieses oder jenes Professors oder nach der durchgearbeiteten Literatur und wusste dabei immer wieder Fragen zu stellen, die meinen Freund in Ratlosigkeit stürzten. Ihm sei zumute gewesen, sagte er, als habe er sein Studium bisher von einer völlig falschen Seite angepackt, aber er habe auch nicht sagen können, wie er es anders hätte anfangen sollen. Jedenfalls sei er nach und nach zu der Ansicht gekommen, dass er im Grunde überhaupt keine Vorstellung von dem habe, was er da studierte, und das habe er Onkel Max schließlich auch gesagt.
›Siehst du‹, habe der Alte ihm darauf geantwortet, ›das habe ich fast erwartet. Bisher hat dich nur noch niemand darauf gebracht, dass du selber über diese Dinge nachdenken könntest, statt irgendwelche Hypothesen nachzuplappern, die man euch an dieser Hochschule als erwiesene Tatsachen vorsetzt. Und jetzt überrascht es dich, dass dies möglich ist. Denn denken kannst du, das habe ich schon gemerkt und – nebenbei gesagt – auch gehofft.‹
»Da merkte ich«, fuhr mein Freund fort, »dass dieser alte Schlaukopf mich nicht nur deshalb eingeladen hatte, um mir ein paar erholsame Ferienwochen zu verschaffen, sondern noch anderes mit mir im Sinn hatte. Der Gedanke, dass er sich in mir vielleicht einen Partner für wissenschaftliche Diskussionen erhoffte, weckte meinen Ehrgeiz und ich versuchte zunächst noch die Positionen zu verteidigen, die er durch seine Fragen bei mir schon erschüttert hatte, doch er parierte meine Gegenangriffe mit der Eleganz eines geübten Florettfechters und zitierte dabei auswendig ganze Passagen von Autoren, die ich nicht einmal dem Namen nach kannte.«
Als mein Freund diesen Onkel Max daraufhin nach den Quellen seiner Weisheit fragte, führte ihn dieser wortlos in sein Studierzimmer, dessen Wände ringsum bis zur Decke hinauf hinter vollgestopften Bücherregalen verborgen waren. Schon beim ersten Anblick habe er an den abgewetzten Lederrücken erkannt, dass er Bücher von einem solchen Alter noch nie in der Hand gehabt habe. ›Bediene dich nach Belieben!‹, habe der Großonkel nur noch gesagt und ihn dann allein gelassen.
Erwin erzählte mir, dass ihm an diesem Nachmittag zumute gewesen sei wie einem Goldsucher, der nach endlosem Wühlen in Sand und taubem Gestein endlich auf eine fündige Ader gestoßen ist. Er nannte mir auch einige Titel, die mir damals ebenso unbekannt waren wie sie Ihnen, Frau Doktor, heute sein werden, etwa die Große Hadubaldsche Grammatik oder Spiridions Sprachtheorie. Als Onkel Max ihn am Abend zum Essen holte, habe er sich von seiner Lektüre kaum losreißen können.
Ich will es kurz machen: Der Großonkel hatte auf irgendeine Weise eine Menge Bücher aufgestöbert, die der allgemeinen Zensur nach der Großen Nationalen Sprachreinigung entgangen waren, und an diesem Abend erfuhr mein Freund aus seinem Munde zum ersten Mal von diesem Konzentrationsmagazin für Vor-Literatur.
In den folgenden Wochen verbrachte Erwin einen Großteil seiner Zeit mit dem Studium dieser Werke und war gegen Ende der Ferien so weit, dass er seine neu gewonnenen Erkenntnisse am liebsten laut hinausgeschrien hätte, um damit einen totalen Umsturz des gesamten Wissenschaftsbetriebs herbeizuführen. Onkel Max hatte jedoch anderes im Sinn. Er machte ihm klar, dass dies der beste Weg sei, um von heute auf morgen in die Verbannung geschickt zu werden oder noch schlimmere Erfahrungen zu machen. ›Meinst du‹, habe er gesagt, ›du seist der Einzige, der sich auf solche Weise den Schädel an der Mauer einzurennen versucht? Es gibt schon noch ein paar Leute im Land, die so denken wie ich. Was wir brauchen, ist ein Mann im Konzentrationsmagazin, der für uns arbeitet. Mach also kein Aufsehen, bring dein Studium auf die vorgeschriebene Weise zu Ende, und das übrige überlasse mir. Es gibt da einen Freund, der in der Kommission für die Einstellung von Magazinbeamten sitzt.‹
»Auf diese Weise bist du also in diese Institution hineingeraten«, sagte ich. »Und was tust du dort nun wirklich?«
»Zunächst einmal meine Arbeit«, sagte Erwin. »Wir sind noch immer dabei, die immensen Bestände nach ihren Inhalten in einem systematischen Katalog zu erschließen. Das kann noch Jahrzehnte dauern. Dazu muss jeder Sachbearbeiter natürlich die einzelnen Werke lesen, um die berührten Themen in Stich- und Schlagwörtern zu erfassen, und das führt zu einem interessanten Nebeneffekt, mit dem unsere Auftraggeber offenbar nicht gerechnet haben: Je intensiver sich ein denkfähiger Mensch in diese Texte vertieft, desto differenzierter wird seine eigene Sprachfähigkeit und damit zugleich auch seine Denkweise. So kommt es, dass ausgerechnet im Konzentrationsmagazin nicht wenige meiner Kollegen inzwischen zu jenem Freundeskreis gehören, zu dem auch du jetzt gestoßen bist. Die Initiatoren der Großen Nationalen Sprachreinigung hatten damals schon eine Ahnung davon, welche Sprengkraft Wörter haben können, aber ihre Nachfolger von heute sind mittlerweile dermaßen in ihrem verflachten Idiom befangen, dass sie mit einer solchen Wirkung schon gar nicht mehr zu rechnen scheinen. Übrigens müssen wir hie und da auch für die Geheimarchive von Staatsministerien ganze Werke auf Mikrofiche aufnehmen.«
»Das ist doch wohl nicht die Aufgabe, die Onkel Max dir zugedacht hatte«, sagte ich.
Erwin schüttelte lächelnd den Kopf und sagte: »Sicher nicht, obwohl man sich in Anbetracht der eben beschriebenen Erfahrung eigentlich nur wünschen kann, dass auch dort irgendwelche Referenten unter den Einfluss dieser Sprache geraten. Überdies ist es auch für den inoffiziellen Teil meiner Tätigkeit von Vorteil, dass wir diese Mikro-Aufnahmegeräte haben. Komm mit, ich zeig dir etwas!«
Er stand auf und sagte schon im Hinausgehen: »Du wirst doch nichts dagegen haben, mein Schlafzimmer zu betreten?« Eine Antwort wartete er gar nicht erst ab, ging mir voraus zu einer Tür am Ende des schmalen Flurs und führte mich in einen Raum, in dem außer seinem Bett, einem Nachttisch und der Wäschekommode nur noch ein großer Kleiderschrank stand. Er öffnete ihn, schob die säuberlich auf Bügeln hängenden Anzüge zur Seite und fuhr mit dem Finger über eine schmale Leiste; dann drückte er mit der flachen Hand gegen die Rückwand, die geräuschlos zurückschlug und den Blick in einen dämmerigen Raum freigab. »Tritt ein in das Reich der wahren Sprachwissenschaft!«, sagte Erwin und ging durch den Schrank.
Nach derart geheimnisvollen Vorkehrungen hatte ich einen nicht minder geheimnisvollen Raum erwartet und war geradezu schockiert, als ich mich in einem Badezimmer wiederfand. Über dem Fußende der Wanne hing ein Heißwasserspeicher von beträchtlicher Größe, daneben war an der Wand ein Waschbecken befestigt mit einem Spiegel darüber. Davor stand merkwürdigerweise ein weiß lackierter Drehstuhl. In einer Ecke befand sich noch ein Wasserklosett und Erwin machte mich gleich darauf aufmerksam, dass es nicht benutzbar sei, weil man die gesamte Installation stillgelegt habe.
Ich schaute mich in dem hellblau gekachelten Raum um und fragte mich allen Ernstes, ob Erwin geistesgestört sei und mir das alles nur vorgefaselt habe. Er muss wohl meinen verschreckten Blick bemerkt haben, denn er lachte hell auf und sagte: »Du hast dir den Tempel der Philologie wohl anders vorgestellt? Lederrücken mit Goldprägung und dergleichen? Ich habe mir das praktischer eingerichtet als Onkel Max. Setz dich auf den Stuhl und schau in den Spiegel! Dein Gesichtsausdruck ist wahrhaft bemerkenswert!«
Während ich gehorsam auf dem Stuhl Platz nahm (ich sagte mir, dass man Verrückten erst einmal ihren Willen lassen müsse, um sie nicht aufzuregen), klappte Erwin auf der Seite ein Stück der Fliesenwand auf und zog aus einem Magazin eine dünne Folie, die er in einen Schlitz an der Unterseite des Badeofens schob. Dann stellte er den Temperaturregler auf heiß und sagte: »Hast du Angst vor deinem eigenen Gesicht? Schau doch in den Spiegel!«
Als ich aufblickte, sah ich nicht, wie ich erwartet hatte, das Spiegelbild meines bestürzten Gesichts, sondern schaute auf eine matt schimmernde Scheibe, auf deren Oberfläche alsbald, während Erwin noch ein bisschen am Kaltwasserhahn drehte, undeutliche Buchstabenzeilen erschienen und sich gleich darauf gestochen scharf abzeichneten. Es war ein Titelblatt, auf dem zu lesen stand:
Hadubalds Große GrammatikNach der Originalhandschrift herausgegebenund mit Kommentaren versehenvonJoseph Matthias Rodenhagen
Auch der Erscheinungsvermerk war zu sehen und zeigte an, dass dieses Werk etwa 200 Jahre vor der Großen Nationalen Sprachreinigung gedruckt worden war.
»Ein praktisches Lesegerät, nicht wahr?«, sagte Erwin, als handle es sich um die selbstverständlichste Sache der Welt. »Wenn du die nächste Seite lesen willst, brauchst du nur auf den roten Knopf des Heißwasserhahns zu drücken. Als Schreibunterlage ist das Waschbecken natürlich nicht zu brauchen; deswegen lege ich ein Brett drüber, wenn ich mir Notizen machen will«, und dabei fischte er unter der Wanne eine Art Pultdeckel hervor, der exakt und rutschfest auf dem Beckenrand aufsaß.
Ich war von alledem so konsterniert, dass ich ihn wie verblödet anstarrte und kein Wort herausbrachte. Da legte er mir die Hand auf die Schulter und sagte: »Das war wohl alles ein bisschen viel auf einmal. Beruhige dich doch! Das hier ist alles nur technischer Kram. Wahrscheinlich brauchst du jetzt erst einmal einen kräftigen Schluck.« Er stieg durch den Kleiderschrank hinüber ins Wohnzimmer, holte die Flasche und unsere Gläser, und als ich– sträflicherweise im Hinblick auf den köstlichen Wein – mein Glas auf einen Zug hinuntergekippt hatte, begann ich allmählich wieder klar zu denken.
Er zeigte mir dann, wie man den Katalog dieser Mini-Bibliothek benutzt (sie muss nach meiner Schätzung etwa 50 000 Bände umfassen) und sagte: »Du kannst hier studieren, so oft und so lange du Lust hast. Ich gebe dir einen Wohnungsschlüssel, damit du jederzeit Zugang hast.«
Damals war ich wegen meines Gipsbeines noch im Krankenstand und ich habe diese Zeit nach Kräften genutzt. Später musste ich meine Studien auf den Abend verlegen. Diese Beschäftigung war allein schon faszinierend genug. Mein Freund hatte nach und nach durch viele Jahre hindurch und auch mit Hilfe anderer Kollegen alle wichtigen Werke der Vor-Literatur, nicht nur Arbeiten zur Sprachwissenschaft, sondern vor allem auch eine Fülle literarischer Texte bis zurück zu den Heldenliedern der Vorzeit auf Mikrofiche aufgenommen und sie seiner Bibliothek einverleibt. Man konnte diese kaum handtellergroßen Blättchen ja in die Tasche stecken wie einen Geldschein, ohne dass jemand bei der Ausgangskontrolle bemerkte, wie hier Literatur aus dem Konzentrationsmagazin herausgeschmuggelt wurde.
Wahrscheinlich hätte ich überhaupt nicht gewusst, wo ich anfangen sollte, und so war es ein Glück, dass ich mich auf dieses Abenteuer vor allem deshalb eingelassen hatte, um Ihre Frage zu beantworten. Erwin nannte mir die einschlägigen Werke, in denen ich Informationen dazu finden konnte, und seither habe ich jede freie Minute in seinem Badezimmer verbracht, um mich in die Vorgeschichte der sogenannten Sprachwirren zu vertiefen, die ihren Abschluss in der Großen Nationalen Sprachreinigung gefunden haben.
Ich glaube, Sie können sich kaum vorstellen, verehrte Frau Doktor, was die Begegnung mit diesen alten Schriften für mich bedeutet hat. Dabei war es jedoch nicht nur der mir völlig unvertraute Inhalt dieser Dokumente, der mich in die Situation eines Entdeckers fremder Welten, ja eines über alle Maßen fündig gewordenen Schatzgräbers versetzte; fast noch mehr faszinierte mich die Sprache selbst, in der viele dieser Texte abgefasst waren. Alles, was ich bislang gelesen oder gehört hatte, erschien mir flach und ohne Tiefendimension gegenüber der Art, wie hier Sprache benutzt wurde, um Gedanken miteinander in Beziehung zu setzen oder Vorgänge in ihrer Zeitfolge oder ursächlichen Verknüpfung zu beschreiben. Ich erkannte mehr und mehr, dass Sprache durchaus nicht so eindeutig ist, wie man uns bisher von der Grundschule an bis hinauf zu den Seminaren der Universität beizubringen versucht hatte. (Eindeutigkeit ist bei uns ja so etwas wie eine Staatsideologie!) Bei der Lektüre dieser alten Schriften begann ich zu begreifen, dass Sprache gerade dazu dienen kann, die Vieldeutigkeit aller Dinge ins Bewusstsein zu heben. Mir war bei dieser Erfahrung zumute, als würde ich aus einem in endlos viele enge, fensterlose Einzelzellen aufgeteilten Gefängnis in eine Freiheit entlassen, in der ich nach Belieben spazieren gehen und mich daran freuen konnte, wie alles mit allem in Beziehung gebracht werden konnte – ein fast berauschendes Gefühl, wenn es nicht um eine so nüchterne und klare Sache ginge wie eben die Sprache.
Während ich meinen Brief bis zu dieser Stelle noch einmal überlese, wird mir bewusst, dass diese Art, Sprache zu handhaben, bereits (und vielleicht zu Ihrem Befremden) stark auf meinen eigenen Stil abgefärbt hat, wenn mir auch allzu deutlich bewusst ist, dass ich noch weit davon entfernt bin, mich aus den Niederungen meiner bisher durch eine spröde, definitorische Amtssprache geprägten Diktion zu der frei schwebenden Sprachequilibristik zu erheben, deren stupende Meisterschaft man in manchen Texten der Vor-Literatur nur bestaunen kann. Immerhin hat sich mein Tempusgebrauch schon dermaßen differenziert, dass ich achtgeben muss, in der Öffentlichkeit nicht als Hadubaldianer denunziert zu warden. (Ich würde heute allerdings dieses für seine gegenwärtigen Benutzer sinnentleerte Schimpfwort eher als Ehrennamen empfinden!)
Diesem schon allzu langen Brief füge ich nun auch noch den Versuch eines Essays über die Vorgeschichte der Sprachwirren bei, um Ihre erste Neugierde zu stillen. Ich wiege mich in der Hoffnung, mit diesem Text, der zugegebenermaßen noch vieles offen lässt, bei Ihnen gleich wieder ein halbes Dutzend Fragen zu provozieren, die mir das Vergnügen verschaffen, recht bald wieder von Ihnen zu hören.
Ihr sehr ergebener
Albert S.
Aufzeichnungen über die Vorgeschichte der Sprachwirren
Als Hadubald der Scharfsinnige anfing zu denken, so berichten die alten Geschichten, fand er eine Sprache vor, die seinen Absichten nicht genügte. Er entstammte einem Volk, dessen Vorstellungen geprägt waren von jahrhundertelanger Beschäftigung mit Ackerbau und Viehzucht. Die damit verknüpften Tätigkeiten erforderten zwar einen gewissen Begriff von Zeitabläufen – etwa im Hinblick auf den Wechsel der Jahreszeiten oder die Zeitpunkte der Paarungsbereitschaft von Tieren und die Dauer ihrer Trächtigkeit –, solche Umstände waren jedoch in den gleich laufenden Rhythmus des Lebens derart eingebettet, dass diese nicht eigentlich als ein zeitliches Nacheinander, sondern als ein ständig gegenwärtiger, in sich kreisender Vorgang empfunden wurden. Aus diesem Grunde kannte Hadubalds Volk nur zwei Zeitformen:
die gewöhnliche, in der alles ausgesagt wurde, was das tägliche Leben betraf;
die erhabene, in der die mythischen Berichte vom Beginn der Welt und über die bemerkenswerten Taten der Vorfahren gesprochen (oder auch gesungen) wurden.
Hadubald der Scharfsinnige hatte jedoch den Entschluss gefasst, über die Zeit nachzudenken, und deshalb musste er sprachliche Mittel finden, Zeit zu beschreiben. Auf seinen Reisen in andere Länder hatte er die Sprache des Alten Volkes kennengelernt, das früher jenseits der hohen Berge gewohnt hatte. Dieses Volk war schon lange ausgestorben, hatte jedoch Schriften von so außerordentlichem Scharfsinn hinterlassen, wie er unter Hadubalds Leuten bislang nicht vorzufinden war.
Was er am meisten an diesen Texten bewundert hatte, war das streng logisch aufgebaute System von Lautveränderungen und -zusätzen, mit deren Hilfe man jedes Verbum in alle nur denkbaren Zeitbezüge setzen konnte. Dieses System erlaubte es, Dinge auszusagen, die in der Vergangenheit geschehen waren, ja selbst solche, die zur Zeit der Vergangenheit bereits Vergangenheit gewesen waren; ebenso ließ sich das Künftige beschreiben und auch solches, das zu einem künftigen Zeitpunkt Vergangenheit sein würde.
Hadubald der Scharfsinnige war fasziniert. Da jedoch unter seinem Volk keiner der Sprache des Alten Volkes mächtig war, konnte er sich ihrer nicht bedienen, wenn er die Ergebnisse seines Nachdenkens seinen Mitmenschen zugänglich machen wollte. So fasste er den Entschluss, das Tempussystem der Alten Sprache auf die eigene Sprache zu übertragen. Dies erwies sich jedoch durchaus nicht als so einfach, wie es hier hingesagt wird.
Da Hadubald die Absicht hatte, über Dinge des täglichen Lebens – zu denen seiner Ansicht nach der Ablauf der Zeit gehörte – zu reden, musste er sich vor allem der gewöhnlichen Form bedienen. Doch auch die erhabene Form gedachte er in sein System einzugliedern. Fügte er aber nach dem Vorbild der Alten Sprache neue Laute und Lautverbindungen den Verben seiner eigenen Sprache hinzu, dann verstand keiner mehr, was er damit meinte. Er erkannte bald, dass er sich mit zusätzlichen Wörtern und Wortformen behelfen musste, die seine Zeitgenossen verstanden. So fand er die Funktion des Hilfsverbs, wobei er gleichfalls an eine Eigentümlichkeit der Alten Sprache anknüpfen konnte, in der man dieses Mittel allerdings nur dann heranzog, wenn man ausdrücken wollte, dass einem in der Vergangenheit etwas widerfahren war.
Hadubald der Scharfsinnige erkannte, dass er zu diesem Zweck Wörter wählen musste, die so häufig im Gebrauch waren, dass sie jedermann täglich benutzte und also auch ohne Schwierigkeiten verstand, etwa Wörter wie sein im Sinne von existieren oder haben im Sinne von besitzen oder werden im Sinne von wachsen, sich entwickeln. Wie ist das, fragte er sich, wenn zur Vergangenheit eines Menschen die Erfahrung des Laufens gehört? Gehört sie nicht zu seinem Sein? Gelaufen-Sein? Also: Er ist gelaufen.
Wie ist das, fragte er sich weiter, wenn zur Vergangenheit eines Menschen die Ausübung des Melkens gehört? Besitzt er nicht diese Erfahrung? Gemolken-Haben? Also: Er hat gemolken.
Wie ist das, wenn in der erhabenen Form von Dingen berichtet wird, die vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem das Erzählte sich zuträgt? Muss dann nicht auch das Hilfsverb in der erhabenen Form verwendet werden? Also: Ein Jahr, nachdem Rudimer Fahlbart sein Weib erschlagen hatte, erkannte er ihre Unschuld.
Und schließlich: Wie ist das, wenn in der Zukunft eines Menschen das Sterben wartet? Wächst er nicht diesem Sterben entgegen? Sterben-Werden? Also: Er wird sterben. Und wenn in der Zukunft der Tod diesen Menschen bereits eingeholt hat? Gehört der Tod dann nicht zu seinem Sein? Also: Es wird gestorben sein.
Auch Hadubald wurde, wie die alten Geschichten erzählen, trotz all seines Scharfsinns vom Tode eingeholt. Aber er hinterließ eine Sprache, an der seine Schüler – die sich hinfort die Scharfsinnigen nannten – ihren Scharfsinn üben konnten und dieser Sprache bedienten sich alle, die über den Ablauf der Zeit nachzudenken begannen. Das waren nicht wenige; denn das Nachdenken kam damals in Mode. Die Ackerbauern und Viehzüchter hingegen, die eine solche Subtilität der Ausdrucksweise nicht benötigten, hielten weiter an ihrer überkommenen Sprache fest, gebrauchten die gewöhnliche Form, wenn sie von alltäglichen Dingen redeten, und die erhabene, wenn sie ihre mythischen Gesänge anstimmten.
Damit war jedermann zufrieden, wenn auch die Ackerbauern und Viehzüchter gelegentlich über die – ihrer Meinung nach – geschraubte Ausdrucksweise der Scharfsinnigen spotteten oder ihrerseits von den Scharfsinnigen wegen ihrer ungenauen Redensweise getadelt wurden. Mit besonderer Schärfe tat dies die Gruppe der orthodoxen Hadubaldianer, die sich von den Scharfsinnigen abgespalten hatte. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, das gesamte Volk zur Annahme der Hadubaldschen Sprachreform zu zwingen. Bei Strafe der Ausstoßung musste sich jedes ihrer Mitglieder, in welcher Lebenslage auch immer, an die Regeln des hadubaldschen Tempussystems halten, ja sie hatten daraus so etwas wie eine rituelle Sprache entwickelt, die schon fast liturgische Formen annahm. So begrüßten sie sich, wenn sie einander auf der Straße oder sonst wo trafen, mit einer feststehenden Formel. Der Jüngere sagte: »Hadubald hat gelebt«, der Ältere antwortete: »Hadubald wird immer leben« und darauf beide gemeinsam: »Wir werden gelebt haben, aber Hadubald wird leben.«
So standen die Dinge, als Spiridion Spalthirn eine neue Art des Denkens entwickelte. Diesen Namen hatte man ihm beigelegt, weil er in seiner Jugend während der Kämpfe mit den Friesjackenleuten einen Beilhieb quer über das Schädeldach erhalten hatte. Diese lebensgefährliche Verletzung war zwar wider allen Erwartens ausgeheilt, hatte jedoch sein Denken auf eine merkwürdige Weise zugespitzt. Das Denken Hadubalds des Scharfsinnigen war auf die Natur der Dinge gerichtet gewesen: Um zu erfahren, was Zeit sei, hatte er sich eine Sprache geschaffen, in der sich seiner Meinung nach Zeitbezüge erfassen ließen. Spiridion Spalthirn jedoch begann über die Sprache selbst nachzudenken. Sind wir imstande, so fragte er sich, mit Sprache die Wirklichkeit zu erfassen? Hadubald – wer immer das gewesen sein mag – ging davon aus, er könne mit seiner Sprache die Wirklichkeit der Zeit beschreiben. Aber können wir das tatsächlich? Gibt es in Wirklichkeit überhaupt Zeit? Oder ist Zeit nur eine Hilfskonstruktion, die sich der Mensch in der Sprache geschaffen hat, um der Wirklichkeit Struktur zu verleihen? Hat der Mensch vielleicht nur deshalb das Raster der Sprache entworfen, weil er es nicht erträgt, im Ungegliederten zu leben oder weil er ohne Logik nicht auskommen kann? Stellen wir nicht vielmehr durch unsere Sprache erst Logik her und übertragen sie dann auf eine Wirklichkeit, die wir eigentlich gar nicht erfassen können?
Auf diesem Wege fand er das Axiom des Siebs. Die Sprache, sagte er, ist wie ein Sieb, dessen Löcher in Mustern angeordnet sind, die den Strukturen unseres Denkens entsprechen. Mit diesem Sieb fischen wir im Trüben der Wirklichkeit. Der größere Teil der Wirklichkeit fließt jedoch durch die allzu groben Löcher ab. Was zurückbleibt und sich auf dem Boden des Siebs absetzt, zeichnet lediglich die Muster nach, die wir durch die Anordnung der Löcher dem Sieb selbst – durch unsere Sprache – gegeben haben. Sprache beschreibt also nicht Wirklichkeit, sondern nur unsere Denkstrukturen.
Spiridion Spalthirns Axiom wurde von jenen Menschen, die nachdachten, bereitwillig aufgegriffen. Die Zeit war reif dazu; denn damals stand die Macht der orthodoxen Hadu-baldianer auf ihrem Höhepunkt. Sie hielten praktisch alle entscheidenden Positionen im Schulwesen besetzt und hatten den Lehrplan derart reformiert, dass etwa zwei Drittel des Unterrichts dem Lernbereich Sprache gewidmet waren. Wo immer man an den geöffneten Fenstern einer Schule vorüberging, konnte man die Schüler im Chor die Verbalformen aufsagen hören: Ich spreche, ich sprach, ich habe gesprochen, ich hatte gesprochen, ich werde sprechen, ich werde gesprochen haben, es wird gesprochen, es wurde gesprochen, es ist gesprochen worden, es war gesprochen worden, es wird gesprochen werden, es wird gesprochen worden sein …
Die Eltern unter den Ackerbauern und Viehzüchtern – von ihren Kindern gar nicht zu reden – konnten sich gegen eine solche Art des Unterrichts, ja des öffentlichen Zwangs, nicht wehren; denn die Gesetze und Erlasse zum Schulwesen wurden ja von den orthodoxen Hadubaldianern formuliert, gegen deren Eloquenz sich keiner in den zuständigen Gremien durchsetzen konnte. Aber auch im Lager jener Leute, die sich aufs Nachdenken verlegt hatten, wuchs die Opposition gegen solche Zustände. So ist es nicht zu verwundern, dass Spiridion Spalthirns Axiom auf einen vorbereiteten Boden fiel.
Spiridion verstand sich selbst nur als reiner Denker und lehnte es strikt ab, zum Haupt einer oppositionellen Gruppe zu werden. So kam es, dass sein Denkansatz in eine Richtung weiterentwickelt wurde, die sich beträchtlich von seinen ursprünglichen Intentionen entfernte. Wenn wir, so fragten die Spiridionisten (diesen Namen hatten sie sich trotz Spiridions Protest beigelegt), in der Sprache nur unsere eigenen Denkstrukturen nachzeichnen, wie kommen wir dann dazu, nach Hadubalds Reform die Denkstrukturen eines fremden, obendrein auch noch ausgestorbenen Volkes zu übernehmen? Sollten wir nicht vielmehr unsere nationale Eigenart pflegen? Lasst uns die Überfremdung unserer Sprache beiseitefegen und zur angestammten Redeweise unseres Volkes zurückkehren!
Gleich das erste Manifest, das die Spiridionisten drucken ließen, wurde unter dem Einfluss der orthodoxen Hadubaldianer von der Zensur verboten, eingezogen und vernichtet. Die Spiridionisten antworteten mit Flugzettelaktionen, Postwurfsendungen und ihre geistigen Führer hielten Reden auf öffentlichen Plätzen. Als diese Störung der allgemeinen Ordnung beunruhigende Formen anzunehmen begann, beschloss eine radikale Gruppe von orthodoxen Hadubaldianern, den geistigen Urheber all dieser Verwirrung aus der Welt zu schaffen. Sie drangen nachts in Spiridions Wohnung ein, zerrten ihn aus dem Bett und spalteten mit einem Beil seinen Schädel – diesmal so gründlich, dass ihm für alle Zeiten das Nachdenken verging.
Die Reaktion auf dieses Attentat ließ nicht lange auf sich warten. Die Spiridionisten standen auf wie ein Mann und es gelang ihnen, einen großen Teil der Bevölkerung – besonders unter den Ackerbauern und Viehzüchtern – auf ihre Seite zu bringen. So kam es binnen weniger Tage zum spiridionistischen Umsturz. Mit Dreschflegeln, Sensen und Äxten bewaffnet zogen die Massen aus allen Windrichtungen zur Hauptstadt und fegten die orthodoxen Hadubaldianer nicht nur aus ihren Positionen, sondern schlugen sie zum größeren Teil auch gleich tot. Am nächsten Tag schon wurde die Große Nationale Sprachreinigung eingeleitet, die sämtliche Hadubaldschen Überfremdungen aus der Sprache entfernte. Man verwendete wieder auf jeweils geziemende Weise die gewöhnliche oder die erhabene Aussageform und jeder, den man bei der Verwendung Hadubaldscher Zeitformen ertappte, wurde öffentlich getadelt und im Wiederholungsfalle zum Schutz der Sprachgemeinschaft in die Verbannung geschickt und niemand hörte je wieder von ihm.
Unter den sieben oder acht Generationen, die seither gelebt haben, ist jener Streit um die Sprache, der damals die Gemüter so erhitzt hat, bald abgeflaut, ja mittlerweile völlig in Vergessenheit geraten. Die Menschen haben sich wieder ihren alltäglichen Verrichtungen zugewendet und kümmern sich nicht mehr um die erbitterten Auseinandersetzungen der Vergangenheit. Da zudem in diesem Zeitraum die alten Mythen rasch an Bedeutung verloren haben, ist zugleich auch die erhabene Aussageform aus dem Sprachbewußtsein der meisten Menschen geschwunden. Sie leben ja größtenteils im Wohlstand, haben kaum Gründe, unzufrieden zu sein, und diese Zufriedenheit beherrscht sie in einem Maße, dass sie sich ganz und gar auf den Genuss der unmittelbaren Gegenwart beschränken.
Allerdings besteht noch ein gewisses Interesse an Dingen aus der Vergangenheit, aber eher in dem Sinne, dass Gegenstände aus der alten Zeit – gerade weil viele von ihnen während der Sprachwirren zerstört worden sind – an Wert gewonnen haben. Dieser Wert liegt allerdings weder in ihrer ursprünglichen Bedeutung noch in ihrem Alter begründet, sondern vielmehr in ihrer Seltenheit, vergleichbar etwa mit der Kostbarkeit eines Pelzmantels, der aus den Fellen fast ausgestorbener Tiere hergestellt worden ist. Und auch das Künftige kümmert die Leute nur insoweit, als man bestrebt ist, das angenehme Leben der Gegenwart nach Möglichkeit weiter unverändert zu erhalten. Um es kurz zu sagen: Für die Vergangenheit sind die Antiquitätenhändler zuständig und für die Zukunft die Versicherungsagenten.
Die gewöhnliche Aussageform hat sich in einem Maße durchgesetzt, wie es selbst die eifrigsten Sprachreiniger kaum erwartet haben dürften. (Ich muss allerdings gestehen, dass ich neuerdings für mich selbst gern auf die Hadubaldschen Zeitformen zurückgreife, aber ich hüte mich, dies in allzu breiter Öffentlichkeit zu wagen) Offenbar besteht in der Bevölkerung kaum noch das Bedürfnis, Vergangenes oder Künftiges sprachlich zu umschreiben. Manchmal frage ich mich: Hat unser gegenwärtiges Bewusstsein unsere Sprache geformt oder hat die Verbannung der Hadubaldschen Zeitformen das Vergangene und das Künftige aus dem Bewusstsein der Leute getilgt? Ich weiß es nicht.
Wenn ich diese Aufzeichnungen jetzt gleich abgeschlossen haben werde, will ich meinen Mantel nehmen und über die Straße ins Café Temperelli gehen. Dort wird mir Herr Franz aus dem Mantel helfen und mich fragen: »Wie immer, Herr Doktor?«, und ich werde antworten: »Was sonst?«, und mich an meinen angestammten Marmortisch setzen. Herr Franz wird mir einen kleinen Schwarzen bringen und fragen: »Erlauben der Herr Doktor, dass ich ihm ein Rätsel aufgebe?« Ich kenne seine Rätsel schon alle, aber ich höre sie immer wieder gern (manchmal habe ich Herrn Franz in Verdacht, ein verkappter Hadubaldianer zu sein). »Fragen Sie!«, werde ich sagen, während ich zwei Stück Zucker in den Kaffee fallen lasse und umrühre.
»Was ist das?«, wird er fragen. »Gestern ist es gestorben, heute lebt es, und morgen wird es geboren werden? Wir messen es stündlich und doch kennen wir weder Anfang noch Ende? Jeder nimmt es sich und doch läuft es allen davon?«
»Die Zeit, Herr Franz«, werde ich sagen, »die Zeit.«
B., am 6. Oktober
Liebe Frau Doktor,
Ihre rasche Antwort auf meinen Brief war so herzlich, dass Sie mich ermutigt hat, für diesmal eine nicht so förmliche Anrede zu wählen. Vor allem freue ich mich, dass Sie dieser ganze philologische Kram doch mehr zu interessieren scheint, als ich zu hoffen gewagt habe. Sie fragen mich, ob ich inzwischen auch zu einem »Hadubaldianer« geworden sei. (Es berührt mich seltsam, diese Bezeichnung, die der Volksmund – wenn auch im Sinne eines gegenwartsabgewandten Spinners – als so ziemlich einziges Relikt unserer Sprachvergangenheit bewahrt hat, in seiner eigentlichen Bedeutung zu lesen!)
Ihre Frage lässt sich schwer beantworten. Ich bewundere Hadubalds Sprachgenie, das uns die heutzutage leider als entbehrlich erachtete Möglichkeit geschenkt hat, sprachliche Äußerungen in einen geordneten Zeitbezug zu setzen, und in diesem Sinne bekenne ich mich gern als Hadubaldianer, ohne mich allerdings der orthodoxen Fraktion seiner Jünger zuzurechnen, die durch ihre oberlehrerhafte Besserwisserei und vor allem durch ihren starren Dogmatismus, der sich mit dem Wesen der Sprache überhaupt nicht vereinbaren lässt, sein Werk nahezu vernichtet hat. (Ich sage nahezu, denn außer meinem Freund Erwin gibt es auch noch ein paar andere Leute dieser Meinung, von denen Sie gleich hören werden.) Es geschieht ja überdies nicht zum ersten Male, dass große Gedanken bedeutender Menschen pervertiert werden, sobald man sie in kleine Münze umwechselt. Man sollte eben immer die eigentlichen Quellen lesen und nicht jene Kompendien, in denen die alle Begrenzungen sprengende Weisheit von irgendwelchen Flachköpfen auf handliches Format zurechtgeklopft wurde.
Ihre unverhohlen ausgesprochene Bewunderung dafür, dass ich mich wegen Ihrer eigentlich eher nebenbei ausgesprochenen Frage in ein solches Abenteuer – Sie sprechen sogar von einem konspirativen Charakter dieser Unternehmung! – gestürzt hätte, schmeichelt mir zwar, macht mich aber eher verlegen. Ist Ihnen wirklich entgangen, dass Sie damit einem in der Routine halbherzig betriebener Schreibtischarbeit schon fast zum Zyniker gewordenen Wissenschaftsbeamten unversehens einen neuen Lebensinhalt geschenkt haben? Ich fühle mich geradezu verjüngt! Dass ich mit Ihnen über all das sprechen kann, ist eine zusätzliche und für einen alten Knaben wie mich wahrhaft herzwärmende Freude, aber ich tue das alles nicht zuletzt auch um meinetwillen. Inzwischen fühle ich mich wie ein Jäger, der eine Spur gefunden hat und ihr nun folgen muss, was immer auch im Dickicht auf ihn lauern mag.